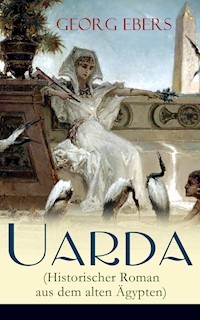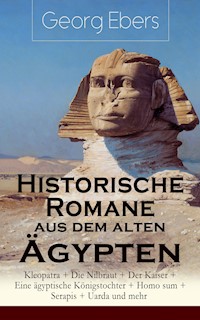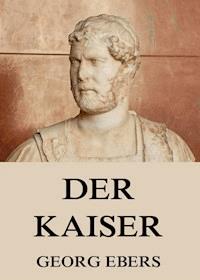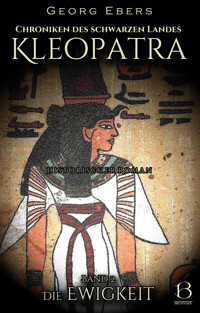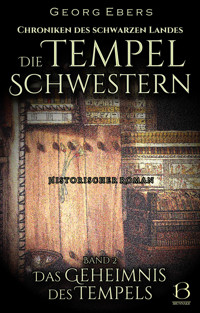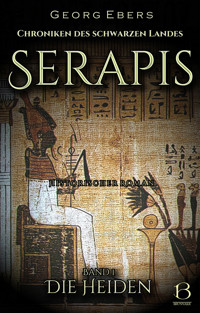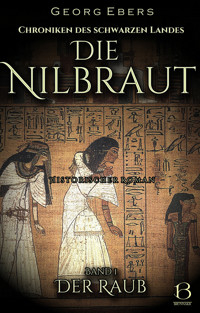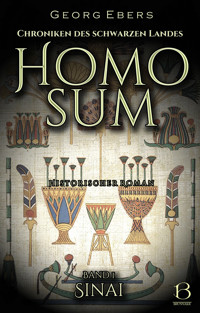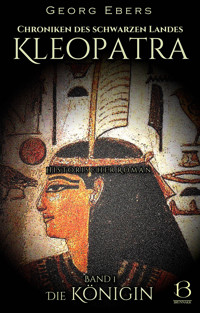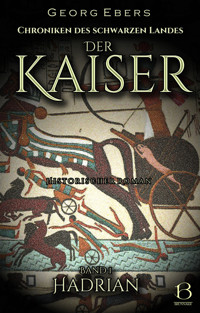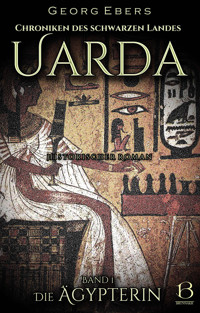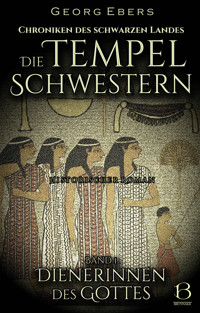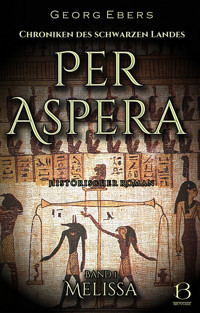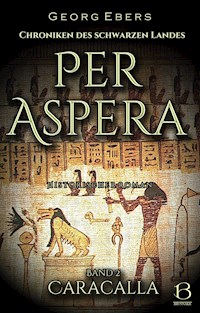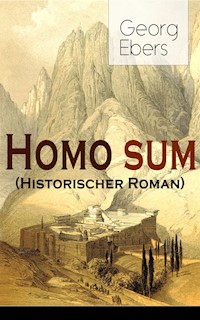
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Homo sum (Historischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Georg Ebers (1837-1898) war ein deutscher Ägyptologe und Schriftsteller. Mit seinen historischen Romanen und populärwissenschaftlichen Büchern trug er zur großen Popularität der Ägyptologie im ausgehenden 19. Jahrhundert bei. Beginnend mit Eine ägyptische Königstochter (1864) verfasste Ebers zahlreiche historische Romane, die auf großes Leserinteresse stießen. Neben Felix Dahn gilt er als der bedeutendste Vertreter des "Professorenromans". Die Themen der Romane wählte er teilweise aus dem Umfeld seiner wissenschaftlichen Arbeit, also der ägyptischen Geschichte, aber auch aus anderen Epochen (Mittelalter). Aus dem Buch: "Felsen, nackte, harte, rothbraune Felsen ringsum; kein Strauch, kein Halm, kein anschmiegendes Moos, das sonst wohl die Natur, als habe ein Athemzug ihres schöpferischen Lebens den unfruchtbaren Stein gestreift, auf die Felsflächen des Hochgebirges hinhaucht. Nichts als glatter Granit und darüber ein Himmel, so leer von jedem Gewölk, wie die Felsen von Sträuchern und Gräsern. Und doch, in jener Höhlung der Bergeswand regt sich menschliches Leben, und zwei kleine graue Vögel wiegen sich in der reinen, leichten, von der Mittagssonne durchglühten Wüstenluft und verschwinden hinter einer Klippenreihe, die, wie eine Mauer von Menschenhand, eine tiefe Schlucht begrenzt…"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Homo sum (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Homo sum: humani nil a me alienum puto. Terenz, Heautontimorumenos,
Vorwort
Während meiner Vorarbeiten zu einer Geschichte der Sinai-Halbinsel nahm mich lange Zeit das Studium der ersten christlichen Jahrhunderte in Anspruch, und unter der Masse von martyrologischen und asketischen Schriften, von Heiligen und Mönchsgeschichten, die es für meinen eng begrenzten Zweck durchzuarbeiten und zu sichten galt, fand ich (und zwar in des Cotelerius ecclesiae graecae monumenta) eine Erzählung, die mir bei aller Unscheinbarkeit eigentümlich und rührend erschien. Ihr Schauplatz war der Sinai und die an seinem Fuße gelegene Oase Pharan.
Als ich sodann auf meiner Reise in das peträische Arabien die Höhlen der Anachoreten vom Sinai mit eigenen Augen sah und mit eigenen Füßen betrat, kam jene Geschichte mir wieder in den Sinn, und sie verließ mich nicht, während ich weiter durch die Wüste zog.
Ein Seelenproblem der eigentümlichsten Art schien mir in ihrem einfachen Verlaufe geboten zu werden.
Ein Anachoret, fälschlich für einen Andern beschuldigt, nimmt, ohne sich zu vertheidigen, dessen Strafe, die Ausstoßung, auf sich. Erst durch das Bekenntniß des Missethäters wird seine Unschuld erkannt.
Es bot einen besondern Reiz, den Regungen der Seele nachzudenken, welche zu solcher Apathie (απαθεια), solcher Vernichtung der Empfindungen führten, und während in mir selbst das Thun und Denken der seltsamen Höhlenbewohner zu immer größerer Anschaulichkeit gelangte, bildete sich, gleichsam als Beispiel, die Gestalt meines Paulus heran. Bald schaarte sich dann ein Kreis von Ideen und endlich eine Erkenntniß um sie her, die mich trieb und drängte, bis ich den Versuch wagte, sie in der Form einer Erzählung zum künstlerischen Ausdruck zu bringen.
Den äußern Anstoß, den schon längst in mir bis zur vollen Anschaulichkeit herangereiften Stoff zu einem Roman auszugestalten, bot mir die durch Abel's koptische Studien veranlaßt Lektüre von koptischen Mönchsgeschichten. Später regte mich besonders an die kleine, aber schwerwiegende Schrift von H. Weingarten über den Ursprung des Mönchsthums, die mich noch jetzt bei dem Studium der ersten Jahrhunderte des Christentums namentlich in Aegypten festhält.
Es ist hier nicht der Platz, diejenigen Punkte hervorzuheben, in denen ich von Weingarten jetzt noch entschiedener als früher abweiche. Mein scharfsinniger breslauer Kollege räumt Vieles bei Seite, das nicht zu bestehen verdient, aber an manchen Stellen seines Buches scheint er mir mit zu scharfem Besen zu kehren.
So leicht es mir gewesen wäre, meine Geschichte statt in den Anfang der dreißiger in den der vierziger Jahre des vierten Jahrhunderts zu verlegen, habe ich dies doch unterlassen, weil ich mit Bestimmtheit nachweisen zu können meine, daß es schon in der von mir gewählten Zeit christliche Anachoreten gab. Darin stimme ich Weingarten völlig bei, daß die Anfänge eines organisirten, christlichen Mönchsthums keinenfalls vor das Jahr 350 zu setzen sind.
Mein Paulus darf ja nicht mit dem ersten »Eremiten« Paulus von Theben verwechselt werden, den die Kritik mit Recht aus der Liste der historischen Persönlichkeiten gestrichen hat. Er ist wie jede andere Figur in dieser Erzählung eine durchaus erfundene Persönlichkeit, der Träger einer Idee, nichts mehr und nichts weniger. – Für meinen Helden hab' ich kein bestimmtes Vorbild gewählt, und ich nehme nur das Prädikat der Möglichkeit in seiner Zeit für ihn in Anspruch. An den heiligen Antonius, der nun auch um seinen vornehmen Biographen Athanasius gebracht werden soll, und der als ein Mann von sehr gesundem Verstande, aber so mangelhafter Bildung, daß er nur des Aegyptischen mächtig war, dargestellt wird, hab' ich am wenigsten gedacht.
Die dogmatischen Streitigkeiten, welche schon in der Zeit meiner Erzählung entbrannt waren, sind mit gutem Bedacht unerwähnt geblieben. In späterer Zeit haben sich die Sinaiten und die Oasenbewohner lebhaft an ihnen betheiligt.
Der Sinai, zu dem ich den Leser führe, darf nicht mit dem eine starke Tagereise südlicher gelegenen Berge verwechselt werden, der jedenfalls seit Justinian diesen Namen trägt, an dessen Fuße das berühmte Kloster der Verklärung steht, und der allgemein für den Sinai der Schrift gehalten wird. In der Beschreibung meiner Reise durch das peträische Arabien habe ich die von Lepsius in die Wissenschaft eingeführte Ansicht, daß der heute »Serbal« genannte Gebirgsriese und nicht der Sinai der Mönche für den Berg der Gesetzgebung gehalten werden muß und auch in der vorjustinianischen Zeit gehalten worden ist, neu zu begründen versucht.
In Bezug auf das steinerne Haus des Senators Petrus mit seinen ganz gegen die Sitte des Orients der Straße zugewandten Fenstern muß ich, um begründeten Zweifeln vorzubeugen, bemerken, daß heute noch in der Oase Pharan die wunderbar gut erhaltenen Brandmauern einer ziemlich großen Anzahl von dergleichen Gebäuden stehen.
Aber solchen äußeren Dingen räume ich in diesem Seelengemälde nur eine untergeordnete Stellung ein. Während in meinen früheren Romanen sich der Gelehrte dem Dichter und der Dichter dem Gelehrten Konzessionen zu machen gezwungen sah, habe ich in diesem, ohne nach rechts oder links zu schauen, ohne belehren oder die Resultate meiner Studien in Gestalten von Fleisch und Bein umsetzen zu wollen, nichts und gar nichts bezweckt, als in abgerundeter Form eine meine Seele bewegende Idee zum künstlerischen Ausdrucke zu bringen. Die schlichten Gestalten, deren innerstes Wesen ich vor dem Leser zu eröffnen versuche, füllen den Raum des Gemäldes, in dessen dunklem Hintergrunde das strömende Meer der Weltgeschichte wogt.
Auf den lateinischen Titel hat mich eine häufig gebrauchte Sentenz gewiesen, die sich mit der Grundeinsicht deckt, zu welcher mich die Anschauung des Denkens und Seins aller Menschen und auch derer, welche schon höhere Stufen der Treppe, die in den Himmel leitet, erklommen zu haben meinen, geführt hat.
In des Terenz Heautontimorumenos antwortet Akt 1, Scene 1, V. 77 dem Menedemus sein Nachbar Chremes:
»Homo sum: humani nil a me alienum puto,«
was Donner wörtlich übersetzt:
»Mensch bin ich; nichts, was menschlich, acht' ich mir als fremd.«
Aber schon Cicero und Seneca gebrauchen diesen Vers als Sprüchwort, und in einem Sinne, der weit über dasjenige hinausgeht, was nach dem Zusammenhang der Stelle, an der er vorkommt, darin zu liegen scheint, und, indem ich mich ihnen anschließe, übertrage ich, auf den Titel dieses Buches deutend:
»Ein Mensch bin ich, und meine, daß ich Mensch bin überall.«
Leipzig, den 11. November 1877.
Georg Ebers.
Erstes Kapitel
Felsen, nackte, harte, rothbraune Felsen ringsum; kein Strauch, kein Halm, kein anschmiegendes Moos, das sonst wohl die Natur, als habe ein Athemzug ihres schöpferischen Lebens den unfruchtbaren Stein gestreift, auf die Felsflächen des Hochgebirges hinhaucht. Nichts als glatter Granit und darüber ein Himmel, so leer von jedem Gewölk, wie die Felsen von Sträuchern und Gräsern.
Und doch, in jener Höhlung der Bergeswand regt sich menschliches Leben, und zwei kleine graue Vögel wiegen sich in der reinen, leichten, von der Mittagssonne durchglühten Wüstenluft und verschwinden hinter einer Klippenreihe, die, wie eine Mauer von Menschenhand, eine tiefe Schlucht begrenzt.
Da ist es gut sein, denn ein Quell benetzt ihren steinigen Boden, und wie überall, wo das Naß die Wüste berührt, grünen würzige Kräuter und erwächst freundliches Strauchwerk
Als Osiris, so erzählt die Mythe der Aegypter, die Göttin der Einöde umarmte, ließ er auf ihrem Lager seinen grünen Kranz zurück. Aber in der Zeit und in den Kreisen, in denen unsere Geschichte spielt, kennt man nicht mehr die alten Sagen, oder will sie nicht kennen. Wir führen den Leser in den Anfang der dreißiger Jahre des vierten Jahrhunderts nach der Geburt des Heilandes und zu dem Sinaiberge, dessen geweihten Boden einzelne, zur Buße gestimmte Weltmüde, Anachoreten, noch ohne Zusammenhang und Regel, seit einigen Jahren bewohnen.
Neben dem Quell in der Thalschlucht, von dem wir gesprochen, erwächst eine vielzweigige Federpalme, aber sie schützt ihn nicht vor den senkrecht niederprallenden Strahlen der Sonne dieser Breiten. Sie scheint nur ihre eigenen Wurzeln zu beschatten; doch ihre gefiederten Zweige sind stark genug, um ein fadenscheiniges blaues Tüchlein zu tragen, und dieses schützt als Schirmdach das Antlitz eines Mädchens, das lang ausgestreckt auf den durchglühten Steinen liegt und träumt, während einige gelbliche Bergziegen, nach Futter suchend, so munter von Stein zu Stein steigen und springen, als sei ihnen die Hitze des Mittags angenehm und erfreulich. Von Zeit zu Zeit greift das Mädchen nach dem neben ihm liegenden Hirtenstecken und lockt mit einem weithin vernehmbaren Zischlaute die Ziegen. Eine junge Gais nähert sich ihr tänzelnd. Wenige Thiere vermögen ihrem Frohsinn Ausdruck zu geben, aber die jungen Ziegen können es.
Jetzt streckt das Mädchen den nackten, schlanken Fuß aus und stößt das auf ihr Spiel eingehende Gaislein in munterer Laune zurück und immer wieder zurück, wenn es von Neuem heranhüpft. Dabei biegt die Hirtin die Zehen so zierlich, als wolle sie einen Zuschauer auffordern, sich ihrer Feinheit zu freuen.
Wiederum springt das Zicklein heran, und dießmal mit gesenktem Kopfe. Seine Stirn berührt ihre Sohle, aber als es das krumme Näslein zärtlich an dem Fuße der Hirtin reibt, stößt diese es so heftig zurück, daß das Thierchen zusammenschrickt und laut aufmeckernd das Spiel unterbricht.
Es war, als habe das Mädchen nur den rechten Augenblick abgewartet, um die Gais empfindlich zu treffen, denn der Stoß war heftig, fast böse gewesen. Das blaue Tuch verbarg das Antlitz der Hirtin, aber gewiß hatten ihre Augen hell aufgeblitzt, während sie dem Thiere wehe gethan.
Minutenlang blieb sie regungslos liegen; aber das Tuch, welches auf ihr Antlitz hinabgesunken war, wogte leise hin und her, bewegt von ihrem fliegenden Athem. Sie lauschte mit aller Spannung, mit leidenschaftlicher Erwartung; man konnte es auch an den krampfhaft zusammengezogenen Zehen erkennen.
Nun ließ sich ein Geräusch vernehmen. Es kam aus der Richtung der rohen Treppe von unbehauenen Blöcken, welche von der schroffen Wandung der Schlucht zu der Quelle niederführte.
Ein Schreck durchschauerte die zarten, nur halb entwickelten Glieder der Hirtin; doch sie regte sich nicht. Die grauen Vögel, welche neben ihr auf dem Dornstrauche saßen, flogen auf, aber sie hatten eben nur ein Geräusch vernommen und vermochten nicht zu unterscheiden, wer es erzeuge.
Der Hirtin Ohr war schärfer als das ihre.
Sie hörte, daß ein Mensch sich nahe, und wußte, daß so nur ein Einziger schreite.
Schnell streckte sie die Hand nach einem Stein aus, der neben ihr lag, und warf ihn in den Quell, dessen Wasser sich allsogleich trübte. Dann wandte sie sich auf die Seite, und legte, als ob sie schlafe, ihr Haupt auf den Arm. Deutlicher und immer deutlicher ließen sich kräftige Schritte vernehmen.
Der die Stufen Hinabsteigende war ein hochgewachsener Jüngling. Seiner Kleidung nach gehörte er zu den Anachoreten vom Sinai, denn er trug nichts als einen hemdartigen Rock von grobem Linnen, dem er entwachsen zu sein schien, und rohe Ledersohlen, die mit faserigem Palmenbast an seine Füße geschnürt waren.
Aermlicher als ihn kleidete kein Herr seinen Sklaven, und doch würde ihn Niemand für einen Unfreien gehalten haben, denn hochaufgerichtet und selbstbewußt schritt er dahin. Er konnte nicht viel mehr als zwanzig Jahre zählen; das verrieth das keimende, weiche Barthaar auf seiner Oberlippe, an Kinn und Wangen, aber aus den großen blauen Augen leuchtete keine Jugendfrische, sondern Unlust, und festverschlossen wie von Trotz waren seine Lippen.
Jetzt blieb er stehen und strich das ungeordnete braune Lockenhaar, das in Ueberfülle, wie die Mähne eines Löwen, sein Haupt umfloß, aus der Stirn. Dann näherte er sich der Quelle, und als er sich bückte, um mit der großen, getrockneten Kürbisschale in seiner Hand Wasser zu schöpfen, bemerkte er zuerst, daß der Brunnen getrübt war, dann die Ziegen und endlich die schlummernde Hirtin.
Unmuthig stellte er das Gefäß vor sich hin und rief das Mädchen mit lauten Worten; sie aber regte sich nicht, bis er sie mit dem Fuße unzart berührte. Da sprang sie, wie von einer Natter gestochen, auf, und zwei Augen, so schwarz wie die Nacht, flammten ihm aus ihrem jungen, bräunlichen Gesichte entgegen. Die zierlichen Flügel ihrer scharf gebogenen Nase bewegten sich schnell, und die schneeweißen Zähne blitzten, als sie ihm zurief:
»Bin ich ein Hund, daß Du so mich weckst?«
Er erröthete, zeigte unwillig auf den Quell und sagte barsch:
»Dein Vieh hat wieder das Wasser getrübt; ich werde hier warten müssen, bis es sich klärt und ich schöpfen kann.«
»Der Tag ist lang,« gab die Hirtin zurück und stieß, indem sie sich aufrichtete, wie von ungefähr einen neuen Stein in's Wasser.
Dem Jüngling war der triumphirend aufleuchtende Blick nicht entgangen, mit dem sie zu dem getrübten Quell hinuntergeschaut hatte, und zornig rief er:
»Recht hat er! Eine Giftschlange bist Du, ein Dämon der Hölle.«
Lachend erhob sie sich und schnitt ihm ein Gesicht, als wollte sie ihm zeigen, daß sie wirklich ein schrecklicher Unhold sei, und es ward ihr das leicht bei der großen Schärfe ihrer leicht beweglichen, jugendlichen Züge. Auch erreichte sie vollkommen ihre Absicht, denn mit allen Zeichen des Entsetzens wich er zurück, streckte abwehrend die Arme vor, sprach den Namen Gottes aus und rief, als er sie lachen und immer unbändiger lachen sah:
»Zurück, Dämon, zurück! Im Namen des Herrn frage ich Dich: Wer bist Du?«
»Mirjam bin ich, wer sonst?« gab sie übermüthig zurück.
Er hatte eine andere Antwort erwartet. Ihre Munterkeit verdroß ihn und unwillig rief er: »Wie Du auch heißt, ein Unhold bist Du, und ich werde Paulus bitten, daß er Dir verbietet, Dein Vieh aus unserer Quelle zu tränken.«
»Zu Deiner Amme liefest Du und verklagtest mich bei der, wenn Du eine hättest,« gab sie ihm zurück, indem sie verächtlich die Lippe aufwarf.
Er erröthete; sie aber fuhr furchtlos und mit lebhaftem Geberdenspiele fort:
»Ein Mann solltest Du sein, denn Du bist stark und groß, aber wie ein Kind läßt Du Dich halten oder wie eine erbärmliche Magd. Wurzeln und Beeren suchen und in dem elenden Dinge da Wasser schöpfen ist Dein Geschäft. Das hab' ich gelernt, als ich so groß war!« Und sie zeigte mit den straff ausgestreckten, spitzen Fingern ihrer beiden Hände, die nicht weniger beweglich waren als die Züge ihres Gesichts, ein verächtlich kleines Maß. »Pfui doch! Stärker bist Du und stattlicher, als all' die Amalekiterbursche da unten, aber versuch' es nur, Dich mit ihnen zu messen im Pfeilschießen oder im Lanzenwerfen!«
»Dürft' ich nur, wie ich wollte,« unterbrach er sie, und flammende Röthe übergoß sein Gesicht. »Mit zehn von den mageren Wichten würde ich fertig!«
»Das glaub' ich,« entgegnete das Mädchen, und ihr lebhafter Blick maß mit dem Ausdruck des Stolzes die breite Brust und die muskelstarken Arme des Jünglings. »Das glaub' ich, aber warum darfst Du nicht? Bist Du der Sklave des Mannes da oben?«
»Er ist mein Vater, und dann . . .«
»Was dann!« rief sie und schwenkte die Hand, als gält' es, eine Fledermaus zu verjagen. »Wollte kein Vogel ausfliegen, das gäb' ein schönes Gewimmel im Neste! Sieh' da meine Gaisen; so lang sie sie brauchen, laufen sie hinter der Mutter her; aber sobald sie ihr Futter allein finden, suchen sie sich's, wo sie es finden, und ich sage Dir: die Einjährige dort weiß gar nicht mehr, ob sie an der gelben oder schwarzen gesogen. Und was thut denn Dein Vater Großes für Dich?«
»Schweig'!« unterbrach sie der Jüngling mit aufrichtigem Unwillen. »Der Böse spricht aus Dir. Hebe Dich von mir, denn ich darf nicht hören, was ich nicht sagen dürfte.«
»Darf, darf, darf,« schnarrte sie ihm nach. »Was darfst Du denn? Nicht einmal hören darfst Du.«
»Am wenigsten das, was Du sprichst, Du Kobold!« rief er heftig. »Verhaßt ist mir Deine Stimme und treff' ich Dich wieder am Quell, so werd' ich Dich mit Steinwürfen verjagen.«
Sie starrte ihn, während er also redete, sprachlos an. Das Blut war ihr aus den Lippen gewichen, und ihre kleinen Hände hatten sich zu Fäusten geballt.
Er wollte an ihr vorübergehen, um Wasser zu schöpfen, aber sie trat ihm in den Weg und hielt ihn gebannt mit dem starren Blick ihres Auges.
Es durchrieselte ihn kalt, als sie mit bebendem Munde und klangloser Stimme fragte: »Was hab' ich Dir gethan?«
»Laß mich!« sagte er und erhob die Hand, um sie von dem Wasser fortzudrängen.
»Du rührst mich nicht an!« rief sie außer sich. »Was hab' ich Dir gethan?«
»Du weißt nichts von Gott,« entgegnete er, »und wer nicht Gottes ist, der ist des Teufels.«
»Das kommt nicht aus Dir,« gab sie zurück, und wieder begann leiser Spott aus ihrer Stimme zu klingen. »Was sie Dich glauben lassen, das zerrt an Deiner Zunge, wie die Hand an der Schnur des Gliedermannes. Wer hat Dir gesagt, ich sei des Teufels?«
»Warum sollt' ich Dir's hehlen?« antwortete er stolz. »Der fromme Paulus warnte mich vor Dir, und ich will es ihm danken. Aus Deinem Auge, sagte er, schaue der Böse. Und Recht hat er, tausendmal Recht. Wenn Du mich ansiehst, so ist es mir, als sollt' ich Alles mit Füßen treten, was heilig. In der letzten Nacht noch träumte mir, ich hätte mich mit Dir im Tanze geschwungen . . .«
Bei diesen Worten verschwanden Ernst und Groll aus Mirjam's Augen.
Sie klatschte in die Hände und rief: »Wär's doch Wirklichkeit gewesen und kein windiger Traum! Erschrick nur nicht wieder, Du Narr! Weißt Du denn, wie das ist, wenn die Flöten tönen und die Saiten klingen und im Reigen die Füße sich heben, als hätten sie Flügel?«
»Die Flügel des Satans,« unterbrach sie Hermas streng. »Ein Dämon bist Du, eine verstockte Heidin.«
»So sagt der fromme Paulus,« lachte Mirjam.
»Das sage auch ich!« rief der Jüngling. »Wer sah Dich je in der Versammlung der Frommen? Betest Du? Dankst Du dem Herrn und dem Heiland?«
»Wofür sollt' ich wohl danken?« fragte Mirjam. »Etwa dafür, daß mich der Frömmste unter euch als einen bösen Dämon verlästert?«
»Eben weil Du sündig bist, versagt Dir der Himmel das Gute.«
»Nein, nein, tausendmal nein!« rief Mirjam. »Kein Gott hat jemals nach mir gefragt. Und bin ich nicht gut, wie sollt' ich's denn sein, da mir doch nur Schlimmes zu Theil ward? Weißt Du, wer ich bin und wie ich so geworden? War ich etwa schlecht, wie sie auf der Pilgerfahrt hieher meine beiden Eltern erschlugen? Sechs Jahre zählte ich damals, nicht mehr, und was ist so ein Kind! Aber ich weiß noch recht gut, daß bei unserem Hause viele Kameele weideten und auch Rosse, die uns gehörten, und daß an der Hand, die mich oftmals gestreichelt, – es war doch wohl die meinem Mutter, – ein großer Edelstein glänzte. Ich hatte auch eine schwarze Sklavin, die mir gehorchte. Wenn sie nicht wollte wie ich, dann hängte ich mich an ihr graues, wolliges Haar und durfte sie schlagen. Wer weiß, wohin sie gekommen? Ich liebte sie nicht, doch hätt' ich sie jetzt, wie wollt' ich ihr gut sein! Nun zehre ich ja selbst seit zwölf Jahren das Brod der Knechtschaft und hüte dem Senator Petrus die Ziegen, und unterstünd' ich mich, auf den Festplatz zu den freien Mädchen zu treten, sie stießen mich fort und rissen mir den Kranz aus dem Haare. Und ich soll dankbar sein? Wofür denn? Und fromm? Welcher Gott hat denn für mich gesorgt? Nennt mich einen bösen Dämon, nennt mich so; aber wenn Petrus und Dein Paulus sagen, daß der da oben, der zu solchem Loose mich groß werden ließ, gut sei, so lügen sie. Gott ist böse, und es sieht ihm gleich, wenn er Dir in's Herz gibt, mich mit Steinwürfen von eurem Quell zu verscheuchen.«
Bei diesen Worten brach sie in ein schmerzliches Schluchzen aus, und die Züge ihres Gesichtes verschoben und verzogen sich vielfältig und heftig.
Hermas fühlte Mitleiden mit der weinenden Mirjam.
Hundertmal war er ihr begegnet, und immer hatte sie bald übermüthig, bald unzufrieden, bald herausfordernd, bald zornig dreingeschaut, niemals sich weich oder bekümmert gezeigt.
Heute erschloß sich ihm zum ersten Mal das Herz, und die Thränen, die ihr Antlitz entstellten, verliehen ihrer Person einen Werth, den sie bisher nicht für ihn besessen hatte, denn Hermas fühlte jetzt, daß sie ein Weib sei, und da er sie schwach und kummervoll sah, so schämte er sich seiner Härte, nahte sich ihr freundlich und sprach:
»Du brauchst nicht zu weinen. Komm' nur immer wieder zur Quelle; ich will Dir's nicht wehren.«
Seine tiefe Stimme klang weich und freundlich, als er das sagte; sie aber schluchzte heftiger, fast krampfhaft auf und wollte reden, vermochte es aber nicht. An all' ihren zarten Gliedern bebend, von Weh geschüttelt, vergehend vor Leid, stand die schlanke Hirtin vor ihm, und es war ihm, als müßt' er ihr helfen.
Lebhaftes Mitgefühl schnitt ihm in's Herz und hemmte ihm die wenig gelenke Zunge.
Als er keine Worte des Trostes fand, faßte er mit der linken Hand den Krug und legte ihr die rechte, die ihn vordem gehalten, freundlich auf die Schulter.
Sie zuckte zusammen, aber ließ es geschehen.
Der warme Hauch ihres Mundes berührte ihn.
Er wollte zurücktreten, aber er fühlte sich wie gehemmt. Ob sie weine oder lache, er wußte es kaum, wie er die Hand auf ihren schwarzen Locken ruhen ließ.
Sie regte sich nicht.
Endlich hob sie das Haupt, ihre Augen brannten in die seinen, und im selben Augenblicke fühlte er, wie zwei zarte Arme seinen Hals umstrickten.
Da war es ihm, als brande ein Meer vor seinen Ohren, als flamme Feuer vor seinem Blick.
Eine namenlose Angst ergriff ihn, gewaltsam riß er sich von ihr los und stürzte mit lautem Geschrei, als wenn ihn die Geister der Hölle verfolgten, die Stufen heran, welche zu der Quelle hinabführten, und achtete es nicht, daß sein Krug an der Felsenwand in tausend Stücke zerschellte.
Wie gebannt blieb sie stehen und schaute ihm nach.
Dann schlug sie die Stirn mit der schmalen Hand, warf sich wieder neben die Quelle hin und starrte in's Leere.
Regungslos lag sie da; nur ihr Mund blieb in steter Bewegung.
Als der Schatten der Federpalme länger wurde, sprang sie auf, lockte die Ziegen und schaute lauschend nach dem Stufenwege hin, auf dem er verschwunden.
Die Dämmerung ist kurz in der Nähe des Wendekreises, und sie wußte, daß sie auf dem steinigen und schluchtenreichen Wege thalabwärts vom Dunkel überrascht werden würde, wenn sie länger säume.
Sie fürchtete sich auch vor den Schrecken der Nacht, den Geistern und Dämonen und tausend Gefahren, über deren Natur sie sich selbst keine Rechenschaft zu geben vermochte; aber sie wich nicht vom Platz und hörte nicht auf zu lauschen und auf seine Wiederkehr zu warten, bis die Sonne hinter dem heiligen Berge verschwunden war, und die Glut des Westens verblaßte.
Todtenstille umfing sie, sie hörte sich selber athmen, und berührt von der nächtlichen Kühle, schauerte sie fröstelnd zusammen.
Jetzt hörte sie lautes Geräusch zu ihren Häupten.
Ein Rudel Steinböcke, gewohnt in dieser Stunde den Durst an der Quelle zu löschen, kam näher und näher, wich aber zurück, da es eines Menschen Nähe witterte.
Nur der Führer der Heerde war auf dem Rande der Schlucht stehen geblieben, und sie wußte, daß er auf ihren Aufbruch wartete, um die anderen zur Tränke zu führen.
Schon hob sie, einer freundlichen Regung folgend, den Fuß, um den Thieren Platz zu machen. Da gedachte sie der Drohung des Hermas, sie von der Quelle zu verjagen, und unwillig hob sie einen Stein auf und warf damit nach dem Bocke, der zusammenschrak und eilig entfloh.
Ihm folgte das Rudel.
Mirjam hörte es enteilen und trieb dann gesenkten Hauptes und den Weg mit den Füßen suchend ihre Heerde durch das Dunkel nach Hause.
Zweites Kapitel
Hoch über der Schlucht mit der Quelle lag eine ebene Felsenfläche von bescheidenem Umfang, in deren Hintergrunde sich eine zerklüftete Wand von nacktem, rothbraunem Porphyr erhob.
Eine stahlharte Dioritader durchzog ihren Fuß wie ein grünes Band, und unter dieser öffnete sich eine kleine, rundliche, von der bildenden Hand der Natur gewölbte Höhle.
Früher hatten wilde Thiere, Panther oder Wölfe, in ihr gehaust; jetzt diente sie dem jungen Hermas und seinem Vater zur Wohnung.
Viele ähnliche Höhlen befanden sich in dem heiligen Berge, und von den größten unter ihnen hatten Anachoreten Besitz ergriffen.
Die des Stephanus war besonders hoch und tief, und dennoch war der Zwischenraum klein, der die beiden Lagerstätten von getrockneten Bergkräutern trennte, auf denen hier der Vater, dort der Sohn ruhte.
Mitternacht war längst vorüber, aber weder der junge, noch der alte Höhlenbewohner schienen zu schlafen.
Hermas stöhnte laut und warf sich heftig von einer Seite auf die andere, ohne des Alten zu achten, der, schwach und von Schmerzen gequält, des Schlummers nöthig bedurfte. Indessen versagte sich Stephanus die Erleichterung, sich umzuwenden oder zu seufzen, wenn er zu bemerken meinte, daß sein rüstiger Sohn Ruhe gefunden habe.
Was mochte dem Knaben, der sonst fest und schwer erweckbar zu schlafen pflegte, die Ruhe rauben?
»Wie kommt es,« dachte Stephanus, »daß die kräftige Jugend so fest und viel, und das der Ruhe bedürftige Alter, ja auch der kranke Mensch, so leicht und wenig schläft? Soll ihnen das Wachen die Lebensfrist, deren Ablauf sie fürchten, verlängern? Wie hängt man doch so thöricht an diesem jammervollen Dasein, und möchte sich fortstehlen und verbergen, wenn der Engel uns ruft, und sich uns die goldenen Thore öffnen! Wie Saul, der Hebräer, sind wir, der sich versteckte, da sie ihm mit der Krone nahten! Die Wunde brennt schmerzlich. Hätte ich nur einen Schluck Wasser! Wäre das arme Kind nicht so schwer entschlafen, ich bäte doch um den Krug.«
Stephanus lauschte zu dem Sohne hinüber und weckte ihn nicht, wie er seine schweren und regelmäßigen Athemzüge vernahm.
Fröstelnd zog er sich unter seinem Schurzfell zusammen, das nur den halben Körper bedeckte, denn durch die Oeffnung der bei Tage glühend heißen Höhle drang jetzt die eisige Nachtluft.
So vergingen lange Minuten. Endlich glaubte er zu bemerken, daß Hermas sich aufrichte.
Ja, der Schläfer mußte erwacht sein, denn er begann zu reden und den Namen Gottes anzurufen.
Nun wandte sich der Alte seinem Sohne zu und begann leise: »Hörst Du mich, Kind?«
»Ich kann nicht schlafen,« antwortete der Jüngling.
»So gib mir zu trinken,« bat Stephanus, »meine Wunde brennt unerträglich.«
Hermas erhob sich sogleich und reichte dem Leidenden den Wasserkrug.
»Danke, danke, mein Kind,« sagte der Alte und suchte tastend nach dem Halse des Gefäßes. Aber er fand ihn nicht und rief erstaunt:
»Wie feucht und kalt! Das ist ja Thon, und unser Krug war ein Kürbis.«
»Ich hab' ihn zerbrochen,« unterbrach ihn Hermas »und Paulus lieh mir den seinen.«
»So, so,« murmelte Stephanus, trank begierig, gab seinem Sohne den Krug zurück und wartete, bis er sich wieder auf dem Lager ausgestreckt hatte. Dann sagte er besorgt:
»Du bliebst lange aus am Abend, der Krug ist zerbrochen, und Du stöhntest im Schlaf. Was ist Dir begegnet?«
»Ein Dämon der Hölle,« entgegnete Hermas. »Und jetzt folgt mir der Unhold in unsere Höhle und ängstigt mich in allerlei Gestalten.«
»Banne ihn denn und bete,« sagte der Alte ernst. »Vor dem Namen Gottes fliehen die unreinen Geister.«
»Ich hab' ihn gerufen,« seufzte Hermas, »aber vergebens. Ich sehe Weiber mit rothen Lippen und wallenden Haaren, und weiße Marmorbilder mit runden Gliedern und glühenden Augen, die mir winken, immer und immer.«
»So nimm die Geißel,« befahl der Vater, »und schaffe Dir Ruhe.«
Gehorsam erhob sich Hermas auf's Neue und ging mit der Geißel in's Freie. Die Enge des Höhlenraumes verbot ihm, sie dort mit kräftig erhobenem Arme zu schwingen.
Bald vernahm Stephanus das Pfeifen der die nächtliche Stille durchsausenden ledernen Schnüre, ihren harten Schlag auf elastische menschliche Muskeln und seines Sohnes schmerzliches Stöhnen.
Bei jedem Hiebe zuckte der Alte zusammen, als habe er ihn selbst getroffen. Endlich rief er so laut wie er es vermochte: »Genug jetzt, genug!«
Hermas kehrte in die Höhle zurück.
Sein Vater rief ihn an sein Lager und forderte ihn auf, mit ihm gemeinsam zu beten.
Nach dem Amen streichelte er des Sohnes üppigen Haarschmuck und sagte: »Seit Du in Alexandria warst, bist Du ein Anderer geworden. Ich wollte, ich hätte dem Bischof Agapitus widerstanden und Dir die Reise verboten! Bald wird mein Heiland mich rufen, ich weiß es, und Niemand wird Dich hier halten. Dann wird der Versucher Dir nahen und all' die Herrlichkeiten der großen Stadt, die doch nur leuchten wie Holz, wenn es faul ist, wie schillernde Schlangen und giftige Purpurbeeren . . .«
»Ich mag sie nicht,« unterbrach ihn Hermas. »Verwirrt und geängstigt hat mich der lärmende Ort. Nie und nimmer betret' ich ihn wieder.«
»So sagst Du immer,« gab Stephanus zurück, »und doch hat Dich die Reise verändert. Wie so häufig dacht' ich früher, wenn ich Dich lachen hörte, der Klang müßte gewiß dem Vater im Himmel gefallen. Und nun? Wie ein singender Vogel bist Du gewesen, und jetzt gehst Du stumm einher, sauer und unwillig schaust Du drein, und böse Gedanken verkümmern Dir den Schlummer.«
»Das ist mein Schade,« antwortete Hermas. »Bitte, laß meine Hand los. Bald ist die Nacht vorbei, und den ganzen langen Tag hast Du Zeit, mir Lehren zu geben.«
Stephanus seufzte, und Hermas suchte sein Lager auf.
Beide floh der Schlaf, und Jeder wußte vom Andern, daß er wache, und hätte ihn gern angeredet, aber Mißbehagen und Trotz schlossen des Sohnes Lippen, und der Vater schwieg, weil er immer nicht die rechten, herzergreifenden Worte finden konnte, nach denen er suchte.
Endlich ward es Morgen. Ein dämmernder Schimmer streifte die Oeffnung der Höhle, und es ward heller und heller in ihrem dumpfen Raume. Der Jüngling erwachte und erhob sich gähnend.
Als er seinen Vater mit offenen Augen daliegen sah, fragte er gleichgültig: »Soll ich hier bleiben oder zur Morgenandacht gehen?«
»Laß uns zusammen beten,« bat Stephanus. »Wer weiß, wie lange uns das noch vergönnt ist. Der Tag ist mir nicht fern, dem kein Abend folgt. Knie' hier nieder und laß mich das Bild des Gekreuzigten küssen.«
Hermas that, wie ihm der Vater geheißen, und als Beide ihren Lobgesang endeten, mischte sich eine dritte Stimme in das Amen.
»Paulus!« rief der Alte; »gelobt sei der Heiland! Sieh' doch ein wenig nach meiner Wunde. Die Pfeilspitze sucht einen Ausgang und brennt mich furchtbar.«
Der neu Angekommene, ein Anachoret, der statt jeder andern Kleidung einen hemdartigen Rock von braunem, ungewalktem Tuch und ein Schaffell trug, untersuchte sorgfältig die Wunde, legte Kräuter darauf und murmelte dabei fromme Sprüche.
»Nun ist es viel besser,« seufzte der Alte. »Um Deiner Güte willen gewährt der Herr mir Erbarmen.«
»Ich gut? Ich Sündengesäß!« entgegnete Paulus mit tiefer, metallreicher Stimme, und seine überaus freundlichen blauen Augen richteten sich aufwärts, als wollten sie versichern, daß man sich gewaltig über ihn täusche. Dann strich er das ergrauende Haar, welches ihm ungeordnet und buschig über Hals und Gesicht hing, aus den Augen und sagte munter:
»Kein Mensch ist mehr als ein Mensch, und Viele sind weniger! In der Arche gab es viel Vieh, aber nur einen Noah!«
»In unserem Schifflein bist Du der Noah,« erwiederte Stephanus.
»Dann ist der große Lümmel hier der Elephant,« lachte Paulus.
»Du bist nicht kleiner als er,« gab Stephanus zurück.
»Schade, daß diese steinerne Arche so niedrig ist, sonst könnten wir uns gleich messen,« rief Paulus. »Ja, wären Hermas und ich so fromm und rein, wie wir groß und stark sind, wir hätten Beide den Schlüssel zum Paradies in der Tasche. Du hast Dich heute Nacht gegeißelt, Bursch, ich hörte es klatschen. Recht so! Wenn das sündige Fleisch sich regt, so versetzt man ihm eins.«
»Er hat schwer gestöhnt und konnte nicht schlafen,« sagte Stephanus.
»Ei, da soll ihn doch!« schrie Paulus dem Jüngling zu und streckte ihm seine gewaltigen Arme mit geballten Fäusten entgegen. Aber die drohenden Worte klangen mehr laut als grimmig, und so wild der ungewöhnlich große Mann in dem Schaffell auch aussah, so lag doch eine so unwiderstehliche Freundlichkeit in seinem Blick und seiner Stimme, daß Niemand glauben mochte, es sei ihm ernst mit dem Zorne.
»Höllische Geister sind ihm begegnet,« sagte Stephanus begütigend, »und ich hätte auch ohne sein Aechzen kein Auge geschlossen. Das ist nun die fünfte Nacht . . .«
»In der sechsten aber,« unterbrach ihn Paulus, »ist Dir der Schlaf vonnöthen. Thu' das Fell um, Hermas. Du sollst hinunter in die Oase zum Senator Petrus und von ihm oder Frau Dorothea, der Diakonissin, für unsern Kranken einen guten Schlaftrunk holen. Sieh' Einer! Der Junge denkt wahrhaftig an das Frühmahl des Vaters! Freilich, der eigene Bauch ist ein guter Mahner. Steck' nur das Brod ein und stell' das Wasser hieher an das Lager. Während Du fort bist, hol' ich frisches, und nun komm' mit mir.«
»Warte noch, warte!« rief Stephanus. »Bring' einen neuen Krug mit aus der Stadt, mein Kind. Du hast uns gestern den Deinen geliehen, Paulus, und ich möchte . . .«
»Bald hätt' ich's vergessen,« unterbrach ihn der Andere. »Ich hab' ja dem unbehutsamen Burschen zu danken, denn nun weiß ich erst, wie man trinken muß, so lang' man gesund ist. Nicht für eine Last Goldes nehm' ich den Krug zurück! Nur wenn man aus der hohlen Hand trinkt, mundet das Wasser! Der Scherben gehört euch. Gegen mein eigenes Wohl würde ich wüthen, wenn ich ihn zurückfordern wollte. Gottlob, jetzt kann mir auch der schlaueste Dieb nichts mehr stehlen, als meinen Pelz.«
Stephanus wollte ihm danken, er aber nahm Hermas bei der Hand und zog ihn mit sich in's Freie.
Eine Zeitlang schritten die beiden Männer schweigend über Klippen und Blöcke bergan.
Auf einer Felsenplatte, die der vom Meer über den Berg in die Oase führende Weg berührte, blieb Paulus stehen, wandte sich dem Jüngling zu und sagte:
»Wenn wir alle Folgen unserer Handlungen zu jeder Zeit bedenken würden, so gäb's keine Sünde.«
Hermas blickte ihn fragend an, Paulus aber fuhr fort.
»Wäre Dir's eingefallen, wie nöthig Dein armer Vater des Schlafes bedarf, Du hättest heute Nacht fein stille gelegen.«
»Ich konnte nicht,« gab der Getadelte mürrisch zurück. »Du weißt ja, ich habe mich unsanft gegeißelt.«
»Das war recht, denn Schläge hast Du verdient wie ein ungezogenes Bürschchen!«
Hermas sah den tadelnden Freund herausfordernd an. Flammende Röthe stieg in seine Wangen, denn er erinnerte sich des Wortes der Hirtin, er möge sie bei seiner Amme verklagen, und unwillig rief er:
»So laß ich nicht mit mir reden; ich bin kein Kind mehr!«
»Auch nicht das Deines Vaters?« unterbrach ihn Paulus und schaute ihn dabei so erstaunt und fragend an, daß Hermas verlegen die Augen abwandte.
»Es ist doch nicht schön, wenn Einer gerade Dem, der nur noch um seinetwillen zu leben verlangt, das bischen Leben verkümmert.«
»Gern hätte ich stille gelegen, denn ich liebe meinen Vater so gut wie ein Anderer.«
»Du schlägst ihn nicht,« entgegnen Paulus, »Du bringst ihm Brod und Wasser und trinkst den Wein nicht allein aus, den Dir der Bischof vom Abendmahle für ihn mit in's Haus gibt. Das ist wohl etwas, aber noch lange nicht genug!«
»Ich bin kein heiliger Mann!«
»Ich auch nicht!« rief Paulus. »Voll Schwächen bin ich und Sünden; aber was die Liebe ist, die der Heiland uns lehrte, das weiß ich, das kannst Du auch wissen. Am Kreuz ist er verschmachtet für Dich und für mich und die Armen und Schächer. Das Lieben ist das Allerleichteste und Schwerste zugleich. Es heischt Opfer! Und Du? Wie lange ist's her, seit Du dem Vater zum letzten Mal ein frohes Antlitz gezeigt hast?«
»Ich kann nicht heucheln.«
»Das brauchst Du auch nicht; aber lieben sollst Du. Wahrlich, nicht mit dem, was die Hand thut, sondern nur mit dem, was das Herz freudig darbringt und sich zu versagen zwingt, beweist man die Liebe.«
»Und ist es kein Opfer, daß ich hier meine Jugend verderbe?« fragte der Jüngling.
Paulus trat vor ihm zurück, schüttelte überrascht das zottige Haupt und sagte: »Steht es so? An Alexandria denkst Du? Ja freilich, schneller verrinnt das Leben dort, als auf unserem einsamen Berge. Das braune Hirtenmädchen magst Du ja nicht, aber vielleicht hat Dir dort eine schöne weiß und rothe Griechin in die Augen geschaut?«
»Laß mich mit den Weibern!« entgegnete Hermas mit aufrichtigem Unwillen. »Es gab dort andere Dinge zu schauen!«
Bei diesen Worten leuchteten des Jünglings Augen, und Paulus fragte nicht ohne Spannung: »Nun?«
»Du kennst Alexandria besser als ich,« antwortete Hermas ausweichend. »Du bist dort geboren, und sie sagen, Du wärest ein reicher Jüngling gewesen.«
»Sagen sie?« fragte Paulus. »Vielleicht haben sie Recht; aber wissen sollst Du: Ich bin froh, daß mir nichts mehr gehört von all' dem Tand, den ich da unten besessen habe, und ich danke dem Heiland, daß ich das Menschengewimmel nur noch mit dem Rücken anzusehen brauche. Was scheint Dir denn in all' dem Getreibe so sonderlich lockend?«
Hermas zauderte.
Er scheute sich zu reden, und doch zog und drängte es ihn, endlich einmal auszusprechen, was ihm die Seele bewegte.
Wenn Einer unter all' den ernsten, die Welt verachtenden Männern, unter denen er groß geworden, ihn verstehen konnte, das wußte er, so war es Paulus, dem er, als er klein war, den rauhen Bart gezaust, auf dessen Schultern er oft gesessen und der ihm tausendmal gezeigt hatte, wie lieb er ihn habe.
Zwar war der Alexandriner der strengsten Einer, aber er war nur hart gegen sich selbst.
Einmal mußte sich Hermas das Herz erleichtern, und mit einem schnellen Entschluß fragte er den Anachoreten: »Hast Du manchmal die Bäder besucht?«
»Manchmal? Mich wundert nur, daß ich in all' dem lauen Wasser nicht aufgeweicht und auseinandergegangen bin wie ein Weißbrod!«
»Warum spottest Du über das, was den Menschen schön macht?« rief Hermas eifrig. »Warum dürfen in Alexandria auch Christen die Bäder besuchen, während wir hier oben, während Du und der Vater und alle Anachoreten das Wasser nur brauchen, um den Durst zu löschen? Mich zwingt ihr, als einer der Euren zu leben, und ich mag kein garstiges Thier sein!«
»Uns sieht nur der Höchste,« gab Paulus zurück, »und wir schmücken für ihn unsere Seelen.«
»Aber auch den Leib hat der Herr uns gegeben,« unterbrach ihn Hermas. »Der Mensch ist Gottes Ebenbild, heißt es. Und wir? Widerwärtig wie ein häßlicher Affe kam ich mir vor, als ich die Jünglinge und Männer aus dem großen Bade beim Thor der Sonne heraustreten sah mit schön geordneten, duftigen Haaren und geschmeidigen Gliedern, die vor Frische und Reinheit glänzten. Und als sie so dahinzogen, und ich meines schäbigen Schaffelles und des Wustes der Mähne hier oben gedachte und meine Arme ansah und Füße, die nicht schlechter und schwächer gebildet sind als die ihren, da überlief es mich heiß und kalt, und es war mir, als schnüre mir ein bitterer Trank die Kehle zusammen. Am liebsten hätt' ich laut aufgeheult vor Scham und Neid und Verdruß. Ich will nicht sein wie ein Scheusal!«
Hermas hatte bei den letzten Worten mit den Zähnen geknirscht, und Paulus schaute ihn beunruhigt an, als er fortfuhr:
»Mein Leib ist Gottes so gut wie meine Seele, und was den Christen in der Stadt erlaubt ist . . .«
»Das dürfen wir hier oben doch wohl nicht,« unterbrach ihn Paulus ernst. »Wer sich einmal dem Himmel verschrieben, der muß sich ganz loslösen von den Reizen des Lebens und ein Band nach dem andern zerschneiden, das ihn mit dem Staube verknüpft. Ich habe ja auch einmal diesen Leib gesalbt und diese rauhen Haare gestrählt und mich über mein eigenes Spiegelbild herzlich gefreut; aber ich sage Dir, Hermas, und bei meinem lieben Heiland, ich sag's nur, weil ich's empfinde, hier tief im Herzen empfinde: Beten ist besser als baden, und ich armes Nichts bin mit Stunden begnadigt worden, mit Stunden, in denen meine Seele sich frei gerungen hat und als Ehrengast beseligt und entzückt theilnehmen durfte an den Festeswonnen des Himmels.«
Während Paulus diese letzten Worte sprach, hatten seine weit geöffneten Augen sich aufwärts gerichtet und einen wunderbaren Glanz gewonnen.
Eine Zeitlang standen Beide einander schweigend und regungslos gegenüber. Endlich strich der Anachoret das Haar aus der Stirn, die nun zum ersten Male sichtbar wurde. Sie war wohlgebildet, wenn auch schmal und in ihrem hellen Weiß grell abstechend von dem sonnverbrannten Gesichte.
»Du weißt nicht, Knabe,« sagte er aufathmend, »welche Freuden Du preisgeben möchtest für nichtige Dinge. Ehe noch der Himmel einen Frommen zu sich hinaufruft, zieht der Fromme den Himmel zu sich auf die Erde hernieder.«
Hermas verstand den Anachoreten gar wohl, denn sein Vater schaute oft nach stundenlangen Gebeten regungslos, ohne zu sehen oder zu hören, was um ihn her vorging, in die Höhe und pflegte, wenn er aus seinem ekstatischen Schauen erwachte, dem Sohne zu erzählen, daß er den Heiland gesehen oder die Chöre der Engel vernommen habe.
Ihm selbst war es niemals gelungen, sich in solche Zustände zu versetzen, obgleich ihn Stephanus häufig gezwungen hatte, viele Stunden von unendlicher Länge auf den Knieen zu liegen und mit ihm zu beten.
Oft war es geschehen, daß das schwache Lebenslicht des Alten nach diesen Uebungen, welche seine Seele auf's Tiefste erschütterten, zu verlöschen drohte, und weil Hermas ihn liebte, so hätte er ihm gern untersagt, sich solchen schädlichen Erregungen hinzugeben. Aber diese galten für vorzügliche Begnadigungen, und wie hätte der Sohn es wagen dürfen, seine Abneigung gegen so besonders heilige Dinge vor dem Vater zum Ausdruck zu bringen?
Paulus gegenüber fand er dazu in seiner heutigen Stimmung den Muth und sagte:
»Ich hoffe gewiß auf das Paradies, aber es wird uns doch erst nach dem Tode geöffnet. Geduldig sein soll der Christ; warum wartet ihr nicht auf den Himmel, bis der Heiland euch ruft, und wollt seine Freuden schon hier auf der Erde genießen? Erst das Eine und dann das Andere! Wozu hätte uns Gott die Gaben des Leibes gegeben, als um sie zu brauchen? Schönheit und Kraft sind nichts Geringes, und nur ein Narr schenkt dem andern edle Geschenke, damit er sie fortwirft.«
Paulus blickte erstaunt auf den Jüngling, der seinem Vater und ihm bis zu dieser Stunde in allen geistigen Dingen widerspruchslos gefolgt war, und antwortete kopfschüttelnd:
»So denken die Kinder der Welt, die dem Höchsten fern stehen. Ebenbilder Gottes sind wir gewißlich, aber welcher Sohn küßt das Bild des Vaters, wenn der Vater selbst ihm die Lippen reicht?
Paulus hatte »die Mutter« statt »des Vaters« sagen wollen; aber da er bei Zeiten bedachte, daß Hermas das Glück, sich an eine Mutter zu schmiegen, so früh verloren, sich schnell verbessert. Er gehörte zu Denen, denen es so weh thun würde, Andere zu verletzen, daß sie, als ahnten sie den Sitz auch der verborgenen Wunden ihres Nächsten, sie niemals berühren, außer um sie zu heilen.
Er pflegte sonst wenig zu sprechen, heut aber fuhr er eifrig fort:
»So viel höher Gott ist, als unser erbärmliches Ich, um so viel würdiger ist es für den Christen, an ihn zu denken, als an seine eigene Person. O, wem es doch glückte, ganz dieses Ich zu verlieren und vollkommen aufzugehen in Gott! Aber es läuft uns nach, und wenn die Seele sich schon verschmolzen zu sein wähnt mit dem Höchsten, so ruft es: ›Hier bin ich,‹ und zerrt unser edleres Theil zurück in den Staub. Schlimm genug, daß wir den Flug der Seele hemmen und unser vergängliches Theil zum Schaden des ewigen mit Brod und Wasser und faulem Schlaf mästen und stärken müssen, so gern wir auch fasten und wachen. Sollen wir dem Fleisch nun gar solche Forderungen zum Schaden der Seele zugestehen, die sich leichtlich abweisen lassen? Nur wer sein elendes Ich verachtet und preisgibt, wird durch des Erlösers Gnade, nachdem er sich selbst verloren, sich wiederfinden in Gott.«
Hermas hatte dem Anachoreten geduldig zugehört.
Jetzt schüttelte er den Kopf und sagte:
»Ich verstehe weder Dich, noch den Vater. So lang ich auf Erden wandle, bin ich ich und kein Anderer. Nach dem Tode freilich, aber erst dann, beginnt das neue, ewige Leben.«
»Mit nichten,« unterbrach Paulus ihn lebhaft. »Das andere, höhere Dasein, von dem Du sprichst, beginnt nicht erst im Jenseits für Den, der schon als Lebender zu sterben, der sein Fleisch abzutödten und seine Forderungen zu besiegen, die Welt und sein Ich fortzuwerfen und den Herrn zu suchen nicht abläßt. Vielen ward es vergönnt, schon mitten im Leben wiedergeboren zu werden zu einem höhern Dasein. Sieh' mich, den Aermsten der Armen! Einer nur bin ich, und doch bin ich vor dem Herrn so sicher ein Anderer als Der, der ich war, bevor die Gnade mich erfaßte, wie dieser Palmenschoß, welcher der Wurzel des umgestürzten Baumes entwächst, nicht Eins ist mit dem verfaulten Stamm. Ein Heide bin ich gewesen, und jede Luft des Staubes hab' ich mit vollen Zügen genossen. Dann ward ich ein Christ; die Gnade des Herrn kam über mich, und ich ward neu geboren und zum zweiten Male ein Kind; dießmal aber, Dank meinem Erlöser, ein Kind des Herrn. Mitten im Leben starb ich, stand ich auf, fand ich die Freuden des Himmels. Menander war ich, und wie Saulus, so ward ich Paulus, und Alles, was dem Menander lieb war: Bäder, Gastmähler, Schauspiele, Rosse und Wagen, Ringkämpfe, gesalbte Glieder, Rosen und Kränze, Purpurkleider, Gesang und Frauenliebe, liegen hinter mir wie schmutzige Sümpfe, aus denen ein Wanderer mühsam entkam. Keine Ader des alten ist in dem neuen Menschen zurückgeblieben, und so wie für mich, so hat für alle Frommen mitten auf dem Wege zum Grabe ein neues Leben begonnen. Auch Deine Stunde wird schlagen, auch Du wirst absterben . . .«
»Wär' ich nur, wie Du, ein Menander gewesen!« rief Hermas, den Andern jäh unterbrechend. »Wie vermag man wohl von sich zu werfen, was man niemals besessen? Um sterben zu können, muß man erst leben! Verächtlich scheint mir dieses Jammerdasein und müde bin ich's, euch nachzulaufen wie das Kälbchen der Kuh. Frei und aus edlem Geschlechte bin ich, der Vater selbst hat's gesagt, und wahrlich, ich bin nicht schwächer als die Bürgersöhne in der Stadt, denen ich vom Bad aus in die Ringschule folgte.«
»In der Palästra warst Du?« fragte Paulus erstaunt.
»In der Timagetischen Ringbahn,« rief Hermas erglühend. »Von der Pforte aus sah ich den Spielen der Jünglinge zu, wie sie rangen und mit schweren Scheiben nach einem Ziele warfen. Die Augen sprangen mir schier aus dem Kopfe beim Zuschauen, und laut aufschreien hätte ich mögen vor Groll, so dastehen zu müssen in dem lumpigen Fell und ausgeschlossen zu sein von dem Wettkampf. Wäre Pachomius nicht dazu gekommen, bei den Wunden des Heilands, ich wär' in die Bahn gesprungen und hätte den Stärksten von Allen herausgefordert und mit ihm gerungen, und die Scheibe weiter geschleudert als der duftende Laffe, der den Sieg errang, und den sie bekränzten.«
»Danke Pachomius,« lächelte Paulus, »daß er dich zurückhielt, denn nur Spott und Schande hättest Du in der Ringbahn geerntet. Stark bist Du gewiß, aber das Diskuswerfen will erlernt sein wie jede andere Kunst. Herakles selbst würde in diesem Spiel unterliegen ohne Uebung und die Kenntnisse der Handgriffe.«
»Ich hätte nicht zum ersten Mal geworfen,« rief der Jüngling. »Sieh' her, was ich kann!«
Bei diesen Worten bückte er sich, nahm eine der flachen Steinplatten auf, die hier zusammengehäuft lagen, um den Weg zu befestigen, holte kräftig aus und schleuderte den granitnen Diskus über den Abhang hinweg in die Tiefe.
»Da siehst Du!« rief Paulus, der dem Wurf aufmerksam und nicht ohne neugierige Erregung gefolgt war. »So stark Dein Arm auch sein mag, jeder Neuling wirft weiter als Du, wenn er die Kunstgriffe kennt. Nicht so, nicht so; mit der scharfen Kante muß die Scheibe wie ein Messer die Luft zerschneiden. Wie Du die Hand hältst; so werfen die Weiber! Das Handgelenk gerade und nun den linken Fuß zurück und das Knie gebogen! Sieh' Einer den Tölpel! Gib mir Deinen Stein! So faßt man die Scheibe, so zieht man den Leib zusammen und drückt die Kniee herunter wie das Holz eines Bogens, damit jede Sehne des ganzen Leibes das Geschoß, wenn es entsandt wird, fortschnellen hilft. So geht es schon eher; aber es ist auch noch nichts Rechtes. Erst heb' die Scheibe mit gestrecktem Arme! Nun fasse Dein Ziel in's Auge! Jetzt schwinge sie hoch nach hinten hinaus. Halt da! Noch einmal! Straffer gespannt muß der Arm sein, bevor Du schleuderst. Das ließ sich schon sehen; aber bis zu der Palme drüben könnte man kommen. Gib mir diese Platte und den Stein dort. So! Die ungleichen Ecken hindern die Flugkraft! Jetzt gib einmal Achtung.«
Mit steigender Lebendigkeit hatte Paulus diese Worte gesprochen, und nun faßte er die Steinplatte wie vor vielen Jahren, als kein Jüngling in Alexandria es ihm gleichthat beim Werfen des Diskus.
Er beugte die Kniee, streckte den Oberleib vor, ließ das Handgelenk spielen, holte mit dem bis auf's Aeußerste gestreckten Arme weit aus und schnellte, während die gekrümmten Zehen seines rechten Fußes sich in den Boden bohrten, den Stein in's Weite.
Vor der Palme, die er als Ziel bezeichnet hatte, fiel er nieder, ohne sie zu erreichen.
»Warte,« rief Hermas, »laß mich nun versuchen, den Baum zu treffen!«
Sein Stein durchsauste die Luft, aber erreichte nicht einmal den Hügel, auf dem die Palme Wurzel geschlagen.
Paulus schüttelte mißbilligend den Kopf, griff seinerseits nach einer Platte, und nun begann zwischen Beiden ein lebhafter Wettkampf. Mit jedem Wurfe flog der Stein des Hermas, der Haltung und Griffe seines Lehrers mit großer Gelehrigkeit nachahmte, weiter, während des ältern Mannes Arm zu ermüden begann.
Jetzt erreichte Hermas' Stein schon zum zweiten Mal die Palme, während Paulus bei seinem letzten Wurfe selbst den Hügel gefehlt hatte.
Die Lust des Wettspiels bemächtigte sich mehr und mehr des Anachoreten.
Er warf die Kleider von den Schultern, und einen neuen Stein ergreifend, rief er, als stünde er unter den von Salböl glänzenden Genossen in der Timagetischen Ringbahn, in der er so viele Kränze errungen:
»Beim Silberbogner Apollo und der pfeilfrohen Artemis, ich erreiche die Palme!«
Das Geschoß durchsauste die Luft, sein Oberkörper schnellte empor, sein linker Arm streckte sich und gab dem wankenden Körper das Gleichgewicht wieder, ein Krach, der getroffene Baumstamm zitterte, und Hermas jubelte auf:
»Wundervoll, wundervoll! Das war ein Wurf! Der alte Menander ist doch nicht gestorben! Leb' wohl, und morgen werfen wir weiter!«
Mit diesen Worten verließ Hermas den Anachoreten und eilte mit weiten Sätzen den Berg herab in die Oase.