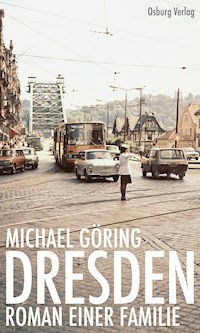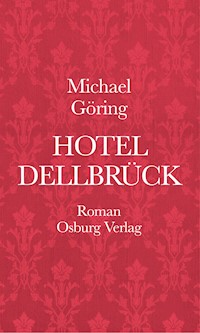
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dezember 1938: Sigmund, 15 Jahre alt, sitzt im Zug nach England. Sigmund ist Jude, Waisenkind, aufgewachsen im Hotel Dellbrück, dem Bahnhofshotel einer westfälischen Kleinstadt. Mit dem Kindertransport kommt er nach Cornwall, wo er von einem methodistischen Ehepaar aufgenommen wird. Hier überlebt er den Krieg und den Holocaust, studiert und wird Lehrer. 1949 entscheidet sich Sigmund für die Rückkehr nach Deutschland. Er unterrichtet an derselben Schule, an der er zwölf Jahre zuvor als "Judenlümmel" schikaniert wurde. Sigmund heiratet Maria, die Tochter des Hoteliers Tono Dellbrück, mit der er vor seiner Flucht nach England aufgewachsen ist. Doch Sigmund fällt es schwer, im Nachkriegsdeutschland heimisch zu werden. Auch sein Sohn Friedemann, der 1955 auf die Welt kommt, ist lange auf der Suche nach Heimat und Bindung. Nach dem Abitur fährt er 1975 mit dem Magic Bus das erste Mal nach Indien, später lebt er eine Zeit lang in Poona und zieht Anfang der 1990er-Jahre mit seiner Freundin Cleo nach Australien. Der Ankerpunkt in Deutschland bleibt das Hotel Dellbrück. Als Frido 2018 auf Besuch in Deutschland vor dem Hotel steht, ist es ein Flüchtlingswohnheim. Unerwartet stark empfindet der jetzt 63-Jährige die Kräfte des Ortes, der ihn und seinen Vater einst so sehr geprägt hat. Der Gang durch das ehemalige Hotel verändert Fridos Leben. Göring greift in diesem Roman erneut zu großen Themen und erzählt sie spannend, einfühlsam und mit leichter Hand: Wie sehr prägt das Schicksal des jüdischen Vaters, der zwischen Schuld- und Hassgefühlen nicht zur Ruhe kommt, den Sohn Frido? Wo findet man Heimat? Wie meistert der Einzelne die Sehnsucht nach Spiritualität und Bindung? Frido stellt die Frage radikal: Wann macht das Leben Sinn? Und wie zuvor Sigmund erlebt auch Frido, wie wichtig es ist, den rechten Moment nicht zu verpassen, wenn man mutig springen und sich Unbekanntem öffnen muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Göring
HOTELDELLBRÜCK
Roman
Erste Auflage 2018
© Osburg Verlag Hamburg 2018
www.osburgverlag.de
Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags
sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg
Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg
Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95510-165-7eISBN 978-3-95510-171-8
Für Miko Emanuel und Eleanor Marie
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Die wichtigsten Personen
Danksagung
Kapitel 1
18. Juni 2018
Lippstadt
Frido
»Was suchen Sie?«
Frido antwortet nicht. Er lässt den jungen Araber stehen, geht die paar Schritte zur Saaltür und öffnet sie. Der Saal ist kleiner, als er ihn in Erinnerung hat. Acht Tische verteilen sich über den Raum, sind beladen mit Spielsachen, Bastelutensilien, Malstiften, Heften. Stühle stehen um die Tische herum. Vor zwei Fenstern hängen grüne Vorhänge, zum Teil aus den Vorhangschienen gerissen, mit bauchigen Falten; die vier anderen Fenster sind frei. Plastikautos parken auf dem Holzboden zwischen Puppen, Duplo-Steinen und Plüschtieren.
»Hier nicht weitergehen«, sagt der Araber, »hier nur Frauen und Kinder. Hier ist Kita. Jetzt nicht, jetzt alle beim Essen, vorne im Speiseraum.«
Er hat schon im Hineingehen den Krach aus dem früheren Restaurant gehört, das Scheppern von Stühlen und Besteck, laute Stimmen, Kreischen der Kinder. Der junge Araber lässt ihn nicht aus dem Blick, während Frido langsam einen kleinen Halbkreis im Saal abschreitet. »Was wollen Sie hier?«, fragt der Araber.
»Nichts«, sagt Frido, »nur schauen«, und fügt leise hinzu, »schauen und erinnern.«
Dann geht er wieder an ihm vorbei, dieses Mal aus der Tür hinaus nach rechts auf die Treppe zu, doch bevor er auf die erste Stufe tritt, hat der Araber ihn eingeholt und sich mitten auf die Treppe gestellt.
»Hier nicht, hier ist alles privat, hier ist Heim!«, sagt er und breitet die Arme aus, um ihn am Weitergehen zu hindern.
»Ich war als Kind oft hier«, sagt Frido. »Das Hotel gehörte meinem Großvater. Wenn wenig Gäste da waren, durften wir in den Zimmern im ersten Stock Verstecken spielen.«
»Nichts Hotel mehr«, sagt der Araber, »Wohnheim! Alles Flüchtlinge und Kinder. Asylanten!«
Frido nickt. »Ich weiß. Steht ja vorne dran. Aber der alte Name ist noch immer eingraviert über der Tür: ›Hotel Dellbrück‹.« Er schaut dem Araber direkt ins Gesicht. Der Junge weicht seinem Blick nicht aus.
»Woher kommen Sie?«
»Ich komme aus Aleppo.«
Frido schätzt ihn auf vielleicht zwanzig Jahre. Der Junge ist groß, schlank, hat einen hellen Teint, kurz geschnittenes schwarzes Haar. Er hat sich seit einigen Tagen nicht mehr rasiert, seine dunklen Augen schauen mit einer Mischung aus Neugierde und Unsicherheit auf ihn.
»Und seit wann sind Sie hier?«
Frido kann nicht behaupten, dass er sich für die Geschichte des Arabers wirklich interessiert. Er will nur freundlich sein, damit der Junge ihm seinen Rundgang nicht verleidet. Während er noch fragt, schaut er ihn schon gar nicht mehr an, sondern blickt zur Decke des Flurs, an der er den Stuck vermisst, der, da ist er sicher, den Flur früher verziert hat. Kalkweißer Stuck mit Blütenköpfen, einer geschwungenen Linie und einer weißen Zierleiste am Rand.
»In Lippstadt seit zwei Jahren, davor Passau, dann München.«
»Und Sie wohnen hier im Hotel Dellbrück?«
»Ja, dritter Stock.«
»Ich würde gern einmal nach oben gehen, mein Vater und meine Mutter sind hier in diesem Haus geboren!«
»Beide hier?«
»Ja«, Frido lacht und ist überrascht, dass der Araber so schnell diese Besonderheit erkannt hat, »ja, sie sind beide hier im selben Jahr in diesem Haus zur Welt gekommen.«
»Sie haben Erlaubnis für Heim? Herr Hildebrand ist nicht da heute.«
Der Araber zeigt mit dem Daumen auf eine Tür im Halbparterre, an der ein Schild angebracht ist: »Direktor«.
»Das war schon bei meinem Großvater das Büro.« Frido lacht. »Da saß Antonius Dellbrück, alle nannten ihn Tono, der ist gestorben, als ich in Hannover studierte.«
Er geht zur Tür des Büros und will sie öffnen. Der Araber erschrickt. »Nein, nein, Herr Hildebrand ist nicht da«, ruft er. Die Tür ist verschlossen. Frido dreht sich zu dem Araber hin.
»Ich heiße übrigens Friedemann Rosenbaum, Sie können mich aber ›Frido‹ nennen, alle nennen mich Frido. Da, wo ich lebe, in Australien, heiße ich ›Frido Ross‹. Ross ist einfacher in Australien als Rosenbaum. Und Sie?«
»Australien? Oh, weit weg.« Der Araber macht eine Pause. Australien hat ihn offenbar beeindruckt. »Ich heiße Djad und ich komme aus Syrien.« Frido lächelt, Djad hat diesen Satz, der völlig akzentfrei daherkam, sicher tausend Mal trainiert, denkt er. »Ich bin vor zwei Jahren gekommen.«
»Ohne Eltern?«
»Ja, ich war unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, ohne Eltern.« Auch dieser Satz wirkt eintrainiert.
»Wie alt sind Sie, Djad?«
»Neunzehn, fast zwanzig.«
»Würden Sie mir Ihr Zimmer im dritten Stock zeigen?«
Djad ist überrascht, er zögert mit der Antwort. »Warum?«, fragt er nach einer Weile.
»Mein Vater und meine Mutter sind im dritten Stock groß geworden, genauer in dem Seitentrakt, der früher mal ein eigenes Haus war.« Frido stockt. So genau braucht er es dem Araber nicht zu erklären. Für die Baugeschichte des Hotels wird der sich nicht interessieren.
»Gut, Sie können kommen!«
Jetzt ist Frido überrascht. Sie gehen am Aufzug vorbei, »ist kaputt, schon lange«, und steigen die Treppe hinauf. Die war früher über die gesamten Stufen mit einem breiten dunkelroten Kokosläufer bespannt, denkt Frido, und für einen Moment spürt er wieder den Kokos unter seinen nackten Füßen. Irgendwann einmal musste er barfuß durchs Treppenhaus gegangen sein, aber wann und warum, kann er nicht erinnern. Jetzt laufen sie über dunkelblaue Auslegeware, mit einer Reihe brauner und schwarzer Kaffee- oder Colaflecken darin. Im dritten Stock stoppt Djad vor einer Tür, an der in metallenen Buchstaben »32« steht. »Mein Zimmer«, sagt er, »und von Farid. Farid ist nicht da. Er ist in Gärtnerei, Gärtnerei Neuhoff. Wollen Sie es wirklich sehen?«
»Nein«, sagt Frido, »so wichtig ist es nicht. Mich interessiert mehr diese Tür.« Er zeigt auf eine Tür am Ende des Gangs, auf der »39a–39f« steht. »Es ist die Tür zur alten Wohnung meines Großvaters. Da hatten meine Mutter und mein Vater ihre Zimmer. Da habe ich geschlafen, wenn ich zu Besuch kam.« Er ist schon auf dem Weg zur Tür, als Djad ihn zurückhält. »Das sind Zimmer für Familien aus Afghanistan. Sind jetzt alle essen, unten. Alles ist zu, verschlossen!«
»Dann warte ich.«
Djad sieht ihn verdutzt an.
»Ich will fragen«, Djad zögert, »warum du aus Australien hier bist? Ich denke, Australien ist sehr reich.«
»Nein, nein, so reich ist es nicht. Ich bin zu Besuch in Deutschland, ich fliege Ende nächster Woche wieder zurück nach Sydney.«
Djad öffnet jetzt die Tür zu Zimmer 32.
»Komm«, sagt er und führt ihn in das Zimmer. An der linken und der rechten Wand stehen je ein Bett, vor dem Fenster ein Tisch mit zwei Stühlen, das Fenster ist gekippt, man hört die Geräusche eines in den Bahnhof einfahrenden Zuges. Es ist alles ordentlich, die Schuhe stehen zu Paaren nebeneinander vor jedem Bett, die Bettdecke ist gefaltet, auf dem Tisch ein geöffneter Laptop, oben auf den beiden Schränken jeweils ein Rucksack, auf einem Bord an der Wand ein Fernseher. Ordentlicher als bei Manuel, denkt Frido. Dann entdeckt er etwas, das er in diesem Zimmer nicht erwartet hatte. Ein kleines Kruzifix aus Metall am Kopfende des linken Bettes.
»Komm«, sagt Djad erneut, und führt ihn zum Tisch, holt von der Fensterbank ein Glas, eine Flasche Cola, ein Schälchen mit Nüssen und weist auf den Stuhl rechts vom Tisch. »Ich würde gern nach Australien fahren, dort leben, arbeiten, aber ich weiß nicht, wie.« Ach, daher weht der Wind, denkt Frido, und lächelt Djad an, der mit großen noch immer etwas ängstlichen Augen auf ihn blickt, während er langsam auf dem Stuhl ihm gegenüber Platz nimmt. »Wie bist du nach Australien gekommen? Viel Geld?« Djad sitzt jetzt sehr aufrecht auf seinem Stuhl, das Kreuz durchgedrückt.
»Nein«, sagt Frido, »mit Geld hatte das nichts zu tun. Aber es ist eine lange Geschichte.«
»Du warst Flüchtling in Australien, Asyl?«
»Nein, nein«, Frido lächelt, »ich war kein Flüchtling, auf jeden Fall kein echter Flüchtling. Ich wollte einfach nur weg.«
Frido nimmt einen Schluck Cola. Für einen Moment sieht er sich als jungen Kerl, so alt wie dieser Djad, aber nicht beim Aufbruch nach Australien, sondern viel früher, wie er den Bus besteigt, damals in Köln nach dem Abitur, den alten Rucksack mit dem hohen Gestell, Hesses Siddhartha in der Jackentasche, wie er sich im Bus umschaut, wer jetzt wie er wochenlang unterwegs sein wird, bis sie irgendwann in Kathmandu ankommen würden. Dabei hat er selbst Kathmandu nie erreicht.
»Warum weg aus Deutschland? Und warum Australien?«, fragt Djad nach. Frido hat keine Lust, seine Geschichte zu erzählen. Er möchte doch einfach nur eine Viertelstunde oder eine halbe in diesem alten Hotel sein, das auf ihn schon als Kind eine besondere Anziehungskraft hatte, die langen Gänge, die vielen Zimmer, die fremden Leute, dieser ganz eigene Hotelgeruch. Und dann Großvater Tono, bei dessen Anwesenheit immer alles leicht erschien.
»Ich wollte einfach weg, wollte mit einer Frau zusammenleben, in die ich mich verliebt hatte.« Er macht eine Pause, nimmt noch einen kleinen Schluck von der Cola. Djad richtet seine dunklen Augen direkt auf ihn. Frido spürt, dass Djad mit seiner Antwort nicht zufrieden ist. »Es hat«, Frido macht eine kurze Pause, als überlege er noch, wie viel er erzählen sollte, »es hat mit meinem Vater zu tun, der war ein richtiger Flüchtling, der war Jude, er musste aus dieser Stadt weg und hat das rechtzeitig geschafft. Er war fünfzehn, als er floh.«
Djad nickt. »Jünger wie ich«, sagt er, »und war er mit Eltern?«
Es war wohl doch nicht richtig, Vaters Geschichte anzusprechen, denkt Frido.
»Nein, mein Vater hatte keine Eltern mehr, er ist wie du als unbegleiteter Jugendlicher aus seinem Heimatland nach England geflohen. Juden sind damals hier verfolgt und ermordet worden.«
»Weiß ich«, sagt der Junge.
Die Ängstlichkeit ist aus Djads Augen verschwunden. Er schaut Frido offen und neugierig an, versucht gar ein Lächeln, während er Fridos Glas nachfüllt.
»Ist noch in England?«
»Mein Vater? Nein, der ist längst tot.« Djad zeigt einen mitfühlenden Blick und bleibt eine Zeit lang still, senkt den Blick auf den Boden.
»Ich würde auch gern nach Australien, schönes Land, und viel Arbeit.« Er hebt den Kopf. »Aber dann wieder nach Syrien, wieder Aleppo.«
»Warum wieder Syrien?«
»Hier ist nicht zu Hause. Hier ist«, Djad stockt, »hier ist Reise, weißt du, nicht meine Seele, nicht Heimat.« Der Junge macht eine Pause. »Ist deine Seele hier oder in Australien?«
Djad schaut ihn mit großen Augen an. Der Junge hat schöne Augen, denkt Frido, lange schwarze Wimpern und dichte feine Augenbrauen. Frido will dieses Gespräch nicht. Statt einer Antwort weist er mit dem Daumen auf das Kreuz über dem Bett.
»Das Kreuz gehört Farid«, sagt Djad, noch bevor Frido eine Frage stellt. »Farid ist kein Moslem, ist syrischer Christ. Du bist auch Christ?«
»Oh«, antwortet Frido, »nicht so ganz. So einfach ist das bei mir nicht.« Er senkt den Blick auf das Cola-Glas vor ihm. Er wird den Araber enttäuschen müssen, er hat keine Lust auf Bekenntnisse, schon die Frage nach der Heimat war überflüssig und jetzt kommt noch die Seele dran und der Glauben! Er wollte doch nur noch einmal durchs Hotel gehen, ein paar alte Bilder in sich wachrufen, ein wenig in Nostalgie schwelgen. Frido drückt sich auf dem Stuhl gegen die Lehne.
»Ich bin so eine Mischung aus Christ und ein wenig Buddhist.« Der Junge blickt ihn unverwandt an, als wüsste er, dass das nicht alles ist. »Dann kommt von meinem Vater noch eine kleine Portion jüdisch hinzu«, Frido überlegt kurz, »von Bhagwan Osho die ein oder andere ganz brauchbare Lebensmaxime, und dann bin ich bei alledem wohl überwiegend Atheist.«
Der Junge nickt. Wahrscheinlich kommt ihm diese Mischung etwas albern vor, denkt Frido, die steckt er sicher in die Schublade ›Typischer Westler‹.
Eine Glocke schrillt im Zimmer. »Entschuldige«, sagt Djad und dreht sich zur Tür. »Ich habe Hausdienst, bin gleich wieder im Zimmer.« Damit läuft er schon auf den Flur hinaus. Frido ist erleichtert, spürt aber eine gewisse Unruhe, die Djads Fragen in ihm ausgelöst haben, und ärgert sich darüber. Er war doch nicht im Hotel, um religiöse Bekenntnisse abzugeben! Und das auch noch vor einem jungen, ihm völlig unbekannten Syrer, den es zufälligerweise in dieses Haus verschlagen hat.
In diesem Moment pfeift eine Lok. Das Hotel Dellbrück ist nun mal das Bahnhofshotel, denkt Frido und hört wieder die Stimme seines Großvaters: »Eine bessere Lage für ein Hotel gibt es einfach nicht«, sein Onkel und seine Tante halten laut dagegen, sie streiten, und erst später hat er verstanden, dass es bei diesen Streitigkeiten um Hotelpläne in Bad Waldliesborn ging, für die Tante und Onkel gern das Hotel Dellbrück am Bahnhof verkaufen wollten, Großvater aber nicht. »Tempi passati«, murmelt Frido und nimmt das Glas Cola in die Hand, ohne davon zu trinken. Er sieht deutlich das frühere Dellbrück, diesen strahlend weißen Bau mit drei Stockwerken über dem Hochparterre mit den hell erleuchteten Festräumen und einem vierten Stockwerk unter dem Dach, wo die Bediensteten ihre kleinen Zimmer hatten. Es wird für ihn immer Tonos Hotel bleiben. Er hat ihn gleich wieder vor Augen, diesen etwas untersetzten Mann mit den kurzen grauen Haaren und den leuchtend blauen Augen hinter der schwarzen Brille. Er sieht ihn lachen, sieht, wie er beim Sprechen die Arme bewegt, wie er den Kopf zu einer Grimasse erstarren lässt, ihn als Kind erschreckt und dann wieder laut lacht. »Ich bin das Ungeheuer, das dich jagt«, ruft Großvater, grunzt laut, läuft hinter ihm her und kitzelt ihn, sobald er ihn eingeholt hat. Tono hat er immer fröhlich erlebt, anders als Sigmund, seinen Vater. Er versucht, auch ein Bild seines Vaters im Hotel wachzurufen, schließlich war er oft genug mit ihm dort, aber es gelingt nicht. Jedes Mal ist es so, als würde Sigmund gleich aus dem Bild weggesogen, und schon erscheint Tono wieder, oder Rile, seine Mutter.
Frido horcht auf den Flur hinaus, keine Spur von Djad. Er fühlt sich jetzt unwohl in diesem fremden Zimmer, steht auf, schaut noch einmal kurz auf das Kreuz über dem Bett von Farid und tritt auf den Flur hinaus, als die Lok gerade ein zweites Mal pfeift, spitz und eindringlich wie alle E-Loks, und er einen weiteren Pfiff hört, einen hellen, sehr lauten Ton. Er ist acht oder neun Jahre alt und steht in eben diesem Flur im dritten Stock neben seinem Großvater, der beim Pfeifen der Lok die rechte Hand hebt und irgendetwas zu diesem Ton oder zu der Lok sagt. Dann zeigt Großvater auf die Treppe und sagt: »Komm!« Sie steigen die Stufen in den vierten Stock hoch. Die Holztreppe, die hier nicht mehr mit dem Kokosläufer bedeckt ist, knarzt unter Großvaters Gewicht und seinen festen Schritten. Oben betreten sie ein schmales Zimmer, in dem ein altmodisches blaues Bett und ein blauer Schrank stehen und an dessen Wänden ein paar Bilder in schwarzen und goldfarbenen Rahmen hängen. »Hier ist dein Vater geboren, der Sigmund!« Großvater geht mit ihm zuerst ans Fenster, und für einen kleinen Moment sehen sie noch die Dampfwolke hoch über den Gleisen, die sich auflöst, während sie aus der Ferne ein letztes Mal den Ton der Lokomotive hören, die den Bahnhof längst verlassen hat.
Auch jetzt knarzt die Treppe, als Frido zum vierten Stock hinaufsteigt. Er geht geradewegs auf eine bestimmte Tür zu, ohne weiter zu überlegen, drückt die Klinke hinunter, und tatsächlich öffnet sich die Tür. Er sieht als Erstes sich selbst. Im großen Spiegel der Tür gegenüber steht ein langer, schlanker Mann, das blaukarierte Hemd oben offen, ein leichtes helles Sommersakko, schwarze enggeschnittene Jeans. Er sieht die hohe Stirn, das Haar, dessen Zurückweichen ihn seit Jahren bekümmert, noch immer ist es kraus, aber längst nicht mehr schwarz, sondern grau, nur die Augenbrauen und die Wimpern haben ihr Schwarz behalten. Die krausen Haare, ein Erbe seines Vaters, hat er als Kind und Jugendlicher überhaupt nicht gemocht, hasste es, wenn seine Mutter von »Naturkrause« sprach, »um die dich jede Frau beneiden würde«. Das war es ja, er wollte keine Krause wie junge Frauen. Erst mit weit über zwanzig konnte er sich mit seinen Haaren anfreunden. Jetzt, denkt er, verlassen sie ihn, ziehen sich immer weiter zurück, mögen ihn nicht mehr. Zwei schmale Falten gehen von der Stirn zur Nasenwurzel, zwei weitere, breitere von den Nasenflügeln zum Kinn, und unter den Augen ruhen Tränensäcke, nicht erst seit Cleos Tod, aber seitdem noch ausgeprägter. Rechts neben der Unterlippe ist die runde Warze, im Durchmesser etwas kleiner als eine Ein-Cent-Münze, manchmal färbt sie sich von innen rot, und wenn er beim Rasieren nicht aufpasst und sie verletzt, blutet sie für einige Zeit. Sie war plötzlich da, lange vor Cleos Tod, aber seltsamerweise empfindet er seit Jahren eine ebenso unerklärliche wie tiefsitzende Scheu, sich dieses Ding einfach wegschneiden zu lassen. Was macht es schon, wenn da eine Warze im Gesicht ist, solange sie sich nicht allzu oft rot färbt. Nein, das Gesicht spiegelt seine 63 Jahre, der Rest, denkt Frido, ist zum Glück jünger.
Ein letzter Blick in den Spiegel, dann tritt er ein. Es ist ein kleines Zimmer, an dessen rechter Wand ein blauer Schrank steht. Das Bett ist modern, eine Art Futon mit kaum sichtbarem Gestell, aber der Schrank ist der alte von damals. Er ist sich sicher: Er ist in dem Zimmer, in das ihn vor fünfzig Jahren sein Großvater geführt hat und in dem er ihm vor diesem blauen Schrank und dem damals blauen Bett von seiner anderen Großmutter erzählt hat, von Tilla, Vaters Mutter, die in diesem Zimmer gewohnt hat und hier seinen Vater zur Welt gebracht hat. Den Namen Tilla hat er behalten, obgleich Vater eigentlich nie von ihr gesprochen hat, außer dass sie Jüdin gewesen ist und Kaltmamsell. Er sieht sich in dem Zimmer um. Plötzlich kommt ihm der Gedanke, ob er hier noch irgendetwas finden könnte, was an seinen Vater erinnert.
Das Zimmer wird offenbar zurzeit nicht benutzt. Die Matratze ist zwar bezogen, aber es liegt kein Bettzeug bereit. Er öffnet die Tür des Schranks, als suche er etwas wie »Sigmund war hier«, eingeritzt in die Türinnenseite. Dabei fällt sein Blick auf ein Bild an der Wand, eine Heidelandschaft, in Öl gemalt, mit drei großen Birken am Rand eines sandigen Weges, auf dem ein einsamer Wanderer geht, eine dunkle Rückenansicht, das Ganze eingefasst in einen schlichten schwarzen Holzrahmen. Für einen Moment glaubt er, dass dieses Bild schon damals, als er mit seinem Großvater hier war, an derselben Stelle neben dem Schrank gehangen hat. Die Schranktüren quietschen in den Scharnieren, da ist nichts auf den Innenseiten geschrieben. In den Fächern links liegen alte Decken übereinandergestapelt, der rechte Schrankteil ist bis auf vier Holzbügel, die an der Messingstange hängen, leer. Er erinnert sich, wie Großvater gesagt hat, eine Hebamme und seine Schwester hätten bei der Geburt geholfen und dann habe man im ganzen Hotel einen Schrei gehört und Sigmund, sein Vater, sei dagewesen.
Fast hundert Jahre war das her, überlegt Frido, und mehr als fünfzig Jahre sind vergangen, seit er, der Sohn, durch die Flure rannte, sich versteckte, und Großvater so tat, als würde er verzweifeln, weil er ihn nicht fand. Onkel Hannes kommt ihm in den Sinn, er sieht ihn in der Soutane als Mönch auf Urlaub im Hotel und er sieht dessen Trauerfeier, einen Tag nach dem Begräbnis in Maria Laach. Dabei blickt er auf die Heideszene im schwarzen Rahmen, auf den sandigen Weg zwischen den Trauerbirken mit dem schwarz gekleideten einsamen Wanderer in der Mitte. Als könne gerade dieses Bild ihn aus der Rührung befreien! Aus einem plötzlichen Impuls heraus nimmt er es von der Wand. Es misst vielleicht fünfzig mal vierzig Zentimeter und auffallend ist, dass jetzt, wo er das Bild kippt, sich dessen Rückwand wölbt. Er fährt mit der Hand über die Hinterseite und fühlt deutlich: in dem schmalen Raum zwischen dem Leinen und der Rückwand aus festem Packpapier steckt etwas, wahrscheinlich sind es Papiere oder Fotos oder vielleicht sogar Dokumente. Vielleicht etwas über Sigmund, das noch keiner kennt. Frido horcht zur Tür hin, in diesem Augenblick kommen Geräusche aus dem Treppenhaus, da ist die Stimme von Djad, der mit einem anderen Mann spricht. Sie scheinen die Treppe hochzusteigen. Kann er das Bild nicht einfach mitnehmen? Oder noch schnell die Rückwand vorsichtig öffnen?
Kapitel 2
80 Jahre früher
18. Dezember 1938
Lippstadt
Sigmund, Rile, Tono, Tante Betty, Emmi
Bis zur Bahnhofstreppe waren es nur noch wenige Meter.
»Natürlich schreibe ich dir, Rile, gleich, wenn ich ankomme. Großes Ehrenwort.«
Seine Stimme war fest geblieben, immerhin. Vor ihnen gingen Tono, Emmi und Tante Betty. Tono trug den kleinen braunen Koffer, den sie letzte Woche für ihn gekauft hatten. Mit dem Weihnachtspäckchen von Rile darin und dem großen Lederanhänger am Griff, auf dem sein Name stand und die neue Adresse: Sigmund Rosenbaum, bei Leyland, 12 Castle Road, Wadebridge, Cornwall, England. Fast hätte der Platz nicht gereicht.
»Und schreib mir auf Deutsch, nicht auf Englisch.«
»Klar doch, was denn sonst.«
Rile nahm seine rechte Hand. Wenn der Abschied doch nur schon vorbei wäre! Ein kalter Wind war aufgekommen, im Radio hatten sie Schneeregen angekündigt, doch noch war es trocken. Betty drehte sich zu ihnen um, versuchte, ihren Mund zu einem Lächeln zu formen, was ihr misslang.
»Du hast wirklich alles dabei, Siggi?«, sagte sie und beinahe hätte ihre Stimme, die heftig schwankte, ganz versagt.
Sigmund nickte. »Alles im Rucksack, Tante Betty.«
Er merkte, dass auch seine Stimme jetzt brüchig klang und dass er schlucken musste. Er dürfte auf keinen Fall anfangen zu weinen, vor Rile, vor Tono, vor Tante Betty. Wenn es doch nur schon vorbei wäre!
»Auch den Brief von diesen Quäker-Leuten? Den musst du ja in Düsseldorf vorzeigen!« Sigmund nickte nur. Er wollte nicht sprechen, er wusste, was er zu tun hatte, Tono und er waren alles mehrmals durchgegangen: Bahnhofsmission in Düsseldorf, Hoek van Holland, die Quäker-Organisation, Harwich, das war nicht schwer. Und er lernte ja schon seit drei Jahren Englisch.
Vor drei Tagen hatte er sich im Bad vor den Spiegel gestellt und sein Spiegelbild befragt, ob er nicht vielleicht doch so etwas wie ein Entdecker sei, wie damals die Eroberer, die zu Reisen in unerforschte Länder aufgebrochen waren. Er hatte im Spiegel lange sein Gesicht betrachtet, das schwarze wuschelige Haar, das kaum ein Kamm beherrschen konnte, die Narbe an der rechten Stirn, die dunklen Augen, den Flaum über der Oberlippe, und hatte versucht, einen möglichst mutigen, männlichen Ausdruck einzunehmen. Den, so meinte er, würde er in Cornwall gebrauchen können, auch wenn Cornwall kein unerforschtes Land mehr war. Er hatte in den letzten beiden Jahren kräftig an Länge zugelegt, war mit seinen fünfzehn Jahren einer der größten in der Klasse und war jetzt nach einigen Versuchen vor dem Spiegel durchaus zufrieden: Er würde nichts erobern, aber er war sicher groß genug, um in diesem Wadebridge zu überleben und in Cornwall viel zu entdecken. Der Gedanke hatte ihm gutgetan. Doch jetzt auf dem kurzen Weg zum Bahnhof neben der weinenden Rile waren die Abenteuer-Phantasien dahin, und besonders groß fühlte er sich auch nicht mehr.
Als Tono ihm letzte Woche sagte, dass er Lippstadt verlassen müsste, war sofort Harry vor seinem inneren Auge erschienen. Harry war schon vor zwei Jahren mit seinen Eltern ausgewandert. Seitdem hatte er keinen Freund mehr in der Klasse. Sie waren noch zusammen in der kleinen alten Synagoge zur Bar-Mizwa gegangen, wobei Harry ihm geholfen hatte, als der Rabbi Fragen zu Geschichten aus der Thora stellte, die er nicht beantworten konnte, weil er doch immer mit den Dellbrücks in die katholische Nicolaikirche ging. Seit dem allerersten Tag auf dem Gymnasium hatten sie nebeneinandergesessen, hatten im gleichen Sommer in der Lippe am Großen Knick schwimmen gelernt und waren mit ihren Rädern oft stundenlang auf den Pfaden lippeaufwärts oder lippeabwärts unterwegs gewesen. Die kleine Fabrik, die Bürsten, Handfeger und Besen herstellte, hatte Harrys Vater im Sommer 1936 verkauft, und schon kurze Zeit danach waren die Rosenthals – Harry, seine Eltern, die drei Schwestern und Harrys Großvater – weg, »abgehauen«, wie Dr. Brauer, der Klassenlehrer, das Wort in die Länge ziehend und mit breitem Grinsen zwei Tage später in der Klasse verkündete.
Am Abend hatten sie noch gemeinsam Latein gelernt. Harry hatte plötzlich mit lautem Knall das Lateinbuch zugeschlagen, war ganz nah an ihn herangerutscht und hatte ihm ins Ohr geflüstert, dass sie nach Kolumbien zögen.
»Ich durfte es dir nicht eher sagen. Morgen fahren wir mit dem Zug nach Basel. Von der Schweiz dann nach Frankreich, Spanien, Portugal, von Lissabon mit dem Schiff nach Kolumbien. Du darfst es aber noch keinem weitererzählen.«
Sigmund starrte erschrocken auf das Buch vor ihm, sagte lange nichts und hob dann langsam den Kopf. »Nach Kolumbien! Was macht ihr denn in Kolumbien?«
»Papa hat dort einen Vetter, der will uns helfen. Papa meint, Bürsten und Besen bräuchten die auch in Kolumbien.« Sigmund war sich nicht sicher, ob er vielleicht träumte. Es war so unwirklich. Sie hatten gerade noch die e-Deklination geübt für die Klassenarbeit am Freitag, und plötzlich galt das alles nicht mehr!
»Und was ist mit mir, wenn du weg bist?«, fragte er Harry.
»Du bist hier sicher, sagt Vater, du bist ja viel mehr katholisch als jüdisch und du lebst bei den Dellbrücks, dir kann gar nichts passieren, aber für uns …« Harry ließ den Satz unvollendet.
Sie waren die beiden ›Judenlümmel‹ in der Klasse. Nicht jeder Lehrer hatte sie so genannt, nein, aber einige schon, Dr. Brauer zum Beispiel, der Klassenlehrer, Herr Bergmann, der Sportlehrer. Die Mitschüler sagten so etwas nicht, waren eher gleichgültig.
»Ich werde dir schreiben, Siggi, mindestens jede Woche«, sagte Harry mit leiser, fast versagender Stimme und stand langsam auf. Sigmund begleitete ihn zur Wohnungstür. Aus dem Zimmer von Rile kam Radiomusik, aus dem Zimmer ihres Bruders Hannes hörten sie Töne einer recht lieblos gestrichenen Geige, in der Küche klapperte Emmi, die das Abendessen vorbereitete, mit Geschirr und Besteck. Beim Gang über den Flur hatte Sigmund das Gefühl, er würde gar nicht richtig auftreten, als fänden seine Füße keinen festen Grund, als würde er eher schwimmen als gehen. Unzählige Male hatte er seinen Freund um diese Zeit zur Wohnungstür begleitet und ihn mit einem »tschüss, bis morgen« verabschiedet. Und das sollte jetzt vorbei sein?
An der Tür zog er Harry mit einer hastigen Bewegung zu sich heran, umarmte ihn still, dann lehnte Harry für einige Sekunden seinen Kopf an seine Schulter. »Mach’s gut, Harry!«
Harry sagte nichts, nickte nur noch ein paar Mal kurz und drehte sich dann abrupt zur Treppe. Sigmund schlich zurück in sein Zimmer, sah auf den Bahnhofsplatz hinaus und beobachtete ein letztes Mal, wie sein Freund auf dem Fahrrad langsam den Platz überquerte. Kurz bevor er in die Wilhelmstraße einbog, drehte sich Harry noch einmal um und Sigmund sah, wie er auf das Hotel schaute, auf das Fenster im dritten Stock des Anbaus, hinter dem er stand. Sekunden später war Harry verschwunden. Er warf sich auf sein Bett. Er hatte doch so fest geglaubt, dass Harry und er die Jahre bis zum Abitur zusammenblieben. Zwei gegen den Rest der Klasse, deren Kinder jetzt weniger mit ihnen sprachen, sie oft nicht einluden, wenn Geburtstage gefeiert wurden. Das tat jedes Mal weh, doch sie waren ja zu zweit gewesen. Jetzt aber würde er allein in der Klasse sein, ein Außenseiter.
Er schlug mit beiden Fäusten auf sein Bett. Was sollte all das? Warum mussten Harry und seine Eltern gehen? Warum freuten sich Leute wie Dr. Brauer, wenn Juden »abhauten«. Waren Juden denn wirklich von Natur aus schlecht? Er wusste, dass es nicht stimmte, wenn die Leute von den »reichen Juden« sprachen. Harrys Eltern hatten nur eine kleine Wohnung über der Bürstenfabrik, reich waren sie sicher nicht, trotz ihrer Fabrik. Bei den Löwensteins konnte es gestimmt haben. Die besaßen einen Pelz- und Teppichhandel. Jetzt waren nur der alte Löwenstein und seine Frau in der Stadt zurückgeblieben, und wenn er abends durchs Restaurant ging, saß der alte Herr immer allein da, nicht mehr am Stammtisch wie früher, sondern allein bei seinem Bier und murmelte etwas von Palästina, was doch nichts für alte Leute sei. »Der junge Löwenstein war mein bester Cognac-Kunde«, hatte Tono gesagt, »immer nur alter französischer Cognac. Der Löwenstein wird sogar unserer Betty fehlen, und zwar beim Jahresabschluss!« Tono hatte gelacht und da hatte auch er gelacht.
Aber es war nicht zum Lachen. Er hatte Harry verloren und verspürte Angst vor dem, was wohl als Nächstes kommen würde. Auch wenn er seit seiner Geburt bei den Dellbrücks lebte und sie ihn alle mochten, wusste er: er war ein anderer als sie. Er war – er sprach es jetzt halblaut aus – ein Waisenkind und ein Jude. Warum himmelten so viele diesen Adolf Hitler an, der seinen Freund vertrieben hatte? Aber dieser Hitler war es ja nicht allein. Sigmund hatte Bergmann vor Augen, ihren Sportlehrer, der drei Wochen zuvor so eine blöde Bemerkung gemacht hatte. Harry und er würden wohl besser nicht länger in der Klassenmannschaft spielen, hatte er gesagt, weil Judenlümmel in einer deutschen Knabenmannschaft nichts zu suchen hätten. Aber dann hatte er Harry doch in die Mannschaft geholt, als sie gegen die 8a spielten und zurücklagen, und Harry hätte damals fast ein Tor geschossen, ganz knapp war der Ball über den Balken gegangen. Aber jetzt war Harry fort, für immer, auf dem Weg nach Kolumbien.
Er hatte Emmi gebeten, vom Abendessen befreit zu sein und im Zimmer bleiben zu dürfen, er habe Magenschmerzen, er wolle nicht zu Abend essen. Emmi brachte ihm Kamillentee, schaute ihm in die Augen, fragte aber nicht weiter. Erst am nächsten Abend erzählte er Tono und Emmi, dass Harry und seine Eltern die Stadt verlassen hätten. »Scheiß Hitler«, hatte Tono gesagt.
Seitdem waren mehr als zwei Jahre vergangen und jede Minute davon war in den letzten Tagen wieder hochgekommen, gleich nachdem Tono ihn ins Wohnzimmer geholt hatte. Es war am späten Abend, die anderen Kinder waren in ihren Zimmern oder schliefen bereits. Am Adventskranz auf dem Wohnzimmertisch brannten zwei Kerzen. Selten hatte er Tono so ernst erlebt wie an jenem Abend. »Nach der Kristallnacht ist es für alle Juden noch unsicherer geworden, auch für Kinder wie dich. Ich habe alles in die Wege geleitet, Siggi. Glaub mir, es ist das Beste, wenn wir dich in England in Sicherheit bringen.« Daraufhin hatte er ihm die Einzelheiten der Verschickung erläutert und geschlossen mit: »Irgendwann kommst du zurück!«
Nach England? Ohne Tono, ohne Rile? Jetzt war eingetreten, was er seit Harrys Flucht hatte kommen sehen: In wenigen Tagen würde er allein auf sich gestellt sein. Doch der Gedanke wollte nicht tiefer eindringen, blieb irgendwo stecken. Sigmund schaute auf die zwei Kerzen im Adventskranz, stellte ein paar Fragen zu wann und wie und wohin genau. Seine Stimme war leise, fast ausdruckslos. »Ich bin froh, dass du das so vernünftig aufnimmst«, sagte Tono, »du wirst sehen, es ist das Beste.« Sigmund nickte.
»Wirklich noch vor Weihnachten?«, fragte er zurück.
»Ja, gleich nächste Woche!« Da raste nur noch dieses »nächste Woche« durch seine Gedanken, blockierte alles Weitere. Er nickte noch einmal, murmelte ein »Gute Nacht«, ging schnell in sein Zimmer und flüsterte wieder »nächste Woche!«. Lange konnte er nicht einschlafen. Als er endlich eingenickt war, wachte er bald wieder auf, schreckte aus Träumen auf, in denen er lange Zeit in unbekannter Landschaft gewandert, aber niemals irgendwo angekommen war, nicht einmal wusste, wo er denn ankommen sollte, bis er wieder aufgewacht war und sich lange im Bett wälzte. Dann war Tono plötzlich in seinem Zimmer, setzte sich im Nachthemd auf die Bettkante, und Sigmund richtete sich auf, warf sich an seinen Hals und umarmte ihn, so fest er konnte. »Irgendwann kommst du zurück, Siggi, ganz bestimmt«, war Tonos Satz, den er beständig wiederholte.
Sie hatten die große Treppe zum Haupteingang des Bahnhofs erreicht. Plötzlich fegte eine Bö die Stufen herunter und Tono, der vor ihnen ging, hatte in letzter Sekunde nach seinem Hut gegriffen. Die hastige Bewegung ließ Sigmund kurz lächeln. Tono hatte in den letzten Jahren an Gewicht zugelegt, doch hatte die Drehung etwas tänzerisch Leichtes, eine Spur von Komik gehabt, bevor sie am Ende beinahe in ein Stürzen überging. Während er noch schmunzelte, schluckte Rile heftig und drückte seine Hand. Oben angekommen, wandte Betty sich zu ihnen hin. »Es tut so weh, euch beide so zu sehen, wie Schwester und Bruder, Hand in Hand! Es ist so unendlich traurig.« Ihre Stimme versagte, und sie drehte sich wieder zur Tür. Sigmund wand schnell seine Hand aus der von Rile. Es würde komisch aussehen, wenn ihn irgendjemand, den er kannte, Hand in Hand mit Rile sah.
Kapitel 3
18. Dezember 1938
Lippstadt
Tono, Emmi, Tilla
Tono ging voran in die Bahnhofshalle, in der sich jetzt am Vormittag nicht sehr viele Menschen aufhielten. Es grauste ihm vor dem Gedanken, den Jungen in wenigen Minuten in den Zug nach England setzen zu müssen. Wann würde er ihn wieder abholen? Würde er ihn überhaupt jemals … Tono wagte nicht weiterzudenken. Vielleicht war das alles übertrieben, aber diese Nacht letzten Monat steckte ihm noch in den Knochen. Bartels Willi hatte geschworen, dass die Feuerwehr nicht gelöscht, sondern nur den Übergriff der Flammen auf das Nachbarhaus verhindert hätte, aber die Synagoge habe abbrennen lassen. Ohne einzugreifen! Am Tag danach war ihm klar geworden, dass auch Sigmund gefährdet war. Er ging zum Schalter, um die Bahnsteigkarten zu lösen.
Sechzehn Jahre waren vergangen, seit im Hotel Dellbrück erstmals das Gerücht umgegangen war, Tilla, die Kaltmamsell des Hauses, sei schwanger. Das Gerücht stimmte. Emmi hatte ihren Mann im Verdacht. Denn Tono hatte anderthalb Jahre zuvor, kurz nachdem Hannes zur Welt gekommen war, eine Liaison mit Lore gehabt, die in der Hotelgaststätte bediente. Ein anderes Hausmädchen hatte Emmi einen Wink gegeben, Tono wusste, dass Abstreiten und Lügen keinen Sinn machen würde und gestand zerknirscht seinen Fehltritt. Emmi war außer sich. Sie machte ihrem Mann eine Riesenszene, drohte mit Bloßstellung und Scheidung und ließ ihn schmoren. Lore schickten sie zu ihren Eltern zurück, und erst als klar war, dass Tonos Seitensprung ohne Folgen geblieben war, lenkte Emmi ein, stellte aber unmissverständlich klar, dass sie beim nächsten Fehltritt die Scheidung einreichen würde.
Tono musste viel Geschick aufbringen und schwur bei allen Heiligen, dass er Tilla nicht angerührt hatte. Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, denn berührt hatte er Tilla schon, war jedes Mal gern in der engen Tür zur Wäschekammer stehen geblieben, wenn sie hereinstürmte und sich an ihm vorbeizwängen musste. Ein einziges Mal hatte er sie sogar geküsst, lang und intensiv, aber das war im Februar 1916, als er Emmi noch gar nicht kannte. Er war damals achtzehn Jahre alt und hatte den Einberufungsbefehl für die Kaserne in Wesel erhalten. An diesen Kuss musste er wieder denken, als er neben seiner Frau im Ehebett lag und alle Eide schwor, dass er an Tillas Schwangerschaft unschuldig war.
Tilla war über Jahre hin die hübscheste Angestellte im Hotel Dellbrück. Ihr Vater, Pferdehändler in Rietberg, hatte Ende 1914 mit ihr an der Hand das Hotel betreten. Fünfzehn Jahre war Tilla damals, gerade fertig mit der Schule, noch ein Kind. Der Krieg war ausgebrochen, der zum Weltkrieg werden sollte; keine schlechte Zeit für einen Pferdehändler, aber man musste sehen, dass man die Töchter in Stellung bekam. Ihr Vater hatte die gute Jacke angezogen, war wie sie schweigend vom Bahnhof zum Hotel hinübergegangen, die vier breiten Stufen zum Hoteleingang hochgestiegen und hatte am Empfang ganz leise nach der Frau Direktor Elisabeth Dellbrück gefragt. Da war Betty schon die Treppe heruntergekommen, groß, sehr aufrecht gehend, in einem leuchtend blauen Kleid mit weißer Bluse, die einen breiten Rüschenkragen hatte. Tilla war sich sehr klein vorgekommen, als Betty sie und ihren Vater ins Bürozimmer bat, an dessen Tür »Direktor« stand. Erst als Betty ihnen gegenüber am Schreibtisch Platz genommen hatte, wagte Tilla, den Kopf zu heben und ihr direkt ins Gesicht zu schauen. Sie war überrascht, wie jung diese Frau Direktor Dellbrück war, die sie so freundlich anlächelte. Sie bekam die Stelle; Küchenhilfe mittags und abends und Zimmermädchen am Vormittag, freie Kost und Logis, 12 Mark im Monat und jedes zweite Wochenende entweder den Samstag oder den Sonntag frei. »Samstags, bitte«, hatte ihr Vater noch erbeten, »damit sie mal in die Synagoge gehen kann und auch zur Mikwe, zum Bad.«
Betty hatte dafür gesorgt, dass Werner sie in der Küche ordentlich anlernte. Schon nach wenigen Wochen hatte sie gesagt, sie wolle, dass Tilla die Kaltmamsell des Hotels würde. Werner hatte sie daraufhin scharf angeschaut. Er stand schließlich in der Küche des Hotels, seit Heinrich Dellbrück es 1897 eröffnet hatte. »Kaltmamsell, wozu? Das wäre Ihrem Vater nie eingefallen«, hatte er gebrummt, sich aber dann doch um Tilla gekümmert. Mit Mayonnaise-Schlagen fing es an, dann belegte Tilla die Brote mit Aufschnitt und Käse, verzierte sie mit geviertelten Gurken, Radieschen, feingeschnittenen Tomatenscheiben, machte den Fleischsalat, den Heringssalat, den Eiersalat, lernte die Sülze einzulegen, bereitete den Matjes zu, und schon bald zeigte sich, dass sie für diese Arbeiten großes Talent besaß. Betty hielt sich mit Lob nicht zurück. Manchmal fügte sie ihren Worten fünfzig Pfennige bei, steckte ihr die Münze oben links in die Küchenbluse, während sie Tilla freundlich anlächelte und Tilla sich verlegen bedankte. Werner bemerkte die Anerkennung, die Tilla erhielt, schimpfte noch mehr mit ihr als sonst. Aber es entging ihm nicht, dass jetzt abends mehr kalte Speisen verlangt wurden als zuvor. Er tröstete sich: es waren schlechte Zeiten, die Gäste hatten nun mal nicht viel Geld, da ging dann eben mehr kalt als warm. Wenn er sich doch wieder darüber ärgerte, ließ er die Wut an Hans ab, dem Küchenjungen, der keine andere Wahl hatte, als Werners Backpfeifen zu ertragen.
1912 hatte Heinrich Dellbrück nach dem großen Rheumaschub seinem ältesten Kind, der Tochter Betty, das Hotel überschrieben. Sie führte das Haus zur Überraschung ihres Vaters sehr erfolgreich. Sogar in den Hungerwintern des Weltkriegs war die Speisekarte des Hotelrestaurants stets ordentlich bestückt. Das sprach sich in der Stadt herum. Auch die zehn Einzel- und acht Doppelzimmer waren gut belegt, da Betty mit den beiden Metallwerken in der Stadt gleich 1913 einen Rabattvertrag ausgemacht hatte. Mit dem häufigen Besuch von Beamten des Kriegsministeriums und von Ingenieuren anderer großer Fabriken sorgten die beiden Werke für eine gute Auslastung.
Als Tilla einen Tag vor Tonos Abmarsch nach Wesel 1916 in der Wäschekammer den ersten »richtigen« Kuss ihres Lebens bekam, wusste sie nicht, wie ihr geschah. Dann rannte Tono aus der Tür und Betty kam in die Kammer. Sie sah Tilla weinen, fragte aber nicht. Tilla lehnte sich an ihre Brust, schlang die Arme um sie, und murmelte nur immer wieder: »Ich wollte das nicht.« Betty beruhigte Tilla, gab ihr einen kleinen sanften Kuss auf die Stirn und strich ihr zart über das Haar. Sie sprachen nicht wieder darüber. Tono kämpfte in Rumänien, wo er sich noch im gleichen Jahr eine geheimnisvolle Krankheit einfing, deren Namen nur seine Schwester erfuhr. Und als sie im Lexikon nachgeschlagen hatte, was der Name bedeutete, beschloss sie, ihn gleich wieder zu vergessen. Wenig später war bei ihrem Bruder eine schwere Ruhr dazu gekommen und er wurde auf Heimaturlaub geschickt. Dieser zog sich hin. Die Ruhr hatte Tonos Herz angegriffen und Dr. Singer, der Chefarzt des Inneren im katholischen Dreifaltigkeitskrankenhaus attestierte eine Herzinsuffizienz als Folgeerkrankung. Das Attest verhalf Dr. Singers Tochter Lisbeth 1917 zu einem außerordentlich üppigen und dennoch preiswerten Hochzeitsmahl für achtzig Gäste im großen Festsaal des Hotels, zu dessen Vorspeise Tilla all ihre Künste aufbieten musste. Für Tono bewirkte das Attest den Bescheid des Militärkommandos, dass er für den Feldeinsatz nicht länger in Frage komme. Tono wurde zum Dienst in der Schreibstube nach Aachen beordert. Als Betty ihn zum Bahnsteig begleitete, hatte Tono bei der Einfahrt des Zuges ein fröhliches Lied gepfiffen. Er hege nicht die geringsten Pläne, als Held zurückzukommen, hatte er ihr erklärt, diejenigen, die es zum Eisernen Kreuz dränge, könne er nur belächeln.
Als Tono 1918 mit einundzwanzig volljährig war und mit Kriegsende nach Lippstadt zurückkehrte, bestand sein Vater darauf, dass Betty nun Tono, dem Stammhalter, das Hotel überschrieb. Betty grollte ihrem Vater einige Tage lang, fügte sich dann aber doch seinem Willen. Tono wurde Chef und war klug genug, alle wichtigen Entscheidungen mit ihr abzusprechen oder gleich ihr zu überlassen.
In der Bahnhofshalle war es kalt. Eine Viertelstunde würde es bis zum Eintreffen des Zuges noch dauern. Tonos Blick traf auf Sigmund, blieb gleich an dessen Narbe an der Stirn hängen, die er sich mit fünf beim Sturz vom Geländer der großen Treppe im Hotel zugezogen hatte, als er, Tono, unaufmerksam gewesen war. Das hatten sie im Krankenhaus nähen müssen. Keine schöne Erinnerung! Wieder erschien in seinem Kopf Tilla. Als sie damals schwanger wurde, hatte er sich Gedanken gemacht, wer wohl mit ihr das Bett geteilt hatte. Ob es im Hotel geschehen war? In Tillas kleinem Zimmer oben unterm Dach? Das hätten die anderen Mädchen gehört und hätten nicht geschwiegen. Auch hatte er sich Sorgen gemacht, wie sie Tillas Arbeit am besten verteilten. Sie war die Fleißigste im Hotel gewesen, nicht nur die Hübscheste. Sie hatten es schließlich hinbekommen mit den Aushilfen aus der Nachbarschaft, und Tilla war ja auch bald wieder in der Küche gewesen. Die hatte sich nicht geschont, und um Siggi kümmerten sie sich einfach tagsüber mit in ihrer Wohnung im dritten Stock. Er spielte mit Hannes und mit Rile, das passte gut. Aber Sigmunds Vater blieb unbekannt. Nur dass auch er Jude war, das hatte Tilla ihm drei Jahre später verraten, als sie auf dem Krankenbett lag und ahnte, dass sie sterben würde.
Als er sich jetzt in der Bahnhofshalle umdrehte, sah er als Erstes seine Frau, die ihn mit ihren großen braunen Augen anblickte. Er wusste, Emmi würde frieren, würde sich wahrscheinlich gleich bei ihm beschweren, dass sie doch wieder viel zu früh losgegangen waren. Diese Augen hatte er vor zwanzig Jahren das erste Mal gesehen und war ihnen gleich verfallen. Es waren nicht nur die Augen gewesen. Emmi hatte in ihm etwas bewegt, hatte ihn aufgefordert, sich zu fragen, was er denn vom Leben erhoffte. Und schon beim dritten oder vierten Treffen hatten sie von Familie gesprochen, von Kindern. Da wusste er, bei ihr würde er zu Hause sein, sie würden eine große Familie gründen, bei ihr wäre es gut. Er liebte seine Emmi noch immer, liebte sie wie damals, trotz ihrer nicht unbeträchtlichen Lust zu nörgeln, ihrer Eifersucht und ihrer leichten Reizbarkeit, Eigenheiten, die nun einmal zu ihr gehörten. Er war sich allerdings sicher, dass er sie die ganze Zeit genau so geliebt hätte, auch wenn er damals wirklich etwas mit Tilla gehabt hätte. Dass Frauen das partout nicht verstehen wollten!
Emmi machte ihm ein Zeichen, bewegte den Mund. »Kalt hier«, formte sie mit den Lippen. Als er gestern den Kindern erzählte, dass Sigmund sie verlassen müsste, weil er nicht mehr sicher war, hatten alle vier geweint. Vor allem seine kleine Rile, die mit ihren knapp fünfzehn Jahren gar nicht mehr so klein war. Vielleicht hatte sie schon mehr als kindliche Gefühle für Sigmund, wer konnte das wissen. Sie tat ihm leid, wie sie sich gar nicht wieder beruhigen wollte. Warum dieser Hitler so was mit den Juden machte, hatte sie ihn bestimmt zehn Mal gefragt!
Er müsste noch irgendetwas Kleines haben, das er Siggi mitgeben könnte, dachte Tono, Schokolade oder Pfefferminz, irgendetwas. Er spürte, dass sich eine Träne in sein rechtes Auge schlich. Ja, er hatte Siggi seit Tillas Tod wie einen Sohn gesehen, er liebte ihn wie seinen Hannes, vielleicht sogar etwas mehr als Hannes, aber das war eine eigene Geschichte, die hatte hier auf dem Bahnhof bei Siggis Abschied nichts zu suchen. Hoffentlich würden diese Leylands in England ihn gut behandeln. Siggi war ja ein eher stiller, zurückhaltender Junge, kein Draufgänger. Er schaute sich nach dem Kiosk um.
Kapitel 4
18. Dezember 1938
Lippstadt
Tilla, Betty
Sigmund war am 1. April 1923 auf die Welt gekommen. Oben, im vierten Stock, im kleinen Zimmer von Tilla hatten Betty und eine Hebamme alles hergerichtet, die Wehen kamen und man konnte die Schreie zwei Stockwerke tief hören und den erlösenden Schrei dann im ganzen Hotel. Ein Junge! Emmi hatte die Wiege zur Verfügung gestellt, in der zwei Jahre zuvor noch Hannes gelegen hatte. Es war die alte Dellbrück’sche Wiege, in der schon Betty und Tono als Säuglinge geschlafen hatten. Einige Tage später war Sigmund beschnitten worden. Tilla hätte gern Sigmunds Vater dabeigehabt, aber er hatte sich nicht mehr gemeldet. Zwei Briefe von ihr waren unbeantwortet geblieben. Auch ihr Vater war nicht gekommen. »Mutter schämt sich, weil du ja keinen Mann hast«, hatte er geschrieben.
Drei Tage nach der Beschneidung feierten sie in der Wohnung von Emmi und Tono Sigmunds Geburt. Sogar der alte Seniorchef war gekommen. Tono öffnete eine Flasche Sekt und ließ den Sektkorken aus dem offenen Fenster in die Nacht hinein knallen, wie schon bei Hannes’ Tauffeier drei Jahre zuvor. Als alle ein Glas in Händen hielten, sah er die Gelegenheit für eine kleine Ansprache.
»In deinem Sigmund, Tilla, zeigt sich Gottes große Liebe.« Alle waren still im Zimmer. Tono liebte solche Sätze, machte eine kurze Pause, schaute auf Tilla, dann auf die Wiege vor ihm. »Wer weiß, was alles auf den kleinen Sigmund zukommt? Wer weiß, was der liebe Gott mit ihm vorhat. Vielleicht wird er«, Tono zögerte ein wenig, »vielleicht wird er Koch in unserem Haus, vielleicht aber zieht er in die weite Welt und wird ein Entdecker. Auf jeden Fall wird er, da bin ich sicher, seinen eigenen Weg finden und ihn gehen. Und dabei wollen wir ihm alles Glück der Welt wünschen.«
Betty begann zu klatschen. »Wie schön, Tono!«, aber Tono machte ein Zeichen; er war noch nicht fertig.
»Wir sind hier im Hotel eine große Familie, in der jeder für jeden einsteht. Du weißt Tilla, du gehörst zu uns, du bist die beste Kraft in unserem Haus, und – du bist die beste Kaltmamsell in ganz Westfalen!«
Jetzt klatschten alle, leise, damit Sigmund nicht aufwachte, am leisesten klatschte Emmi. Tilla freute sich, dass Tono so schöne Worte für sie gefunden hatte. Sigmund lag – von allem unberührt – schlafend in seiner Wiege. Tono goss sich noch einmal Sekt nach, wobei er stur auf sein Glas starrte, um Emmis scharfem Blick auszuweichen. Jetzt schaute Emmi auf den kleinen Sigmund und strich sich dabei über den Bauch. In vier Monaten würde ihr zweites Kind da sein, und sie hoffte, es würde ein Mädchen.
»Was für ein wunderbares Kind, Tilla, du kannst so stolz auf deinen Sohn sein!« Betty strahlte Tilla an, ließ den Blick von ihr zu Sigmund wandern und zurück zu ihr. Betty meinte es ehrlich. Sie freute sich für Tilla, und es machte ihr gar nichts, dass da kein Vater für Sigmund war. Dieses Fehlen sollte Sigmund nicht schaden, das hatte sie sich vorgenommen. Sie hatte Tilla gleich am Wochenbett gesagt, dass Sigmund einer von ihnen wäre, wie sie. Tilla hatte dies gern gehört, war aber realistisch genug zu wissen, dass es nicht für alle stimmte. Sie musste nur auf Emmi schauen. In diesem Moment meldete sich der Seniorchef zu Wort.
»Komm, trink noch einen kleinen Schluck, Mädchen, es ist ein guter Tropfen!«
Heinrich Dellbrück lächelte ihr zu und hob unter Mühen das Glas. Sein schweres Rheuma plagte ihn mehr und mehr, und er kam nur noch selten die hundert Meter von seiner Wohnung ins Hotel. Tilla lächelte zurück, nippte an ihrem Glas und nickte dem Seniorchef zu. Sie war bei aller Freude unsicher. Sie war nicht oft im Wohnzimmer der Dellbrücks gewesen.
Tono und Emmi hatten zwei Jahre zuvor das Nachbargebäude des Hotels gekauft und in allen Stockwerken Durchbrüche geschaffen. Seitdem gab es im Hotel mehr Zimmer und am Ende des dritten Stocks eine Tür, die in Tonos und Emmis Wohnung im Nachbargebäude führte, in der sie gleich drei Kinderzimmer eingeplant hatten. Zu Recht: Auf Hannes war Maria gefolgt, mit der Emmi bei der Feier zu Sigmunds Geburt schwanger war und die in der Familie seit ihrem ersten Tag immer nur Rile genannt wurde. Drei Jahre später, nach Tillas frühem Tod, hatten sie Sigmund als weiteres Kind in ihre Wohnung aufgenommen, in der er ohnehin schon die meiste Zeit seiner ersten drei Jahre mit Hannes und Rile verbracht hatte. Tono hatte sich zuerst gewundert, dass die Entscheidung, Sigmund als Pflegekind bei ihnen großzuziehen, für seine Frau so selbstverständlich war. Aber er verstand: Emmi hatte stets Distanz zu Tilla gehabt, nicht zu Sigmund. Und obgleich Emmi am Abend, als sie diese Entscheidung trafen, bereits mit Manfred, ihrem dritten Kind, schwanger war, hatten sie anschließend eine Nacht voller Leidenschaft miteinander verbracht wie kaum eine zuvor, und es war ihm der verrückte Gedanke gekommen, dass in dieser Nacht Sigmund wirklich ihr Kind geworden war.
Betty zog ein neues Taschentuch aus der kleinen Tasche. Es war eine blöde Idee von Tono, den Siggi in die Fremde zu schicken. Das war alles völlig übertrieben! Siggi war doch bei ihnen aufgewachsen. Der war trotz dieser Bar-Mizwa, oder wie das hieß, Katholik, ging mit ihnen in die Nikolaikirche, kannte all die schönen Kirchenlieder, der hätte Ministrant sein können. Und jetzt nach England! So weit weg. Vielleicht aber hatte Tono recht. Sie würden es ja sehen. Fast alle Cohns waren schon nach Amerika ausgewandert, die jungen Löwensteins waren fort, die Ostheimers, die Windmüllers, die jungen Salms, es war keine gute Zeit für die Juden unter diesem Führer, so tüchtig er war. Aber Siggi würde ihr fehlen. Und wie! Sie hatte doch Tilla auf dem Sterbebett versprochen, dass sie immer für Siggi da sein und immer auf ihn aufpassen würde! Vielleicht sollte sie mit nach England gehen? Aber das war ja nicht möglich. Tono brauchte sie im Hotel. Er konnte zwar zu jedem Gast stets freundlich sein, ›Womit kann ich dienen, mein Herr?‹ und sang bei jeder Feier, wenn die Gäste dies wollten, aber er war kein guter Kaufmann. Wenn Tono allein wäre mit dem Hotel, würde das nicht lange gut gehen. Das wussten alle. Nein, ihr Bruder hatte andere Qualitäten, aber nicht die eines Kaufmanns. Und was sollte sie mit einem Fünfzehnjährigen an der Hand in England?
Betty seufzte. Warum hatte Tilla nur so früh sterben müssen? Warum musste gerade sie diese fürchterliche Grippe bekommen? Siggi war doch erst drei Jahre alt gewesen. Sie hatten sie ins Krankenhaus gebracht und nicht gedacht, dass man sie zehn Tage später im Sarg hinaustragen würde. Betty griff noch einmal zum Taschentuch. Erst hatte sie Tilla verloren, jetzt würde sie auch noch Siggi verlieren, den sie doch wie einen eigenen Sohn liebte! Wer würde denn jetzt auf ihn aufpassen?
Jeder im Hotel wusste, dass Tono die Entscheidungen seiner Schwester überließ und dafür lieber hinter der Rezeption stand und Neuankömmlinge mit großer Geste empfing. Mittags und abends lief er im Restaurant von Tisch zu Tisch und fragte jeden mit ausgesuchter Höflichkeit, ob es denn auch geschmeckt habe. In seinem Büro notierte er auf kleinen Kärtchen, was die Hausgäste gegessen und was sie besonders gelobt hatten. Kam Regierungsrat Meyer aus Berlin nach einem Jahr wieder ins Hotel, wurde er schon am ersten Abend damit begrüßt, ob er nicht wieder gedächte, den rheinischen Sauerbraten zu essen mit extra viel Rosinen, er, Tono, erinnere sich gut, dass der Herr Regierungsrat gerade dieses Gericht bei seinem letzten Besuch so gelobt hätte. Am Gesicht des Gastes war abzulesen, wie sehr es ihm schmeichelte, dem Hotelier auf diese Weise im Gedächtnis geblieben zu sein. Und bestellte Herr Meyer als Vorspeise marinierten Matjes oder den feinen Hühnersalat, so holte Tono, als Tilla noch da war, diese aus der Küche, nicht ohne sich zu vergewissern, ob Tillas Schürze auch weiß und ohne Flecken war.
»Darf ich Ihnen, Herr Regierungsrat, die Kaltmamsell des Hauses vorstellen?« Tono wusste, dass Tilla mit ihrem hübschen Gesicht, den großen dunklen Augen und dem schwarzen vollen Haar auf jeden Mann Eindruck machte. Und Tilla wusste es ebenfalls. Es konnte vorkommen, dass der Regierungsrat nun jeden Abend zum Essen zusätzlich eine kalte Vorspeise bestellte und darum bat, dass die Kaltmamsell doch bitte selbst die Speise bringen möge. Tono vermerkte die Vorspeisenwünsche auf seinen Kärtchen und Tilla bekam von Herrn Meyer zwei Groschen oder gar ein Fünfzigpfennigstück in die Hand gedrückt. Tilla erwiderte diese Freundlichkeit ganz wie vom Gast erwartet mit einem langen, dankbaren Blick und Knicks. Und Tono war zufrieden. Regierungsrat Meyer würde in Lippstadt nie in einem anderen Hotel absteigen, und eine Lohnerhöhung war bei Tilla nicht nötig. Auch Tilla war zufrieden, in guten Wochen kamen ein bis zwei Mark zusätzlich in den Sparstrumpf. Manchmal blieb ein Blick eines Gastes länger bei ihr hängen, aber nach wenigen Tagen hatte sie ihn dann doch vergessen.
So mancher Gast hatte in den Jahren nach Tillas Tod nach ihr gefragt. Tono erzählte dann die tragische Geschichte. Hanna, Tillas Nachfolgerin in der Küche, bemühte sich bei den Speisen sehr, aber Tono merkte schnell, dass es sich nicht lohnte, Hanna in weißer Schürze aus der Küche zu holen, um dem Gast selbst die Schinkenplatte oder den Heringssalat zu servieren. Das machte er dann lieber selbst. Sein unangestrengtes, geradezu fröhliches Zugehen auf seine Gäste bereitete ihm und den Gästen immer wieder Vergnügen, er setzte es ganz bewusst ein. Feierte eine Gesellschaft im Festsaal, genügte zu vorgerückter Stunde eine kleine Aufforderung und Tono setzte sich an das schwarze Klavier und spielte und sang drei, höchstens fünf Lieder; es waren immer dieselben, denn sein Repertoire war und blieb bescheiden, aber es reichte, um die Gäste zu erfreuen, die danach meist eine weitere Runde Wein oder Bier bestellten und den Sänger und Chef des Hauses daran großzügig teilnehmen ließen. Dies bereitete Emmi in den letzten Jahren zunehmend Kummer. Doch auch wenn Tono bis weit nach Mitternacht im Festsaal tätig war und dabei so manches Glas Bier oder Wein getrunken hatte, so ging er morgens doch frisch rasiert und noch vom Duft des Rasierwassers umgeben zu den Hotelgästen an die Frühstückstische und begleitete mit einem kurzen Diener seine Fragen, womit er helfen könne und ob sie, die werten Gäste, eventuell etwas vermissten. Es war nicht seine Schuld gewesen, dass in den Jahren nach Ende des Krieges die Zahl der Übernachtungen abgenommen hatte. Die Zeit nach 1918 war nicht günstig gewesen für Dienstreisen zu Unternehmen in der westfälischen Provinz. Zum Glück hatte Betty erneut vorgesorgt, indem sie gleich mit mehreren Bauern ausgemacht hatte, dass diese sich noch am Schlachttag aufmachten, um Werners Kühlraum im Hotel mit frischem Schweine- und Rinderfleisch, Geflügel und feinen Würsten zu füllen. Der Umsatz des Restaurants hatte in dieser Zeit das Hotel aufrechterhalten. Betty wusste, was sie tat.
Tono hatte den Kiosk erreicht. Er schaute auf die Auslage. »Geben Sie mir bitte Dr. Hillers Pfefferminz.« Tono zeigte auf die weiße Rolle mit den schwarzen Großbuchstaben. Er hatte doch alles versucht, damit Siggi katholisch wurde, damals mit Dechant Schlootmann. Das war 1932, da hätte er ihn taufen können und heute würde keine Gefahr für den Jungen bestehen. Aber was hatte Schlootmann gesagt? »Die Juden haben Christus ans Kreuz geschlagen, da sollten wir besser keine Juden zu Katholiken machen!« Was für ein Unsinn! Als ob der kleine Siggi den Herrgott ans Kreuz geschlagen hätte. Aber Schlootmann war stur geblieben, auch nach dem dritten Bier. Doch vor drei Wochen war er plötzlich im Hotel erschienen, mit einem kleinen Zettel in der Hand, auf dem die Adresse dieser Quäker stand. Hoffentlich würden die halten, was sie versprachen. Teuer genug war es ja, aber für Siggi hatte er das gern getan. Sobald die Nazis weg sind, kommt Siggi zurück, das war klar. Aber das konnte lange dauern. Alle liebten den Führer. Ja, er hatte für Arbeit gesorgt, auch dem Hotel ging es gut, die Metallwerke hatten wieder volle Auftragsbücher, da kamen mehr Dienstreisende als zuvor, da stimmte alles. Sogar im Restaurant lief es ordentlich. Viele Lippstädter leisteten sich Geburtstagsfeste im Lokal, Betty hatte auch jetzt wieder vorteilhafte Bedingungen mit den Bauern und den Schlachtern ausgemacht. Letzten Monat erst hatte die Brauerei den Fasspreis gesenkt, weil das Hotel so guten Umsatz machte. Sie konnten nicht klagen, konnten auch das Geld aufbringen für diese Quäker-Gesellschaft und für Siggis Überfahrt. Doch was mit den Juden geschah, war nicht richtig. Sie alle bloßzustellen, den Verkehr mit ihnen zu verbieten, dann die Sache mit den Synagogen. Nein, dass Siggi jetzt nach England aufbrach, war richtig. Er hörte wieder, wie sie das Segenslied für Sigmund gesungen hatten, damals bei der kleinen Feier nach Siggis Geburt, Emmi mit ihrer hohen zarten Stimme, sein Vater mit dem brummelnden Bass und Betty mit ihrem Tremolo im Sopran voller Rührung:
Viel Glück und viel Segen
auf all deinen Wegen,
Gesundheit und Frohsinn
sei auch mit dabei.
Und er erinnerte sich, dass in diesem Moment erstmals die P 8 in den Bahnhof eingefahren war. Er hatte sie an dem hohen Ton erkannt. Diese Lok war der Stolz der Preußen. Als Inhaber eines Bahnhofshotels war es selbstverständlich, dass er Ahnung hatte von Loks und Fahrplänen. Er hatte das Wohnzimmerfenster geöffnet, damit alle, auch sein Vater, diesen besonderen neuen Ton hören würden. Als Tono jetzt wieder an die Lok dachte, wurde ihm gleich wohler zumute. Es war der erste leichte Moment auf diesem Weg zum Abschied. Emmi hatte damals darauf bestanden, dass das Fenster gleich wieder geschlossen würde, wegen Siggi in der Wiege und weil es ihr kalt war. Vielleicht würde ja auch heute die P 8 den Zug nach Düsseldorf ziehen.
Emmi fror. Sie schaute auf die Uhr. Wenn der Zug pünktlich wäre, dauerte es keine zehn Minuten mehr. Sie mochte nicht, dass Rile bei diesem Abschied dabei war. Rile war so zart, und sie litt so deutlich unter der Situation. Wahrscheinlich hatte sie ein paar Jungmädchen-Gefühle für Siggi entwickelt. Da war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Siggi jetzt … Sie zögerte. Das war nicht der richtige Gedanke. Nein, nach England müsste er deswegen sicher nicht gehen. War ohnehin übertrieben, ihn ins Ausland zu schicken, war eine von diesen Ideen von Tono, der ja schnell übertrieb, wenn seine Gefühle angesprochen waren. Immer musste Überschwang dabei sein!
Das hatte sich ja damals auch Tilla zunutze gemacht. Tilla wusste, wie sie mit Tono und Betty umgehen musste. Das liebe, brave Mädchen vom Lande. Sie hatte richtig gehandelt, dass sie zu Tilla ins Zimmer gegangen war, als jeder sehen konnte, dass Tilla ein Kind erwartete. Für das erste Hotel am Platze geziemte es sich nicht. Gut, sie waren nicht das erste Haus am Platze, eher das zweite, aber eine Kaltmamsell, die ein Kind erwartete und nicht verheiratet war, nicht einmal den Namen des Vaters preisgab, das war nicht richtig. Vielleicht durften Juden so was, aber in einem katholischen Hotel ging das eigentlich nicht. Tilla hatte geweint, als sie zu ihr in den vierten Stock hinaufgestiegen war und sie zur Rede stellte. Sie habe Angst um den guten Ruf des Hotels, hatte sie ihr gesagt und gefragt, ob sie denn überhaupt wisse, wer der Vater ihres Kindes sei. Da hatte Tilla sich lange nicht mehr vor Weinen beruhigen können. Natürlich wüsste sie, wer der Vater war, sie hätte doch nur diesen einen Freund. Tilla hatte wahrscheinlich geglaubt, man würde ihr kündigen. Aber das hätten Betty und Tono ja nie zugelassen. Zwölf Jahre waren jetzt vergangen, seit sie gestorben war. Es war richtig gewesen, dass sie sich nach ihrem Tod entschlossen hatten, Siggi bei sich großzuziehen, auch wenn viele in der Stadt glaubten, Siggi sei eben doch Tonos Sohn. Auf dem Gymnasium war Siggi klüger als Hannes. Und er hatte etwas ganz Eigenes, wenn er so nachmittags über Stunden an der Lippe entlangwanderte. Ja, sie mochte ihn, mochte ihn sogar sehr. War schade, dass er jetzt allein ins Ausland musste. Rile würde für lange Zeit traurig sein. Und bei dieser Politik, die der Hitler machte, konnte niemand vorhersagen, wann Sigmund zurückkommen könnte. Vielleicht gab es ja wieder Krieg. Sie würde Rile trösten müssen.