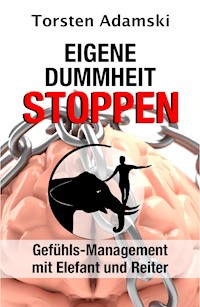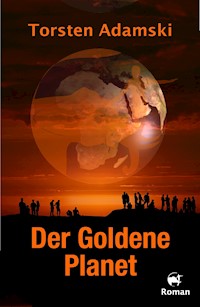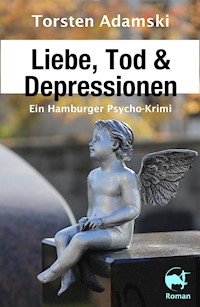2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein selbstzufriedener 40-jähriger Programmierer, den alle nur Herr Schmidt nennen, wird einen Tag nachdem er bei seiner Mutter in Poppenbüttel ausgezogen ist, in seiner neuen Wohnung auf St. Pauli von einer Mücke ins Ohr gestochen. Als er wieder aufwacht, hört er in seinem Kopf die Stimme seines Unbewussten - seines Elefanten. Durch den unfreiwilligen Dialog mit seinem Elefanten und dessen fotografischem Gedächtnis muss Herr Schmidt erkennen, dass er bis jetzt ein armseliges Leben in selbst gewählter Einsamkeit geführt hat. Auf einer skurrilen Reise voller Humor stellt er sich der Angst vor seiner Mutter, rettet einen Zwerghamster und findet heraus, was er wirklich braucht, um erwachsen zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Verena, Lilia, Ariane und Malte.
Torsten Adamski
Hotel Mom –Flucht nach St. Pauli
© 2019 Torsten Adamski
1. Auflage
Umschlaggestaltung und Illustration:
Torsten Adamski
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-7497-4317-9 (Paperback)
978-3-7497-4318-6 (Hardcover)
978-3-7497-4319-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Der Balkon
Kapitel 2: Die Straße
Kapitel 3: Ich und ich
Kapitel 4: Stabilität und Innovation
Kapitel 5: Frühstück mit Elefant
Kapitel 6: Invasion der Angst
Kapitel 7: Schandtatenliste Teil 1
Kapitel 8: Der Engel
Kapitel 9: Trennung von Papa
Kapitel 10: Schandtatenliste Teil 2
Kapitel 11: Aufbruch nach Poppenbüttel
Kapitel 12: Ankunft in Poppenbüttel
Kapitel 13: Showdown in Poppenbüttel
Kapitel 14: Unerwarteter Shuttle-Service
Kapitel 15: Wiedersehen mit Papa
Kapitel 16: Die Rettung des Date
Kapitel 17: Das Date und die Kunst
Kapitel 18: Balkon im Mondlicht
Kapitel 19: Nackte Tatsachen
„Lange Zeit sträubte ich mich einzusehen, wie wichtig es ist, über sich selbst lachen zu können. Verständlicherweise fiel es mir auch in anderen Situationen schwer, die Herausforderungen des Lebens mit Humor zu nehmen. Erst als mir klar wurde, dass die Welt so ist, wie wir glauben, dass sie ist, konnte ich von diesem unsäglichen Glaubenssatz ablassen, denn wer will schon in einer bierernsten Welt leben?“
Torsten Adamski
Kapitel 1: Der Balkon
Brrr – brrr – brrr. Brrr – brrr – brrr. Brrr – brrr – brrr. „Dies ist die Mailbox von Olaf Schmidt. Ich habe im Moment was anderes zu tun, aber wenn du mir unbedingt eine Nachricht hinterlassen willst, lass dich nicht aufhalten.“
„Jungchen? Warum gehst du nicht ran? Ich bin es, deine Mutter! Liegst du etwa noch im Bett? Es ist schon nach Mittag und ich habe gestern Abend gar nichts mehr von dir gehört! Also rufe mich gleich zurück oder soll ich mir etwa Sorgen machen?“
Herr Schmidt saß auf seinem Balkon im 4. Stock der Gilbertstraße auf St. Pauli und seufzte. Die Sonne schien zwar und er konnte über die Häuser die Kräne des Hafens erkennen, aber die Stimme seiner Mutter hallte immer noch in seinen Ohren nach und verdarb ihm die Freude an dem wunderschönen Ausblick. Aber er musste einsehen, dass er selbst schuld war. Warum hatte er auch den Anrufbeantworter laut gelassen? Es war doch klar, dass sie heute anrufen würde. Gestern Abend war schön. Sehr schön! Gestern Abend konnte er dabei zusehen, wie sich die oberen Decks der Queen Mary II ganz langsam hinter den Häuserdächern langschob. Sein erster Abend in Freiheit – ganz allein auf seinem Balkon! Er hatte nicht vergessen, sie anzurufen. Er hatte es explizit vermieden. Er wollte den Anfang seines neuen Lebens in vollen Zügen genießen. Doch nun schien sie ihn wieder eingeholt zu haben – mit einem banalen Telefonanruf. Er versuchte, sich einzureden, dass es nur eine Stimme auf einem Anrufbeantworter war. Seine Situation hatte sich nicht wirklich geändert in den letzten drei Minuten – es ist immer noch alles gut. Probleme gibt es nur im Kopf.
Die Sonne schien. Doch trotzdem war es etwas zu kalt für diese Jahreszeit. Sagte jedenfalls gerade die Stimme aus dem Radio in der Küche. NDR-Info – wissen, was die Welt bewegt. Eigentlich ein toller Claim, aber Herr Schmidt war sich nicht ganz sicher, ob er NDR-Info hört, um zu wissen, was die Welt bewegt. Täglich neue Überraschungen, meistens Katastrophen, die allerdings von den Experten, die dazu ihre Experten-Meinungen äußerten, meistens nicht als überraschend eingestuft wurden. Als er weiter darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass Überraschungen unvermeidlich waren, wenn man Nachrichten im Radio hört. Das ist der Sinn und Zweck des Formates: Neuigkeiten, die man noch nicht kennt und nach denen man sich richten kann. Nachrichten. Ob man sich dann wirklich danach richtet oder nicht, bleibt natürlich jedem frei gestellt. Aber Radio zu hören und sich an überraschenden Neuigkeiten zu stören, macht keinen Sinn.
Er lächelte. Es gab ihm ein gutes Gefühl, wenn er Widersprüche in seinen Gedanken fand und diese dann nur mit Hilfe seiner eigenen Gedanken klären konnte. Also, Nachrichten im Radio bringen gezwungenermaßen Überraschungen mit sich, aber nach den Nachrichten, braucht man sich nicht zu richten, jedenfalls nicht gezwungenermaßen. Wenn man dies erst einmal erkannt hat, gibt es kein Problem.
Herr Schmidt lächelte wieder, diesmal mit einem selbstbewussten Anflug von Frohsinn, denn Selbstbewusstsein entstand für ihn aus Intelligenz. Die Macht der Logik. Und der zu Folge muss Intelligenz immer wieder überprüft werden. Wegen der eigenen Betriebsblindheit. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Dieser Aufwand lohnt sich, wie sich eben ja auch beim Thema Nachrichten wieder herausgestellt hatte. Er war nicht so einer, der mal schnell - husch husch - etwas dahindachte und es nicht überprüfte. Er konnte sich auf seine Gründlichkeit verlassen.
Eigentlich, so kam ihm ein weiterer Gedanke, hörte er NDR-Info nur, weil er irgendetwas hören wollte und dabei sicher sein wollte, dass er keine Werbung hören müsste. Und darauf konnte man sich bei diesem Sender verlassen. Herr Schmidt fand es schön, dass es im Leben Dinge gab, auf die man sich verlassen konnte.
Eigentlich war Herr Schmidt der Namen seines Vaters – Norbert Schmidt. Er selbst hieß eigentlich Olaf – aber seit diesem für ihn verhängnisvollen Film namens Herr Lehmann nannten ihn die meisten seiner wenigen Freunde Herr Schmidt, ohne ihm allerdings verständlich machen zu können, warum. Er sah nicht im Entferntesten aus wie Christian Ulmen, er war noch nie in Berlin, er trank keinen Alkohol und hatte auch noch nie in einer Bar gearbeitet. Kein Alkohol hört sich so prinzipiell, so geplant an, aber dem war nicht so. Kein Alkohol meinte eigentlich kaum Alkohol, denn nur, weil er ein, zwei Mal im Jahr an einem Wein oder Sekt nippte, wusste er, dass er immer noch keinen Alkohol mochte. Und betrunken sein war eine vollkommen unnötige Behinderung – da war Herr Schmidt sich sicher. Nicht so sicher war er sich plötzlich, ob er überhaupt Freunde hatte. Ob er überhaupt wusste, was Freundschaft war oder woran man erkennen konnte, dass aus einem Bekannten ein Freund geworden wäre.
Er schaute auf, hoch in den Himmel. Es war gut, dass er von seinem Balkon aus den Himmel sehen konnte. Der Himmel war sein Freund. Sein Balkon war auch sein Freund. Ein geräumiger, stabiler Freund, auf dem neben dem quadratischen Glastisch ohne Probleme die zwei großen, neuen Gartenstühle passten. Wahrscheinlich sogar vier. Wenn er vier Stühle gehabt hätte, hätte er dies sofort überprüfen können. Es ginge vielleicht auch mit den beiden Küchenstühlen. Die waren zugegebenermaßen ein ganzes Stück kleiner als seine bequemen Gartenstühle aus Rattan-Imitat, aber für eine solide Einschätzung würde es sicherlich reichen. Er stand auf, ging durch die Balkontür in die angrenzende Küche, holte die beiden Stühle auf den Balkon und positionierte sie an den beiden freien Seiten des Tisches. Dann nahm er auf dem ersten Küchenstuhl platz, streckte seine Beine aus und blickte sich um. Alles in Ordnung. Dieselbe Prozedur auf dem nächsten und sicherheitshalber auch noch auf dem zweiten Gartenstuhl. Er lächelte zufrieden, denn er hatte sich nicht geirrt: man konnte bequem zu viert auf seinem Balkon sitzen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Einer sofort selbst durchgeführten Beweisführung kann keine Logik widerstehen.
Er schaute wieder in den Himmel. Der Himmel war immer wichtig, obwohl die meisten Menschen ihn nur selten angemessen würdigten. Außer den Astronomen natürlich. Er hatte auch einmal ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, Astrophysik zu studieren, aber jetzt im Nachhinein war es gut, dass er sich nicht dafür entschieden hatte, auch wenn ihm diese Entscheidung damals schwer fiel. Er hatte alles richtig gemacht, mit den Stühlen, mit seinem Umzug in die Gilberstraße, mit seinem Leben, auch wenn er immer noch nicht wusste, was es mit der Freundschaft auf sich hatte.
Dieser Gedanke machte ihn wieder nachdenklich. Kein Wunder, Gedanken – denken – nachdenklich. Alles passte. Es ist wichtig, dass man die eigenen Gedanken versteht. Manchmal dauert es vielleicht etwas länger als einem lieb ist, weil die notwendigen Überprüfungen ihre Zeit brauchen, aber so ist es nun einmal im Leben: Qualität braucht ihre Zeit und auch im Denken kann man wichtige Dinge nicht über´s Knie brechen.
Für diese Fälle hatte er sein Notizbuch. Er schlug das DinA6-kleine, dunkelblaue Heftchen auf und nahm den kleinen Bleistift aus der kleinen Lasche in der Innenseite des vorderen Einbandes. Er überlegte einen Moment, ob er nicht doch noch zwei weiteren Laschen für einen Anspitzer und ein Radiergummi hinzufügen könnte. Er verwarf diesen Gedanken aber wieder, weil er befürchtete, dass das kleine Büchlein dann zu dick werden würde. Er hatte sich nicht umsonst für das handliche DinA6-Format entschieden. Es war wichtig, dass er es immer dabei haben konnte. Obwohl er es nur selten unterwegs benutzte. Was daran lag, dass er recht selten unterwegs war. Wenngleich er sich eigentlich erst einmal ganz genau im Klaren sein müsste, was selten genau meint. Er schrieb die Wörter SELTEN UNTERWEGS auf die nächste freie Seite. Er fügte noch das Datum hinzu und ein Fragezeichen.
Dann fiel ihm ein, dass er sein Büchlein eigentlich aus einem anderen Grund gezückt hatte. FREUNDSCHAFT. Auch diesen Begriff schrieb er mit schnellem Strich in Versalien auf die nächste Seite seines Buches. Freundschaft. Er ahnte, dass irgendetwas in ihm wusste, was damit genau gemeint sein könnte. Aber er konnte es noch nicht formulieren und Ahnungen waren nicht seine bevorzugten Ratgeber beim Denken.
Die Sonne hatte sich inzwischen hinter einer weitläufigen, dichten Wolke versteckt. Stimmt, es war wirklich etwas zu kühl für die Jahreszeit. Juni ist eigentlich schon fast Sommer, aber in Hamburg weiß man meistens erst dann wie das Wetter wird, wenn es schon da ist. Er hatte noch keine guten Erfahrungen mit der Wettervorhersage gemacht, obwohl er ständig im Radio hörte, wie es war und wie es werden sollte. Es gab einfach zu viele lokale Faktoren, um sich dem Wetter mit einer soliden Logik zu nähern. Und eigentlich interessierte er sich herzlich wenig für das Wetter. Warum auch? Die Wetterlage muss einen Städter nicht interessieren. Bauern und Menschen, die auf dem Land lebten, ja – für diese Menschen spielt das Wetter wahrscheinlich eine große Rolle, aber was sollte in der Stadt anders sein, wenn es regnet oder eben nicht?
Seine Selbstzufriedenheit nahm weiter zu, weil er merkte, dass er kein leichtfertiger Mensch war, der sich nur oberflächlich mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigte. Leichtfertigkeit war eines der Grundübel der modernen Zeit. Leichtfertigkeit war für ihn ein Zeichen mangelnder Intelligenz. Zu schnell Informationen über sich preisgeben, sich zu schnell den Informationen hingeben, zu schnell der Informationsflut vertrauen, ohne gründlich darüber nachzudenken, welcher Wert in den Informationen wirklich steckt. Informationen und Wissen sind zweierlei Paar Schuhe. Alle sprechen voller Begeisterung von der Informationsgesellschaft, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass Informationen erst dann nützlich sind, wenn sie zum Wissen führen. Und zum Wissen können sie nur führen, wenn sich richtig verarbeitet und angewendet werden. Und das funktioniert meistens nicht einfach nur so. Informationen können nicht einfach nur konsumiert werden, sie müssen reflektiert und verstanden werden. Dafür braucht es Zeit und eine adäquate Strategie, die dafür sorgt, dass man nicht in der Informationsflut untergeht und aus reiner Bequemlichkeit aufhört, nachzudenken. Jeder intelligente Mensch hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er Falsches von Richtigen und Wichtiges von Unwichtigen unterscheiden kann.
Er wollte gerade wieder etwas in sein Notizbuch schreiben, als seine Aufmerksamkeit wieder an seiner vorigen Notiz hängen blieb. FREUNDSCHAFT.
Er erinnerte sich plötzlich an Joachim Brentz, mit dem er über zehn Jahre lang zur Schule ging. Sie verbrachten viel Zeit zusammen, damals. Joachim Brentz war ein kleingewachsener, unsportlicher Rothaariger mit einer dicken Brille. Herr Schmidt störte sich nie daran, aber die meisten anderen Klassenkameraden zogen Joachim ständig damit auf. Rothaarig und mit Nachnamen Brentz. Schon klar. Eigentlich sogar ganz originell. Nur, war Joachim sein Freund? Irgendwie schon, aber bewiesen war das für ihn nicht. Er hatte ihn nie verteidigt oder versucht, sich auf eine andere Weise für ihn einzusetzen. Wie auch – seine eigene Beliebtheit hielt sich zugegebenermaßen stark in Grenzen. Außer mit seinem logischen Verständnis für Mathematik und Physik konnte er nicht besonders glänzen. Manchmal kamen ein paar von den coolen Kiffern zu ihm und schrieben die Hausaufgaben von ihm ab, aber sonst hatte er nicht viel zu bieten.
In der neunten und zehnten Klasse war er noch in der Leichtathletik-Staffel über vier mal einhundert Meter, weil er aus irgendeinem Grunde sehr schnell laufen konnte, aber nach seinem Fahrradunfall mit doppelten Schlüsselbeinbruch, gesplitterter Gelenkpfanne der rechten Schulter und zehnwöchigen Krankenhausaufenthalt war auch diese sportliche Episode seiner Jugend vorbei. Joachim hatte ihn damals fast jeden Tag im Universitätskrankenhaus Eppendorf besucht. Er hatte den Schulstoff dabei und meistens auch etwas Obst – sein Vater betrieb einen kleinen Gemüseladen in der Grindelallee. Joachim versuchte ihn aufzuheitern, was ihm auch meistens gelang, denn ein vollkommen untalentierter Kerl, der versucht, witzig zu sein, bringt auch einen Frischoperierten wieder dazu, glauben zu können, dass es immer noch schlimmer hätte kommen können. Komisch, wenn er jetzt darüber nachdachte, war es sonnenklar, dass er mit Joachim befreundet war. Oder zumindest Joachim mit ihm.
Nur, als Joachim wenige Monate später mit seiner Familie nach Aschaffenburg umzog, war das kein großes Problem für Herrn Schmidt. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass Joachim ihm irgendwann einmal fehlte. Die Oberstufe fing an und er wurschtelte sich als Einzelkämpfer durch das Abitur. Er hatte schon mit 15 Jahren angefangen, einfache Anwendungen zu programmieren und verdiente als Abiturient wahrscheinlich mehr Geld, als die meisten seiner Lehrer. Er hätte ohne Probleme einfach mal in die Bahn steigen können, um nach Aschaffenburg zu fahren, aber er war einfach nicht auf die Idee gekommen. Er hatte nicht einmal daran gedacht, Joachim telefonisch erreichen zu wollen und merkwürdiger weise hatte auch Joachim nicht angerufen. Oder hatte seine Mutter es ihm einfach nicht erzählt?
Seine Mutter. Mama. Herr Schmidt schaute sich hektisch um und horchte vom Balkon aus in die angrenzende Küche hinein. War da eben nicht ein Geräusch an der Wohnungstür? War er wirklich allein? Im Hinterhof auf dem Bauspielplatz vier Stockwerke unter ihm vergnügte sich lautstark eine Horde Halbwüchsiger mit Hämmern und Sägen. Er wurde nervös und das Blut stieg ihm in den Kopf, weil er von seinem geliebten Balkon aus nicht eindeutig überblicken konnte, ob jemand in seine geliebte Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung eingedrungen war oder nicht. In sein Reich. Jemand. Jemand konnte nur seine Mutter sein. Warum hatte er ihr auch den Ersatzschlüssel überlassen? Weil er geglaubt hatte, dass es eine gute Idee sei. Für den Notfall. Falls man sich einmal ausgesperrt hat oder den Schlüssel verliert. Irgendjemand sollte immer einen Ersatzschlüssel im Leben haben.
Sein Nacken verspannte sich und er konnte die hektischen Flecken spüren, wie sie an den Seiten seines Halses pulsierten. Er hielt den Atem an - jederzeit damit rechnend, das verhasste JUNGCHEN in der tiefen Stimmlage seiner Mutter zu hören. JUNGCHEN. Und dabei dieser Blick, wenn sie in die Küche treten würde und ihn verkrampft auf dem Balkon hocken sehen könnte. Versteinert. Wehrlos. Die Sekunden tröpfelten zäh dahin, doch nichts geschah. Als unten auf dem Bauspielplatz die Seitenwand einer Bretterbude mit lautem Getöse umfiel, schreckte Herr Schmidt aus seiner Starre und kam wieder zu sich.
ERSATZSCHLÜSSEL schrieb er mit etwas zittriger Hand auf die nächste Seite seines Notizbuches. Auch dieses Thema hätte er bei Gelegenheit zu klären. Nein, nicht bei Gelegenheit, sondern so schnell wie möglich. Aber strategisch. Nicht aktionistisch, nicht leichtfertig – sondern genau überlegt. Nur die Ruhe bewahren, schließlich hatte er nach wie vor alles unter Kontrolle. Es gab eine Türkette an der Wohnungstür. Wenn er sich angewöhnen würde, diese Sicherung zu benutzen, hätte seine Mutter keine Chance. Er musste es sich nur angewöhnen. Ganz einfach. Warum war er nicht früher darauf gekommen? TÜRKETTE.
Er stand entschlossen auf und ging in die Küche, um sich eine eiskalte Zitronenlimonade aus dem Kühlschrank zu holen. Er nahm eins von den alten Star-Wars-Sammelgläsern aus dem Schrank und ging dann wieder schnellen Schrittes zurück auf den Balkon. Seinen Balkon. Er hatte ganz genau darauf geachtet, dass er nicht der Versuchung unterlag, in den zweieinhalb vorderen Zimmern nachzuschauen, ob nicht doch irgendjemand in seine Wohnung eingedrungen sein könnte. Er spürte zwar nach wie vor das Pochen seiner hektischen Flecken am Hals, aber Hautverfärbungen aufgrund von Durchblutungsanomalien sind das eine, zwanghaftes, paranoides Verhalten ist ein ganz anderes Kaliber. Da gilt es, sich zusammenzureißen. Schließlich war er kein kleiner Junge mehr, der vor seiner Mutter wegzulaufen hatte.
Der tiefe Zug aus dem Star-Wars-Sammelglas versöhnte ihn ein wenig mit seiner Situation. Die kräftig prickelnde Kühlung seiner Kehle übertünchte für einen Moment das unangenehme Pochen an seinem Hals. Eiskalte Zitronenlimonade war schon immer genau sein Getränk.
Im Moment war Bio-Zisch sein Favorit. An jeder Tankstelle, an jedem Kiosk wanderte sein Blick als erstes zu den Regalen oder Kühlschränken, um die Auswahl an Zitronenlimonade auf noch nicht erforschte Varianten zu prüfen. Wenn ihn Arbeitskollegen oder Bekannte nach einem Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk fragten, fiel ihm als erstes immer voller Überzeugung der Wunsch nach einer Zitronenlimonade ein, die er noch nicht kannte. Einmal hatte ihm ein französischer Nachbar drei verschiedene Sorten aus Lyon mitgebracht und ein anderes Mal bekam er zwei Flaschen von einem Kollegen aus Israel. Alle waren gut trinkbar – wenn sie eisgekühlt waren. Die anderen sieben oder acht Wunschäußerungen in den letzten 15 Jahren führten allerdings zu keinem Ergebnis. Wahrscheinlich wurden seine Wünsche einfach nicht so sehr ernst genommen. Wünsche, die erfragt, aber nicht ernst genommen wurden, waren nach Herrn Schmidts Meinung ein weiteres, schwerwiegendes Problem der zivilisierten Menschheit.
Star-Wars-Sammelgläser hatte sich Herr Schmidt niemals gewünscht. Er konnte mit diesem amerikanischen Märchenkram einfach nichts anfangen. Am meisten nervte ihn diese unglaublich unglaubwürdige Langsamkeit der Lasergeschosse und natürlich dieses andauernde Geschwafel von der hellen und der dunklen Seite der Macht. Als wenn es da irgendwo eine klare Grenze geben würde. Stopp – noch einen Schritt und du trittst aus dem Licht in den Schatten der Dunkelheit ein! Selbst jeder Anfänger weiß doch, dass sich das ganze Universum in der Raumzeit bewegt – wie sollte es feste Grenzen geben können, wenn sich der Raum nach Belieben krümmen kann?
Vor genau 30 Jahren traten die Gläser trotzdem in sein Leben und wurden zum festen Bestandteil seines Alltags. Sie waren das letzte Geschenk, das er von seinem Vater bekommen hatte. Dem eigentlichen Herrn Schmidt. Sein Vater hatte sie direkt aus Amerika mitgebracht, kurz bevor er selbst komplett aus dem Leben seines Sohnes verschwand. Vom Licht in den Schatten, könnte man meinen, wenn man es nicht besser wüsste. Herr Schmidt konnte sich an keine gemeinsame Momente mit seinem Vater im Licht erinnern. Für seinen Vater gab es eigentlich immer nur die Arschlochkarte, die seine Mutter bei jeder Gelegenheit ausspielte. Aber die Sammelgläser schienen selbst ihr irgendwie heilig. Wie eine Versicherung, dass ihr verhasster Ex-Mann nicht wieder zurückkommen würde, solange es den Gläsern gut ginge.
Han Solo fing langsam an, zu verblassen. Das war Herrn Schmidt schon aufgefallen, als er die sechs Gläser vorgestern in Zeitungspapier eingewickelt hatte. Er hatte vorher nie darüber nachgedacht, ob er diese hässlichen Gläser wirklich mit in seine erste eigene Wohnung nehmen sollte. Er hasste das Design. Aber dieser Hass war nur oberflächlich. Die Bedeutung hinter den Gläsern war aber tiefer gehend und irgendwann würde er sie verstehen. Und bis dahin würde er nicht zulassen, dass die Oberflächlichkeit, die er mehr hasste als alles andere, ihn auch nur für einen Moment ergriff und dafür sorgte, dass er diese hässlichen Gläser in den Müll werfen würde.
Oberflächlichkeit - Freundschaft. Waren das vielleicht Gegensätze? Beim nächsten kräftigen Schluck kam es ihm für einen langen Moment so vor, als könnte das kühle Nass in seiner Kehle die puckenden Knöpfe an seinem Hals mitreißen, hinunter in seinen Darm, damit er sie endlich ausscheißen könnte. Aber was würden sie zurück lassen? Große Narben an beiden Seiten seines Halses? Möglicherweise angeordnet in einem Halbkreis, als wäre er schon einmal fälschlicherweise gehängt worden?
Oberflächlichkeit - Freundschaft. Ihm überkam die Gewissheit, dass er sich auf einer heißen Spur befand. War Freundschaft der Beweis, dass zwei Menschen die Oberflächlichkeit ihres Daseins gemeinsam durchdrungen haben? Wenn dem so wäre, hatte er die Geschichte damals mit Joachim eindeutig vermasselt. Er war an der Oberfläche geblieben, vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht aber auch aus Unfähigkeit. Seine Oberfläche glich einem Lotusblatt, an dem alles abperlte. Doch warum sollte die Geschichte schon zu Ende geschrieben sein? Der Gedanke, heraus zu finden, was aus Joachim geworden war, erfüllte ihn mit Neugier und er notierte JOACHIM BRENTZ, ASCHAFFENBURG auf der nächsten Seite seines Notizbuches.
Es wäre für Herrn Schmidt eine Kleinigkeit gewesen, sich ein digitales Tagebuch zu programmieren, aber er hatte sich nach reiflicher Überlegung bewusst dagegen entschieden, um eine klare Grenze zwischen seinen beruflichen Aktivitäten und seinen privaten Gefilden zu besitzen. Selbst geschaffene Grenzen geben Orientierung. Viele seiner Kollegen hielten ihn für einen Nerd, allerdings nicht in Richtung genialen Geek, dafür fehlte ihm das Talent, der Ehrgeiz und die Extrovertiertheit, seine Marotten gewinnbringend ins Rampenlicht zu stellen. Er konnte nicht abstreiten, dass er viele Facetten des einzelgängerischen, sonderbaren Computerfreaks bediente, aber für ihn war das nie ein wichtiger Teil seiner Identität. Er mochte die Logik des Programmierens und den Luxus, dass ihn nicht ständig jemand in die Prozesse reinredete. Aber er glaubte noch nie an das Gerede über eine heilige Mission, um die Menschheit in eine bessere digitale Welt zu führen. Software für Versicherungen oder Autohäuser zu schreiben, damit diese ihre Geschäftsmodelle oder Produkte besser an die Kunden bringen könnten, hatte für ihn keinen respektablen Sinn über das schnöde Geldverdienen hinaus. Ihm fehlte der Glaube, mehr sein zu können, als er sich vorstellen konnte. Er hatte lediglich zufälligerweise früh genug angefangen zu programmieren, um sich schon als Schüler eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen. Er wollte nie ein Hacker werden. Er konnte sich weder für den digitalen Widerstand der Anonymious-Bewegung begeistern, noch glaubte er an eine Schwarm-Intelligenz, die trotz der beträchtlichen, menschenverachtenden Nebenwirkungen der Digitalisierung eine positive Wirkung auf das Zusammenleben der Menschen haben würde.
Viele Menschen unterschätzen in seinen Augen die Gefahr, sich in der digitalen Vermischung zwischen Privatleben und Beruf zu verlieren. Es ist doch kein Wunder, dass wir allein von der Menge der Informationen überfordert werden, wenn alles auf dem gleichen Kanal abläuft. Wenn du 300 berufliche Emails am Tag bewältigen musst, hast du beruflichen Stress. Wenn dann auch nur 5 private noch dazukommen, hast du auch privaten Stress, obwohl es eigentlich nicht sein müsste. Wenn du beim Job schon ständig auf den Monitor glotzen muss, was soll es dir bringen, auch noch in deiner Freizeit in das Meer der Oberflächlichkeit der sozialen Netzwerke einzutauchen? Weil es bequem ist, deine private Leere mit digitalen Likes und befreundeten Datenmüll zu füllen? Nur wer den Verlockungen der Bequemlichkeit konsequent widersteht, wird eine klare Orientierung in Krisenzeiten haben. Seine Leitplanke sollte die Entdigitalisierung seines Privatlebens bleiben. Handschriftliche Notizen für den Eigenbedarf und Briefe schreiben, obwohl er im Moment nicht wusste an wen. Musik aus dem Radio oder als Schallplatte und Filme im Fernsehen oder im Kino ansehen. Keine private Nutzung der sozialen Netzwerke. Lieber einmal mehr nach draußen auf die Straße, um das wahre Leben zu verstehen, auch wenn da draußen die Enttäuschung auf ihn warten würde. Besser eine reale Enttäuschung als eine digitale Hoffnung.
Plötzlich hörte Herr Schmidt wieder ein verdächtiges Geräusch. Er musste sich eingestehen, dass ihn im Moment alle Geräusche irritierten, die aus seiner Wohnung kamen. Also fasste er den Entschluss seine Bedenken ein für alle mal aktiv aus dem Weg zu räumen. Er stand auf und ging durch die Küche den Flur entlang zur Wohnungstür. Er verriegelte die Türkette der Haustür und schaute in die anderen Zimmer. In dem kleinen Zimmer lehnte seine Schreibtischplatte mit den Tischböcken noch an der Wand, die beiden Computer, die Taschen mit dem Zubehör und die Monitore standen auf dem Boden und warteten darauf, in einen Arbeitsplatz verwandelt zu werden.
Das Schlafzimmer war bis auf seine Matratze mit dem Bettzeug, dem Wecker und der kleinen Lampe noch vollkommen leer. Im großen Wohnzimmer sah er neben den beiden Schränken und den vier Regalen, die sechs Umzugskartons, die zwei Koffer und die wenigen Tüten, in denen seine gesamte Vergangenheit verstaut waren. Dann fiel sein Blick auf seinen alten Scout-Schulranzen, der in der Ecke lag. Er hob ihn auf und strich zärtlich über den verschlissenen Kunststoff. Für einen Moment spielte er mit dem Gedanken, ihn aufzumachen, aber dann ließ er es, legte ihn wieder in die Ecke und ging zurück durch den langen Flur in Richtung Küche.
Die Holzdielen knarrten bei jedem seiner vorsichtigen Schritte und ihm wurde klar, wie fremd ihm seine neue Wohnung noch immer war. Einzig den Balkon und Teile der Küche hatte er schon voll in Besitz genommen. Dann hielt er inne, kehrte noch einmal um, marschierte entschlossenen Schrittes ins Wohnzimmer, stellte den Anrufbeantworter stumm und ging erleichtert in die Küche zurück. Ein Blick in den leeren Kühlschrank verriet ihm, dass es sinnvoll wäre, noch einmal einkaufen zu gehen. Wenn er seinen Einzug angemessen feiern wollte, bräuchte er schließlich das Notwendigste, auch, wenn er dabei nicht an Gäste dachte, die es zu bewirten galt. Erst einmal nur für sich, ganz bei sich bleiben und der historischen Tatsache gedenken, dass er fast 40 Jahre gebraucht hatte, um bei seiner Mutter auszuziehen.
Kapitel 2: Die Straße
Alles war anders auf St. Pauli. Der Geruch, die Geräusche, die Häuser, die Autos, die Gehwege und ganz besonders die Leute auf den Straßen. Es kam ihm vor, als wäre er endlich auf dem anderen Planeten gelandet, der schon immer der seine hätte sein sollen. Es gibt sicherlich Schlimmeres als fast 40 Jahre in einer Doppelhaushälfte mit seiner Mutter und seiner Tante in Poppenbüttel zu leben. In einer geräumigen Doppelhaushälfte muss man fairerweise sagen, denn er hatte einen eigenen Hintereingang über die Garage in seine zwei Zimmer im Souterrain. Es gab einen weitläufigen Garten mit einem gepflegten Rasen, verschiedenen Kräuterbeeten, acht Bienenstöcken, einem kleinen Teich und wilden Brombeersträuchern. Die Nachbarschaft war anständig, nichts sagend und langweilig. Es gab keine Parkplatznot, alles war sauber, selbst am Neujahrstag musste man gründlich suchen, um Spuren einer Sylvesterknallerei zu entdecken. Der perfekte Ort, um sein Leben reibungslos an sich vorbei ziehen zu lassen. Nur, war es nicht einmal sein Leben, es war das Leben seiner Mutter.
Als er ihr vor 2 Wochen gesagt hatte, dass er nach St. Pauli ziehen würde, war sie zunächst für ihre Verhältnisse sehr gefasst geblieben. Sie dachte sofort laut an die Reeperbahn, an das Rotlichtviertel, an Absteigen, Alkohol und Prostitution. Sie hielt seinen Plan für einen Ausbruchsversuch, der vielleicht ein paar Tage anhalten