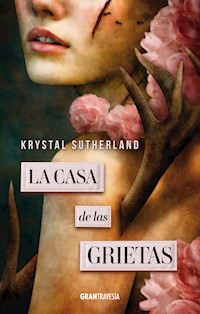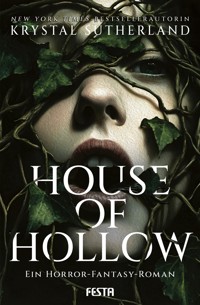
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Iris und ihre älteren Schwestern Vivi und Grey noch Kinder waren, ist ihnen etwas zugestoßen, an das sie sich nicht erinnern können. Sie verschwanden einen ganzen Monat lang. Danach veränderten sie sich: Zuerst wurden ihre dunklen Haare weiß, dann färbten sich ihre blauen Augen langsam schwarz … Die Menschen finden die Hollow-Mädchen beunruhigend schön und irgendwie gefährlich. Iris ist inzwischen 17. Sie hat versucht, die dunklen Erinnerungen zu verdrängen, die in ihr lauern wie klebriger Teer. Doch als Grey spurlos verschwindet, erwacht die Wahrheit und Iris begreift: Grey hat all die Jahre vor ihren jüngeren Schwestern ein schauriges Geheimnis verschwiegen. Melissa Albert: »Dieses eindringliche moderne Märchen wird Sie wie ein glitzernder Nebel einhüllen, bevor es Ihnen an die Gurgel geht.« PopSugar: »Wunderbar gruselig und voll beunruhigender übernatürlicher Schnörkel.« Kirkus Reviews: »Eine rasante Geschichte, die Themen wie Trauer und Verlust mit Elementen der Folklore und sehr einfallsreichen Body-Horror verbindet. Das allgegenwärtige Gefühl des Grauens steigert sich bis zu einer schockierenden Wendung.« Publishers Weekly: »Sutherlands düsteres Werk strotzt vor unheimlicher Atmosphäre.« Dawn Kurtagich: »Ein berauschender, herrlich grotesker Fiebertraum voll unerträglichem Gestank von Aasblumen, verwunschenen Waldwegen und Türen, die nirgendwohin führen. Ein wunderschön geschriebenes, süchtig machendes, düsteres Märchen mit Hörnern!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Claudia Rapp
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe House of Hollow
erschien 2021 im Verlag G. P. Putnam’s Sons.
Copyright © 2021 by Krystal Sutherland
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Titelbild: Lady Elizia / 99design
unter Verwendung von Nipawan / AdobeStock
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-229-2
www.Festa-Verlag.de
PROLOG
Ich war zehn Jahre alt, als mir klar wurde, dass ich seltsam bin. Anders.
Gegen Mitternacht kam eine Frau in Weiß durchs Fenster in mein Zimmer und schnitt eine Locke meiner Haare ab, mit einer Nähschere. Ich war währenddessen hellwach, verfolgte ihre Bewegungen im Dunkeln, war aber vor Angst so erstarrt, dass ich mich weder rühren noch schreien konnte.
Ich sah zu, wie sie meine Haarlocke an ihre Nase hielt und einatmete. Ich sah zu, wie sie die Locke auf ihre Zunge legte und ihren Mund schloss und den Geschmack ein paar Augenblicke lang wirken ließ, bevor sie schluckte. Ich sah zu, wie sie sich über mich beugte und mit einer Fingerspitze die hakenförmige Narbe an meiner Kehle entlangfuhr.
Erst als sie meine Tür öffnete – erst als sie sich auf den Weg zu den Zimmern meiner älteren Schwestern machte, die Schere nach wie vor in der Hand –, vermochte ich zu schreien.
Meine Mutter packte sie dann im Flur. Meine Schwestern halfen, sie festzuhalten. Die Frau war rabiat und wütete, schlug mit einer wilden Kraft um sich, die, wie wir später erfahren sollten, von Amphetaminen geschürt wurde. Sie biss meine Mutter. Meiner Schwester Vivi, der mittleren, verpasste sie einen so harten Kopfstoß ins Gesicht, dass ihre Nase mehrfach gebrochen und beide Augenhöhlen noch wochenlang blutunterlaufen waren.
Es war Grey, meine älteste Schwester, die sie schließlich bändigte. Als sie glaubte, dass meine Mutter gerade nicht hinsah, beugte sie sich hinab zum Gesicht der wild gewordenen Frau und drückte ihre Lippen auf deren Mund. Es war ein sanfter Kuss, ganz wie im Märchen, aber grauenvoll aufgrund der Tatsache, dass das Kinn der Frau vom Blut meiner Mutter verschmiert glänzte.
Für einen Moment roch es plötzlich süßlich und falsch, eine Mischung aus Honig und etwas anderem, etwas Verfaultem. Grey rückte von ihr ab und hielt den Kopf der Frau in ihren Händen, beobachtete sie aufmerksam, eindringlich, abwartend. Die Augen meiner Schwester waren so schwarz, dass sie wie polierte Flusskiesel aussahen. 14 war sie damals, und schon zu diesem Zeitpunkt das schönste Geschöpf, das ich mir vorstellen konnte. Ich wollte ihr die Haut vom Körper schälen und mich darin einhüllen, sie als meine tragen.
Die Frau bebte und schauderte unter Greys Berührung und dann … hörte sie einfach auf.
Als die Polizei eintraf, waren die Augen der Frau groß und blickten ins Leere, ganz weit entfernt. Ihre Glieder so schlaff, dass sie nicht einmal mehr stehen konnte und von drei Beamten nach draußen geschleppt werden musste wie eine Betrunkene.
Ich frage mich, ob Grey damals schon wusste, was wir waren.
Die Polizei sollte uns später informieren, dass die Frau im Internet über uns gelesen und vor dem Einbruch bereits über mehrere Wochen gestalkt hatte.
Wir waren wegen einer bizarren Sache berühmt, die uns drei Jahre zuvor widerfahren war, als ich sieben war. Ich konnte mich nicht daran erinnern und dachte auch nie darüber nach, aber offenbar faszinierte der Vorfall eine Menge anderer Leute immens.
Danach hatte ich unsere Andersartigkeit auf dem Schirm. Ich hielt Ausschau danach, achtete in den folgenden Jahren darauf, wie sie auf unerwartete Weise um uns herum erblühte.
Da war der Mann, der versuchte, Vivi in seinen Wagen zu zerren, als sie 15 war, weil er glaubte, sie wäre ein Engel. Sie brach ihm den Kiefer und schlug ihm zwei Zähne aus.
Da war der Lehrer, den Grey hasste und der gefeuert wurde, nachdem er sie gegen eine Wand gedrückt und vor den Augen ihrer gesamten Klasse auf den Hals geküsst hatte.
Da war das hübsche, beliebte Mädchen, das mich getriezt hatte und dann vor der gesamten Schülerschaft in der Morgenrunde schweigend anfing, sich den Kopf zu rasieren. Die Tränen flossen ihr übers Gesicht, während ihre dunklen Locken in Spiralen vor ihre Füße fielen.
Als mein Blick an jenem Tag in dem Meer von Gesichtern auf Greys traf, starrte sie nur mich an. Die Quälerei war schon monatelang gegangen, aber ich hatte meinen Schwestern erst am Abend zuvor davon erzählt. Grey zwinkerte mir zu und senkte den Blick dann wieder auf das Buch, das sie gerade las. Die Show interessierte sie nicht. Vivi verhielt sich wie immer weniger subtil; sie saß zurückgelehnt mit den Füßen auf der Lehne des Stuhls vor ihr und grinste von einem Ohr zum anderen, die schiefe Nase vor Vergnügen kraus gezogen.
Dunkle, gefährliche Dinge geschahen im Dunstkreis der Hollow-Schwestern.
Wir alle besaßen schwarze Augen und Haar so weiß wie Milch. Wir alle trugen zauberhafte Namen, jeweils vier Buchstaben: Grey, Vivi, Iris. Wir gingen gemeinsam zur Schule. Wir aßen in der Pause gemeinsam zu Mittag. Wir gingen gemeinsam nach Hause. Wir hatten keine Freundinnen, denn die brauchten wir nicht. Wir glitten wie Haie durch die Flure, und die anderen wichen wie kleine Fische vor uns zur Seite, flüsterten hinter unserem Rücken.
Alle wussten, wer wir waren. Alle hatten unsere Geschichte gehört. Alle hatten ihre eigene Theorie darüber, was uns zugestoßen war. Meine Schwestern nutzten das zu ihrem Vorteil. Sie waren wirklich gut darin, das Geheimnis zu hegen und zu kultivieren, und die rauschhafte Faszination, die sich um sie rankte, in die gewünschten Formen zu lenken wie Gärtnerinnen beim Heckenschnitt. Ich folgte ihnen einfach, bewegte mich still und bewusst unauffällig in ihrem Windschatten, denn die Aufmerksamkeit war mir peinlich. Andersartigkeit brachte nur mehr Seltsames hervor, zog es an, und es schien mir gefährlich, das Schicksal herauszufordern und die Dunkelheit zu uns einzuladen, die wir schon von Natur aus anzuziehen schienen.
Mir kam überhaupt nicht in den Sinn, dass meine Schwestern die Schule lange vor mir verlassen würden, bis es dann so weit war. Die Schule hatte keiner von beiden je gelegen. Grey war mörderisch klug, aber auf dem Stundenplan stand nie irgendetwas, das ihr sonderlich gefallen hätte. Wenn sie zum Beispiel Jane Eyre lesen und analysieren sollte, mochte sie stattdessen beschließen, dass Dantes Inferno interessanter war, und ihren Aufsatz darüber schreiben. Wenn sie im Kunstunterricht ein realistisches Selbstporträt zeichnen sollte, malte sie lieber ein Monster mit leeren Augenhöhlen und Blut an den Händen. Manche Lehrer liebten das, die meisten taten es nicht. Und bevor sie die Schule abbrach, hatte Grey immer nur mittelmäßige Noten. Falls sie das störte, zeigte sie es nicht; sie ließ sich mit einer Selbstgewissheit durch den Unterricht treiben, als hätte eine Hellseherin ihr die Zukunft vorhergesagt und sie wäre mit dem zufrieden, was sie erfahren hatte.
Vivi zog es vor, gleich so oft wie möglich zu schwänzen, was für die Verwaltung sicher eine Erleichterung war, denn wenn sie zum Unterricht auftauchte, war sie schwierig. Sie gab den Lehrern ständig Widerworte, machte Schlitze in ihre Uniform, damit diese mehr nach Punk aussah, verschönerte die Waschräume mit Graffiti und weigerte sich, ihre unzähligen Piercings herauszunehmen. In ihrem letzten Jahr bekam sie für die wenigen Hausaufgaben, die sie abgab, ihre Einsen mit Leichtigkeit – aber es waren schlicht nicht genügend Abgaben, um nicht hinausgeworfen zu werden. Das passte Vivi gut in den Kram. Jeder Rockstar brauchte eine Vorgeschichte, und von der High School zu fliegen, die 30.000 Pfund im Jahr kostete, war doch ein guter Anfang für eine solche Story.
Sie waren beide schon damals so, beide im Besitz eines alchemistischen Selbstbewusstseins, das eigentlich weit älteren Menschen vorbehalten sein sollte. Es war ihnen egal, was andere Leute über sie dachten. Es war ihnen egal, was andere Leute für cool hielten (und das machte sie natürlich unfassbar cool).
Sie verließen die Schule – und unser Zuhause – nur wenige Wochen nacheinander. Grey war 17, Vivi war 15. Sie gingen in die Welt hinaus, beide auf dem Weg in eine glamouröse, exotische Zukunft, von der sie immer gewusst hatten, dass sie für sie bestimmt war. Und so war ich mit einem Mal allein, das einzig übrig gebliebene Hollow-Mädchen, das immer noch darum kämpfte, trotz der langen Schatten, die sie geworfen hatten und die nach wie vor auf mir lagen, zu gedeihen. Das stille, kluge Mädchen, das Naturwissenschaften und Geografie liebte und sich mit Mathematik von Natur aus leichttat. Das Mädchen, das verzweifelt und vor allem nur eines wollte: unauffällig sein.
Langsam, Monat für Monat, Jahr für Jahr, begann die Andersartigkeit, die um meine Schwestern herum gewuchert hatte, zurückzuweichen und zu verblassen. Und für eine ziemlich lange Zeit war mein Leben so, wie ich es mir seit jener Nacht ersehnt hatte, als ich zusah, wie Grey eine Einbrecherin mit einem einfachen Kuss betäubt hatte: normal.
Das konnte natürlich nicht auf Dauer so bleiben.
1
Mir stockte der Atem, als ich das Gesicht meiner Schwester sah, das mich vom Boden aus anstarrte.
Greys schmale, hakenförmige Narbe war nach wie vor das Erste, was einem an ihr auffiel, und direkt danach, wie schmerzhaft schön sie war. Die Vogue – ihr drittes US-Cover in ebenso vielen Jahren – musste mit der Post gekommen und mit ihrem Gesicht nach oben direkt auf dem Flurläufer gelandet sein, wo ich sie im silbrig-geisterhaften Morgenlicht vorfand. Der Schriftzug ›Die Geheimnisvolle‹ schwebte in Moosgrün darunter. Ihr Körper war dem Fotografen zugewandt, ihre Lippen zu einem Seufzer geöffnet, die schwarzen Augen blickten direkt in die Kamera. Ein Geweih erhob sich aus ihrem weißen Haar, als wüchse es aus ihrem Kopf empor.
Für einen kurzen, bestrickenden Moment hatte ich geglaubt, sie wäre tatsächlich leibhaftig hier. Die berühmte, berüchtigte Grey Hollow.
In den vier Jahren, seit sie unser Zuhause verlassen hatte, war meine älteste Schwester zu einer hauchzarten Frau herangewachsen, mit Haaren wie Zuckerwatte und einem Gesicht, das der griechischen Mythologie entsprungen sein könnte. Selbst auf statischen Bildern hatte sie etwas Durchsichtiges, Flüchtiges an sich, so als würde sie jeden Moment in den Äther aufsteigen und sich wie Dunst auflösen.
Vielleicht war das der Grund, wieso die Journalisten sie ständig als ätherisch beschrieben, auch wenn Grey für mich immer eher diesseitig und erdnah gewesen war. Kein Artikel erwähnte je, dass sie sich im Wald am meisten zu Hause fühlte oder wie gut sie darin war, Dinge zum Wachsen zu bringen. Pflanzen liebten sie. Der Blauregen draußen vor ihrem Zimmer war nachts oft durch das offene Fenster hereingeschlängelt und hatte sich um ihre Finger gerankt.
Ich hob die Zeitschrift vom Boden auf und blätterte zur Titelstory vor.
Grey Hollow hüllt sich in ihre Geheimnisse wie in feinste Seide.
Als ich die Designerin in der Lobby des Lanesborough Hotels treffe (Hollow lässt Journalisten niemals in die Nähe ihres Apartments, und wenn man den Gerüchten glauben darf, veranstaltet sie auch keine Partys oder lädt Gäste zu sich ein), trägt sie eine ihrer eigenen, charakteristisch rätselhaften Kreationen. Überladen mit Stickereien und Hunderten von Perlen, mit Garn, das aus echtem Gold gesponnen wurde, und einem Tüllstoff, der so leicht ist, dass er wie Rauch um sie schwebt.
Hollows Couture wird gern als Mischung aus Märchen und Nachtmahr beschrieben, eingehüllt in einen Fiebertraum. Ihre Roben sind voller Blätter und welkender Blüten, auf dem Catwalk tragen ihre Models Geweihe von Rehkadavern und die Pelze gehäuteter Mäuse, und sie besteht darauf, dass ihre Stoffe über Holz geräuchert werden, bevor die Schnitte daraus entstehen, sodass ihre Modenschauen vom Duft eines Waldbrands durchzogen sind.
Hollows Kreationen sind wunderschön und dekadent und seltsam, aber es ist das Verborgene, die Heimlichkeit, die ihren Stücken innewohnt, was sie so rasch so berühmt gemacht hat. Geheime Botschaften sind von Hand ins Futter einer jeden Robe gestickt – aber das ist längst nicht alles. Stars berichten, dass sie eingerollte Papierfetzen gefunden haben, die in die Verstärkung ihres Mieders eingenäht waren, dass neben Edelsteinen auch geschnitzte Knochensplitter tierischen Ursprungs an den Kleidern appliziert oder Runensymbole mit Geheimtinte aufgemalt und Miniaturphiolen mit Parfüm eingenäht wurden, die mit einem Knacken wie Leuchtstäbe brechen, wenn die Trägerin sich in dem Kleid bewegt, und Hollows gleichnamigen, berauschenden Duft freisetzen. Die Bildsprache, die sich in ihren Stickereien findet, ist fremdartig, bisweilen verstörend. Man denke an Blumen, die ihren genetischen Code sichtbar auf den Blütenblättern zeigen, oder skelettierte Minotauren mit Gesichtern ohne Haut.
Genau wie ihre Schöpferin ist jedes dieser Stücke ein komplexes, verschachteltes Rätsel, das geradezu darum bettelt, gelöst zu werden.
An dieser Stelle hörte ich auf zu lesen, denn ich wusste bereits, was im Rest des Artikels stehen würde. Ich wusste, darin würde etwas über die Sache stehen, die uns als Kindern zugestoßen war, über den Vorfall, an den sich keine von uns erinnern konnte. Ich wusste, es würde etwas über meinen Vater drinstehen, über die Art und Weise, wie er gestorben war.
Ich berührte die Narbe an meiner Kehle mit den Fingerspitzen. Jene Narbe, die ich mit Grey und Vivi gemeinsam hatte. Die Narbe, bei der sich keine von uns erinnern konnte, wie sie uns zugefügt worden war.
Ich nahm die Zeitschrift mit hinauf in mein Zimmer und schob sie unter mein Kissen, damit meine Mutter sie nicht fand, sie nicht in der Küchenspüle verbrannte wie die letzte.
Bevor ich das Haus verließ, öffnete ich die Find-Friends-App und überprüfte, ob sie eingeschaltet war und meinen Standort übertrug. Für meine allmorgendlichen Laufrunden war es Bedingung, dass meine Mutter meinen kleinen, orangefarbenen Avatar verfolgen konnte, während er in Hampstead Heath umherhüpfte. Tatsächlich war es Bedingung, wenn ich das Haus verlassen wollte, dass meine Mutter meinen kleinen, orangefarbenen Avatar verfolgen konnte, während er wo auch immer umherhüpfte. Cates eigener Avatar schwebte immer noch weiter südlich an der gleichen Stelle, beim Royal Free Hospital, weil ihre Schwesternschicht in der Notaufnahme sich wie üblich in den Überstundenbereich hinzog.
Ich lauf jetzt los, schrieb ich ihr.
Okay, ich hab dich im Blick, kam ihre umgehende Antwort. Schreib mir, wenn du wieder sicher zu Hause bist.
Ich trat hinaus in die winterliche Kälte; es war noch vor der Morgendämmerung.
Wir wohnten in einem hohen Haus mit Spitzdach, die Fassade mit weißem Stuck verziert und von Bleiglasfenstern durchsetzt, die mich an Libellenflügel erinnerten. Die letzten Schatten der Nacht hingen noch unter den Dachvorsprüngen und sammelten sich wie Pfützen unter dem Baum in unserem Vorgarten.
Es war nicht die Art von Haus, die sich eine alleinerziehende Mutter mit einem Schwesterngehalt unter normalen Umständen leisten könnte, aber es hatte den Eltern meiner Mutter gehört, die beide bei einem Autounfall starben, als sie mit Grey schwanger war. Sie hatten es zu Beginn ihrer Ehe erworben, während des Zweiten Weltkriegs, als die Grundstückspreise in London aufgrund der Bombenangriffe eingebrochen waren. Sie waren damals noch Teenager, kaum älter als ich heute. Das Haus war einst erhaben und prachtvoll gewesen, allerdings hatte die Zeit es absinken und sich ducken lassen.
Auf meinem Lieblingsfoto des Gebäudes, das irgendwann in den 60ern in der Küche aufgenommen worden war, lag der Raum im prallen, trägen Sonnenlicht; die Art von Licht, das in den Sommermonaten stundenlang nachklingt und an den Baumkronen klebt wie goldene Heiligenscheine. Meine Großmutter blickte mit zusammengekniffenen Augen in die Kamera, ein Kaleidoskop aus glitzerndem Grün auf ihrem Gesicht, das von einem Buntglasfenster hervorgezaubert wurde, das inzwischen längst zerbrochen war. Mein Großvater stand neben ihr, hatte den Arm um sie gelegt, eine Zigarre im Mund, der Gürtel seiner Hose saß sehr hoch, und er trug eine Aschenbecherbrille auf der Nase. Die Luft um sie herum schien warm und dunstig, und meine Großeltern lächelten beide. Sie sahen gelassen aus, entspannt. Wenn man ihre Geschichte nicht kannte, konnte man glauben, dass sie glücklich waren.
Meine Großmutter war viermal schwanger gewesen, hatte viermal ausgetragen, aber nur ein lebendiges Baby zur Welt gebracht, und das ziemlich spät: meine Mutter Cate. Die Zimmer dieses Hauses waren für Kinder gedacht gewesen, aber leer geblieben, und meine Großeltern hatten nicht lange genug gelebt, um mitzubekommen, wie ihre Enkelkinder geboren wurden. In jeder Familie gibt es Dinge, über die nicht gesprochen wird. Geschichten, von denen man weiß, ohne genau zu wissen, woher man davon weiß. Erzählungen über schreckliche Dinge, die lange Schatten werfen, über die Generationen hinweg. Adelaide Fairlights drei tot geborene Babys machten eine solche Geschichte aus.
Eine weitere war die Sache, die uns zustieß, als ich sieben war.
Ich hatte noch nicht einmal das Ende der Straße erreicht, als Vivi anrief. Ich nahm den Anruf über meine AirPods entgegen, denn ich wusste, dass sie es war, ohne auf mein Display zu schauen.
»Hey«, sagte ich. »Du bist ja früh auf. Es kann doch noch nicht Mittagszeit sein in Budapest.«
»Haha.« Vivis Stimme klang gedämpft, abgelenkt. »Was tust du gerade?«
»Ich bin eine Runde laufen. Du weißt schon, das, was ich jeden Morgen tue.« Ich wandte mich nach links und rannte den Fußweg entlang, vorbei an leeren Sportplätzen und den Gerippen der Bäume, die hoch aufragten, nackt und bloß in der Kälte. Es war ein grauer Morgen, und die Sonne gähnte träge in den Himmel hinein, halb verhüllt hinter einem Bahrtuch aus Wolken. Die Kälte stach wie feine Nadeln, wo sie freiliegende Haut fand, ließ meine Augen tränen und meine Ohren mit jedem Herzschlag schmerzen.
»Igitt«, machte Vivi. Ich hörte eine Flugansage im Hintergrund. »Wieso tust du dir so was an?«
»Ist der letzte Schrei, um die Herzkranzgefäße gesund zu halten. Bist du am Flughafen?«
»Ich komme doch heute mit dem Flieger für einen Gig nach London, schon vergessen? Bin gerade gelandet.«
»Nein, davon weiß ich nichts. Hast du mir definitiv nicht erzählt.«
»Ich bin sicher, das habe ich.«
»Nee, negativ.«
»Egal, ich bin jedenfalls hier, und Grey kommt ebenfalls heute mit dem Flieger aus Paris, für irgendein Fotoshooting, und wir treffen uns alle in Camden vor dem Gig. Ich hol dich ab, sobald ich aus diesem beschissenen Flughafen raus bin.«
»Vivi, heute ist Schule.«
»Du bist immer noch in dieser nervtötenden Institution? Warte, bleib dran, ich muss eben durch die Einreisekontrolle.«
Meine übliche Strecke führte mich durch die grünen Wiesen und Felder von Golders Hill Park, wo das Gras mit gelben Narzissen und weiß-violetten Krokussen gesprenkelt war, als wäre eine Konfettibombe explodiert. Der Winter war mild gewesen, und der Frühling breitete sich bereits jetzt, Mitte Februar, über die Stadt aus.
Minuten vergingen, zäh und schleppend. Ich hörte weitere Ansagen der Fluggesellschaften im Hintergrund, während ich entlang der Westgrenze von Hampstead Heath und dann in den Park hineinlief, an der gebleichten, milchweißen Fassade von Kenwood House. Ich rannte tiefer in das Labyrinth der gewundenen Waldwege der Heide hinein, wo die Gewächse an manchen Stellen so dicht und grün und alt waren, dass man nur schwer glauben konnte, dass man sich immer noch in London befand. Es zog mich unwillkürlich zu den ungezähmten, wilden Abschnitten, wo die Pfade schlammig waren und dicke, märchenhafte Bäume darüber wuchsen und Bogengänge bildeten. Bald würden die Blätter aufs Neue sprießen, aber heute Morgen lief ich unter einem Dickicht aus blanken Ästen entlang, und mein Pfad wurde zu beiden Seiten von einem Teppich aus herabgefallenen Blättern und Zweigen begrenzt. Hier roch die Luft durchweicht, von der feuchten Kälte gedunsen. Der Matsch war dünnflüssig, weil es erst kürzlich geregnet hatte, und spritzte mir hinten gegen die Waden, während ich hindurchlief. Die Sonne ging jetzt auf, aber das frühmorgendliche Licht war wie durch einen Tropfen Tinte getrübt. Das verlieh den Schatten Tiefe, ließ sie hungrig wirken.
Die undeutliche Stimme meiner Schwester am Telefon fragte: »Bist du noch dran?«
»Ja«, erwiderte ich. »Zu meinem großen Bedauern, ja. Deine Telefon-Manieren sind haarsträubend.«
»Wie schon gesagt, Schule ist ultraöde, ich bin dagegen sehr aufregend. Ich verlange daher, dass du schwänzt und mit mir abhängst.«
»Das kann ich nicht …«
»Du willst doch nicht, dass ich die Schulleitung anrufe und denen sage, dass du den Tag freinehmen musst für einen ärztlichen Test auf Geschlechtskrankheiten oder so was.«
»Das würdest du …«
»Okay, schön, dass wir drüber gesprochen haben, bis nachher!«
»Vivi …«
Das Gespräch war im selben Moment beendet, als eine Taube aus dem Unterholz hervorschoss und mir direkt ins Gesicht flog. Ich schrie auf, fiel rückwärts in den Matsch und hob instinktiv die Hände, um meinen Kopf zu schützen, obwohl der Vogel bereits davongeflattert war. Und dann – eine vage Bewegung auf dem Pfad, weit voraus. Dort stand eine Gestalt, von Bäumen und wucherndem Gras teilweise verborgen. Ein Mann, blass und mit nacktem Oberkörper trotz der Kälte, gerade weit genug entfernt, dass ich nicht hätte sagen können, ob er überhaupt in meine Richtung gewandt war.
Aus dieser Entfernung und im graublauen Licht schien er, als würde er einen gehörnten Schädel auf seinem Kopf tragen wie eine Maske. Ich dachte an meine Schwester auf dem Cover der Vogue, an die Geweihe, die ihre Models auf dem Laufsteg trugen, an die Untiere, mit denen sie ihre Seidenroben bestickte.
Ich atmete einige Male tief ein und verharrte dort im Matsch sitzend, war unsicher, ob der Mann mich gesehen hatte oder nicht, aber er bewegte sich nicht. Eine Brise kühlte meine Stirn und brachte den Geruch nach Holzrauch mit sich sowie den ungebärdigen, animalisch nassen Gestank von etwas Wildem.
Ich kannte diesen Geruch, auch wenn ich mich nicht erinnern konnte, wofür er stand, was er bedeutete.
Ich kam hastig auf die Füße und rannte mit aller Kraft zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Mein Blut siedete und rauschte, meine Füße glitten auf dem nassen Untergrund aus, und Visionen von einem Monster, das mich am Pferdeschwanz zurückriss, spulten sich wieder und wieder in meinem Kopf ab. Ich sah mich immer wieder um, bis ich Kenwood House aufs Neue passiert hatte und auf die Straße hinausstolperte, aber mir folgte niemand.
Außerhalb der grünen Blase von Hampstead Heath war die Welt geschäftig und normal. London wachte zunehmend auf. Als ich wieder zu Atem kam, ersetzte Scham meine Angst, weil sich der feuchte braune Fleck über die gesamte Rückseite meiner Leggings ausgebreitet hatte. Als ich nach Hause rannte, blieb ich wachsam und aufmerksam, wie Frauen das eben tun, mit nur einem AirPod im Ohr, während mir das Adrenalin durchs Rückenmark fuhr wie ein scharfer Schnitt. Ein Taxifahrer lachte mich aus oder an, und ein Mann, der sich die erste Zigarette des Tages vor seiner Tür genehmigte, sagte mir, dass ich schön sei, dass ich lächeln solle.
Beide hinterließen ein Prickeln in meinen Eingeweiden, eine Mischung aus Furcht und Wut, aber ich rannte einfach weiter, und sie verblichen, nur mehr Teil des Klangteppichs aus Störgeräuschen der Stadt.
So war es immer mit Vivi und Grey. Ein Anruf von ihnen genügte, um das Seltsame, das Fremde wieder hereinsickern zu lassen.
Am Ende meiner Straße schrieb ich meiner Schwester eine Nachricht:
Komm bloß nicht zu meiner Schule.
2
Zu Hause stellte ich fest, dass der rote Mini meiner Mutter in der Einfahrt stand und die Eingangstür nur angelehnt war. Mit einem Klagelaut der Angeln ging sie ein Stück weiter auf, fiel dann wieder zu, atmete mit dem Wind. Feuchte Fußspuren führten nach drinnen. Unsere uralte Katze Sasha, ein echter kleiner Dämon, saß auf dem Fußabtreter und leckte sich die Pfote. Die Katze war älter als ich, ihr Fell so dünn und schäbig und sie selbst krumm und schief, dass sie langsam aussah wie ein schlecht ausgestopftes Tier. Sie fauchte, als ich sie hochnahm – Sasha hatte mich oder Vivi oder Grey nie gemocht und zeigte ihre Abwehr auch jetzt wieder deutlich mit ihren Krallen, aber inzwischen war sie zu altersschwach, um sich noch ernsthaft zu wehren.
Irgendetwas stimmte nicht. Die Katze durfte seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr nach draußen.
»Cate?«, rief ich leise, als ich die Tür aufdrückte und das Haus betrat. Ich erinnerte mich nicht mehr daran, wann oder wieso wir aufgehört hatten, unsere Mutter Mum zu nennen, aber Cate gefiel es besser so, und deshalb waren wir dabei geblieben.
Sie antwortete nicht. Ich ließ Sasha runter und stieß die schlammigen Schuhe von meinen Füßen. Leise Stimmen hallten vom oberen Stockwerk die Treppe herunter, Bruchstücke eines merkwürdigen Gesprächs.
»Und mehr können Sie nicht für mich tun?«, fragte meine Mutter. »Sie können mir nicht einmal sagen, wo sie hin sind? Wie es passiert ist?«
Eine blecherne Stimme antwortete über den Lautsprecher: ein Mann mit amerikanischem Akzent. »Ehrlich, Lady, Sie brauchen keinen Privatdetektiv, Sie brauchen psychiatrische Hilfe.«
Ich folgte den Stimmen, meine Schritte waren leise. Cate ging neben ihrem Bett auf und ab, immer noch in ihrer Schwesternuniform aus der Notaufnahme, und die oberste Schublade ihres Nachttischs stand offen. Das Zimmer lag im Dunklen, nur eine schwache, honigfarbene Lampe spendete Licht. Die Nachtschichten im Krankenhaus erforderten Verdunklungsvorhänge, sodass hier drin immer ein leicht saurer Geruch herrschte, weil die Sonne niemals hereinschien. In einer Hand hielt Cate ihr Telefon. In der anderen eine Fotografie, auf der sie mit einem Mann und drei Kindern zu sehen war. Das hier wiederholte sich jeden Winter, immer in den Wochen nach dem Jahrestag: Meine Mutter heuerte einen Privatdetektiv an, um zu versuchen, das Rätsel zu lösen, das die Polizei bis heute nicht geklärt hatte. Der Detektiv scheiterte unweigerlich jedes Mal.
»Das war’s dann also?«, wollte Cate wissen.
»Herrgott, warum fragen Sie nicht Ihre Töchter?«, gab der Mann am Telefon zurück. »Wenn es irgendwer weiß, dann doch die.«
»Wichser«, fuhr sie ihn scharf an. Meine Mutter fluchte nur sehr selten. Es zu hören, fühlte sich falsch an und sandte mir ein Prickeln bis in die Fingerspitzen.
Cate legte auf. Ein tiefer, erstickter Ton entwich ihrer Kehle. Kein Geräusch, das man in Gegenwart anderer Menschen machte. Augenblicklich schämte ich mich, etwas so Privates mit angehört zu haben. Ich wollte mich abwenden, aber die Dielen knarrten wie alte Knochen unter meinem Gewicht.
»Iris?«, vergewisserte sich Cate erschrocken. In ihren Ausdruck hatte sich etwas Seltsames gemischt, als sie zu mir aufsah – Zorn oder Furcht? –, aber was auch immer es war, es wich rasch der Besorgnis, als sie meine schlammverschmutzten Leggings erblickte. »Was ist passiert? Hast du dich verletzt?«
»Nein, ich wurde bloß von einer tollwütigen Taube angegriffen.«
»Und da hattest du solche Angst, dass du dir in die Hose geschissen hast?«
Ich bedachte sie mit einer Schnute, die sagen sollte: sehr witzig. Cate lachte, setzte sich auf die Bettkante und winkte mich mit beiden Händen zu sich. Ich ging hinüber und ließ mich vor ihr im Schneidersitz auf den Boden nieder, sodass sie meine langen weißblonden Haare zu zwei ordentlichen Zöpfen flechten konnte, wie sie es fast jeden Morgen tat, seit ich klein gewesen war.
»Alles okay?«, fragte ich, während sie mit ihren Fingern durch mein Haar kämmte. Ich atmete den stechend chemischen Geruch von Krankenhausseife ein, über dem Schweiß und schlechter Atem und andere typische Düfte einer 15-Stunden-Schicht in der Notaufnahme lagen. Manche Menschen dachten an ihre Mütter, wenn sie das Parfüm rochen, das sie getragen hatte, als sie Kinder waren, aber für mich würde meine Mutter immer so riechen: nach dem Maisstärke-Puder ihrer Latexhandschuhe und dem scharfen Kupfergeruch vom Blut anderer Leute. »Du hast die Haustür offen gelassen.«
»Nein, hab ich nicht. Oder doch? Es war eine lange Schicht. Ich hab ewig viel Zeit mit einem Kerl verbracht, der überzeugt war, dass seine Familie ihn mittels Analsonden kontrolliert.«
»Gilt das als medizinischer Notfall?«
»Ich schätze, ich würde auch wollen, dass jemand ganz schnell eingreift, wenn mir so was widerfahren würde.«
»Guter Punkt.« Ich nagte an meiner Unterlippe und atmete durch die Nase aus. Es war besser, sie jetzt persönlich zu fragen, als später per Textnachricht. »Wäre es okay, wenn ich heute Abend weggehe? Vivi ist in der Stadt und hat einen Gig, und Grey kommt auch mit dem Flieger aus Paris. Ich möchte Zeit mit den beiden verbringen.«
Meine Mutter erwiderte nichts, aber ihre Finger glitten beim Flechten meiner Haare ab und zogen so fest, dass ich erschrocken aufkeuchte. Sie entschuldigte sich nicht.
»Sie sind meine Schwestern«, beharrte ich leise. Manchmal fühlte es sich an, als würde ich um Erlaubnis bitten, mir nach dem Unterricht hobbymäßig Heroin zu spritzen, wenn ich nachfragte, ob ich mich mit ihnen treffen konnte – besonders mit Grey. »Sie werden nicht zulassen, dass mir irgendwas Schlimmes passiert.«
Cate stieß ein kurzes Lachen aus und konzentrierte sich wieder aufs Flechten.
Das Bild, das sie betrachtet hatte, lag verkehrt herum auf der Decke, als würde sie hoffen, dass ich es nicht bemerke. Ich drehte es um und nahm es in Augenschein. Darauf waren meine Mutter und mein Vater Gabe und wir drei zu sehen, als wir jünger waren. Vivi trug einen grünen Dufflecoat aus Tweed, Grey eine bordeauxrote Jacke aus Kunstfell. Ich hatte einen kleinen roten Tartanmantel mit goldenen Knöpfen an. Um unseren Hals trugen wir alle die gleichen goldenen Herzanhänger, in die unsere Namen eingestanzt waren. IRIS, VIVI, GREY. Weihnachtsgeschenke von den Großeltern, die wir in Schottland besucht hatten, als das Foto aufgenommen wurde.
Die Polizei hatte die Kleidung und den Schmuck nie gefunden, trotz ihrer umfangreichen Suche danach.
»Das ist von dem Tag«, stellte ich leise fest. Ich hatte vorher noch nie ein Foto von jenem Tag gesehen. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass es eins gab. »Wir sehen alle so anders aus.«
»Du kannst …« Cates Stimme versagte, verzog sich zurück in ihre Kehle. »Du kannst zu Vivis Konzert gehen.«
»Danke, danke!«
»Aber ich will, dass du vor Mitternacht zu Hause bist.«
»Abgemacht.«
»Ich sollte uns etwas zu essen machen, bevor du zur Schule gehst, und du solltest definitiv duschen.« Sie flocht meine Zöpfe fertig und küsste mich auf den Scheitel, bevor sie das Zimmer verließ.
Als sie draußen war, sah ich mir das Foto noch einmal an, betrachtete ihr Gesicht, das Gesicht meines Vaters, nur ein paar Stunden bevor das Schlimmste geschah, was ihnen je passieren sollte. Es hatte meine Mutter ausgehöhlt, hatte ihr die Apfelbäckchen genommen und sie dünner und grauer werden lassen. Einen Großteil meines Lebens war sie die Wasserfarbenversion einer Frau gewesen, als wäre ihr die Farbigkeit, die Leuchtkraft entzogen worden.
Gabe hatte es noch weit mehr ausgehöhlt.
Dennoch waren es wir drei Mädchen, die sich am meisten verändert hatten. Ich erkannte die dunkelhaarigen, blauäugigen Kinder kaum, die mir aus dem Bild entgegenstarrten.
Man hat mir gesagt, dass wir verschlossener waren, nachdem es geschehen war. Dass wir monatelang mit niemandem sprachen, nur miteinander. Dass wir uns weigerten, in separaten Zimmern zu schlafen, oder sogar nur in separaten Betten. Dass unsere Eltern manchmal mitten in der Nacht aufwachten, nach uns sahen und uns zusammen vorfanden: Wir hockten in unseren Schlafanzügen beieinander, hatten die Köpfe zusammengesteckt wie Hexen, die sich über einen Kessel beugten, und flüsterten.
Unsere Augen wurden schwarz. Unser Haar wurde weiß. Unsere Haut fing an, nach Milch zu riechen und wie Erde nach einem Regen. Wir hatten ständig Hunger, schienen aber nie zuzunehmen. Wir aßen und aßen und aßen. Wir kauten sogar noch im Schlaf, mahlten unsere Milchzähne herunter und bissen uns manchmal auf die Zunge oder in die Wange, sodass wir mit blutbefleckten Lippen aufwachten.
Die Ärzte diagnostizierten alles Mögliche, von PTBS bis ADHS. Wir sammelten ein ganzes Alphabet von Abkürzungen, aber keine Behandlung oder Therapie schien je in der Lage zu sein, uns wieder in den Zustand zu versetzen, den wir innegehabt hatten, bevor es geschehen war. Wir waren nicht krank, wurde schließlich entschieden. Wir waren lediglich seltsam. Anders.
Die Leute fanden es jetzt immer schwer zu glauben, dass Grey und Vivi und ich die Kinder unserer Eltern waren.
Alles an Gabe Hollow war sanft gewesen, mit Ausnahme seiner Hände, denn die waren rau von der Arbeit als Schreiner und seinem Wochenendhobby, Trinkbecher zu töpfern. Er hatte kuschelige Kleidung getragen, erworben in Secondhand-Läden. Seine Finger waren lang und fühlten sich wie Schmirgelpapier an, wenn man seine Hand hielt. Er schaute keinen Sport und wurde niemals laut. Spinnen fing er in Plastikbechern ein und trug sie nach draußen in den Garten. Er sprach mit seinen Küchenkräutern, wenn er sie goss.
Unsere Mutter war eine ebenso sanfte Frau. Sie trank nur aus den Bechern, die mein Vater für sie töpferte, ganz gleich ob Tee, Saft oder Wein. Sie besaß nur drei Paar Schuhe und trug die schlammverkrusteten Gummistiefel, sooft sie konnte. Nachdem es geregnet hatte, hob sie die Schnecken vom Gehsteig auf und brachte sie in Sicherheit. Sie liebte Honig – Honig auf Toast, Honig auf Käse, Honig in ihre heißen Getränke eingerührt. Sie nähte sich ihre Sommerkleider selbst, die Schnittmuster hatte sie noch von ihrer Großmutter.
Zusammen hatten sie Barbour-Wachsjacken getragen und waren lieber auf dem heimischen Land spazieren gegangen, als ins Ausland zu reisen. Sie hatten Wanderstöcke aus Holz und Angeln zum Fischen in Bächen besessen. Beide hatten es geliebt, sich an Regentagen in Wolldecken zu kuscheln und zu lesen. Beide hatten hellblaue Augen, dunkles Haar und liebevolle, herzförmige Gesichter.
Sie waren sanftmütige Menschen. Warmherzige Menschen.
Aber gemeinsam hatten sie irgendwie uns hervorgebracht. Wir waren jeweils 1,80 groß, ganze 25 Zentimeter größer als unsere winzige Mutter. Wir waren kantig, in die Länge gezogen, mit scharfen statt weichen Zügen. Wir waren alle unbequem schön, mit hohen Wangenknochen und Rehaugen. Schon als Kinder sagten die Leute zu uns oder zu unseren Eltern, wie erlesen schön wir waren. Sie sagten es auf eine Weise, die es wie eine Warnung klingen ließ – und das war es wohl auch.
Wir wussten alle um die Wirkung unserer Schönheit und gingen unterschiedlich damit um.
Grey kannte ihre Macht und trug sie schwungvoll zur Schau, wie ich es noch bei wenigen Mädchen gesehen hatte. Auf eine Art, die ich mich nicht traute nachzumachen, denn ich hatte die Folgen gesehen, die es haben konnte, schön zu sein, hübsch zu sein, niedlich zu sein, sexy zu sein und die falsche Art von Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, nicht nur von Jungen und Männern, sondern auch von anderen Mädchen, anderen Frauen. Grey war eine buchstäblich bezaubernde Frau, die an Sex denken ließ und wie eine Wildblumenwiese duftete, die Verkörperung lauer Spätsommerabende in Südfrankreich. Sie hob ihre naturgegebene Schönheit hervor, wo es möglich war. Sie trug High Heels und zarte Spitzen-BHs und schminkte sich Smokey Eyes. Sie wusste immer ganz genau, wie viel Haut sie zeigen musste, um diesen coolen sexy Look auszustrahlen.
Woran ich festmachte, dass meine älteste Schwester anders war als ich? Vor allem daran, dass sie nachts allein nach Hause ging, immer wunderschön, manchmal betrunken, häufig in kurzen Röcken oder Oberteilen mit tiefem Ausschnitt. Sie durchquerte dunkle Parks und spazierte über menschenleere Straßen oder mit Graffiti übersäte Fußwege entlang der Kanäle, wo sich Vagabunden zum Trinken und Drogennehmen versammelten und in kleinen Gruppen zum Schlafen verbargen. All das tat sie ohne Furcht. Sie ging an Orte und trug Sachen, bei denen die Leute – sollte ihr je etwas zustoßen – sagen würden, dass sie ja selbst schuld sei.
Sie bewegte sich durch die Welt wie keine Zweite, keine andere Frau, die ich kannte.
»Was du nicht begreifst«, sagte sie mal zu mir, als ich sie darauf hinwies, wie gefährlich das war, »ist, dass ich der Schrecken bin, der im Dunkeln lauert.«
Vivi war das genaue Gegenteil. Sie versuchte, ihre Schönheit zu vertreiben. Sie rasierte sich den Kopf, ließ sich piercen, tätowierte sich die Worte FUCK OFF! über die Fingerknöchel wie einen Bannspruch, der sie vom unerwünschten Begehren jener Männer abschirmen sollte, die sie nicht wollte. Selbst mit diesen Schutzzaubern, selbst mit ihrer krummen Nase und dem lauten Mundwerk und der unrasierten Körperbehaarung und den dunklen Schatten unter den Augen, die sie durch Alkohol und Drogen und schlaflose Nächte dort permanent fixiert hatte, war sie immer noch so schön, dass es schmerzte, und wurde entsprechend von der Sehnsucht der Kerle verfolgt. Sie sammelte jedes anzügliche Pfeifen, jeden Klaps auf den Hintern, jedes Grapschen an ihre Brust und bewahrte sie alle unter ihrer Haut, wo sie in einem Kessel aus Zorn brodelten, den sie dann auf der Bühne ausgoss, auf den Saiten ihrer Bassgitarre herausließ.
In diesem Spektrum fiel ich irgendwo zwischen meine Schwestern. Ich versuchte nicht, meine Schönheit aktiv zu nutzen oder zu verwüsten. Ich wusch mein Haar regelmäßig und trug keinen Duft, nur Deodorant. Ich roch sauber, aber nicht berauschend, nicht süß, nicht verführerisch. Ich schminkte mich nicht und trug nur lockere Kleidung. Ich nähte den Saum meiner Uniform nicht kürzer. Ich war abends nicht allein zu Fuß unterwegs.
Ich wollte das Foto in Cates offene Schublade zurücklegen. Unter ihren Socken und der Unterwäsche lag eine braune Aktenmappe, ausgebeult von den Papieren darin. Ich zog sie heraus und klappte sie auf. Sie war voller Kopien von Polizeiakten, die Kanten wellten sich bereits. Ich erblickte meinen Namen, die Namen meiner Schwestern, erhaschte Schnipsel unserer Geschichte, während ich mich durchblätterte, und konnte den Blick nicht abwenden.
Die Kinder behaupten, keine Erinnerung daran zu haben, wo sie gewesen sind oder was ihnen widerfahren ist.
Officer und Officer weigern sich, im selben Raum mit den Kindern zu sein, und geben an, die gleichen Albträume gehabt zu haben, nachdem sie deren Aussagen aufgenommen hatten.
Die Blumen, die im Haar der Kinder vorgefunden wurden, sind unidentifizierte Hybride – möglicherweise Pyrophyten.
Die Leichenspürhunde reagieren auch mehrere Tage nach ihrer Rückkehr auf die Kinder.
Gabe Hollow sagt aus, dass die Augenfarbe seiner drei Töchter sich verändert hat und dass ihnen mehrere Milchzähne nachgewachsen sind, die sie bereits verloren hatten.
Mein Magen drehte sich um, schien mir bis gegen die Kehle zu drücken. Ich klappte die Mappe mit einem Ruck zu und versuchte, sie zurück in die Schublade zu stopfen, aber sie blieb am Holz hängen, klaffte wieder auf und beförderte eine Kaskade von Papieren auf den Boden. Ich kniete mich hin und raffte die Blätter mit zitternden Händen zu einem Haufen zusammen, wobei ich versuchte, mir die Seiten nicht genauer anzuschauen. Bilder, Zeugenaussagen, Beweisstücke. Mein Mund war trocken. Das Papier fühlte sich zwischen meinen Fingern verdorben und falsch an. Ich wollte am liebsten alles verbrennen, so wie man versehrte Pflanzungen abbrannte, damit sich die Fäulnis nicht weiter ausbreiten konnte.
Und dann fand ich oben auf dem hastig zusammengerafften Stapel ein Foto von Grey, elf Jahre alt. Aus dem Papier wuchsen zwei weiße Blumen – echte, lebendige Blumen –, als würden sie aus ihren Augen hervorbrechen.
3
Ich war hungrig, als ich in der Schule ankam, auch nachdem Cate mir ein Frühstück gemacht hatte. Selbst jetzt, Jahre nachdem das ungeklärte Trauma meinen ungewöhnlichen Appetit ausgelöst hatte, war ich immer noch ständig hungrig. Erst letzte Woche war ich ausgehungert nach Hause gekommen und hatte die Küche geplündert. Kühlschrank und Vorratsschrank waren voller Lebensmittel, nachdem Cate ihren Einkauf erledigt hatte, den sie alle zwei Wochen tätigte: zwei Laibe frisches Sauerteigbrot, ein Becher eingelegter Oliven, zwei Dutzend Eier, vier Dosen Kichererbsen, ein Beutel Karotten, Chips und Salsa, vier Avocados … und so weiter, eine lange Liste. Genug zu essen für zwei Leute für zwei Wochen. Ich aß alles auf, bis zum letzten Bissen. Ich aß und aß und aß. Ich aß, bis mein Mund blutete und mein Kiefer vom Kauen schmerzte. Selbst als alle neu eingekauften Lebensmittel verschlungen waren, kippte ich noch eine alte Dose Bohnen, eine Schachtel weich gewordenes Müsli und eine Büchse mit Butterkeksen hinterher.
Danach, als mein Hunger endlich gestillt war, stellte ich mich vor den Spiegel in meinem Zimmer, drehte mich von einer Seite zur anderen und fragte mich, wohin zur Hölle das Essen verschwand. Ich war immer noch mager, es war nicht einmal ein Bäuchlein zu sehen.
An der Schule angekommen fühlte ich mich reizbar und schreckhaft. Als in der Schlange der Eltern, die ihre Kinder absetzten, eine Autotür zugeschlagen wurde, schlug ich mir die Hand mit solcher Wucht vor die Brust, dass meine Haut noch minutenlang brannte. Ich richtete die Krawatte meiner Uniform und versuchte, meine Gedanken zu beruhigen. Meine Finger fühlten sich schmierig an und rochen nach etwas Verfaultem, obwohl ich sie zu Hause dreimal gewaschen hatte. Der Geruch kam von den Blumen auf dem Foto. Ich hatte eine davon vom Auge meiner Schwester gepflückt, bevor ich das Zimmer verließ. Es war eine merkwürdige Blüte, mit wachsartigen Blättern und Wurzeln, die sich wie eine Naht durch das Papier wanden. Ich hatte sie wiedererkannt. Es war die gleiche Blume, die Grey als Muster verwendete und mit der sie viele ihrer Entwürfe bestickte.
Ich hatte sie an meine Nase gehalten und eingeatmet, rechnete mit dem süßen Duft von Gardenien, aber stattdessen hatte der Gestank nach rohem Fleisch und Abfall mich würgen lassen. Ich hatte die Akten und die stinkende Blüte in der Schublade meiner Mutter gelassen und ihre Schlafzimmertür hinter mir zugeschlagen.
In der Schule atmete ich wieder etwas entspannter und fühlte mich, als käme ich zu mir selbst zurück – oder zumindest zu der mit Bedacht kuratierten Version meiner selbst, die ich in der Highgate-Mädchenschule war. Mein Rucksack, dessen Nähte unter dem Gewicht der Computerbücher und der Lernhilfen fürs Abitur ächzten, schnitt mir in die Schultern. Die Regeln und die Struktur, die hier herrschte, ergaben Sinn. Die Seltsamkeit, die in alten, leeren Häusern und im Walddickicht uralter Heideflächen lauerte, konnte die Monotonie der Uniformen und Neonbeleuchtung nur schwer durchbrechen. Dies war meine Zuflucht vor der grundlegenden Andersartigkeit meines Lebens geworden, auch wenn ich nicht hierhergehörte, unter die Kinder einiger der reichsten Londoner Familien.
Ich eilte durch die hektischen Flure in Richtung der Bibliothek.
»Du bist fünf Minuten zu spät«, stellte Paisley fest, eine der Schülerinnen, denen ich vor und nach dem Unterricht Nachhilfe gab, insgesamt ein Dutzend. Paisley war eine mickrige Zwölfjährige, der es irgendwie gelang, die Schuluniform lässig und stylish aussehen zu lassen. Ihre Eltern zahlten mir seit Wochen gutes Geld, damit ich versuchte, ihr die Grundzüge des Programmierens beizubringen. Das Ärgerliche war, dass Paisley ein Naturtalent war. Wenn sie sich konzentrierte, lernte sie mit einer eleganten Leichtigkeit, die mich an Grey erinnerte.
»Oh, das tut mir aber leid, Paisley. Ich gebe dir nach der Schule eine Extrastunde gratis, um es wiedergutzumachen.« Sie warf mir einen finsteren Blick zu. »Nicht? Das dachte ich mir. Wo ist dein Laptop?«
»Ich hab gehört, dass du eine Hexe bist«, sagte sie, während sie wieder anfing, auf ihrem Telefon herumzutippen, und ihr die Locken ihrer mausbraunen Haare über die Augen fielen. »Ich hab gehört, dass deine Schwestern rausgeworfen wurden, weil sie dem Teufel in der Aula einen Lehrer geopfert haben.«
Wow. Die Gerüchte waren in den letzten vier Jahren wirklich außer Kontrolle geraten, aber ehrlich gesagt überraschte es mich mehr, dass es so lange gedauert hatte, bis eins davon bei ihr angekommen war.
»Ich bin keine Hexe. Ich bin eine Meerjungfrau«, gab ich lapidar zurück, während ich meinen Laptop aufklappte und das Lehrbuch an der Stelle aufschlug, an der wir das letzte Mal aufgehört hatten. »Und jetzt zeig mir mal die Hausaufgaben, die ich dir letzte Woche gegeben habe.«
»Warum ist dein Haar weiß, wenn du keine Hexe bist?«
»Ich bleiche es, damit es so aussieht«, log ich. In Wirklichkeit hatte ich versucht, es dunkler zu färben, in der Woche nachdem Grey und Vivi weggezogen waren. Ich hatte drei Schachteln Haarfarbe gekauft und einen verregneten Sommerabend damit verbracht, süßen Apfelwein zu trinken, während ich mir die Haare färbte. Ich hatte die 45 Minuten gewartet, die laut Anleitung notwendig waren, und dann noch ein bisschen länger, um ganz sicherzugehen, bevor ich die Farbe auswusch. Ich freute mich darauf, mein neues Ich im Spiegel zu sehen. Es fühlte sich an wie die Verwandlungsszene in einem Spionagefilm, wenn die Hauptfigur auf der Flucht und gezwungen ist, ihr Aussehen im Waschraum einer Tankstelle zu verändern, nachdem sie zur Abtrünnigen geworden ist.
Als ich über den beschlagenen Spiegel wischte, stieß ich ein frustriertes Kreischen aus. Mein Haar hatte sein milchiges Blond behalten, die Farbe überhaupt nicht angenommen.
»Hausaufgaben«, befahl ich erneut.
Paisley verdrehte ihre kleinen Augen und beförderte ihren Laptop aus der Fjällräven-Tasche hervor. »Hier, bitte.« Sie drehte den Bildschirm in meine Richtung. »Nun?«, hakte sie nach, als ich durch ihre Programmierung scrollte.
»Das ist gut. Obwohl du dir gar keine Mühe geben willst, hast du den Dreh raus.«
»Wie schrecklich schade, dass dies unsere letzte Stunde gewesen ist.«
Herrgott, welche Zwölfjährige redete denn so?
Ich schnalzte tadelnd. »Nicht so schnell. Zu unser beider Leidwesen haben deine Eltern mich bis zum Ende des Halbjahrs bezahlt.«
»Das war, bevor sie erfahren haben, wer deine Schwestern sind.« Paisley reichte mir einen Umschlag. In der kreisrunden Handschrift ihrer Mutter stand mein Name auf der Vorderseite. »Die sind richtige Jesus-Freaks. Lassen mich nicht mal Harry Potter lesen. Plötzlich halten sie dich gar nicht mehr für einen so guten Einfluss auf mich.« Sie packte ihre Sachen zusammen und stand auf, um zu gehen. »Ciao, Sabrina«, rief sie mit süßlicher Stimme auf dem Weg nach draußen.
»Wow«, erklang eine Stimme aus dem Off. »Manche Leute sind so vorlaut.«
»Oh«, machte ich, als eine kleine Gestalt mit billig blondiertem Haar zwischen den Regalen hervortrat, einen Stuhl heranzog und sich mir gegenüber hinsetzte. »Hallo, Jennifer.«
In den Monaten nachdem Grey und Vivi die Schule verlassen hatten, als die Einsamkeit, die ich ohne sie um mich herum spürte, sich so in meinem Körper breitmachte, dass jeder Herzschlag schmerzte, wollte ich unbedingt Freundinnen finden und versuchte es verzweifelt bei meinen Mitschülerinnen. Vorher hatte ich niemals Freunde gebraucht, aber ohne meine Schwestern hatte ich niemanden mehr, mit dem ich zu Mittag essen konnte, niemanden außer meiner Mutter, um die Wochenenden nicht allein zu verbringen.
Als Jennifer Weir mich zu ihrer Geburtstagsübernachtungsparty einlud (wenn auch nur widerwillig, wie ich vermutete, denn unsere Mütter arbeiteten zusammen im Royal Free Hospital), sagte ich vorsichtig zu. Es war dann auch so vornehm, wie ich erwartet hatte: Für jedes Mädchen war ein eigenes Mini-Tipi im riesigen Wohnzimmer der Weirs aufgebaut, das jeweils vor Lichterketten strotzte und in einem schwebenden Meer aus roséfarbenen und goldenen Ballons schwamm. Wir schauten drei der Conjuring-Filme bis in die frühen Morgenstunden und aßen so viel Geburtstagstorte und feinstes Gebäck, dass ich dachte, irgendwer würde sich übergeben. Wir redeten über Jungs, die auf eine benachbarte Schule gingen, und wie süß sie waren. Wir schlichen uns zum Schnapsschrank von Jennifers Eltern und tranken jede zwei Tequila-Shots. Selbst Justine Khan, das Mädchen, das mich erst gepiesackt und sich dann später vor versammelter Schule den Kopf rasiert hatte, schien sich nicht an meiner Gegenwart zu stören. Für ein paar rosafarbene, überzuckerte, vom Alkohol weich gezeichnete Stunden wagte ich es, mir eine Zukunft vorzustellen, die genau so aussah – und vielleicht hätte sie im Bereich des Möglichen gelegen, wäre da nicht das berühmt-berüchtigte Flaschendrehen gewesen, das damit endete, dass sowohl ich als auch Justine in der Notaufnahme landeten.
Jennifer Weir hatte seit jener Nacht nicht mehr mit mir gesprochen, nachdem ich ihr Haus verlassen hatte, während mir Blut von den Lippen tropfte.
»Wolltest du irgendwas?«, fragte ich sie.
»Na ja, tatsächlich«, erwiderte Jennifer lächelnd, »habe ich Karten für das Konzert heute Abend im Camden Jazz Café gekauft. Ich hab gehört, dass deine Schwester dort sein wird.«
»Natürlich wird sie da sein«, sagte ich verwirrt. »Sie ist Teil der Band.«
»Oh … Nein, Dummchen, ich meinte deine andere Schwester. Grey. Ich hab mich gefragt … Weißt du, ich würde sie so was von gern kennenlernen. Vielleicht könntest du mich ihr vorstellen?«
Ich starrte sie eine Weile lang bloß an. Jennifer Weir und Justine Khan (die sich gemeinsam JJ nannten) hatten mir den größten Teil der letzten vier Jahre das Leben zur Hölle gemacht. Während Jennifer mich vollkommen ignorierte, tat Justine das Gegenteil: Da stand dann das Wort HEXE mit Blut quer über meinen Spind geschmiert, tote Vögel wurden in meinen Rucksack geschmuggelt, und einmal waren Glasscherben über mein Mittagessen verstreut gewesen.
»Na, jedenfalls«, fuhr Jennifer fort, und ihr allzu süßes Lächeln fing bereits an, säuerlich zu werden, »denk drüber nach. Wäre ja nicht das Schlechteste, was dir passieren könnte, oder? Mit mir befreundet zu sein? Ich seh dich dann heute Abend.«
Als sie weg war, las ich Paisleys Brief, in dem ihre Eltern erklärten, dass sie »besorgniserregende Vorwürfe« gehört hatten, und ihre Vorauszahlung zurückverlangten. Ich zerriss die Nachricht und warf sie in den Papierkorb, dann schaute ich auf den Countdown, den ich auf meinem Telefon eingerichtet hatte, wie viele Tage noch bis zum Schulabschluss übrig waren: Hunderte. Es dauerte noch ewig. Die Schule hatte ein langes Erinnerungsvermögen, wenn es um die Hollow-Mädchen ging, und ich trug die Last seit dem Monat, als meine beiden Schwestern die Stadt verlassen hatten.
Meine erste Unterrichtsstunde an diesem Tag war Englisch. Ich setzte mich auf meinen üblichen Platz ganz vorn am Fenster, die aufgeschlagene Ausgabe von Frankenstein auf meinem Tisch, die Seiten dekoriert mit regenbogenbunten Haftnotizen. Ich hatte das Buch zur Vorbereitung zweimal gelesen, Passagen sorgfältig unterstrichen, mir Notizen gemacht und dabei versucht, das Muster zu erkennen, den Schlüssel zu finden. Bei meiner Englischlehrerin Mrs. Thistle löste mein Verhalten widersprüchliche Gefühle aus: Einerseits war eine Schülerin, die alle vorgegebenen Bücher las – immer, häufig sogar mehr als einmal –, ein echtes Phänomen. Andererseits brachte eine Schülerin, die bei einem literarischen Werk nach der richtigen Antwort suchte und fragte, sie beinahe um den Verstand.
Draußen nieselte es. Während ich meine Sachen auf dem Tisch sortierte, wurde meine Aufmerksamkeit von einer schnellen, seltsamen Bewegung abgelenkt, und ich blickte durch die Scheibe über den nassen Graben des Grünstreifens zwischen den Gebäuden.
Dort, in einiger Entfernung, stand der Mann mit dem Stierschädel und beobachtete mich.
4
Ich stand so plötzlich und mit so viel Schwung auf, dass mein Tisch nach vorn kippte und meine Bücher und Stifte sich über den Fußboden verteilten. Die gesamte Klasse verfiel aufgrund meiner unvermittelten, gewalttätigen Unterbrechung der Langeweile ihres Schultags in erschrockenes Schweigen, und alle wandten sich zu mir um und starrten mich an.
Ich hatte die Augen aufgerissen und atmete mit Mühe ein, während mein Herz in meiner Brust schmerzhaft hämmerte.
»Iris«, fragte Mrs. Thistle alarmiert, »geht es dir gut?«
»Gehen Sie nicht zu nahe ran«, warnte Justine Khan unsere Lehrerin. Ich hatte sie mal für schön gehalten – und das war sie wahrscheinlich immer noch, wenn man nicht tiefer sah als bis zur Fassade ihrer Haut, wenn man den tiefen, gärenden Teich aus Gift darunter nicht erkennen konnte. Ihren Vorhang aus dunklem Haar trug sie heute lang und gerade; sie hatte immer eine Bürste im Rucksack, um es in der Pause zu pflegen. Es glänzte und war so gut gepflegt, dass es fast schon beschämend war. Es erfüllte außerdem noch einen weiteren Zweck, nämlich den, die Narben an ihrem Hals zu verstecken, die meine Fingernägel auf beiden Seiten hinterlassen hatten, als sie mich geküsst hatte. »Alle wissen, dass sie beißt.«
Hier und da erklang ein Kichern, aber die meisten Schülerinnen schienen zu verstört zu sein, um sich für eine Reaktion zu entscheiden.
»Äh …« Ich brauchte eine Ausrede, einen Grund, um von hier zu verschwinden. »Ich muss mich übergeben«, sagte ich und ging auf die Knie, um meine Sachen in meine Tasche zu stopfen. Ich ließ Tisch und Stuhl liegen, wie sie umgestürzt waren.
»Geh ins Krankenzimmer«, wies Mrs. Thistle mich an, aber ich war bereits halb aus der Tür.
Ein weiterer Vorteil, wenn man der Lehrerliebling ist und sich nicht dafür schämt: Sie zweifeln deine Worte nie an, wenn du sagst, du seist krank.
Als ich das Klassenzimmer hinter mir gelassen hatte, warf ich mir den Rucksack über die Schulter und rannte nach draußen zu der Stelle, wo ich den Mann gesehen hatte, in der schattigen Schlucht zwischen zwei Gebäuden. Der Tag war grau und finster, typisch für London. Matschiges Wasser klatschte mir beim Rennen hinten gegen die Socken. Ich konnte schon von Weitem sehen, dass dort jetzt niemand mehr war, aber ich rannte immer weiter, bis ich stand, wo er gestanden hatte. Die Luft ringsumher war dumpfig und roch nach Rauch und nassem Tier. Durch den Regenschleier konnte ich von hier in mein Klassenzimmer schauen.
Ich rief Grey an. Ich musste ihre Stimme hören. Sie war immer gut darin gewesen, mich zu beruhigen.
Die Mailbox ging an; sie musste schon im Flieger aus Paris sitzen. Ich hinterließ eine Nachricht. »Hey. Äh. Ruf mich zurück, wenn du landest. Ich kriege hier gleich einen Anfall. Ich glaube, jemand verfolgt mich. Okay. Tschüs.«
Widerwillig versuchte ich es dann bei Vivi. »Ich wusste, dass du deine Meinung ändern würdest!«, sagte sie nach einem Klingeln.
»Hab ich aber nicht.«
»Oh. Na, das ist aber blöd. Dreh dich um.«
Ich tat wie geheißen. In der Ferne auf dem Parkplatz sah ich sie winken.
»Ach«, machte ich. »Ich muss los. Da ist so eine komische Frau, die mich stalkt.«
Mit ihren 19 Jahren war meine mittlere Schwester eine tätowierte, gepiercte, Zigaretten mit Nelkenaroma rauchende Bassistin mit blonder Stoppelfrisur, einer schiefen Nase und einem hämischen Lächeln, das so spitz war, dass es einen praktisch sezierte. Als ich auf dem Schulparkplatz zu ihr trat, saß sie lässig drapiert auf der Motorhaube eines roten Flitzers, der irgendeinem Lehrer in der Midlife-Crisis gehörte. Der Regen schien sie nicht im Geringsten zu stören. Obwohl sie gerade aus Budapest eingeflogen war, hatte sie kein Gepäck dabei, nur einen kleinen Lederrucksack. Sie war angezogen wie die Frau in dem alten Song von Cake, mit einem kurzen Rock und einer langen Jacke. Vor zwei Jahren, als Greys Narbe zum heißesten Modeaccessoire der Saison wurde und junge Mädchen anfingen, sich einen Sichelmond in den Hals zu ritzen, hatte Vivi ihren mit einem Blauregen-Tattoo verdeckt, das sich über ihre Schlüsselbeine ausbreitete, den Rücken hinabwucherte und ihre Oberarme bedeckte. Ihre Zunge war gepierct, ihre Nase war gepierct und in ihren Ohrläppchen steckte wahrscheinlich genug Metall, dass man es für eine Patrone einschmelzen könnte.
Grey war Haute Couture, Vivi war purer Rock ’n’ Roll.
Ich betrachtete sie von oben bis unten. »Hast du dich auf dem Weg zum Set von Mad Max verlaufen, Furiosa?«
Sie ließ den Blick ihrer schwarzen Augen auf mir ruhen, während sie einen Zug an ihrer Zigarette nahm. Nur wenige Leute konnten von sich behaupten, mit einem rasierten Schädel und der ekligen Angewohnheit, Kette zu rauchen, dennoch auszusehen wie eine Sirene, aber auf Vivi traf das zu. »Das sagt die Richtige, Hermine.« Ich dachte erneut an den Song von Cake: A voice that is dark like tinted glass.
»Oh, der hat aber gesessen«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Auf deine alten Tage fällt dir wohl nichts mehr ein.«
Dann lachten wir beide. Vivi glitt von dem Auto und zog mich in eine warme Umarmung. Ich konnte die dehnbare Kraft ihrer Muskeln unter dem schweren Vorhang ihres Mantels spüren; sie wusste sich zu wehren, wenn nötig. Selbstverteidigungskurse nahm sie sehr ernst, seit dieser Kerl sie damals in seinen Wagen hatte zerren wollen. »Schön, dich zu sehen, Kleines«, sagte sie.
»Himmel, du riechst furchtbar. Was ist das?«
»Ah.« Vivi wedelte die Luft von ihren Achseln in meine Richtung. »Dieser abscheuliche Gestank wäre dann wohl Greys Parfüm.«
Hollow