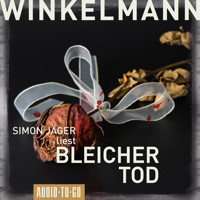9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er will dein Haus. Er will deine Frau. Er will dein Leben. Er ist der Housesitter. Stell dir vor, du kommst mit deiner Freundin aus dem Urlaub in dein Haus zurück. Du merkst sofort, dass irgendetwas anders ist: Die Möbel sind verrückt. In der Küche stehen benutzte Töpfe. Die Handtücher riechen fremd. Dann spürst du einen jähen Schmerz – und es wird Nacht um dich. Stell dir vor, du wachst erst nach Tagen im Krankenhaus auf. Deine Freundin ist verschwunden – entführt. Denn da draußen ist jemand, der sich nach einem warmen Heim sehnt. Nach einer liebenden Frau. Nach deinem Leben. Und er ist zu allem entschlossen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Housesitter
Thriller
Über dieses Buch
Er will dein Haus. Er will deine Frau. Er will dein Leben. Er ist der Housesitter.
Stell dir vor, du kommst mit deiner Freundin aus dem Urlaub in dein Haus zurück. Du merkst sofort, dass irgendetwas anders ist: Die Möbel sind verrückt. In der Küche stehen benutzte Töpfe. Die Handtücher riechen fremd.
Dann spürst du einen jähen Schmerz – und es wird Nacht um dich.
Stell dir vor, du wachst erst nach Tagen im Krankenhaus auf.
Deine Freundin ist verschwunden – entführt.
Denn da draußen ist jemand, der sich nach einem warmen Heim sehnt. Nach einer liebenden Frau. Nach deinem Leben. Und er ist zu allem entschlossen ...
Vita
Andreas Winkelmann, geboren 1968 in Niedersachsen, ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldrand nahe Bremen. Wenn er nicht gerade in menschliche Abgründe abtaucht, überquert er zu Fuß die Alpen, steigt dort auf die höchsten Berge oder fischt und jagt mit Pfeil und Bogen in der Wildnis Kanadas.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Umschlagabbildungen: Sebastian Arning/Getty Images, duncan1890;Akirastock/iStock
ISBN 978-3-644-22291-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Nina, weil ich ihr gern Angst mache!
Dunkelheit umgab das Haus, nur die erleuchteten Fenster im Untergeschoss waren wie eine Einladung.
Komm herein, sei unser Gast, fühl dich wie zu Hause.
Still verharrte er in seinem Versteck und betrachtete das Licht aus einiger Entfernung, so wie er es zeit seines Lebens getan hatte. Der Abstand war ihm wichtig. Oft genug hatte das Licht sich verändert, sobald er eingetaucht war, hatte seine Wärme verloren. Und dann war nichts mehr geblieben von dem sicheren Gefühl, endlich ein Zuhause gefunden zu haben. Das Licht barg ebenso Chance wie Gefahr, war zugleich Verlockung und Vernichtung. Das hatte er schon früh begriffen, in einer der vielen, langen und einsamen Nächte, in denen er auf den Glaskegel einer Straßenlaterne vor seinem Fenster gestarrt und Insekten beobachtet hatte, die immer wieder ins Licht flogen, obwohl sie darin ihren Tod fanden.
Jetzt bewegte sich etwas am Fenster des Hauses. Es war die Frau. Eine große Brünette mit warmem Lächeln und braunen Augen. Die wenigen Male, die er ihr nah genug gekommen war, hatte er gespürt, wie gut sie ihm tun würde. Es umgab sie etwas, für das ihm die Worte fehlten. Manche Frauen hatten es, andere nicht. Mareike hatte es gehabt. Aber an Mareike durfte er jetzt nicht denken, denn wenn diese Erinnerung erst seinen Kopf füllte, übernahm etwas anderes in ihm die Führung, etwas, das er nicht kontrollieren konnte.
Er sah die Brünette zurückkommen. Sie stellte etwas auf dem runden Tisch im Esszimmer ab, und er beobachtete, wie sich ihre Lippen beim Sprechen bewegten. Sie beugte sich über den Tisch, strich ihr langes Haar über die linke Schulter zurück und blickte direkt zum Fenster.
Licht im Inneren eines Hauses ließ alles, was sich draußen in der Dunkelheit abspielte, unsichtbar werden. Daher konnte die Brünette ihn nicht sehen, befand sich selbst für ihn aber auf dem Präsentierteller. So konnte er sie in aller Ruhe beobachten, wie sie ganz nah an die Scheibe herantrat und in die Dunkelheit hinausschaute. Ihre Augen wurden zuerst größer, dann verengten sie sich, ganz so, als suche sie etwas, schließlich richtete sie sich auf, verschränkte in dieser typisch weiblichen Art schützend die Arme vor dem Brustkorb und sagte etwas über ihre rechte Schulter hinweg. Einen Moment später trat der Mann neben sie.
Ein mittelgroßer, schlanker Typ, mit kurzem braunen Haar und magerem Gesicht. Ein Gesicht, das er sich gemerkt hatte und nie wieder vergessen würde. Der Mann legte der Brünetten einen Arm um die Taille und schaute mit ihr hinaus. Plötzlich zuckte er zusammen, und die Brünette erschrak heftig. Der Mann brach in Lachen aus, und bevor sie ihm einen spielerischen Schlag versetzen konnte, verschwand er aus dem Fensterausschnitt. Sie rief ihm etwas hinterher. Man musste nicht Lippen lesen können, um zu wissen, dass es ein Schimpfwort war. Die Brünette verharrte noch einen Moment am Fenster, löste dann die Bänder der Vorhänge und zog sie zu.
Sperrte ihn aus.
Er war verwirrt.
Auf gar keinen Fall hatte sie ihn gesehen. Aber woher rührte ihre Sorge? Hatte sie etwas gespürt? Vielleicht war ihr in diesem Moment klargeworden, dass jeder sie von draußen in dem hell erleuchteten Zimmer sehen konnte. Mitunter belebte ein Moment der Erkenntnis alte Ängste neu, die schon längst vergessen geglaubt waren – so etwas musste es gewesen sein. Wie auch immer, es war ärgerlich, denn nun musste er doch seinen Standort wechseln, wenn er sie weiterhin beobachten wollte. Widerwillig verließ er seinen Platz hinter der Hecke, schlüpfte durch eine Lücke und schlich tief gebückt zur anderen Seite des Grundstückes. Dabei kam er der Straßenlaterne vor dem Haus gefährlich nahe. Er musste darauf achten, nicht von ihr beschienen zu werden.
Auf halber Strecke zum nächsten Fenster presste er sich gegen den Boden, machte sich ganz klein und verharrte.
Er hatte etwas gehört.
Leise Schritte auf Betonpflaster.
Im nächsten Moment kam ein alter Mann die Straße hinunter. Er führte eine hässliche kleine Promenadenmischung an der Leine. Der Alte bewegte sich wie im Halbschlaf, und auch der Hund machte einen trägen Eindruck. Aber Hunde durfte man niemals unterschätzen, er war bereits dreimal von einem Hund aufgestöbert und verscheucht worden. Dieser hier bemerkte ihn jedoch nicht. Am Pfeiler der Zufahrt blieb er stehen, um zu markieren. Sein Herrchen zog ungeduldig an der Leine, und einen Moment später verschwanden beide in der Nacht.
Hinter dem Fenster, unter dem er jetzt hockte, lag die Küche. Hier gab es keinen Vorhang, den man zuziehen konnte. Dafür zwei Regalbretter, die zwischen den Laibungen angebracht waren, um darauf in kleinen Porzellantöpfen Küchenkräuter zu ziehen. Die Pflanzen störten! Er würde die Brünette nur sehen können, wenn sie direkt vor dem Fenster stand. Dabei waren es genau diese Bilder, die er sich erhofft hatte. Tagsüber war es hier langweilig gewesen, aber da er nicht wusste, wann genau die beiden zum Flughafen aufbrechen würden, hatte er sie wohl oder übel von morgens bis abends beobachten müssen. Er hatte sich gefreut, als klargeworden war, dass es sich bis in den späten Abend hineinziehen würde.
Er zog sich in die Büsche zurück, ließ sich nieder, lehnte sich mit dem Rücken gegen den dünnen Stamm einer jungen Eibe, zog die Oberschenkel heran und beobachtete. Ließ das Licht auf sich wirken, verlor sich darin und merkte nicht einmal, wie die Zeit verging.
Plötzlich öffnete sich die Haustür zu dem kleinen Einfamilienhaus in der Gartenstraße im Hamburger Stadtteil Bergedorf. Schnell verließ er seinen Platz, drückte sich tief auf den Boden und betrachtete die Szene aus der Ameisenperspektive.
Die Brünette trat zuerst heraus. Sie kramte in ihrer großen Handtasche, wahrscheinlich ihr Handgepäck. Sie war elegant und sportlich gekleidet: Lederstiefel mit hohem Absatz, die bis unters Knie reichten, dazu einen kurzen schwarzen Rock und eine enganliegende Lederjacke. Das Haar fiel ihr auf die Schultern. Er meinte, ihr teures Parfüm riechen zu können.
Ihr Freund trat einen Moment später heraus, stellte zunächst ihren und dann seinen Koffer auf den Gehweg. Schließlich zog er die Tür hinter sich zu und schloss ab.
Auf dem Weg zum Wagen kamen sie ganz nah an ihm vorbei. Er drückte sich noch tiefer gegen den Boden und wandte sein Gesicht ab, weil er befürchtete, es könne das Licht der Straßenlaterne reflektieren.
Die Plastikrollen der Koffer waren entsetzlich laut. Keine zwei Meter von ihm entfernt rollten sie vorbei. Erst als er das leise Piepen hörte, mit dem der Mann das Auto entriegelte, hob er den Kopf weit genug, um die beiden sehen zu können. Der Mann öffnete den Kofferraum des Wagens und lud beide Koffer ein. «Bereit für deinen ersten Urlaub?», fragte die Brünette.
Der Mann schlug die Kofferraumklappe zu und umarmte sie. «Ich freue mich darauf», sagte er. Die beiden küssten sich.
Er lag da im Dreck und dachte darüber nach, es sofort zu tun. Nicht noch zwei Wochen zu warten. Ihm einfach den Kopf zu zertrümmern, das wäre mit einem einzigen harten Hieb getan. Sie bewusstlos zu schlagen und beide in den Kofferraum zu stecken. Würden die Nachbarn etwas mitbekommen? Was, wenn sie schrie? Dieses Was-wäre-wenn lag ihm nicht, er bekam Kopfschmerzen, sobald er zu intensiv über etwas Bestimmtes nachdachte. Die Dinge mussten gleichmäßig und langsam ablaufen, ohne Überraschungen. Außerdem sah sein Plan einen anderen Ablauf vor, und er würde auf das Schönste verzichten, wenn er voreilig handelte.
Bevor der Mann in den Wagen stieg, blieb er noch einmal stehen und sah zum Haus zurück. Seine Augen verengten sich misstrauisch. Was dachte er? Hatte er Angst, dass in seiner Abwesenheit etwas geschehen könnte mit seinem Zuhause?
Schließlich stieg er ein, startete den Motor, und der Wagen fuhr in die Nacht davon.
Er wartete noch, bis das Motorengeräusch vollkommen verklungen war. Dann wartete er noch etwas länger, für den Fall, dass ein Nachbar vom Lärm des Autos oder der Koffer aufgewacht und ans Fenster getreten war. Erst als er langsam auskühlte, drückte er sich mühsam vom Boden hoch und ging auf die Haustür zu.
Bevor er sich Schloss und Alarmanlage widmete, drehte er sich noch einmal um und wünschte den beiden in Gedanken einen guten Flug.
Vor allem aber eine heile Rückkehr.
«Meine sehr verehrten Fluggäste, über Hamburg liegt derzeit eine Gewitterzelle. Wir hatten gehofft, sie würde bis zur Landung weitergezogen sein, doch sie scheint Gefallen an der Hansestadt gefunden zu haben. Die Landung wird daher etwas unruhig werden, es besteht aber kein Grund zur Sorge.»
Die Stimme des Piloten aus den Bordlautsprechern klang vollkommen ruhig. Thomas Bennett war weit davon entfernt, sich Sorgen zu machen.
«Bitte stellen Sie nun Ihre Sitze in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische vor sich hoch und schnallen Sie sich an.»
Das Flugzeug begann zu wackeln und zu ruckeln. Unter den zweihundert Rückreisenden brach Unruhe aus. Hektisch wurde an Gurten und Sitzen gezerrt, ohnehin schon genervte Mütter fuhren quengelnde Kinder an, eine ältere Dame kam aus der Toilette und schien vergessen zu haben, wo sich ihr Sitz befand. Aus dem Bund ihrer bequemen Reisehose hing das violette Unterhemd heraus. Die Vierergruppe knapp zwanzigjähriger Jungs, bei denen nicht ganz klar war, ob sie angetrunken waren oder einfach nur gut gelaunt, und die sich bereits eine Standpauke einer Stewardess eingehandelt hatten, johlte auf, einer machte die Geräusche eines abstürzenden Flugzeuges nach.
Thomas Bennett beugte sich über den Gang und stupste den jungen Mann an der Schulter an.
«Lass das mal lieber, die Kinder sind so schon verängstigt – und meine Freundin auch. Sie hasst Landungen.»
Eben hatte der junge Mann noch gescherzt und gelacht, wenn auch auf eine gehässige Art und Weise, doch als er Thomas jetzt ansah, änderte sich seine Mimik. Aggressivität lauerte in seinem Blick.
«Sonst was, Alter? Bist du hier der Sheriff, oder wie?»
Thomas hatte nicht damit gerechnet, so angefahren zu werden. Er hatte freundlich, fast schon ein wenig flapsig gesprochen. Saskia neben ihm krallte sich panisch an den Armlehnen fest.
Er wusste nicht, was er erwidern sollte, und war froh, als eine der Flugbegleiterinnen den jungen Mann nachdrücklich um Ruhe bat. Mit Schwung klappte sie das Tischchen vor ihm hoch und bedachte ihn mit einem einschüchternden Blick.
Kaum ging sie weiter, formte der junge Mann mit der Hand eine Waffe, legte auf Thomas an und tat, als würde er abdrücken. Dabei grinste er überheblich. Dann beugte er sich ein Stück vor und machte in Richtung Saskia eine anzügliche Bewegung mit der Zunge.
Saskia legte Thomas eine Hand auf den Unterarm und schüttelte den Kopf. Ein wortloses «Lass es gut sein». Zum Glück. Thomas hätte ohnehin nicht gewusst, wie er hier im Flieger darauf reagieren sollte.
Die Mallorcabräune nach zwei Wochen unter der Mittelmeersonne stand ihr ausnehmend gut. Ihre Haut hatte einen Bronzeton angenommen, und ihr brünettes Haar war ein wenig heller geworden. Thomas hatte sie auf Mallorca beim Stand-up-Paddling beobachtet, sein Surfer Girl im knappen Bikini, anscheinend schwerelos auf dem Wasser, den Blick in die Weite gerichtet, eingerahmt vom goldenen Licht des Sonnenunterganges. Das nasse Haar hatte sie noch schlanker und irgendwie auch verletzlicher wirken lassen, und Thomas hatte sich wie immer gefragt, ob er in der Lage sein würde, sie zu beschützen.
Er beugte sich zu ihr und küsste sie.
«Tut mir leid», sagte er leise in ihr Ohr, damit der Blödmann auf der anderen Seite des Ganges es nicht mitbekam. «Wenn wir ausgestiegen sind, töte ich ihn.»
«Aber lass es wie einen Unfall aussehen.»
«Er wird in die Flugzeugturbine stolpern. Niemand macht meine Frau ungestraft an.»
«Meine Frau?», wiederholte sie, was er gesagt hatte, und Thomas spürte, wie die Situation sich veränderte, wie aus Flapsigkeit Ernst wurde, er verstand nur nicht, warum.
«Freundin. Ich meinte natürlich Freundin.»
Jetzt verschwand auch der letzte Rest ihres Lächelns.
«Natürlich.»
Das Flugzeug legte sich in eine Rechtskurve, die Triebwerke wurden für einen Moment lauter. Dann gab es einen heftigen Ruck, jemand schrie leise auf, und Saskia krallte sich an Thomas’ Arm fest. Die Lichter erloschen.
«Ich töte auch den Piloten, wenn er damit nicht aufhört», scherzte er.
Erst als das Flugzeug wieder einigermaßen ruhig flog, löste Saskia ihre Finger aus seinem Fleisch. Die Abdrücke ihrer Nägel zeichneten sich wie rote Halbmonde auf seinem Unterarm ab.
«Ich hasse das», stieß sie mit der angehaltenen Atemluft aus.
«Ich erinnere dich ungern, aber du wolltest unbedingt fliegen.»
Saskia atmete tief durch. «Eigentlich hatte ich es für zu Hause geplant», begann sie und beugte sich nach unten zu der kleinen Tasche, die zwischen ihren Füßen stand. «Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir beide gleich sterben werden, ist jetzt vielleicht doch der bessere Zeitpunkt.»
Sie hielt Thomas eine kleine Schatulle hin, die in Geschenkpapier gehüllt und mit einer roten Schleife versehen war.
«Ein Geschenk?», fragte Thomas und spürte, wie sein Hals plötzlich trocken wurde. Er schluckte mühsam.
Vor zwei Monaten war Saskia zu ihm in sein Haus gezogen. Die Bewährungsprobe eines gemeinsamen Alltags hatten sie bestanden, auch wenn sie sich wegen der vielen Arbeit in seiner Firma nur abends sahen. Und dennoch, die Zahnbürste neben seiner und die langen Haare im Waschbecken und der Dusche waren nicht zu übersehende Zeichen für große Veränderungen. Zum ersten Mal in seinem Leben war es ihm ernst mit einer Beziehung, dennoch wäre er nicht auf die Idee gekommen, Saskia einen Antrag zu machen. Dazu war es zu früh, und es sprach aus seiner Sicht nichts dagegen, einfach so zusammenzuleben, ohne Trauschein und dieses ganze Brimborium. Sie hatten auch nie darüber gesprochen, nicht einmal im Spaß. Hatte er etwas übersehen? Hatte Saskia sich für ihren ersten gemeinsamen Urlaub einen Antrag gewünscht? Hatte sie deshalb so vehement darauf bestanden? Selbst wenn er von allein darauf gekommen wäre, hätte Thomas sie niemals am Strand dieser Partyinsel gefragt, ob sie seine Frau werden wollte. Das war kitschig und hatte keinen Stil.
«Mach es auf», sagte sie.
Bevor er dazu kam, ruckelte das Flugzeug noch einmal heftig, und ein Blitz erhellte die dunkle Kabine. Saskia presste ihre Unterarme auf die Lehnen, ihre Hände verkrampften sich. Thomas verschränkte seine Finger in ihren.
«Keine Angst, ich bin bei dir.»
Er machte sich daran, das Geschenk auszupacken. Warum nur fiel es ihm so schwer? Warum hätte er es ihr am liebsten wieder zurückgegeben und auf den richtigen Zeitpunkt verwiesen?
Aber es war kein Ring.
Es war ein gelbes Maßband, wie es von Schneidern benutzt wurde.
Thomas nahm es aus dem kleinen Kästchen, rollte ein paar Zentimeter ab und starrte es verständnislos an.
«Was ist das?», fragte er.
«Ein Maßband», sagte Saskia.
«Ja, sicher … aber … wofür?»
«Damit du meinen Bauchumfang messen kannst. Jeden Tag. Die nächsten sieben oder acht Monate.»
«Nein, du darfst nicht so schwer heben!»
Thomas sprang vor, schnappte sich den Koffer, der auf dem Gepäckband langsam vorbeizockelte, und wuchtete ihn auf den Gepäckwagen.
«Ich bin doch nicht krank», sagte Saskia.
«Trotzdem, wir müssen ja kein Risiko eingehen.»
Sie zog seinen Kopf zu sich hinunter und küsste ihn. Die umstehenden Reisenden beobachteten sie, und es war Thomas ein wenig unangenehm, denn der Kuss war sichtbar leidenschaftlich.
«Ich liebe dich», flüsterte sie ihm ins Ohr.
Thomas kam nicht dazu, ihre Liebeserklärung zu erwidern, denn auf dem Band tauchte nun sein eigener Koffer auf. Er stellte ihn zu Saskias auf den Gepäckwagen, und sie gingen in Richtung Ausgang. Da der Flug spätabends um halb elf gelandet war, war es in der Ankunftshalle relativ leer und ruhig.
Thomas dagegen war unruhig. Früher oder später würde Saskia ihn nach seinen Gefühlen fragen, das wusste er, und er war verzweifelt auf der Suche nach den richtigen Worten. Hätte sie ihm im Flieger während der Landung wirklich einen Antrag gemacht, dann hätte er ja gesagt und wäre mit der Schmach, als Mann in diesem Punkt versagt zu haben, irgendwie zurechtgekommen. Die Nachricht von ihrer Schwangerschaft hatte ihn jedoch vollkommen aus der Bahn geworfen. Im Nachhinein war Thomas dankbar für die wirklich holprige Landung, denn die hatte Saskia von ihm abgelenkt. Wenn es ums Geschäft ging, konnte Thomas sich ganz gut verstellen, in Personalgesprächen wahrte er stets perfekte Umgangsformen, selbst wenn ein Mitarbeiter ihm durch Dummheit oder Ignoranz fürchterlich auf die Nerven ging. Doch beim Anblick des gelben Maßbandes, dieses Symbols für den größten Umbruch des Lebens, den man sich vorstellen konnte, war sein Inneres quasi kollabiert. Den ersten klaren Gedanken hatte er erst wieder fassen können, als das Flugzeug in seiner Parkposition vor dem Terminal ausgerollt war.
Schwanger.
Ein Kind.
Er würde Vater werden.
Thomas wartete auf den Freudenschub, der ihn lauthals auflachend Saskia um den Hals fallen und sie mit Küssen überhäufen lassen würde. Nichts davon hatte er bisher getan. Er war schweigsam gewesen seit der Nachricht, und er war Saskia dankbar dafür, dass sie ihn in Ruhe gelassen hatte. Wahrscheinlich wusste sie es ohnehin – oder besser, sie glaubte, es zu wissen. Denn ein Grund dafür, warum er so erschüttert war, war so tief in seinem Inneren verborgen, dass auch Saskia ihn niemals würde ergründen können. Thomas hatte nicht vor, jemals mit irgendjemandem darüber zu sprechen – auch nicht mit Saskia.
Vor ihnen glitten die Glastüren auseinander und gaben den Weg frei auf den Taxibereich vor der Ankunftshalle. Die hohen Peitschenlaternen spendeten ein warmes rötliches Licht. Der nasse Asphalt glitzerte, in der Ferne zuckten vereinzelt die Blitze des abziehenden Gewitters. Der Nachthimmel war größtenteils schwarz, stellenweise aber gesprenkelt von Sternen. Eine für Deutschland ungewöhnliche klebrige Wärme hüllte sie sofort ein.
«Kein Unterschied zu Mallorca», konstatierte Thomas.
Ein Taxifahrer eilte auf sie zu, doch Thomas schüttelte den Kopf. Sie waren mit dem eigenen Wagen hier, er stand in Parkhaus fünf. Hier zu parken war zwar teuer, aber Thomas hatte seinen fast neuen Wagen nicht zwei Wochen lang unbeobachtet vor der Haustür stehen lassen wollen. Im Parkhaus wurde er wenigstens videoüberwacht.
Thomas musste am Zebrastreifen anhalten, weil ein Taxi mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos vorbeirauschte.
Von hinten rammte ihm jemand einen Kofferwagen in die Hacken.
«Sieh an, der Sheriff und seine ängstliche Miezekatze.»
Es war die Vierergruppe aus dem Flugzeug. Der junge Mann, den Thomas angesprochen hatte, baute sich vor ihm auf. Er war größer und kräftiger und roch nach Alkohol.
«Und? Immer noch ’ne große Klappe?»
Die Jungs umringten sie. Thomas spürte Angst in sich aufsteigen. Es war niemand in Sicht, der ihnen helfen würde.
«Tut mir leid, wir wollen keinen Ärger», sagte er.
«Nee, natürlich nicht, du Flachwichser.» Der Junge wandte sich Saskia zu. «Und, Miezekatze? Besorgt er es dir richtig? Oder haste mal Bock auf einen richtigen Mann?»
Erneut machte er diese widerliche Geste mit der Zunge.
Saskia schlug ihm ansatzlos mit der flachen Hand ins Gesicht, dass es nur so klatschte.
Der Junge zuckte zurück und stolperte gegen Thomas. Seine Freunde johlten belustigt.
«Du blöde Kuh!», stieß der Junge aus.
«Hey, jetzt ist aber …»
«Was willst du?», schrie der Junge, fuhr zu Thomas herum, packte den Griff des Kofferwagens und rüttelte daran.
«Gibt es Probleme?»
Die Stimme kam von der Eingangstür des Terminals. Dort standen zwei Securitymänner in schwarzer Uniform.
Sofort ließ der Junge den Griff los und entfernte sich von Thomas und Saskia.
«Nee, alles cool, keine Probleme», sagte er.
«Na, dann verzieht euch.»
Das taten die Jungs, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Thomas sah ihnen nach. Sein Herz raste und seine Hände klammerten sich noch immer an den Griff des Wagens.
«Verdammte Arschlöcher», schimpfte Saskia neben ihm.
Sie schien überhaupt nicht verängstigt zu sein, nur sehr wütend.
«Bist du wahnsinnig», fuhr Thomas sie an. «Solche Situationen löst man nicht mit Gewalt. Das hätte leicht eskalieren können.»
Es war still im Wagen. Nur das gleichmäßige Brummen des Motors war zu hören.
Saskia war vollkommen erschöpft und nickte während der Fahrt immer wieder ein. Ihr Kopf sackte zur Seite gegen die Scheibe, sie wachte auf, blickte verwirrt um sich und schlief wieder ein. Im Schlaf zuckten ihre Hände nervös und legten sich auf ihren Bauch, so als wolle sie etwas festhalten.
Sie hatten sich zwar nicht gestritten, aber Saskia war beleidigt, dass er sie so rüde angemacht hatte nach dem Vorfall am Flughafen. Dass sie sein Verhalten feige fand, hatte Saskia nicht gesagt, aber das war auch nicht nötig. Thomas selbst fand sich feige. Immer wieder musste er daran denken, wie er sich hinter dem Gepäckwagen verschanzt hatte, während Saskia die Initiative ergriffen hatte. Er wünschte sich, anders gehandelt zu haben. Doch dafür war es jetzt zu spät, der Schaden war angerichtet.
Die Straßenlaternen waren bereits dunkel, als Thomas in die Gartenstraße einbog. Wie immer waren die Straßenränder rechts und links zugeparkt. Die Grundstücke waren in dieser Gegend der Stadt teuer und deshalb klein, einen Stellplatz besaßen die meisten, aber für den zweiten Wagen reichte es nicht, der wurde eben am Bordstein geparkt. Thomas hoffte, einen Platz direkt vor dem Haus zu bekommen, denn in der Auffahrt stand Saskias Wagen. Als sie sich seinem kleinen modernen Neubau näherten, bemerkte er das Licht hinter den Fenstern und wunderte sich. Dann fiel ihm die automatische Lichtsteuerung ein, die zur Alarmanlage gehörte und den Eindruck erwecken sollte, die Bewohner seien zu Hause. Zwar war bei Thomas noch nicht eingebrochen worden, aber man konnte ja nie wissen. Seine direkten Nachbarn hatte er darüber informiert, dass er zwei Wochen in den Urlaub fahren würde, trotzdem aber Licht im Haus brannte. Wahrscheinlich wäre es ihnen ohnehin egal gewesen. Links wohnte ein junges Pärchen, ziemlich hip, die waren eigentlich nie zu Hause, und wenn, dann feierten sie Partys. Sie machte irgendwas mit Mode, er war Werbefachmann. Rechts wohnte ein alter Mann, der einzige verbliebene «Ureinwohner» der Straße. Er war fast taub und außerdem ein echter Griesgram. Thomas nahm an, dass er es seinen jungen, aber gut verdienenden Nachbarn gönnte, bestohlen zu werden.
Die Stadt konnte anonym sein, wenn sie es wollte. Und hier wollte sie es.
Der Stellplatz vor seiner Einfahrt war frei. Thomas musste sich Mühe geben, seinen Wagen in die enge Lücke zu manövrieren. Dabei wachte Saskia auf. Verwirrt sah sie sich um.
«Sind wir schon da?», fragte sie mit schlaftrunkener Stimme und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund.
Thomas stellte den Motor ab.
«Wie geht es dir?» Er nahm ihre Hand.
«Ganz gut. Das Kind kommt noch nicht sofort, denke ich.»
«Sehr witzig!»
Sie sah ihn nicht an, ließ ihren Blick über die dunkle Straße gleiten. Auf ihrer Stirn erschienen ein paar Sorgenfalten.
«Warum können die die Straßenlaternen nachts nicht anlassen?»
Es war mehr ein Vorwurf als eine Frage. Saskia hatte Angst vor der Dunkelheit. In ihrer Kindheit war in ihr Elternhaus eingebrochen worden, und obwohl sie sich kaum an etwas erinnern konnte, war die Angst doch geblieben. Sie war überaus erfreut gewesen, als sie bei ihrem Einzug vor zwei Monaten festgestellt hatte, dass Thomas über eine Alarmanlage verfügte.
«Einbrüche finden tagsüber statt», sagte Thomas, der die Statistiken kannte. «Wenn du hinten im Garten arbeitest, räumen sie dir vorn die Wohnung aus. Auch Einbrecher brauchen ihren Nachtschlaf.»
«Na toll! Da fühle ich mich ja gleich viel wohler.»
Thomas wollte etwas sagen, möglichst etwas Mutiges nach der Sache am Flughafen, aber ihm fielen nicht die richtigen Worte ein.
«Lass uns reingehen, ich bin todmüde», sagte Saskia und öffnete die Tür. Damit war die Chance vertan.
Thomas stieg aus und holte ihren Koffer aus dem Kofferraum.
Saskia wartete vor der Tür auf ihn. Thomas bekam das Türschloss nicht sofort auf, etwas schien im Inneren zu haken. Er zog den Schlüssel heraus, überprüfte, ob es der richtige war, und steckte ihn wieder hinein. Abermals hakte er.
«Was ist denn?», fragte Saskia.
«Ich weiß nicht … irgendwie …»
Endlich gab die Sperre nach, und der Schlüssel ließ sich drehen.
«Na also.» Thomas öffnete die Tür und ließ Saskia vorangehen.
Noch auf der Schwelle blieb sie abrupt stehen. «Was ist das denn für ein Geruch?», fragte sie und rümpfte die Nase.
Thomas mühte sich ab, Saskias schweren Koffer über die drei Stufen zu wuchten. Als er im Flur stand, schnupperte er ebenfalls.
«Ich weiß nicht, was du meinst.»
«Hier riecht es anders als sonst.»
«Ja, abgestanden. Zwei Wochen wurde nicht gelüftet.»
«Schon möglich», nuschelte Saskia. «Ich dusche noch schnell und gehe dann sofort ins Bett.»
«Okay, ich hole meinen Koffer.»
Saskia hatte das Gefühl, den Körper einer Siebzigjährigen die Treppe hinauf ins Obergeschoss zu schleppen. War das wirklich nur die Müdigkeit nach einem langen Tag, oder machte sich die Schwangerschaft jetzt schon bemerkbar? Bisher war ihr morgens nicht einmal übel gewesen. Kam das erst später? Sie wusste es nicht, und dass sie schwanger war, stand ja auch erst seit einer Woche fest.
Auf ihrem Handy befanden sich die Beweise, die sie Thomas noch gar nicht gezeigt hatte. Fotos von dem Schnelltest, ein kurzes Video, wie sich der Farbstreifen veränderte. Der erste Beweis ihrer Schwangerschaft, das erste Lebenszeichen ihres Babys. Kein körniges schwarzweißes Ultraschallbild, nein, ein in dem kleinen Bad ihres Hotelzimmers gedrehtes Video mit Palmwedeln im Hintergrund. Der Auftakt eines neuen Lebens.
Zwar hatte sie nicht geplant, schwanger zu werden, aber irgendwie erschien ihr der Zeitpunkt richtig. Seit einigen Monaten vertrug sie die Pille nicht mehr und hatte auf die Temperaturmessmethode umgestellt. Vielleicht hatte sie nicht richtig aufgepasst, vielleicht hatte die leichte Grippe die Messungen verfälscht, wie auch immer, es gab keine Zufälle im Leben, alles folgte einem vorbestimmten Plan, und dieser Plan sah nun einmal vor, dass sie und Thomas Eltern werden würden.
Jetzt fragte sie sich allerdings, ob Thomas bereit war dafür.
Ein wenig enttäuscht war Saskia von seinem Verhalten am Flughafen schon. Sie wusste ja, wie wenig er von Waffen, Gewalt und körperlichen Auseinandersetzungen hielt. Dass er in einer konkreten Bedrohungssituation aber nicht in der Lage war, sie zu beschützen, machte sie doch nachdenklich. Sein rüdes Verhalten danach verstand sie zwar, billigte es aber nicht. Er hatte sie angefahren, um sich selbst besser zu fühlen, um ihr zu verdeutlichen, dass sie einen Fehler gemacht hatte, nicht er.
Männer. Nicht immer einfach.
Im Obergeschoss angekommen, verharrte Saskia auf dem Treppenabsatz und sog erneut Luft durch die Nase ein. Der Geruch kam ihr noch immer fremd vor. Es roch irgendwie … alt. Anders konnte sie es nicht beschreiben. Wahrscheinlich waren ihre Nerven nur überreizt.
Die Tür zum Schlafzimmer stand einen Spaltbreit offen. Saskia starrte die Dunkelheit in diesem Spalt an und fragte sich, ob die Tür auch schon offen gestanden hatte, als sie das Haus verlassen hatten, und plötzlich erinnerte sie sich daran, dass sie sich an jenem Abend vor zwei Wochen beobachtet gefühlt hatte. Der Eindruck, jemand halte sich im Garten auf und gaffe durch die beleuchteten Fenster hinein, war sehr stark gewesen, und sie hatte Thomas darauf angesprochen. Wie immer hatte er ihre Furcht nicht ernst genommen und sie aus Spaß erschreckt. Und doch, da war jemand gewesen, Saskia war sich sicher.
Der Geruch, die Tür … schon wollte sie nach Thomas rufen, aber der war ja noch einmal zum Wagen hinausgegangen, also ließ sie es sein.
Sie sparte sich den Weg ins Schlafzimmer und zog die schmutzige Kleidung gleich im Bad aus. Dann stellte sie die Dusche an, wartete darauf, dass das Wasser heiß wurde, und warf einen Blick in den Spiegel. Dabei fiel ihr die Unordnung auf der gläsernen Ablage darunter auf. Sie konnte sich nicht erinnern, das Bad so hinterlassen zu haben. Einige Dinge fehlten, die befanden sich in den Koffern, aber die, die zurückgeblieben waren, standen anders als sonst.
Saskia drängte ihre Panik zurück. Womöglich hatte sie das Chaos auf der Ablage selbst hinterlassen. Vor zwei Wochen war es zeitlich eng gewesen, sie war direkt von der Spätschicht gekommen.
Saskia betrat die Dusche, regulierte das Wasser noch ein wenig wärmer, trat unter den Strahl und ließ ihn auf ihren Kopf prasseln. Im selben Moment glaubte sie, den Boden unter sich vibrieren zu spüren, so als sei im Untergeschoss des Hauses etwas umgestürzt. Sie trat aus dem Wasserstrahl und lauschte, konnte aber nichts hören.
Wahrscheinlich hatte Thomas die Haustür zugeworfen.
Thomas ging im Dunkeln durch das große Wohnzimmer zur Terrassentür, um frische Luft hereinzulassen. Saskia hatte recht, es roch muffig im Haus, aber das war nach vierzehn Tagen ohne Bewohner ja auch kein Wunder. Als er die Tür aufzog, bemerkte er, dass der weiße Kunststoffgriff schmutzig war. Schwarze Fingerabdrücke hafteten daran. Am Tag vor dem Urlaub hatte Thomas noch den Rasen gemäht und den Mäher gereinigt, wahrscheinlich war er danach mit schmutzigen Händen hereingekommen. Normalerweise war seine Putzfrau gründlich, aber er hatte sie für drei Wochen in den Urlaub geschickt.
Thomas wischte die Spuren ab, trat auf die Terrasse hinaus und betrachtete den kleinen Garten, der durch hölzerne Sichtschutzzäune, Büsche und eine Buchenhecke zu den Nachbargrundstücken hin abgegrenzt war. Der Rasen war lang geworden in den vierzehn Tagen, außerdem musste es ordentlich gestürmt haben, denn auf der Terrasse standen die Stühle anders als sonst.
Thomas befühlte die Auflagen. Sie waren feucht. Vermutlich hatte der Wind den Regen unter die Überdachung gedrückt. Hatte er die Auflagen nicht ins Haus gebracht, bevor sie aufgebrochen waren?
Thomas kehrte ins Wohnzimmer zurück, machte Licht – und erschrak! Nichts war so wie sonst – der Tisch, die Couch, die Lampen, alles war verrückt. Bücher, die sonst im Regal standen, lagen auf dem Tisch, dazwischen Geschirr, das in die Küche gehörte. Leere Wasserflaschen lagen auf dem Boden, im Bücherregal entdeckte er eine Konservendose mit hochgeklapptem Deckel, der Griff eines Löffels ragte heraus.
Einbruch, schoss es ihm durch den Kopf.
Er tastete nach seinem Handy, doch das steckte in seiner Jackentasche, und die Jacke lag im Wagen.
Also das Festnetz.
Die Ladeschale mit dem Festnetztelefon stand in der Küche.
Sieh zuerst nach Saskia, sagte er sich, riss aber gleichzeitig die Tür zur Küche auf.
Eine Bewegung. Ein Schatten.
Etwas prallte mit großer Wucht gegen seinen Kopf, der Boden wankte, die Welt wankte, in seinen Ohren kreischte es, alles wurde von einem grellweißen Licht überlagert, der Raum kippte vornüber, Thomas taumelte, fiel, bekam einen weiteren harten Schlag gegen den Schädel, und dann verschwand alles im Nichts.
Blut und Haar wusch er noch im Untergeschoss unter dem futuristisch gestylten Wasserhahn in der Küche ab. Als er mit den Fingern die Hautfetzen von dem metallenen Grat entfernte, schnitt er sich daran, und sein eigenes Blut mischte sich mit dem des Mannes. In konzentrischen Kreisen spülte das Wasser die Mischung in den Abfluss. Er beugte sich tief über den Hahn, hielt seinen Mund darunter und trank von dem Wasser.
Dann richtete er sich auf und stellte es ab.
Aber er hörte weiter Wasserrauschen.
Es kam von oben.
Die Brünette stand unter der Dusche.
Eine Tropfspur vom Hammer folgte ihm aus der Küche bis vor die Treppe ins Obergeschoss. Dort verharrte er einen Moment und lauschte. Das Wasser rauschte und rauschte, so als wolle die Brünette sich selbst hinwegspülen. Sie war bei ihrer Ankunft verändert gewesen, war nicht mehr die, die er beobachtet hatte, als sie vor vierzehn Tagen abgereist war. Warum waren beide so voller Anspannung gewesen? Er würde sie fragen, die Brünette, und früher oder später würde sie ihm antworten.
Er zog die Schuhe aus und stieg in Socken die Treppe hinauf. Die linke hatte ein Loch, aus dem sein großer Zeh ragte. Das störte ihn, er hatte das ganze Haus nach Stopfnadeln und Garn abgesucht, jedoch nichts dergleichen gefunden. Früher hatte es so etwas in jedem Haushalt gegeben. Noch sehr genau hatte er das Bild seiner Mutter vor Augen, wie sie abends vor dem Fernseher saß und stopfte, während er das Sandmännchen schaute. Liebe Kinder, gebt gut acht, ich hab euch etwas mitgebracht. Mutter hatte diesen Satz immer leise mitgesungen.
Man lief nicht mit Löchern in den Socken herum, es gehörte sich einfach nicht!
Das Rauschen verstummte in dem Moment, da er den oberen Treppenabsatz erreichte.
Die Tür zum Bad war nur angelehnt, durch einen schmalen Spalt sah er die Brünette hinter der Glaswand hervortreten. Sie nahm ein großes weißes Handtuch von der Stange, beugte den Oberkörper vornüber und wollte sich das Haar trocken rubbeln. Doch plötzlich verharrte sie, betrachtete mit nachdenklich gerunzelter Stirn das Handtuch, hielt es sich unter die Nase und schnupperte daran.
Er hatte sich einige Male damit abgetrocknet, konnte es sein, dass sein Geruch daran haftete?
Es war interessant, sie zu beobachten. Ihr sorgenvoller Blick wanderte vom Handtuch zur Ablage unter dem Spiegel und wieder zurück. Er ahnte ihren Blick zur Tür voraus und trat schnell einen Schritt beiseite. Erst als er hörte, wie sie das Handtuch schließlich doch benutzte, um sich das Haar zu trocknen, spähte er erneut durch den Spalt. Sie hatte ihm den Rücken zugedreht. Er beobachtete das Spiel ihrer Muskeln unter der nackten Haut. Sie war sehr dünn, jeder noch so feine Muskel zeichnete sich ab. Ihre Haut war stark gebräunt, unterbrochen nur von hellen Abdrücken dort, wo der Bikini sie vor der Sonne geschützt hatte.
Schließlich trat sie mit strubbeligem Haar vor den Spiegel, wischte den feuchten Beschlag mit dem Handtuch ab, ließ es zu Boden fallen, drehte sich seitlich, betrachtete sich und fuhr sich mit der Hand sanft über den Bauch. Es kam ihm so vor, als streckte sie ihren Bauch bewusst weit heraus, obwohl sie an dieser Stelle ihres Körpers genauso dünn war wie überall sonst. Eine ganze Weile stand sie dort so und streichelte sich.
Sie war makellos und wunderschön.
Plötzlich schämte er sich noch mehr für das Loch in seiner Socke und fragte sich, ob er noch genug Zeit hatte, hinunterzulaufen und die Schuhe wieder anzuziehen. Nur gehörte es sich ebenso wenig, auf dem Teppich im Obergeschoss mit Straßenschuhen herumzulaufen.
Sie nahm ihm die Entscheidung ab, indem sie sich vom Spiegel abwandte und auf die Tür zukam.
«Thomas», rief sie, «hast du hier oben …»
Dann entdeckte sie ihn.
Erstarrte, riss die Augen auf, gab ein merkwürdiges Geräusch von sich und taumelte zurück.
Er trat einen Schritt vor, den Hammer in der Hand. Warme, feuchte Luft empfing ihn, dazu ihr Geruch, dieser ganz natürliche Geruch weiblicher Haut.
Weil er ahnte, dass sie gleich schreien würde, hob er einen Finger an seine Lippen und machte: «Psssst.»
Das hatte nicht den gewünschten Erfolg. Sie schrie trotzdem.
Er schloss die Tür hinter sich und drängte sie zurück.
«Willkommen daheim. Ich habe so lange auf dich gewartet!»
Es gab keine Fluchtmöglichkeit aus diesem Raum. Das Fenster war ein schmaler langer Spalt hoch oben in der Wand, sodass man von außen nicht hineinschauen konnte. Sie wich schreiend zurück bis in die Dusche, aus der sie gerade erst gekommen war.
«Nicht schreien. Jetzt wird alles gut, du bist zu Hause!»
Sie wollte sich nicht beruhigen.
Der alte Rhythmus drängte sich ihm erneut auf.
Schlag, Schlag, Pause …
Ein Rhythmus, der sich selbst gegen ihre schrillen Schreie durchsetzte, die in der gekachelten Dusche widerhallten.
Schlag, Schlag, Pause …
Die weibliche Leiche lag mit eingeschlagenem Kopf auf dem Bett. Am Körperschwerpunkt um die Hüfte, wo ihr Gewicht die Matratze tief eindrückte, hatte sich viel Blut gesammelt, sodass der erste Eindruck eine Wunde in diesem Bereich vortäuschte. Umrundete man das Bett, erkannte man jedoch schnell die verheerende Wunde an der linken Kopfseite. Mit großer Wucht war der eigentlich äußerst stabile Schädelknochen eingeschlagen worden.
Eine Delle wie in einem Kotflügel, dachte Priska Wagner und schluckte alles herunter, was in ihrem Hals aufzusteigen drohte. Sie war einiges gewohnt, ein freiliegendes Hirn und zersplitterte Schädelknochen allerdings nicht. Selbst nach zehn Jahren Polizeiarbeit gab es Dinge, die sie zum ersten Mal sah.
Weil der Anblick sie schockierte und sie ihn kaum ertrug, konzentrierte sie sich auf etwas anderes: die Bettwäsche. Warum schlief eine Frau in Werbebettwäsche des Fußballvereins Bayern München? Schon bei Männern konnte Priska das nicht verstehen, aber eine Frau? Sie fraß sich regelrecht an der Frage fest, obwohl die Antwort sicher nicht zur Klärung des Falles beitrug – ausschließen konnte man es aber auch nicht. Vielleicht hatte der Streit zweier rivalisierender Fußballfanatiker zu dieser grausamen Tat geführt? Die prügelten sich schließlich auch auf offener Straße die Schädel blutig.
Weil sie so genau hinsah, bemerkte Priska einen Abdruck auf der Bettwäsche, der ihr sonst wohl nicht aufgefallen wäre. Er versteckte sich direkt im Emblem des Fußballvereins. Zwei einzelne Blutflecken, voneinander getrennt durch einen etwa zwei Zentimeter breiten, sauberen Streifen. Die Flecken selbst hatten eine eigenartige Form: zwei Rechtecke mit abgerundeten Ecken. Schon auf den ersten Blick war Priska klar, dass die beiden Flecken nicht einzeln entstanden waren, sondern zusammengehörten. Der Täter musste nachlässig gewesen sein oder hatte unter großem Stress gestanden, so etwas führte zu Fehlern. Ebendeshalb wurden Morde wie dieser in der Regel schnell aufgeklärt.
«Was ist das?», fragte Priska in den Raum hinein. Beim Hereinkommen hatten sie Rupert Friedhoff begrüßt, den Spurentechniker. Er stand jetzt hinter ihr. Priska kannte den schweigsamen Mann, von dem der Flurfunk vermeldete, er sei früher ein hervorragender Fechter gewesen und nur knapp an einer Olympianominierung gescheitert. Mehr als Höflichkeiten hatten sie nie ausgetauscht, aber Priska fand, dass das auch reichte. In ihrem Bekannten- und Freundeskreis, der nicht sonderlich groß war, gab es niemanden aus ihrem Berufsleben. Es ging ihr besser, wenn sie diese beiden Welten strikt voneinander trennte.
Friedhoff trat an ihre Seite. Dabei schraubte er ein Stativ unter eine Kamera. Seine Bewegungen waren langsam und effizient, und er beugte sich über den Fleck, wie sich ein kleines Kind über einen interessanten Käfer beugen würde: behutsam, bedacht und konzentriert.
«Ein blutiger Abdruck», bestätigte er.
«Und wovon?»
«Da wir gerade erst anfangen, kann ich das nicht sagen, aber möglicherweise von der Tatwaffe.»
«Auf was tippen Sie?»
Friedhoff wiegte den Kopf von einer Seite auf die andere.
«Hammer?»
«Ein Hammerkopf würde einen geschlossenen Abdruck hinterlassen», wandte Priska ein.
«Möglicherweise hat eine Falte in der Decke zu der Trennung geführt.»
Priska dachte darüber nach. Ihr Blick haftete weiterhin an der auffälligen Bettwäsche. «Sind Sie Fußballfan?», fragte sie den Spurentechniker.
Zum ersten Mal sah Friedhoff sie direkt an.
«Fußball ist dumpf, brutal und ohne jede Eleganz», fällte er sein vernichtendes Urteil.
Priska legte ihm eine Hand auf die Schulter. Der weiße Plastikanzug raschelte unter ihren Fingern.
«Und ich dachte schon, ich stünde ganz allein da mit meiner Einschätzung.»
Ein schüchternes Lächeln zuckte um Friedhoffs Mundwinkel. Er wandte sich ab, kniete sich vor die große Aluminiumkiste mit Ausrüstungsgegenständen und kramte darin herum.
Priska fand, der Mann habe den richtigen Beruf ergriffen. Als Talkmaster wäre er eine Niete gewesen.
Wie auf Kommando trat Hannes Kerkmann an ihre Seite und füllte die Gesprächslücke. Er ignorierte die Leiche, sein Blick haftete auf seinem Notizblock, dabei kaute er auf einem Bleistift herum. Das Ende war bereits ganz zerfasert und feucht, und auf seinen Lippen klebten kleine Splitter der grünen Lackierung. Irgendwann würde Priska diesem Anfänger, den man ihr vor einem halben Jahr an die Seite gestellt hatte, sagen müssen, wie eklig das war und wie abstoßend das Geschmatze klang.
Kerkmann war fast eins neunzig groß und unfassbar dürr. Seine Kleidung schlackerte an seinem Körper herum und war immer zerknittert. Und dann diese Schuhe! Größe vierundfünfzig, wie er ihr verraten hatte. Outdoorqualität, mit umlaufender Schutzleiste und Goretexmembran. Schwer zu bekommen in seiner Größe. Er kaufte sie in einem Internetshop, der auf Schuhe in Übergrößen spezialisiert war. Die Spitzen waren abgeschabt und verbeult, weil er ständig irgendwo gegenstieß. Überhaupt schien er überhaupt keine Kontrolle über seinen Körper zu haben. Immer wenn sie ihn aus der Ferne betrachtete, fiel Priska der Begriff «Passgänger» ein – eine Anomalie bei Pferden, die beim Turnierreitsport in Deutschland unerwünscht war und im Trabrennsport sogar zur Disqualifikation führte. Kerkmann war natürlich ein Mensch, aber sein Gang sah witzig aus, weil er mit dem rechten Fuß immer auch den rechten Arm nach vorn schwang und umgekehrt. Ihn beim Tanzen zu beobachten musste die reinste Offenbarung sein.
Sein schwarzes Haar trug er lang. Priska musste zugeben, dass es schön war, jede Frau hätte ihn darum beneidet. Sie jedenfalls tat es. Er hatte ein jungenhaftes, ebenmäßiges Gesicht, gerade Zähne und ausdrucksstarke dunkle Augen. Ein hübsches Gesicht auf einem merkwürdigen Körper – das war es, was Priska beim ersten Anblick gedacht hatte. Viel zu hübsch und zu offen für den Polizeidienst. Kein Pokerface, nichts Verschlagenes, einfach nur ehrlich, freundlich und meistens positiv. Priska fand, Kerkmann hätte besser Jugendbetreuer werden sollen. Sie stellte ihn sich gern auf einem Baumstumpf sitzend vor, eine Westerngitarre vor dem Bauch, eine Gruppe Kinder vor sich, die sich nicht an seinen schiefen Klängen störten, sich aber von seiner Art und Erscheinung begeistern ließen. Ja, genau das war es: Kerkmann strahlte Begeisterung fürs Leben aus. Es war ihr schleierhaft, wie jemand wie er zur Mordkommission kommen konnte. Zugutehalten musste sie ihm aber, dass seine Gegenwart etwas Erhellendes und Erfreuliches hatte. Blickte man in Kerkmanns Gesicht, konnte man glatt den Fehler begehen und an das Gute im Menschen glauben.
«Das Schloss an der Nebeneingangstür ist tatsächlich manipuliert worden», nuschelte er. «Allerdings mit großem Geschick, es sind kaum Beschädigungen zu erkennen. Das muss ein Profi gemacht haben.»
Priska Wagner ließ die Information auf sich wirken. Kerkmanns Geschmatze und der Anblick des zerstörten Kopfes, sowohl der der Leiche als auch der des Bleistiftes, waren dann aber doch zu viel; sie wandte sich ab und verließ den Schlafraum.
«Sonst noch was?», fragte sie und stieg die Treppe hinunter.
«Der Täter hat Schmutz ins Haus getragen. Sand aus dem Garten, außerdem Grasschnitt, der Rasen wurde wohl gerade erst gemäht. Allerdings nur bis in die Küche, dort hat er die Schuhe ausgezogen und ist auf Socken weitergegangen. Er wird sich dem Haus vom rückwärtigen Grundstück genähert haben. Dort hinten ist es durch den Bewuchs und den kleinen Wald geschützt.»
Das Stichwort kam Priska wie gerufen. Sie steuerte geradewegs die hintere Tür an und trat auf die Terrasse des Einfamilienhauses hinaus. In den vergangenen zwei Tagen hatte es viel geregnet, die Luft war rein, einigermaßen kühl und tat ihr gut. Die Sonne stand um diese Zeit, es war erst kurz nach neun, noch tief am Himmel, ihr Licht fiel in schmalen Lanzen durch das dichte Blätterdach des hundert Meter entfernten Waldes. Von dort schallte ein Vogelkonzert herüber, das kaum zu dem passte, was sich in diesem Haus abgespielt hatte.
Priska ging bis an die Rasenkante vor. Der Garten war groß, und doch gab es keine ungepflegte Stelle. Nirgends spross Unkraut, alles stand in Reih und Glied, die Büsche und Bäume waren akkurat geschnitten. Der Rasen, die Beete, die Wege – alles eingefasst mit Steinen. Priskas Vater hatte auch so einen Garten, mehr Ausstellungsstück als Natur, man erkannte den preußischen Hang zur Pflichterfüllung und Spießigkeit. Priska hatte sich mal erdreistet, es genau so vor ihrem Vater zu formulieren. Danach hatte er ein halbes Jahr nicht mehr mit ihr gesprochen.
Die Leiche oben auf dem Bett war im Alter ihres Vaters oder etwas jünger, also kurz vor der Rente – die sie nun nicht mehr beziehen würde.
«Was wissen wir über das Opfer?», fragte sie ihren artig mitgelaufenen Assistenten. Partner wollte sie ihn noch nicht nennen; das würde noch eine Weile dauern.
«Ulrike Bokelmann, achtundfünfzig, staatlich examinierte Altenpflegerin. In der häuslichen Pflege tätig. Unverheiratet, keine Kinder. Lebte allein hier, es ist ihr Elternhaus. Keine polizeilichen Einträge. Die Nachbarn bezeichnen sie als ruhig, zurückhaltend und freundlich. Nur einer hält sie für eine – ich zitiere – hundsgemeine, halsstarrige Matrone.»
«Na, da haben wir den Täter ja schon.»
«Ich weiß nicht …», das Bleistiftende verschwand wieder in Kermanns Mund, «… der Mann ist knapp achtzig und kann ohne Rollator keinen Schritt gehen.»
«Kerkmann, das war ein Scherz.»
«Ach so!»
Mit Scherzen hatte Kerkmann es nicht so, und es würde wohl noch eine Weile dauern, bis Priska sich darauf eingestellt hatte. Sie scherzte gern, mit Vorliebe sarkastisch, all der Schmerz, das Leid und die Gewalt, das sie sehen mussten, ließen sich damit prima deckeln. Ohne Humor brachte es kein Ermittler weit. Hannes Kerkmann war zu gut für diesen Job. Er würde daran zerbrechen. Früher oder später. Typen wie Kerkmann gehörten nicht in die Welt, in der sie lebte.
«Warum mag der Nachbar Frau Bokelmann nicht?»
«Zu Frau Bokelmanns Aufgaben gehört es, für den kassenärztlichen Dienst die Einschätzung der Pflegestufen vorzunehmen, und Herr Kranz, so heißt der Nachbar, behauptet, sie haben ihm die dritte Pflegestufe verweigert, weil er seinen Kopf noch nicht unter dem Arm trägt. »
«Schau an, Pflegeneid, ein ganz ungewöhnliches Mordmotiv. Hatten wir auch noch nicht.»
Kerkmann rang sich jetzt immerhin ein schiefes Lächeln ab.
«Die Befragung in der Nachbarschaft hat sonst nicht viel ergeben», fuhr er fort. «Niemand hat eine verdächtige oder unbekannte Person gesehen, weder in den letzten Tagen noch in der Nacht zu heute.»
Priska nickte schweigend und ließ ihren Blick schweifen.
Ein einfaches Haus aus den Siebzigern, mitten in einer dichtbebauten Wohnstraße voller neugieriger Nachbarn. Priska war genauso aufgewachsen, sie kannte das Umfeld. Jeder kannte hier jeden, und alles wurde beobachtet. Eigentlich war es gar nicht möglich, hier ungesehen ein Verbrechen zu begehen. Was dem Täter zugutegekommen war, war die Lage der Grundstücke auf dieser Seite der Straße. Sie grenzten an ein schmales Waldstück, das sie von einem Gewerbegebiet trennte.
«Gibt es da drüben nur Gewerbe oder auch Industrie?», fragte Priska.
«Ich … äh, ich weiß es nicht. Warum?»
«Weil in Industriegebieten rund um die Uhr gearbeitet werden darf, während in reinen Gewerbegebieten zum Feierabend die Lichter ausgehen. Der Täter ist sicher von dort gekommen, also schicken Sie ein Team rüber, das sich umhört.»
«Is gebongt.»
Priska schloss kurz die Augen. Wenn Kerkmann noch einmal «Is gebongt» sagte, würde sie ausflippen. Das tat er immer, wenn er Anweisungen erhielt, und es nervte sie ungeheuer.
«Rekapitulieren Sie», sagte Priska.
Kerkmann brauchte eine halbe Minute, bis er so weit war.
«Möglicher Tathergang», begann er so, wie Priska es ihm beigebracht hatte.
«Da der Todeszeitpunkt laut Rechtsmediziner zwischen zweiundzwanzig und vierundzwanzig Uhr liegt, hat sich der Täter im Schutze der Dunkelheit von der rückwärtigen Seite des Grundstückes genähert und seinen Wagen dabei wahrscheinlich im angrenzenden Gewerbe- Schrägstrich Industriegebiet stehen lassen. Er kennt sich mit Schlössern aus, ein Profi, vielleicht aus der Branche der Schlüsselnotdienste. Da nach ersten Erkenntnissen das Haus weder durchsucht wurde noch etwas fehlt, war dies kein Raubmord. Der Täter kam mit dem Vorsatz, das Opfer zu töten. Er überraschte es im Schlaf und erschlug es mit zwei Schlägen mit einem schweren Gegenstand, laut Gerichtsmediziner wahrscheinlich ein Hammer. Das Opfer starb sofort. Der Spurenlage nach zu urteilen, verließ der Täter danach auf kürzestem Weg durch die Hintertür das Haus. Wir haben unbrauchbare Fußspuren und eventuell Haare, doch die können auch von anderen Besuchern des Hauses stammen. Eine Nachbarin sprach von regelmäßigen Kaffeetreffs hier. Bei dem Opfer handelt es sich um die achtundfünfzigjährige Ulrike Bokelmann, Altenpflegerin, alleinstehend, keine Kinder. Wir müssen davon ausgehen, dass der Täter sein Opfer kannte, und zwar gut genug, damit sich aus dieser Bekanntschaft ein gewisser Grad an Hass entwickeln konnte, der für eine solche Tat notwendig ist.»
Priska warf Hannes Kerkmann einen anerkennenden Blick zu.
«Okay, jetzt ich», sagte sie, atmete noch einmal tief durch und begann.
«Er nutzt den Schutz der Dunkelheit und des angrenzenden Waldes, um sich dem Haus zu nähern, er weiß genau, welches Werkzeug er für das billige Schloss an der Hintertür benötigt, und auch, in welchem Raum sein Opfer schläft. Er kennt das Haus also, war früher schon einmal hier. Dafür spricht auch, dass er das Opfer kannte, und er muss es gekannt haben, denn er wusste von seinem leichten Schlaf. Warum sonst sollte er seine Schuhe ausziehen und auf Socken weiterlaufen? Um Sauberkeit wird es ihm nicht gegangen sein. Falls doch, haben wir es mit zwanghaftem Verhalten zu tun. Er kann besonders gut mit dem Hammer umgehen, sonst hätte er statt eines Hammers ein Messer verwendet.»
Nachdem Priska fertig war, schwiegen beide nachdenklich. Dann fragte Priska: «Hatte das Opfer einen Lebenspartner oder Freund?»
Kerkmann konsultierte seinen Notizblock.
«Die direkte Nachbarin, Frau Erika Nietfeld, sagt nein. Nach ihrer Meinung ging Frau Bokelmann in ihrem Beruf auf und wollte nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen nichts mehr von Männern wissen.»
«Aha. Okay. Checken Sie mal, ob sie nicht dennoch auf der Suche nach einem Partner war. Online, auf Tanztreffs oder wie man das eben so macht.»
«Is gebongt.»
Priska verzog das Gesicht, als litte sie Schmerzen.
«Kerkmann …»
«Ja?»
Er sah so eifrig aus wie ein Hund, der darauf wartet, dass man seinen Stock in die Landschaft warf. Enthusiasmus und Neugierde konnte Priska ihm nicht absprechen, ebenso wenig Ehrgeiz und Disziplin. Er war einer dieser Typen, die alles richtig machen wollten und dabei alles verkehrt machten. Die Kollegen reagierten ganz ähnlich auf Kerkmann, Priska hatte die Lästereien über den Neuen bereits im Flurfunk gehört. Kerkmann selbst zum Glück nicht. Menschen wie er, die von ihrem Tun vollends überzeugt waren, brachen schnell zusammen, wenn sie erfuhren, was andere von ihnen hielten. Kerkmann brauchte Zuspruch und Lob, nicht Häme und Spott. Letzteres würde er früh genug erfahren, deshalb vollendete Priska ihren Satz nicht in der Form, wie er ihr auf der Zunge gelegen hatte.
«Wir checken die Datenbanken nach einem ähnlichen Modus Operandi. Auch wenn das hier offensichtlich eine Beziehungstat war, kommt es mir so vor, als hätte der Täter nicht zum ersten Mal gemordet. Diese Zielstrebigkeit, diese Kaltblütigkeit, das passt nicht zu jemandem, der aufgeregt, vielleicht sogar einer Panik nahe ist, wie es bei einem Ersttäter der Fall gewesen wäre.»
«Serie?», fragte Kerkmann und riss die Augenbrauen hoch.
«Ich reiß Ihnen eigenhändig die Zunge raus, wenn Sie dieses Wort noch einmal in den Mund nehmen, Kerkmann. Ist das klar?»
«Is gebongt!»
«Die Aufwachphase lässt sich nicht beschleunigen. Wir müssen abwarten.»
Die Stimme kam von irgendwoher, war aber laut und deutlich.
Thomas Bennett wollte ihr zuschreien, dass er doch längst wach sei, aber seine Kehle war verstopft.
«Erwarten Sie aber bitte nicht zu viel. Fünf Wochen in der Narkose ist eine lange Zeit.»
Wieder die Stimme. Dunkel und sonor, ohne eine Spur von Aufregung. Thomas wollte wissen, zu wem sie gehörte, unbedingt, er riss die Augen weit auf, schloss sie jedoch sofort wieder, denn das ihn umgebende weiße Licht drang wie eine Lanze in seinen Kopf und löste entsetzliche Schmerzen aus.
«Hat er eben gezwinkert?»
Eine weibliche Stimme. Thomas kannte sie, er konnte nur nicht sagen, woher. Bitte, flehte er in Gedanken, bitte sprich weiter, damit ich dich erkennen kann, damit ich dich sehen kann. Ich will hier nicht bleiben.
Etwas zerrte an ihm, an seinen Beinen, wollte ihn zurückreißen in einen dunklen Schlund. Thomas trat aus, aber was immer auch an ihm hing, es wollte nicht nachgeben. Der Schlund kam näher und näher und Thomas flehte die Stimme an, zu sprechen.
«Bitte … sag etwas …»
«Oh mein Gott! Er will sprechen! Holen Sie das Ding aus seinem Hals.»
Da war sie wieder, die vertraute weibliche Stimme, diesmal überschlug sie sich fast, und Thomas streckte seine Arme nach ihr aus, wollte sich an sie klammern, damit sie ihn vor dem Schlund rettete.
«Ich bin hier, mein Schatz, ich bin ja hier.»
Das Gezerre an seinen Beinen ließ nach und verschwand schließlich völlig. Der Schlund sackte unter ihm weg, er hatte das Gefühl, mit hoher Geschwindigkeit aus großer Tiefe aufzusteigen, so als sei er von einem Katapult abgeschossen worden.
Er blinzelte in das helle Licht und sah verschwommen ein Gesicht vor sich, dahinter ein zweites wie eine Maske, mit langem, spitzem Kinn und einer Art Taucherbrille vor den Augen.
«Ich bin hier … jetzt wird alles gut.»
«Versuchen Sie bitte, nicht zu sprechen», sagte die sonore Stimme aus dem Hintergrund, und Thomas begriff, sie gehörte zu der Maske mit dem spitzen Kinn.
«Erkennst du mich, mein Schatz. Ich bin es.»
Plötzlich war die Erinnerung wieder da, und Thomas wusste, wer sich da über ihn beugte, seine Wangen streichelte, seine Hände berührte und mit ihm sprach. Eine große Ruhe überkam ihn, und er sehnte sich danach, die Augen wieder schließen und ewig schlafen zu können.
Irgendwann war die Ewigkeit zu Ende, und Thomas schlug die Augen auf.
Rechts von sich sah er ein Fenster mit Dunkelheit dahinter. Auf der Fensterbank Vasen mit Blumen. Gegenüber an der Wand ein großes gerahmtes Landschaftsbild. Unter dem Bild ein kleiner runder Tisch mit zwei Stühlen daneben. Auf dem Tisch lag ein großes Schlüsselbund, das ihm irgendwie bekannt vorkam. Seine Beine und Füße waren unter einer weißen Decke verborgen, und links von ihm stand ein weiteres Bett, leer, aber mit benutzter Bettwäsche. Zwischen seinem und dem anderen Bett standen medizinische Geräte. Noch weiter links gab es zwei Türen. Wohin sie führten, wusste er nicht. Weil das Bewegen des Kopfes und der Augen Schmerzen verursachte, starrte Thomas geradeaus. Warum befand er sich in einem Krankenhaus?
Denn das war es doch. Ein Krankenhaus. Oder nicht?
Die Stille war beängstigend.
Warum war niemand hier?
Vielleicht sollte er rufen?
Das war keine gute Idee, wie er schnell feststellte. Kein Ton, nicht einmal ein Räuspern verließ seinen Mund, dafür brannte es in seiner Kehle, und die Schmerzen trieben ihm die Tränen in die Augen. Er wollte sie fortwischen und bemerkte die Schläuche und Kabel an seinem Arm.
Plötzlich öffnete sich eine der beiden Türen.
Seine Mutter kam herein, in der Hand einen dampfenden Becher. Sie trug eine blaue Baumwollhose, dazu einen weißen Rollkragenpullover und eine leichte Daunenweste. Leise schloss sie die Tür, drehte sich zu Thomas um und erstarrte. Aber nur einen kurzen Moment, dann fing sie sich, trat zu ihm ans Bett und stellte den Becher ab.
«Versuch nicht zu sprechen, mein Schatz», sagte sie leise und legte ihm eine Hand an die Wange. Sie war ganz warm von dem Becher. «Dein Hals ist entzündet, es würde nur weh tun, wenn du sprichst. Nicken oder den Kopf schütteln muss vorerst reichen. Erkennst du mich?»
Was für eine dumme Frage!
Er befolgte ihren Rat und nickte.
Ihr Gesicht hellte sich auf, und ihre Schultern hoben sich, so als fiele eine schwere Last von ihr ab.
«Und weißt du, was passiert ist?»
Kopfschütteln.
«Du wurdest schwer verletzt und befindest dich in einem Krankenhaus. Aber es geht dir bald wieder besser, und alles wird gut, also mach dir bitte keine Sorgen.»
Seine Mutter drückte auf einen Knopf, der an einem Kabel über dem Bett hing.
«Hast du Schmerzen?», fragte sie.
Thomas nickte und wollte den Arm heben, um auf seinen Kopf und seinen Hals zu deuten, doch seine Mutter hielt ihn davon ab.
«Beweg dich lieber noch nicht. Gleich kommt ein Arzt. Tut dir der Kopf weh?»
Ein stummes Ja.
«Und der Hals?»
Wieder.
Die Tür sprang auf, und eine junge Frau in weißer Kleidung trat ein. Seine Mutter wandte sich zu ihr um.
«Er ist wach und ansprechbar. Würden Sie schnell Dr. Scholz holen?»
Die Schwester verschwand.
«Dr. Scholz hat Nachtdienst auf der Station. Du wirst sehen, er ist sehr sympathisch. Oh Gott, ich bin so froh, dass du wieder bei uns bist.»
Eine Träne rann seiner Mutter über die Wange, gleichzeitig lächelte sie.
«Tut mir leid, ich wollte nicht …»
Die Tür sprang ein weiteres Mal auf.
Ein Mann kam herein. Groß, schlank, mit abstehenden Ohren und rotem Gesicht. Er trug beigefarbene Hosen und ein kariertes blaues Hemd.
«Nein!», schrie Thomas und bekam die Quittung dafür sofort. Seine Kehle stand in Flammen, doch er ignorierte den Schmerz. Wie konnte Mama zulassen, dass dieser Mann das Zimmer betrat! Sie musste doch wissen, wer das war. Der Reiter, es war der Reiter, sein Name war wochenlang durch die Presse gegangen, Angst und Schrecken hatte er verbreitet und fünf junge Mädchen missbraucht. Er hatte ihnen an abgelegenen Reitplätzen aufgelauert, die Pferde erschreckt, sodass sie ihre Reiterinnen abwarfen, und sich anschließend an den verletzten Mädchen vergangen.
Der Reiter erstarrte und blieb an der Tür stehen. Sein langes Gesicht mit den tiefen Falten darin war ein einziges Fragezeichen.
«Geh wieder raus, Charles!», fuhr seine Mutter den Mann an, doch der reagierte nicht.
«Raus mit dir», schrie sie, und endlich verschwand der Reiter.
Thomas zitterte vor Angst.
Seine Mutter hatte dieses Monster geduzt, so als kenne sie es.
Plötzlich hatte er Angst vor ihr und rückte in dem Bett so weit von ihr ab wie möglich.
«Nein, nicht … du musst keine Angst haben, alles ist gut», sagte sie beschwichtigend und streckte die Hand nach ihm aus.
Priska Wagner beendete das Gespräch und legte ihr Handy beiseite.
Nachdenklich starrte sie auf die Wand in ihrem Büro. Dort hing ein billiger Druck, der eine Herde Mustangs in weiter Steppenlandschaft vor einem grandiosen Himmel zeigte. Ein Bild von ursprünglicher Kraft und ohne menschliche Spuren. Deshalb liebte sie es.
Der Kollege Scheurich aus Hamburg, mit dem sie gerade gesprochen hatte, war nicht besonders redselig, vielleicht sogar ein wenig abweisend gewesen. Priska ärgerte sich darüber. Immer noch stieß sie im Alltag auf alte Ressentiments gegenüber Frauen bei der Mordkommission oder auf das nervige Kompetenzgerangel zwischen den Dienststellen und Bundesländern. Manche Dinge waren einfach nicht aus den Köpfen herauszubekommen, im Kleinen wie im Großen nicht. Was auf der ganzen Welt nicht funktionierte, funktionierte eben auch nicht bei der Polizei.
Sie hatte den Kollegen angerufen, weil der einen Fall bearbeitete, bei dem als Tatwerkzeug möglicherweise ein Hammer zum Einsatz gekommen war. Der Fall lag schon ein paar Wochen zurück, war aber noch ungeklärt. Die Tatorte lagen zwar in unterschiedlichen Bundesländern, aber recht nah beieinander. Zwischen Buchholz in der Nordheide, wo Ulrike Bokelmann getötet worden war, und Hamburg-Bergedorf waren es gerade einmal fünfzig Kilometer mit dem Wagen. Weitere Verbindungen zwischen den beiden Fällen schien es nicht zu geben, zumindest wollte der Kollege keine erkennen. Was Priska von ihm über den Hamburger Fall erfahren hatte, stimmte sie selbst auch nicht besonders hoffnungsvoll, dennoch hatte sie Scheurich vorgewarnt, sie würde persönlich bei ihm vorbeischauen. Priska wollte den Weg auf sich nehmen, weil ihr Interesse geweckt war – und vielleicht auch ein wenig, um den Mann zu ärgern. Scheurichs Fall war ungewöhnlich: Ein männliches Opfer war in seiner eigenen Wohnung fast getötet worden, von seiner Lebensgefährtin fehlte seitdem jede Spur. Dagegen war der Mord an Ulrike Bokelmann fast langweilig, wenngleich die Details Fragen aufwarfen, die sich nicht so einfach beantworten ließen.
Eines der Details hatte Priska vor einer Stunde vom Rechtsmediziner Dr. Moskowitz erfahren, der Bokelmanns Leiche untersucht hatte. Moskowitz hatte noch einmal seine schon am Tatort getroffene Vermutung bestätigt, dass die Frau durch Gewalt gegen den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand getötet worden war. Als Tatwerkzeug kam ein Hammer in Betracht, wenngleich sich der Doktor hier nicht sicher war. Durch die große Kraft, mit der die beiden Schläge ausgeführt worden waren, fanden sich an der Schädelwunde selbst keine charakteristischen Spuren eines Hammerkopfes, in der Wunde jedoch hatte der Rechtsmediziner einen Metallsplitter gefunden. Die Analyse des Metalls war bereits in Auftrag gegeben, würde aber noch einige Tage in Anspruch nehmen – wie immer waren die Labore überlastet.