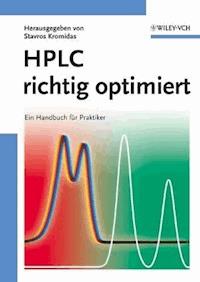
HPLC richtig optimiert E-Book
156,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Neben der Methodenentwicklung ist die Optimierung bestehender Methoden eine zentrale Aufgabe im HPLC-Labor. Eine Aufgabe, die heute in immer kurzerer Zeit und kosteneffizient erledigt werden muss. Das Handbuch bietet eine fundierte Hilfe, um diese Herausforderung noch besser zu meistern.
International renommierte Autoren behandeln sowohl die allgemeinen Grundlagen und Strategien der Optimierung als auch die spezifischen Aspekte der unterschiedlichen Techniken wie RP-HPLC, NP-HPLC, Micro- und Nano-HPLC sowie der Kopplungstechniken wie LC-MS. Auch die richtige Saulenauswahl sowie Enantiomerentrennungen gehoren zu den behandelten Themen. Die Autoren liefern konkrete, praktische Tipps ebenso wie relevante Hintergrundinformationen. Sie bieten daruber hinaus Einblicke in die Optimierungspraxis sieben international renommierter Firmen verschiedener Branchen. Einige Beitrage stellen die Anwendung gangiger Optimierungssoftware wie DryLab oder ChromSword dar. Das ganze wird abgerundet durch praxisnahe Berichte erfahrener Anwender aus den verschiedenen Anwendungsgebieten, inbesondere aus den Life Sciences, wie beispielsweise Proteomics oder Pharmaentwicklung. Alle Beitrage sind in einem auf das Wesentliche konzentrierten und anwendungsnahen Stil geschrieben. Der Aufbau des Buches mit abgeschlossenen Kapiteln erleichtert das gezielte Nachschlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 906
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
Autorenverzeichnis
Zum Aufbau des Buches
1 Grundsätzliches zur Optimierung
1.1 Grundsätze der Optimierung in der HPLC am Beispiel der RP-Chromatographie
1.2 Schnelle Gradienten
1.3 Selektivitätsänderung in der RP-HPLC mithilfe des pH-Wertes
1.4 Auswahl des richtigen pH-Wertes in der HPLC
1.5 Optimierung der Auswertung in der Chromatographie
1.6 Gütekennwerte der Kalibration und Messunsicherheit als Indikatoren für Optimierungspotenzial
2 Die Charakteristika der Optimierung in einzelnen HPLC-Modi
2.1 RP-HPLC
2.2 Optimierung in der Normalphasen-Chromatographie
2.3 Optimierung von GPC-Analysen durch geeignete Wahl von stationärer Phase und Detektionsverfahren
2.4 Gelfiltration – Größenausschluss-Chromatographie von Biopolymeren –Optimierungsstrategien und Fehlersuche
2.5 Optimierung in der Affinitätschromatographie
2.6 Optimierung von Enantiomerentrennungen in der HPLC*
2.7 Miniaturisierung
3 Kopplungstechniken
3.1 Immunchromatographische Kopplungen
3.2 Erweiterte Charakterisierungs- und Analysemöglichkeiten durch 2-dimensionale Chromatographie
3.3 LC-MS – Hinweise zur Optimierung und Fehlersuche
3.4 LC-NMR-Kopplung
4 Computer-unterstützte Optimierung
4.1 Computer-unterstützte HPLC-Methodenentwicklung mit der DryLab®-Software
4.2 ChromSword®-Software für die automatische und Computerunterstützte HPLC-Methodenentwicklung
4.3 Multifaktorielle systematische Methodenentwicklung und -optimierung in der Umkehrphasen-HPLC
5 „Anwender berichten“
5.1 Nano-LC-MS/MS in der Proteomforschung
5.2 Wege zur Überprüfung der Robustheit in der RP-HPLC
5.3 Trennung komplexer Proben
5.4 Evaluierung eines integrierten Verfahrens zur Charakterisierung von Chemikalienbibliotheken auf der Basis von HPLC-UV/MS/CLND
Anhang
Stichwortverzeichnis
Weitere interessante Titel zur HPLC
V. R. Meyer
Fallstricke und Fehlerquellen der HPLC in Bildern
2006
ISBN 3-527-31268-4
V. R. Meyer
Praxis der Hochleistungs-Flüssigchromatographie
2004
ISBN 3-527-30726-5
S. Kromidas
More Practical Problem Solving in HPLC
2004
ISBN 3-527-31113-0
J. Weiß
Ionenchromatographie
2001
ISBN 3-527-28702-7
S. Kromidas
Practical Problem Solving in HPLC
2000
ISBN 3-527-29842-8
Herausgeber
Dr. Stavros Kromidas
Rosenstraße 16
66125 Saarbrücken
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527314706
Epdf ISBN 978-3-527-62353-2
Epub ISBN 978-3-527-66035-3
Mobi ISBN 978-3-527-66034-6
Vorwort
Das Optimieren von Verhaltensweisen und Prozessen stellt eine notwendige Voraussetzung für langfristigen Erfolg dar. Das Ziel und die Beweggründe können dabei recht unterschiedlich sein: Selbsterhaltung bei Lebewesen, „Leben retten“ beim Helfer in Afrika, Gewinnmaximierung beim Marketing-Strategen oder neue Erkenntnisse beim Wissenschaftler. Dieses Prinzip gilt natürlich auch in der Chemie und in der Analytik.
Das vorliegende Buch behandelt ausschließlich das Thema „Optimierung“ in der HPLC. Es wird versucht, diesen wichtigen Aspekt der HPLC auf vielfältige Art und Weise zu beleuchten. Zum einen haben wir uns mit grundsätzlichen Fragen und mit prinzipiellen Überlegungen und Hintergründen auseinander gesetzt. Im gleichen Maße haben wir uns bemüht, möglichst viele Praxisbeispiele, Anregungen und Vorschläge für den HPLC-Alltag vorzustellen und zu diskutieren. Die Ausführungen sollen beim Planen effektiver Strategien zur Methodenentwicklung ebenso unterstützen und helfen wie in der täglichen Praxis vor Ort, wenn es um Konzepte für eine schnelle Optimierung geht. Das Ziel des Buches ist, einen Beitrag für eine zweckgerichtete, bezahlbare Vorgehensweise bei Methodenentwicklung und Optimierung in der HPLC zu leisten.
Dazu haben international renommierte Fachleute ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Diesen Kollegen gilt mein herzlicher Dank. Dem Verlag WILEY-VCH und insbesondere Steffen Pauly danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit und Kooperationsbereitschaft.
Saarbrücken, Januar 2006
Stavros Kromidas
Autorenverzeichnis
Klaus Albert
Institut für Organische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 18
72076 Tübingen
Bonnie A. Alden
Waters Corporation, CRD
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Mario Arangio
CarboGen AG
Schachenallee 29
5001 Aarau
Schweiz
Wolf-Dieter Beinert
VWR International GmbH
Scientific Instruments
Hilpertstraße 20A
64295 Darmstadt
Roberto Biancardi
Solvay Solexis SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)
Italien
Hans Bilke
Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10
6250 Kundl
Österreich
Yung-Fong Cheng
Cubist Pharmaceuticals
65 Hayden Ave.
Lexington, MA 02421
USA
Maristella Colombo
Oncology – Analytical Chemistry
Nerviano Medical Sciences
Viale le Pasteur, 10
20014 Nerviano (MI)
Italien
Diane M. Diehl
Waters Corporation, CAT
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
John W. Dolan
BASi Northwest Laboratory
3138 NE Rivergate
Building 301C
McMinnville, OR 97128
USA
Melvin R. Euerby
AstraZeneca R&D Charnwood
Analytical Development,
Pharmaceutical and Analytical R&D
Charnwood/Lund
Bakewell Road
Loughborough, Leicestershire,
LE11 5RH
United Kingdom
Sergey Galushko
Dr. S. Galushko Software
Entwicklung
Im Wiesengrund 49b
64367 Mühltal
Eric S. Grumbach
Waters Corporation, CAT
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Marc D. Grynbaum
Institut für Organische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 18
72076 Tübingen
Heidi Händel
Institut für Organische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 18
72076 Tübingen
Tom Hennessy
Biopolis
Biomedical Science Group
20 Biopolis way
Singapore 1 38668
Singapur
Pamela C. Iraneta
Waters Corporation, CRD
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Markus Juza
Chiral Technologies Europe
Parc d’Innovation
Boulevard Gonthier d’Andernach
BP 80140
67404 Illkirch Cedex
Frankreich
Marianna Kele
Waters Corporation, CRD
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Peter Kilz
PSS Polymer Standards Service
GmbH
Postfach 3368
55023 Mainz
Stavros Kromidas
Rosenstraße 16
66125 Saarbrücken
Manfred Krucker
Institut für Organische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 18
72076 Tübingen
Hans-Joachim Kuss
Psychiatrische Klinik der
Ludwig-Maximilians-Universität
Nussbaumstraße 7
80336 München
Jörg P. Kutter
MIC – Department of Micro and
Nanotechnology
Technical University of Denmark
2800 Lyngby
Dänemark
Christiane Lohaus
Medizinisches Proteom-Center
Zentrum für Klinische Forschung
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150
44780 Bochum
Ziling Lu
Waters Corporation, CAT
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Egidijus Machtejevas
Institut für Anorganische Chemie
und Analytische Chemie
Johannes Gutenberg-Universität
Duesbergweg 10–14
55099 Mainz
Jürgen Maier-Rosenkranz
GRACE Davison –
Alltech Grom GmbH
Discovery Sciences
Etzwiesenstraße 37
72108 Rottenburg-Hailfingen
Friedrich Mandel
Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Straße 8
76337 Waldbronn
Katia Marcucci
Sienabiotech S.p.A.
Via Fiorentina, 1
53100 Siena
Italien
Katrin Marcus
Medizinisches Proteom-Center
Zentrum für Klinische Forschung
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150
44780 Bochum
Jeffrey R. Mazzeo
Waters Corporation, CAT
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Michael McBrien
Advanced Chemistry Development, Inc.
110 Yonge Street, 14th Floor
Toronto, Ontario
Canada M5C 1T4
Alberto Méndez
Waters Cromatografia S.A.
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Spanien
Helmut E. Meyer
Medizinisches Proteom-Center
Zentrum für Klinische Forschung
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150
44780 Bochum
Veronika R. Meyer
EMPA St. Gallen
Materials Science and Technology
Lerchenfeldstraße 5
9014 St. Gallen
Schweiz
Egbert Müller
Tosoh Bioscience GmbH
Zettachring 6
70567 Stuttgart
Uwe D. Neue
Waters Corporation, CRD
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Patrik Petersson
AstraZeneca R&D Lund
Analytical Development
Pharmaceutical and Analytical R&D
Charnwood/Lund
Lund 22187
Schweden
Michael Pfeffer
Schering AG
In-Process-Control
13342 Berlin
Karsten Putzbach
Institut für Organische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 18
72076 Tübingen
Oleg Pylypchenko
Institute of Bioorganic Chemistry of
Ukrainian National Academy of
Sciences
Murmanskaja str., 1
02660 Kiev-94, MCP-600
Ukraine
Milena Quaglia
LGC
Analytical Technology
Queens Road
Teddington, Middlesex, TW11 OLY
United Kingdom
Giuseppe Razzano
Via D. Manin,18
Magenta (Cap. 20013)
Milano
Italien
Vincenzo Rizzo
CISI – University of Milan
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Italien
Heike Schäfer
Medizinisches Proteom-Center
Zentrum für Klinische Forschung
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150
44780 Bochum
Stefan Schömer
pro-isomehr
Altenkesseler Straße 17
66115 Saarbrücken
Irina Shishkina
Institute of Bioorganic Chemistry of
Ukrainian National Academy of
Sciences
Murmanskaja str., 1
02660 Kiev-94, MCP-600
Ukraine
Dirk Sievers
Waters GmbH
Hauptstraße 87
65760 Eschborn
Federico R. Sirtori
Nerviano Medical Sciences
Oncology – Analytical Chemistry
Viale Pasteur 10
20014 Nerviano (MI)
Italien
Urban Skogsberg
Cambrex Karlskoga AB
R&D Analysis
69185 Karlskoga
Schweden
Lloyd R. Snyder
LC Resources Inc.
26 Silverwood Ct.
Orinda, CA 94563
USA
Frank Steiner
Dionex Softron GmbH
Dornierstraße 4
82110 Germering
Cinzia Stella
Imperial College
Biological Chemistry Department
Biomedical Sciences Division
Sir Alexander Fleming Building
London, SW7 2AZ
United Kingdom
Vsevolod Tanchuk
Institute of Bioorganic Chemistry of
Ukrainian National Academy of
Sciences
Murmanskaja str., 1
02660 Kiev-94, MCP-600
Ukraine
KimVan Tran
Waters Corporation, CAT
34 Maple Street
Milford, MA 01757
USA
Klaus K. Unger
Institut für Anorganische Chemie
und Analytische Chemie
Johannes Gutenberg-Universität
Duesbergweg 10–14
55099 Mainz
Jean-Luc Veuthey
Faculty of Sciences
School of Pharmaceutical Sciences
University of Geneva
20, Bd d’Yvoy
1211 Genève 4
Schweiz
Knut Wagner
Pharma Analytical Laboratory
Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Michael G. Weller
Institut für Wasserchemie und
Chemische Balneologie
Technische Universität München
Marchioninistraße 17
81377 München
Norbert Welsch
Institut für Organische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 18
72076 Tübingen
Loren Wrisley
Analytical and Quality Sciences
Wyeth Research
401 N. Middletown Road
Pearl River, NY 10965
USA
Zum Aufbau des Buches
Das Buch besteht aus fünf Teilen.
Teil 1: Grundsätzliches zur Optimierung in der HPLC
Im Teil 1 wird versucht, wichtige Aspekte der Optimierung in der HPLC aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Im ersten Kapitel (1.1 Stavros Kromidas) werden die Grundsätze der Optimierung am Beispiel der RP-HPLC dargestellt und Vorschläge zur Methodenentwicklung gemacht. Schnelle Gradienten an kurzen Säulen führen häufiger als man zunächst annehmen würde zu ausreichender Auflösung bei kürzesten Analysenzeiten, diese Thematik wird in Kapitel 1.2 diskutiert (Uwe D. Neue). Der pH-Wert ist bei der Trennung von polaren/ionischen Substanzen mit Abstand der wichtigste Faktor im Optimierungsgeschehen. Diesem Aspekt sind die zwei nachfolgenden Kapitel gewidmet (1.3 Uwe D. Neue, 1.4 Michael McBrien). Optimierung bedeutet mehr als lediglich die „richtige“ Wahl von Methodenparametern. Zur Optimierung gehören alle Bemühungen, möglichst die maximale – oder vielleicht die notwendige – Information zu gewinnen. So kommen der Auswertung von chromatographischen Daten und der Kalibrierung eine gewichtige Bedeutung zu. Diese Themen werden in Kapitel 1.5 (Hans-Joachim Kuss) und 1.6 (Stefan Schömer) behandelt.
Teil 2: Die Charakteristika der Optimierung in einzelnen HPLC-Modi
Im Teil 2 wird auf die Spezifika der Optimierung in einzelnen Techniken eingegangen. In der RP-Chromatographie (Abschnitt 2.1) stellt neben der Auswahl des Eluenten (s. dazu auch Kapitel 1.1 bis 1.4) vor allem die Säulenauswahl eine schwierige und zeitraubende Aufgabe dar. Das Thema „RP-Säule“ wird von insgesamt sechs Autoren bearbeitet: Zwei Autoren (2.1.1 Stavros Kromidas, 2.1.2 Uwe D. Neue) gehen eher praktisch an diese Aufgabenstellung heran, während Frank Steiner (2.1.5) und Lloyd R. Snyder (2.1.6) zur Frage „Säulencharakterisierung“ und „Säulenauswahl“ grundsätzliche, theoretische Überlegungen – jedoch mit konkreter, praktischer Relevanz – vorstellen. Mit der Anzahl von experimentellen Daten nimmt naturgemäß die Aussagekraft zu, wobei das Handling der Zahlen und vor allem das Finden und Deuten von Korrelationen nur mit mathematischen Tools möglich ist. Chemometrie ist ein geeignetes Tool, um beispielsweise die Ähnlichkeit von Säulen anhand chromatographischer Daten herauszufinden. Die Anwendung der Chemometrie aus praktischer Sicht wird kurz in Kapitel 2.1.1 (Stavros Kromidas) und ausführlich in Kapitel 2.1.3 (Melvin R. Euerby) und 2.1.4 (Cinzia Stella) dargestellt. Zum Abschluss des Abschnittes „RP-HPLC“ zeigt Urban Skogsberg (2.1.7), wie durch Magic-Angle-Spinning-NMR-Spektroskopie genaue Informationen über die Wechselwirkungen und die Anordnung von funktionellen Gruppen an RP-Oberflächen erhalten werden können. Anschließend geht es um die Optimierung, aber auch um die Fehlersuche und die Fehlervermeidung in folgenden Bereichen der HPLC: Normal Phase (2.2 Veronika R. Meyer), GPC (2.3 Peter Kilz), Gelfiltration (2.4 Klaus K. Unger), Affinitätschromatographie (2.5 Egbert Müller) und Enantiomerentrennung (2.6 Markus Juza). Drei unterschiedliche Ansätze wurden gewählt, um sich mit dem Thema Miniaturisierung auseinander zu setzen: Jürgen Maier-Rosenkranz beschäftigt sich in Kapitel 2.7.1 mit der Micro/Nano-LC, in Kapitel 2.7.2 stellt Jörg P. Kutter Flüssig(chromatographische)-Trennungen auf Chips vor und in Kapitel 2.7.3 beschreibt Uwe D. Neue die Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Variante der klassischen HPLC, der UPLC. Mit allen drei Techniken ist eine bemerkenswerte Zeitersparnis möglich – es werden allerdings auch Limitierungen und Schwierigkeiten genannt.
Teil 3: Kopplungstechniken
Teil 3 ist ausschließlich den Kopplungen vorbehalten. Je anspruchsvoller die analytische Fragestellung in der Separationstechnik ist (Komplexität und Anzahl der Probenkomponenten, große chemische Ähnlichkeit der zu trennenden Analyte usw.), umso notwendiger erscheinen Kopplungstechniken. Dabei führen zum einen Kopplungen zwischen verschiedenen Trenntechniken zu einer Verbesserung der chromatographischen Auflösung wie z. B. Immunochromatographie (3.1 Michael G. Weller) und LC-GPC-Kopplung (3.2 Peter Kilz). Zum anderen führt bei einer gegebenen Auflösung die Kopplung LC-Spektroskopie zu einer spezifisch(er)en Aussage. Die populärsten Kopplungstechniken sind LC-MS (3.3 Friedrich Mandel) und LC-NMR (3.4 Klaus Albert).
Teil 4: Computer-unterstützte Optimierung
Automatisierung kann generell zur Fehlervermeidung und Zeitersparnis führen. Die vollautomatische bzw. halbautomatische, Computer-unterstützte Methodenentwicklung und Optimierung in der HPLC hat in der Zwischenzeit einen beachtlichen Reifegrad erreicht. Anhand mehrerer realer Beispiele legt Lloyd R. Snyder (4.1) die Möglichkeiten der DryLab- und Sergey Galushko (4.2) die der ChromSword-Software dar. Michael Pfeffer (4.3) vergleicht die zwei Software- Konzepte aus Anwendersicht und präsentiert ein neues Software-Tool, in dem auch die automatische Säulenauswahl integriert ist.
Teil 5: „Anwender berichten“
Im letzten Teil kommen Anwender zu Wort. In vier unterschiedlichen Fällen werden zwar anspruchsvolle und/oder neue Techniken/Konzepte zur Lösung einer bestimmten Fragestellung vorgestellt – diese jedoch eben aus Anwendersicht und praxisnah. Der eine oder andere Lösungsansatz könnte für manche(n)
Leser(in) eventuell interessant sein. Katrin Marcus (5.1) stellt die Praxis der LCMS/MS-Kopplung in der Proteomforschung vor, Hans Bilke (5.2) zeigt Wege zur Überprüfung der Robustheit in der RP-LC auf, Knut Wagner (5.3) beschreibt eine Hardware-Lösung zur Trennung komplexer Gemische und Mario Arangio (5.4) geht auf die Möglichkeit der Multidetektion (UV, MS, CLND) zur Charakterisierung neu synthetisierter Substanzen ein.
Die fünf Teile stellen thematische Einheiten dar, dennoch muss das Buch nicht unbedingt linear gelesen werden. Dazu wurden die einzelnen Kapitel so verfasst, dass sie abgeschlossene Module darstellen, ein „Springen“ ist jederzeit möglich. Damit haben wir versucht, dem Charakter des Buches als Nachschlagwerk gerecht zu werden. Unterschiedliche Auffassungen der Autoren zu einem Thema wurden akzeptiert, auch wurde manche Wiederholung in Kauf genommen, um die Harmonie im textlichen Kontext nicht zu beeinträchtigen. Schließlich werden einige wichtige Inhalte von mehreren Autoren behandelt, die naturgemäß unterschiedliche Akzente setzen. So beispielsweise „pH-Wert“ (Uwe D. Neue, Michael McBrien), „gewichtete Regression“ (Hans-Joachim Kuss, Stefan Schömer), „Selektivität von stationären RP-Phasen“ (Stavros Kromidas, Uwe D. Neue, Melvin R. Euerby, Cinzia Stella, Lloyd R. Snyder), „Chemometrie“ (Stavros Kromidas, Melvin R. Euerby, Cinzia Stella) oder „LC-MS“ (Friedrich Mandel, Katrin Marcus). Der Leser möge von der unterschiedlichen Darstellung des Themas und von der individuellen Gewichtung der Autoren profitieren.
1
Grundsätzliches zur Optimierung
1.1 Grundsätze der Optimierung in der HPLC am Beispiel der RP-Chromatographie
Stavros Kromidas
Zunächst werden einige Fragen diskutiert, die sinnvollerweise zu Beginn einer Methodenentwicklung zu klären sind. Anschließend wenden wir uns den prinzipiellen Möglichkeiten zur Verbesserung der Auflösung in der HPLC zu. Es folgt eine Diskussion über Effizienz und Abfolge der einzelnen Maßnahmen für den isokratischen und den Gradienten-Modus. Ein Schwerpunktthema der Ausführungen bilden Strategien und Konzepte zur Methodenentwicklung und Überprüfung der Peakhomogenität. Schließlich werden Wege zur Verfolgung weiterer Ziele als „besser trennen“ aufgezeigt: „schneller trennen“, „empfindlicher messen“, „Geld sparen“. Das Kapitel wird mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick beendet.
1.1.1 Vor den ersten Optimierungsschritten
Es ist aus Gründen der Ökonomie sinnvoll, sich zu Beginn einer Methodenentwicklung/Trennungsoptimierung als erste Aktion mit folgenden Fragen zu befassen:
Was will ich?
Also: Was ist das eigentliche Ziel meiner Trennung?
Was habe ich?
Also: Über welche analytisch relevante Informationen bzgl. der Probe verfüge ich?
Wie mache ich
es? Also: Steht das, was ich bräuchte, zur Verfügung und ist das, was ich vorhabe, auch tatsächlich realisierbar?
Auch wenn auf den ersten Blick diese Fragen etwas (zu) theoretisch oder gar abgehoben erscheinen mögen, halte ich es für notwendig, zu Beginn eines Projekts die analytische Fragestellung und die realistischen Möglichkeiten zu deren Bewältigung bewusst wahrzunehmen. Ein frühes Gespräch mit meinem Chef, meinem Kollegen, meinem Kunden oder zur Not mit mir selbst kann späteren Ärger, Zeitvergeudung und letztendlich Kosten ersparen. Diese Zeit kann als eine sichere Investition angesehen werden.
Zur ersten Frage: Was will ich?
Wenn irgend möglich, sollten vor dem Start folgende oder ähnliche Fragen beantwortet werden:
Brauche ich eine Methode, um
diesen
hochtoxischen Metaboliten auf jeden Fall zu quantifizieren, oder verfolge ich das Ziel, dass die Behörde meine Methode akzeptiert?
Was ist im vorliegenden Fall wichtig: Schnelle Analysenzeiten, langlebige Säulen, robuste Bedingungen, oder steht im Vordergrund eine höchstmögliche Spezifität ohne Wenn und Aber?
Warum darf der
VK
(
VK:
Variationskoeffizient) höchstens 2 % betragen? Um wie viel schlechter wird unser Produkt, wenn sich ein
VK
von 2,5 % ergeben würde? Gehen die Analysenkosten tatsächlich mit der Qualität des Produkts einher?
Es handelt sich, vereinfacht formuliert, um folgende Frage: Geht es im konkreten Fall um die Erfüllung von Anforderungen, oder geht es tatsächlich um „Wahrheit“, d. h., stehen formale Aspekte oder die analytische Fragestellung im Vordergrund? Diese Frage sollte wegen möglicher Konsequenzen bewusst und ehrlich beantwortet werden. Wie schwer es in unserer Zeit ist, zu sinnvollen und durchdachten Entscheidungen zu stehen, ohne als Exot oder gar als Querulant zu gelten, wurde an anderer Stelle beschrieben [1].
Wenn (!) das Umfeld es ermöglicht, sollte man sich darin üben, alles zu hinterfragen. Unkonventionelle Fragen führen häufig zu einfachen, vernünftigen Lösungswegen.
Zur zweiten Frage: Was habe ich?
Informationen über die Probe erleichtern die Entwicklung eines geeigneten Methodendesigns, z. B.:
Was steht im Bericht der Kollegen aus der chemischen Entwicklung über Lichtempfindlichkeit und Sorptionsverhalten des neuen Wirkstoffs gegenüber Glasoberflächen? Kann ich schnell dort anrufen? Das heißt, komme ich mit einem vertretbaren Aufwand an relevante Informationen heran?
Stehen in der internen Datenbank (die bedauerlicherweise selten gepflegt und noch seltener in Anspruch genommen wird) nicht doch Informationen über ähnliche Trennungen aus der Vergangenheit, die seinerzeit nicht weiterverfolgt wurden?
Ich kann doch schnell über die bekannte Struktur der Hauptkomponente ihren p
K
s
-Wert ausrechnen und so beim geeigneten pH-Wert die ersten Versuche starten (s. Kap. 1.4). Die entsprechende Software hatten wir doch vor kurzem gekauft, oder wie war es? Wie sind die Erfahrungen des Kollegen Miller aus der Nachbarabteilung, der früher mit ähnlichen Substanzen zu tun hatte?
Wenn die Widerstände nicht allzu groß sind, sollte man das Mittel der Kommunikation und des Austauschs nutzen – wenn es sein muss, ohne darüber zu sprechen.
Zur dritten Frage: Wie mache ich es?
Man sollte die Machbarkeit eines Vorhabens unbedingt realistisch abschätzen, mögen sonstige Fakten und Argumente objektiv auch noch so „richtig“ sein, z. B.:
Kann ich meinen Abteilungsleiter davon überzeugen, dass es aus Gesamt-Firmensicht sinnvoll wäre, im Vorfeld (!) mit den späteren Routineanwendern über Methodendesign und weitere Details der Methode zu sprechen? Wenn allerdings Angst um Know-How-Verlust oder Budgetfragen oder sonstige psychosoziale Barrieren ein Gespräch mit den „anderen“ de facto unmöglich machen, ist dies eine bittere, aber eine zu akzeptierende Realität. Oder: Ist es sinnvoll, um eine Änderung folgender allgemein bekannter und akzeptierter Situation zu kämpfen?: Ein Termin ist vorgegeben, also ist die Validierung in zwei Wochen durchzuziehen. Die späteren (immensen) Folgekosten durch Wiederholmessungen, Reklamationen usw., die unweigerlich dadurch entstehen, dass kaum eine analytische Methode unter realen Bedingungen in zwei Wochen zu validieren ist, belasten ja nicht „uns“, sondern die Qualitätskontrolle. Als Prüfkosten gehen sie unter und werden mangels nüchterner, ganzheitlicher Betrachtung sowieso seit Jahrzehnten in Kauf genommen. Die Konsequenzen, oder positiv formuliert, das Verbesserungspotenzial möge der Leser sich selbst ausmalen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























