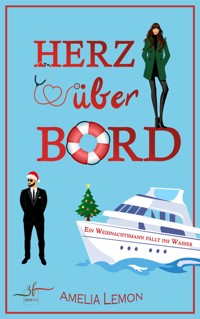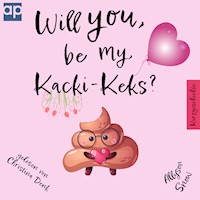4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Überraschungen, Weihnachtschaos und … Kuscheln?
Connor Bennett, Anwalt in Manhattan und beruflich stets auf der Überholspur, hat keine Zeit für Entschuldigungen. Das bekommt auch eine ahnungslose Fahrradfahrerin zu spüren, die er versehentlich anfährt. Statt Mitgefühl gibt er der verdutzten Frau seine Visitenkarte und rast weiter. Was er nicht ahnt: Diese Frau ist Rachel, Kuscheltherapeutin und die Person, bei der seine Mutter ihm einen Entspannungstermin gebucht hat.
Beim nächsten Aufeinandertreffen knistert es nicht nur vor Wut, sondern auch vor Spannung. Während Connors Leben durch Familiengeheimnisse ins Chaos stürzt, bringt Rachel unerwartet Ruhe in seinen hektischen Alltag. Doch kann ein Workaholic wie Connor wirklich loslassen – und sich der Liebe öffnen?
Eine Liebeskomödie über die Magie der Zweisamkeit und die Kunst der Entspannung inmitten der hektischsten Jahreszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
hug me, mr. grinch
AMELIA LEMON
Verlag:
Zeilenfluss Verlagsgesellschaft mbH
Werinherstr. 3
81541 München
_____________________
Texte: Amelia Lemon
Satz: Zeilenfluss
Cover: Zeilenfluss
Korrektorat:
TE Language Services – Tanja Eggerth,
Nadine Löhle - Goldfeder Texte
_____________________
Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung oder Vervielfältigung dieses Buches – auch auszugsweise – sowie die Übersetzung dieses Werkes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Handlungen und Personen im Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
_____________________
ISBN: 978-3-96714-490-1
eins
STÜRMISCHE TAKTIKEN
Es gab nur weniges, das Connor mehr hasste als die Notwendigkeit, die Autoheizung anzuschalten, damit man nicht als Eiszapfen im Büro ankam.
Egal, welches Gebläse er runterdrehte oder in eine andere Richtung pusten ließ, Connor hatte das Gefühl, dass ihm die warme Luft trotzdem unangenehm in die Augen fuhr.
Die Sonne schaffte es nicht durch die Wolken, und die New Yorker Straßen waren überfroren, obwohl sich in der Rushhour bereits tausende Fahrzeuge über die Fahrbahnen geschoben hatten. Die Autos krochen im Schneckentempo voran. Connor war seit einer halben Stunde unterwegs und hatte nicht mal die Hälfte seines Arbeitsweges hinter sich gebracht. Normalerweise brauchte er für die Route zwanzig Minuten.
Erneut stoppten die Autos vor ihm, und Connor trat frustriert auf die Bremse.
Die Wetterexperten warnten seit drei Tagen vor einem Schneesturm und einer Kaltfront. Der Schneesturm ließ auf sich warten, aber die Kaltfront hielt sich umso hartnäckiger. Im Moment herrschten hier lauschige fünf Grad Fahrenheit. Jeder vernünftige Mensch blieb also drinnen – oder nahm das Auto.
Das hielt aber einen offensichtlich betrunkenen Weihnachtsmann nicht davon ab, mit nacktem Hintern kopfüber in einer Mülltonne zu hängen. Ein Streifenwagen, der einfach den breiten Gehweg entlangfuhr, stoppte neben der Mülltonne, und zwei Polizisten stiegen aus. Sie machten ein Foto vom entblößten Hinterteil, ehe sie die reglose Gestalt im Santa-Kostüm herauszerrten. Sowas gab es nur in New York.
Es gab außerdem jene unverwüstliche Spezies der New Yorker, die bei diesem Wetter tatsächlich mit dem Fahrrad fuhr. So dick eingepackt, dass sie nicht mal den Kopf zu drehen vermochten, um nachzusehen, ob sie gefahrlos abbiegen konnten. Als ob es ihr gottgegebenes Recht wäre, dass alle anderen auswichen.
Als ein solches Exemplar an ihm vorbeiradelte und mit dem Lenker den Seitenspiegel seines Autos streifte, merkte Connor, wie es in seinen Gelenken kribbelte. Es zog sich über seine Haut, bis hinauf in seinen Kopf und hinter seine Stirn. Er atmete tief ein und konzentrierte sich auf die Ampel. Er betrachtete die Wolkenkratzer, die wie graue Riesen vor einem noch graueren Himmel thronten und die Fröhlichkeit eines Weltuntergangs ausstrahlten. Die einzigen Farbtupfer bildeten die riesigen Werbeplakate. Halbnackte Frauen warben für Parfüm und Unterwäsche. Männer trugen die neueste Wintermode: Rollkragenpullover, dünner Wollmantel und Lederhandschuhe. Ein Schneeanzug, den man sich bis zur Nasenspitze hoch zuzog, wäre realistischer gewesen.
Keiner seiner Gedanken konnte das Kribbeln beruhigen, im Gegenteil. Es wurde stärker und Connor unruhiger. Ein Fahrradfahrer, der viel zu eng an Connors Auto vorbeifuhr, reichte aus, damit er sich so gestresst fühlte wie nach einem zwölfstündigen Arbeitstag vor Gericht.
Er brauchte unbedingt Kaffee.
Viel Kaffee.
Zwei Liter mindestens.
Vielleicht brauchte er auch ein neues Leben.
In Ermangelung eines Flugtickets und weil er bis zum Flughafen bei dem Wetter vier Stunden gebraucht hätte, fing er erst mal mit dem Kaffee an.
Doch der wartete wie jeden Morgen in seinem Büro, und von jenem trennten ihn noch zwölf Kreuzungen. Zwölf Kreuzungen, deren Ampeln garantiert genauso auf Rot stehen würden wie die der sechs Kreuzungen zuvor. Selbst zu Fuß wäre er schneller gewesen. Aber falls er es noch nicht erwähnt hatte: Es war eben verdammt kalt draußen.
Vor Connor kam wieder Bewegung in die Autos, und er gab Gas. Nun ja, bis zur nächsten Ampel. Das waren … keine Ahnung … fünfzig Meter gewesen?
Seine Uhr zeigte 7:10 Uhr. Er konnte zwar kommen und gehen, wie er wollte, schließlich war er einer der Geschäftsführer und saß generell bis kurz nach Mitternacht im Büro, aber an jedem anderen Tag war er pünktlich um sieben Uhr da. Nur heute nicht. Weil Petrus anscheinend die Weltkarte nicht lesen konnte und in New York das Wetter für die Arktis vorbeigeschickt hatte.
Die Ampel sprang auf Grün, Connor hätte es noch in dieser Grünphase über die Kreuzung schaffen können, wenn die sich vor ihm mal getraut hätten, ihr verflixtes Gaspedal zu benutzen. Die Ampel schaltete auf Gelb. Die zwei Fahrzeuge vor ihm hielten noch nicht an, sondern fuhren über die Kreuzung. Es war bereits gelb, als er endlich dran war. Connor sah schnell auf die Autos links und rechts und drückte das Gaspedal durch.
Aber verflucht noch eins! Vor seiner Motorhaube schoss ein Fahrradfahrer vorbei. Connor hörte das Poltern, als beides zusammenstieß.
Prächtig. Wirklich wunderbar!
Connor stieg auf die Bremse und stemmte sich hinter seinem Lenkrad hoch. Das Fahrrad lag auf dem Fußgängerüberweg, dessen Besitzer konnte er nicht sehen. Connor schaltete die Warnblinkanlage ein, und beinahe hätten ihm die Autos auf der Abbiegespur die Tür abgefahren, weil er sie unvermittelt aufstieß.
Wütendes Hupen schallte ihm entgegen, sie wichen aus, und er schlug schnell die Tür zu. In der Zwischenzeit hatte sich der Biker aufgerappelt, stützte sich auf seiner Motorhaube ab und blies die Backen auf. Oder Connor sollte wohl eher sagen: die Bikerin. Kräftiges, dunkles Haar quoll unter ihrer roten Bommelmütze hervor. Sie taumelte zur Seite, und da kam schon der nächste Fahrradfahrer angerauscht. Connor sprang vor und riss sie am Arm zurück, damit sie den nicht auch noch demolierte.
Sie fuhr zu ihm herum, ihre Knie knickten ein, und sie klammerte sich haltsuchend an Connors Jacke fest. Die Nase auf der Höhe seines Gürtels.
»Hu«, machte sie überrascht.
»Wenn Sie schon unvermittelt über die Fußgängerampel rauschen, sollten Sie wenigstens nachsehen, ob nicht doch noch ein Auto angefahren kommt.« Er konnte sich diesen Satz wahrlich nicht verkneifen. Connor packte sie unter den Armen und zog sie auf die Füße. »Können Sie stehen?«
»Solange Sie mich festhalten.«
»Ich sollte meine Frage präzisieren: Geht es Ihnen so weit gut, dass Sie allein stehen können?«
»Fragen Sie doch einfach, ob ich verletzt bin«, schlug sie vor. »Wie jeder normale Mensch in dieser Situation.«
Anscheinend hatte sie sich den Kopf gestoßen. Sie blinzelte ohnehin, als hätte sie Schwierigkeiten, alles zu erfassen. Mist, verflixter, das hatte ihm gerade noch gefehlt. Connor ignorierte das Hupen der Wartenden hinter seinem Auto und bugsierte sie auf den Gehweg. Er setzte sie auf den Stufen eines Hauseingangs ab und zog die Mütze von ihrem Kopf. Er fuhr mit den Fingern in ihr Haar und tastete sie nach einer Beule ab.
Irgendwann hob sie die Hand. »Könnten Sie … könnten Sie damit aufhören?«
»Ich will wissen, ob ich Sie ins Krankenhaus fahren muss«, knurrte er.
»Müssen Sie nicht.«
»Wenn Sie dann wegen einer Kopfverletzung sterben, haben nicht Sie das Problem, sondern ich.«
»Wegen der Gewissensbisse?«
»Wegen der Ermittlungen. Und dann kommt vielleicht noch Ihre Familie und klagt mir eine Million aus dem Kreuz.«
»Meine Familie hält nichts davon, andere zu verklagen.«
»Glück für uns beide.«
Sie starrte ihn irritiert an. Er konnte es ihr nicht mal verübeln. Man sollte eben nicht vor seinem ersten Kaffee in sein Auto knallen. Normalerweise trank er schon zu Hause welchen – genauer gesagt die ersten fünf Tassen –, aber heute hatte er nicht mal Zeit für eine gehabt. Er war nicht vom Piepsen seines Weckers aufgewacht, sondern weil er aus dem Bett gefallen war. Offensichtlich hatte er sehr unruhig geschlafen – und genau so fühlte er sich. Als hätte er die Nacht damit verbracht, sich durchs Bett zu rollen.
Hinter seinem Wagen hupten die anderen Autos, und die meisten Fahrer zeigten ihnen den Mittelfinger, wenn sie erst mühsam auf die Nachbarspur gewechselt waren, um an seinem Audi vorbeizukommen.
»Sie sollten Ihren Wagen wegfahren, bevor die Polizei kommt.«
»Auch die muss einsehen, dass erste Hilfe wichtiger ist als eine freie Straße.« Er wusste selbst, wie glatt ihm diese Antwort über die Lippen kam. Schneller als bei jedem anderen Menschen, der normalerweise Respekt vor der Polizei hatte.
Sein Unfallopfer musterte ihn von oben bis unten. »Anwalt?«, fragte sie.
Wenn er jetzt Ja sagte, gab es zwei Möglichkeiten: Entweder drohte sie ihm, ihn bei der Anwaltskammer anzuzeigen (als würden die sich für den Fahrstil eines Anwalts interessieren), oder sie erzählte ihm die herzzerreißende Geschichte, dass sie für irgendetwas oder für irgendjemanden einen Anwalt bräuchte und er ihr das im Austausch dafür bieten könnte, dass sie ihn nicht anzeigte. Woher er das wusste? Weil er es selbst schon oft genug erlebt hatte.
Aber verflucht noch eins, er kam vom Thema ab. Er wollte wissen, ob sie ein Fall für das Krankenhaus war. »Wie sind Sie gefallen?«
»Ich bin gegen das Auto geknallt und hab mir vor allem den Ellenbogen angeschlagen.« Sie zeigte auf den linken Arm. Sie protestierte nicht mal, als er ihr den Reißverschluss der Jacke öffnete und behutsam den Ärmel runterzog. Sie trug ein kurzärmeliges Shirt darunter, und sie bibberte. Trotz ihrer dicken Jacke war die Haut an ihrem Ellenbogen aufgeschürft, und sie zuckte zusammen, als er ihn vorsichtig bewegte und dann abtastete.
»Wenn Sie kein Anwalt sind, sind Sie dann vielleicht Arzt?«, fragte sie.
»Nein.«
»Sanitäter?«
»Nein.«
»Sie geben nicht viel über sich preis, oder?«
»Ich war früher Armeesanitäter«, gab er zurück. »Und der Arm ist höchstens geprellt, zumindest kann ich nichts Ungewöhnliches fühlen. Wollen Sie jetzt ins Krankenhaus oder nicht? Ich habe heute noch mehr zu erledigen, aber ich komme am Bellevue Hospital Center vorbei und könnte Sie absetzen.«
»Wohl das Mindeste, wenn Sie mich überfahren«, murmelte sie, und er runzelte die Stirn.
»Ich habe Sie nicht überfahren«, schnarrte er. »Sie hatten keine Augen im Kopf.«
»Sie hatten bereits Rot.«
»Gelb.«
»Oh, Verzeihung, das ist natürlich sehr viel besser«, erwiderte sie schnippisch. »Dabei wird selbst Kindern bereits beigebracht: Bei Rot bleib stehen, bei Grün kannst du gehen. Bei Gelb gib acht, so wird’s gemacht.«
»Ich habe achtgegeben, aber nicht mal ich kann hellsehen«, beharrte er. »Sie sind mit Vollgas um die Ecke und auf die Straße geschossen gekommen.«
»Erstens bin ich nicht um eine Ecke gefahren, zweitens war die Ampel, über die ich fahren wollte, grün! Und Ihre nicht.« Sie drückte ihm den Finger in die Brust, und als er darauf hinabsah, zog sie ihn eilig zurück.
»Ach, was rede ich mir überhaupt den Mund fusselig?«, fragte sie offenbar sich selbst. Sie hob die Hände und damit auch den verletzten Arm. Sie zischte darüber vor Schmerz. Schnell schob sie ihn in den Ärmel zurück und zog ihre Jacke vor ihrer Brust zusammen. »Keine Sorge, ich werde Sie nicht für irgendwas belangen wollen. Ich fahre jetzt einfach weiter.«
»Ihr Rad ist verbogen.«
Sie stützte sich auf seinen Arm, um sich von den Treppenstufen zu hieven, und humpelte zu ihrem Rad. Die Querstange war völlig verzogen, die Kette gerissen, und ein Pedal hing schief.
»Mist«, stöhnte sie.
»Das Fahrrad ist sowieso nicht für diese Witterung geeignet«, sagte Connor. »Sie hätten sich wenigstens dickere, grifffestere Reifen besorgen können. Über kurz oder lang wären Sie in einer Kurve gestürzt und hätten sich was gebrochen. Schlimmstenfalls den Hals.«
»Ja, Daddy«, erwiderte sie sarkastisch. »Es kann sich nun mal nicht jeder einen Audi leisten.«
»Den kann ich auch nur bezahlen, weil ich sieben Tage die Woche pünktlich auf Arbeit erscheine. Und wenn Sie sich weiterhin nicht entscheiden, ob ich Sie irgendwohin fahren soll, verpasse ich dann noch den dritten meiner Termine heute.« Er schaute auf die große Uhr einer Kirche nahe der Kreuzung. »Vielleicht auch den vierten.«
Ihren Blick konnte er nicht im Geringsten deuten. Er konnte von ›Ach Gott, was tun Sie mir leid‹ bis zu ›Sie sollten weniger Termine machen‹ alles bedeuten.
Nichts davon sprach sie aus. Stattdessen fragte sie: »Sie fahren nicht zufällig an der 5th Avenue vorbei?«
»Nein.«
»Und würden Sie für mich …?«
Um sie an der 5th Avenue abzusetzen, hätte er noch mal zwanzig Minuten in die entgegengesetzte Richtung fahren müssen. Also lautete die einzige vernünftige Antwort: »Nein.«
Sie legte den Kopf schief, und ihre Haare fielen ihr in die Stirn. »Sind Sie gestresst?«
»Ach, woher denn?«, fauchte er. »Ich habe nur gerade den Schreck meines Lebens erlebt, weil mir eine Fahrradfahrerin gegen die Motorhaube geknallt ist.«
»Also kompensieren Sie Ihre Angst mit Wut?«
Er kompensierte gerade ihre frechen Fragen mit Wut. Wahrscheinlich war er an eine Psychologin geraten. Oder, ihren Klamotten nach zu urteilen, noch schlimmer: an eine esoterische Lebensberaterin. Sie trug einen dunkelgrauen Wollmantel und trotz der eisigen Temperaturen eine Leinenhose, die sich um ihre Knöchel bauschte. Beides in einem betont fröhlichen Sonnengelb. Sowas erwartete er bei einer Heilpraktikerin.
Er gab ihr keine Antwort, sondern wandte sich ab, allerdings nicht, ohne ihr vorher eine Visitenkarte in die Hand zu drücken. Das Fahrrad hob Connor auf und stellte es neben sie auf den Gehweg. Während sie ihn lediglich beobachtete, stieg er ins Auto und gab Gas.
Er hatte nicht auf die Ampel geachtet, und endlich war das Glück ihm heute mal hold: Sie sprang just in diesem Moment auf Grün um.
Auch auf dem Rest der Strecke erwischte er nahezu nur grüne Ampeln, als würde sich das Universum bei ihm für den Zwischenfall entschuldigen wollen. Trotzdem hämmerte es hinter seiner Stirn, als er endlich den großen Bürotower betrat.
Im Gegensatz zu der Kälte draußen war es im Foyer unerträglich warm. Er hatte kaum die Aufzüge erreicht, da wollte er sich den Mantel, das Sakko und am besten gleich noch das Hemd von den Schultern reißen.
Die Türen des mittleren Fahrstuhls standen offen, und Connor trat hinein. Zu seinem Leidwesen war er nicht allein. Hinter ihm hastete Oliver Barnes in den Lift. Er strahlte ihn mit so guter Laune an, dass Connor spontan dafür plädierte, ein solches unverschämt fröhliches Lächeln vor neun Uhr am Morgen als Straftat zu betrachten. Oder es wenigstens mit Straffreiheit zu belegen, wenn man so jemandem aus reiner Notwehr den Hals umdrehte.
»Auch zu spät?«, fragte Oliver.
Wonach sah es denn aus, zum Teufel? Mühsam schluckte Connor den Satz hinunter und rang sich ein Lächeln ab. »Der Verkehr ist furchtbar. Kein Wunder bei dem Wetter.«
Oliver nickte, als hätte Connor die Weisheit des Tages von sich gegeben. »Und es soll noch mindestens die ganze nächste Woche so bleiben.«
Na herrlich. Hatte er noch mehr so gute Neuigkeiten?
»Der Schneesturm ist ja auch nicht vom Tisch«, plauderte Oliver fröhlich weiter, während Connor zusah, wie die Stockwerke auf dem Display hochzählten. Es gab keinen dreizehnten Stock, weil das angeblich Unglück brachte. Völliger Unsinn, der vierzehnte Stock war eben der richtige dreizehnte Stock, aber seine Mutter hatte bei der Einrichtung darauf bestanden.
»Ich habe mir übrigens den Fall der Wessleys angesehen«, sagte Oliver und klang dabei, als hoffte er, so Connors Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
»Gut«, brummte jener.
»Es gibt da ein paar Ungereimtheiten.«
»Schicken Sie mir eine Mail.« Zum Glück öffneten sich die Türen des Lifts im fünfzehnten Stock, und Connor preschte heraus. Er eilte den Gang hinunter, in der Hoffnung, in seinem Zimmer anzukommen, ohne dass ihm noch jemand ein sinnloses Gespräch aufdrängte.
Als er sein Büro betreten wollte, blieb er mit dem Ärmel an der Türklinke hängen. Am liebsten hätte er aus lauter Frustration dagegengetreten. Er wusste, was das hieß. Schließlich kannte er die Anzeichen nur zu gut. Connor war hoffnungslos überreizt, und es war nicht mal neun Uhr. Ihm stand ein Vormittag voller Meetings und ein Nachmittag mit Gerichtsterminen bevor. Es handelte sich nur um Routine-Angelegenheiten. Scheidungsfälle stinkreicher und stinkwütender Menschen, die sich um ihre vergoldete Mikrowelle stritten und hin und wieder die Ermahnung brauchten, sich doch bitte wie Erwachsene zu verhalten. Nichts davon war sonderlich herausfordernd. Trotzdem stresste ihn allein der Gedanke daran.
Auf seinem Schreibtisch stand der Kaffee, der inzwischen nur noch lauwarm war, weil er, wie erwähnt, zu spät war. Hätte er sonst nicht erwartet, dass der Kaffee bereits bei seinem Erscheinen auf seinem Tisch stand, hätte Sarah ihm diesen erst jetzt gebracht – heiß.
So konnten die eigenen Anforderungen gegen einen laufen, sobald sich der Zeitplan verschob.
Normalerweise hielt er sich strikt an sein Morgenritual. Ins Büro kommen, Kaffee trinken, Mails und Nachrichten lesen. Heute musste er das abkürzen, weil er in fünf Minuten ein Meeting hatte. Der einzige Vorteil an der halbwarmen Plörre war, dass er sie relativ schnell hinunterstürzen konnte, während er seine Mails überflog. Er fühlte sich nicht im Mindesten angekommen oder gar halbwegs auf der Höhe, als Sarah ins Zimmer trat.
»In zwei Minuten steht die wöchentliche Besprechung bei Ihrer Mutter an«, sagte sie.
»Danke«, murrte er.
Wie immer blieb Sarah keine Sekunde länger als nötig bei ihm. Sie schätzte innerhalb eines Wimpernschlages ab, ob er noch was von ihr wollte, und verschwand dann.
Seufzend stellte er seine leere Kaffeetasse ab und verließ sein Zimmer. Auf dem Weg zum Büro seiner Mutter kam er an der Büroküche vorbei und warf der Kaffeemaschine einen sehnsüchtigen Blick zu. Aber seine Mum verabscheute Unpünktlichkeit. In der Hinsicht konnte sie die Übertragung ihrer Gene wirklich nicht verleugnen.
Das Büro seiner Mum lag eine Etage über seinem. Es war eines der wenigen Büros, die nicht mit Glaswänden vom Gang her einsehbar waren. Es war aber auch das einzige, das seit vier Wochen eine kaputte Tür hatte. Wollte man hinein, musste man sich regelrecht gegen die Tür werfen. Wollte man sie schließen, wäre es einfacher gewesen, das Loch zuzumauern.
Er prellte sich fast die Schulter, als er die Tür aufstieß. »Wann lässt du sie endlich reparieren?«, stöhnte er und taumelte hinein. Seine Mutter thronte hinter einem riesigen Schreibtisch und starrte auf ihren Laptop. Auf der anderen Seite des Raumes standen ein riesiges Ledersofa und zwei passende Sessel. Vor der breiten Glasfront und der Skyline Manhattans stand ein Tisch mit einem Schachbrett und zwei Stühlen.
»Mach schon mal deinen nächsten Zug«, sagte sie und deutete auf das Schachbrett. Dort standen nicht mehr alle Figuren. Sie spielten die Partie seit über einer Woche, und es war ein zähes Ringen.
Seine Mum hatte ihm das Spielen beigebracht, da war er sechs Jahre alt gewesen. Seither spielten sie permanent gegeneinander – oft über Tage und manchmal auch über Wochen. In den fünfundzwanzig Jahren hatte er noch nie gewonnen. Sie hatte ihn nicht mal als Kind aus Freundlichkeit gewinnen lassen, weil sowas kein echter Sieg für sie gewesen wäre.
Irgendwann machte er einen taktischen Fehler, und den nutzte sie gnadenlos aus.
Sie hatte ihm stets gesagt, dass sie dann in Rente gehen und ihm die Kanzlei überlassen würde, sobald er sie besiegte. Wenn Connor so weitermachte, würde sie wohl zweihundert Jahre alt werden müssen, und selbst dann würde er keine Garantie darauf geben. Es sei denn, er machte sie eines Tages so betrunken, dass sie den König nicht mehr vom Läufer unterscheiden konnte.
Connor setzte sich auf den Stuhl auf der Seite der schwarzen Figuren und betrachtete das Brett. Das Hämmern hinter seiner Stirn war mit dem Kaffee ein wenig abgeebbt, doch jetzt meldete es sich umso beharrlicher wieder zurück. Das einzige Geräusch im Raum kam von der Tastatur. Seine Mutter schrieb einen ausführlichen Text, so emsig wie ihre Finger über die Tasten flogen. Manchmal klackerten ihre Ringe dabei aneinander.
Er schob seinen Läufer ein paar Felder nach links, um den Springer seiner Mum zu bedrohen. Das Klappern der Tastatur wich dem Klackern ihrer Absätze auf dem Boden, und seine Mutter setzte sich auf den Stuhl auf der anderen Seite des Schachbretts.
»Du siehst gestresst aus«, sagte sie.
»Ich hatte vorhin einen Unfall.«
Sofort wurde ihr Blick forschender, und sie betrachtete ihn von oben bis unten.
»Ich saß nur im Auto. Mir ist eine Fahrradfahrerin reingeknallt«, fügte er schnell hinzu.
»Geht es ihr gut?«
»Nur eine Schürfwunde am Ellenbogen.«
»Hast du sie ins Krankenhaus gefahren?«
»Sie wollte nicht.«
Seine Mutter nickte und rückte ihren Springer aus der Gefahrenzone seines Läufers.
»Ich habe ein paar Beschwerden über dich gehört«, sagte sie. »Genau genommen häufen sich die Beschwerden seit etwa vier Monaten.«
Connor hatte gerade die Hand nach seinem Turm ausgestreckt, aber was seine Mutter da von sich gab, ließ ihn beinahe vergessen, was er eigentlich vorgehabt hatte. Vor vier Monaten hatte ihn Sofia verlassen. Die einzige Frau, bei der er sich hatte vorstellen können, sie zu heiraten. Und er wusste selbst, dass er seither nicht mehr auf der Höhe war.
»Aber auch vorher hattest du nicht gerade den besten Ruf«, sagte seine Mutter und klang dabei so neutral, als ginge es um das Wetter. »Die meisten wollen dir aus dem Weg gehen, und sie haben Angst vor dir.«
Connor sagte nichts. Was zum Henker sollte er auch dazu sagen?
»Versteh mich nicht falsch.« Seine Mum strich über den Rand des Schachbretts. Sie hatte lange, schmale Finger, aber mit einem Mal sahen sie seltsam aus. Und er wusste nicht, ob es daran lag, dass sie andere Ringe als sonst trug, oder daran, dass gerade das Blut in
seinen Ohren rauschte. »Konsequenz und Durchsetzungsvermögen sind wichtige Charaktereigenschaften«, fuhr sie fort. »Aber ich fürchte, du übertreibst es, vor allem in letzter Zeit. Du bist nicht mehr objektiv, und außerdem mutest du dir zu viel zu. Wie viele Stunden hast du diese Nacht geschlafen?«
»Sechs.«
»So viele hast du im Bett gelegen, aber geschlafen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.«
Connor setzte seinen Turm ab, und seine Mutter schob ihre Dame vor. »Schach«, sagte sie, und Connor ließ den Kopf sinken. Mist, er hatte nicht aufgepasst. Das war echt nicht sein Tag.
Seufzend lehnte er sich zurück und sah seine Mutter an. »Willst du mir sagen, dass ich Urlaub nehmen soll?«
»Du hattest vor einem Monat Urlaub. In dem Urlaub hast du nichts weiter gemacht, als zu arbeiten. Nur eben vom Strand aus.«
»Es war nötig.«
»Ja, für dich. Weil die Arbeit das Einzige ist, das gerade in deinem Leben konstant und sinnvoll ist.«
»In deinem ist das nicht im Geringsten anders. Vor allem nicht, seit …« Er brachte es nicht über sich, es auszusprechen. Sie wusste auch so, was er meinte. Er konnte es an ihren zusammengepressten Lippen sehen und daran, wie ihr Blick zu ihrem linken Ringfinger zuckte. Sie trug dort einen Ring, aber einen anderen als sonst. Dieser hier fasste einen klobigen Smaragd statt einem klaren Diamanten. Sie bevorzugte Schmuck aus Rotgold, ihr Ehering war jedoch aus Titan gewesen. Unbrechbar. Leider war der Ring unbrechbarer gewesen als die zugehörige Ehe. Trotzdem hatte sie erst geendet, als sein Vater vor ein paar Monaten gestorben war.
Seine Mutter lächelte. Zuerst wirkte es verkniffen, doch dann entspannte sie sich sichtlich. »Nicht ganz, ich habe immer noch dich. Und ich mache mir Sorgen. Deswegen war ich so frei, etwas für dich zu vereinbaren.«
Um Himmels willen, hoffentlich kein Psychologe.
Wenn der ihm ebenso solche Fragen stellte wie die Radfahrerin vorhin, würde Connor innerhalb von fünfzehn Minuten um Medikamente betteln. Nach der großen Dröhnung – damit auch alles schön in Watte eingepackt war und er nicht mal mehr seinen geheiligten Kaffee vermisste.
Seine Mutter griff in die Tasche ihres Blazers und holte ein Stück bedruckten Karton heraus. Eine Visitenkarte, auf der schnörkellos ein einziger Name stand: Rachel.
»Du brauchst wieder menschliche Nähe. Und zwar nicht nur von mir. Und nicht nur von Angestellten, die dich lieber von hinten sehen«, sagte seine Mum.
Sie hatte ihm doch hoffentlich keinen Termin bei einer Prostituierten besorgt? Das traute er ihr ohne weiteres zu!
»Was zur Hölle soll das bedeuten?«, presste er heraus, und seine Mutter legte den Kopf schief.
Mit einem immer breiter werdenden Lächeln verkündete sie ihm: »Rachel ist eine professionelle Kuschlerin – sie umarmt Menschen. Und ich fahr dich jetzt persönlich zu ihr hin.«
zwei
MIESES KARMA BRINGT MIESE KUNDSCHAFT
Schöner Mist. Rachel hatte doch nur neue Räucherstäbchen besorgen wollen. In tiefster Eiseskälte. Aber sie brauchte sie. Ihre Kunden waren sie gewohnt – und ihre Kunden brauchten feste Rituale während der Sitzungen. Das gab ihnen Sicherheit und half ihnen dabei, sich zu entspannen.
Entspannung.
Das hätte der verflixte Kerl, der sie angefahren hatte, auch mal nötig gehabt. Aber einsehen zu müssen, dass er verflucht noch eins an dem Zusammenstoß schuld war, hätte ihm wahrscheinlich nur die Arterien platzen lassen.
Mit dem verbogenen Fahrrad war sie quer durch Manhattan gelaufen, zu ihrem Stammdealer der Räucherstäbchen gehumpelt und in ihre Wohnung zurückgekehrt. Sie war durchgefroren, ihr taten der Knöchel und der Ellenbogen weh. Das Einzige, was ihre schlechte Laune auf dem Weg hin und zurück gelindert hatte, war die Vorstellung gewesen, wie sie diesen elenden Audi-Fahrer bewusstlos schlug und ihm eine ganze Packung Räucherstäbchen in jedes Nasenloch steckte, um sie dann anzuzünden. Als Räucherstäbchenhalter hätte er wenigstens einen Nutzen gehabt.
Connor Bennett – das stand jedenfalls auf der Visitenkarte, die er ihr in die Hand gedrückt hatte. Und er war doch Anwalt! Sie hatte mit klammen Fingern seinen Namen auf dem Handy gegoogelt, als sie mal zu lange an einer Ampel gestanden hatte, die offenbar vergessen hatte, dass Fußgänger auch mal die Straßenseite wechseln mussten.
Jetzt ließ Rachel ihr verbogenes Fahrrad im Treppenhaus stehen und schleppte sich die schiefgetretenen Stufen hinauf. Ihr tat jeder Knochen weh. Kein Wunder bei dem Sturz. Sie hatte ein ordentliches Tempo draufgehabt, als der Audi sie aus der Zielgeraden gerammt hatte.
Verwunderlicher war eher, dass sie den Gedanken an den Fahrer nicht losbekam. Schließlich wich ihre schlechte Laune mit der Kälte aus ihren Gliedern, als sie die Treppen hinaufstieg. Die Gewaltfantasien hätten damit überflüssig sein sollen. Trotzdem meinte Rachel, seine Finger auf ihrem Arm zu spüren, genauso wie die eisige Kälte, die unter ihre Haut gekrochen war, bis sie sie scheinbar völlig ausgefüllt hatte – und das Einzige, was sie davon abgelenkt hatte, war seine Berührung gewesen. Obwohl seine Finger kalt gewesen sein mussten, hatten sie sich eher heiß angefühlt.
Rachel rieb sich den Kopf und wäre auf einer Treppenstufe beinahe prompt nach hinten gekippt. Sie war immer noch wackelig auf den Beinen, und dass sie bis in den obersten Stock laufen musste, hellte ihre Stimmung auch nicht gerade auf. Sie lebte seit zwei Monaten hier, und ihre Kondition hatte sich immer noch nicht den Herausforderungen der Treppe angepasst. Deswegen überlegte sie sich meist sehr genau, was sie draußen machen musste, um nicht auf halbem Weg wieder umkehren zu müssen. Sie bezweifelte ja, dass der Fahrstuhl, von dem der Vermieter gesagt hatte, er sei »momentan« kaputt, jemals funktioniert hatte. In den zwei Monaten hatte sie nicht einen einzigen Monteur gesehen, der sich um das Ding gekümmert hätte. Dabei waren einige ihrer Kunden zu alt für so viele Treppenstufen. Ein paar waren ihr deswegen schon abgesprungen. Sie schafften es einfach nicht, sich einmal die Woche bis in den fünften Stock zu quälen.
Damit hatte sich ihr Kundenstamm halbiert. Aber eine andere Wohnung konnte sie sich momentan nicht leisten. Ein Umzug wäre mühselig gewesen, und sie hatte Glück gehabt, eine so große Wohnung zu einer so günstigen Miete in Manhattan zu finden.
Sie musste im vierten Stock anhalten, um Luft zu schöpfen. Eine der drei Türen, die zu den Wohnungen führte, klappte auf, und Mrs. Robinson trat heraus. Früher musste sie mal groß gewesen sein, aber eine Krankheit hatte ihr einen Buckel beschert, und ihr Oberkörper befand sich beinahe im Neunzig-Grad-Winkel zu ihren Beinen. Man konnte ihr den stets griesgrämigen Blick wohl kaum verübeln, trotzdem ging Rachel mit einem flüchtigen Lächeln schnell weiter. Noch während sie hinaufstieg, schalt sie sich eine Närrin. Mrs. Robinson war vielleicht auch nur einsam. Gerade Rachel sollte es am besten wissen.
Rachel schloss ihre Tür auf, und sofort quoll ihr das Aroma von Zimt und Sandelholz entgegen. Sie liebte es, und mit den neuen Räucherstäbchen würde es noch mal intensiver werden.
Bis zu ihrem nächsten Termin waren es fünfzehn Minuten. Genug Zeit also, um sich einen Tee zu machen.
Während das Wasser aufkochte, kontrollierte Rachel ein letztes Mal ihren ›Behandlungsraum‹. Den meisten Platz nahm die Kuschelecke ein. Sie bestand aus unzähligen Kissen und einer bequemen Liege. Eine Lichterkette hangelte sich gemeinsam mit ihrem Efeu die Wand entlang, und die bunten Lichter wurden von den dicken Blättern gedämpft. Im Fenster hing ein großer Weihnachtsstern, der beharrlich gegen das triste Grau draußen anleuchtete.
In einem Regal standen ihre Klangschale, eine Musikanlage mit diversen Entspannungs-CDs und eine zusammengerollte Yoga-Matte. Als sie sich selbstständig gemacht hatte, hatte Rachel vorgehabt, Yoga zu lernen, um es ebenfalls anbieten zu können. Da hatte sie allerdings noch nicht gewusst, dass Yoga verdammt anstrengend war und sie ungefähr so biegsam wie ein Stahlrohr.
Rachel entzündete eines der Räucherstäbchen und inhalierte den Duft. Genauso wie sie das Aroma des Brennnesseltees einsog, als er endlich fertig war. Ihr Handy klingelte, und auf dem Display erschien Hollys Bild. Aber für ihre Freundin hatte sie gerade keine Zeit.
Der schrille Ton ihrer Türklingel hallte durch die Wohnung und reizte Rachels Nervensystem. Sie hasste dermaßen hohe Töne, eilte in den Flur und drückte rasch den Türsummer.
In den Rahmen ihrer Tür gelehnt wartete sie auf das Geräusch der Schritte von unten. Normalerweise holte sie sich während der Zeit, die ihre Kunden brauchten, um hinaufzukommen, ihren Tee. Aber heute kam eine neue Kundin. Rachel wollte sie voll konzentriert empfangen, denn, verflixt noch eins, sie brauchte gerade alle Kundschaft, die sie bekommen konnte. So gut ihr Geschäft angelaufen war, machte ihr der kaputte Fahrstuhl einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.
Innerlich betete sie. Hoffentlich war es keine alte Dame. Dass es eine Frau war, wusste sie, weil diese sie heute Morgen angerufen hatte. Mrs. Lucia Bennett. Klang nett.
Doch die Schritte, die nun die Treppe hinaufkamen, wirkten schwer – wie die eines Mannes. Derjenige ging zügig, und in das Knarzen der Dielen mischte sich ein Klackern wie von Absätzen.
Na, hoffentlich hatte da nicht wieder jemand was missverstanden.
Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass jemand glaubte, sie stünde für Swinger-Einlagen oder sexuelle Dienstleistungen zur Verfügung. Ihr Beruf war zwar nicht so unbekannt, dass man ihn ständig erklären musste oder keine Kunden fand, aber es war schwer, die richtigen Kunden zu finden.
Sie sah einen Mann die Treppe hinaufgehen, direkt gefolgt von einer Frau mit dickem, blondem Haar.
Rachels Herz schlug schneller, wie immer, wenn sie neuen Kunden begegnete. Sie wollte einen guten Eindruck machen, auf den ersten Blick vertrauenswürdig erscheinen, und im Spiegel, der neben der Tür hing, strich sie schnell ihr Haar glatt.
Als der Mann den Kopf hob, gab es in Rachels Gehirn prompt einen kleinen Blitzschlag. Diese hellen Augen mit den dunklen Schatten darunter kannte sie. Genauso wie diese Nase, die sie schon in der ersten Sekunde an einen Raubvogel erinnert hatte. Das einzig Lässige an ihm waren seine Haare. Im Gegensatz zu seinem tadellos sitzenden Anzug, dem passenden Wollmantel und den braunen Handschuhen, die ihn aussehen ließen, als wäre er gerade aus einem Werbeplakat gefallen, standen sie kreuz und quer von seinem Kopf ab, als hätte sie der Wind durcheinandergeblasen. Sie waren genauso blond wie die seiner Begleiterin. Herr im Himmel, das war der Autofahrer von vorhin! Connor Bennett blieb auf dem Treppenabsatz stehen und starrte sie mindestens genauso überrascht an, wie sie sich fühlte.
»Was?«, entfuhr ihm, aber da versetzte ihm die Frau – die Rachel entweder für seine Frau oder seine Mutter hielt – einen Stoß in den Rücken. »Bleib doch nicht auf der Treppe stehen. Das ist eine lausige Angewohnheit.«
Okay, Rachel tippte definitiv auf die Mutter. Als sie sich an Rachels Autofahrer-Bekanntschaft vorbeigedrängelt und die letzten Stufen erklommen hatte, erkannte Rachel die vielen kleinen Fältchen um ihre Augen. Es war schwer einzuschätzen, wie alt sie war. Den Fältchen nach zu urteilen, hätte Rachel sie auf um die fünfzig geschätzt. Aber sie war sorgfältig geschminkt, ihre Frisur saß hurrikanfest und unter dem Mantel kam ein teures Kostüm zum Vorschein. So mühelos, wie sie sich bewegte, hätte sie auch locker als Dreißigjährige durchgehen können.
»Sie sind also Rachel?«, fragte Mrs. Bennett.
Schnell nickte Rachel. Es fiel ihr schwer, sich auf Mrs. Bennett zu konzentrieren, wenn ihr Gehirn immer wieder ihren Augen befahl, zu dem Kerl von heute Morgen zu starren.
»Das ist mein Sohn«, stellte Mrs. Bennett ihn vor. »Connor Bennett. Der Termin ist für ihn.«
Okay …
Rachel rang sich ein Lächeln ab und trat zurück. Mit einer einladenden Geste winkte sie die beiden hinein. Connor sah aus, als wäre er lieber gerade nackt den Eiffelturm hochgeklettert, als hier zu sein.
Rachel hatte noch nie erlebt, dass eine Mutter für ihren Sohn einen Termin bei einer Kuschlerin ausgemacht hatte. Der Altersdurchschnitt ihrer Kundschaft lag bei dreiundsiebzig Jahren, Connor hingegen war höchstens dreißig.
Mrs. Bennett setzte sich an den kleinen Tisch in ihrer Küche, als wäre sie nicht zum ersten Mal hier.
»Möchten Sie eine Tasse Tee?«, brachte Rachel heraus.
»Oh ja, gern«, erwiderte Mrs. Bennett erfreut. »Ich werde hier warten. Damit ich sicherstellen kann, dass mein Sohn nicht einfach vor der Zeit abhaut, nur weil ihm irgendwas einfällt, was gerade furchtbar dringend ist.«
Rachel warf Connor einen schnellen Blick zu. Er hatte seinen Mantel nicht abgelegt, sondern starrte seine Mutter an, als schwankte er noch zwischen der Flucht aus dem fünften Stock durch das Fenster oder ob ihm vielleicht eine Diskussion irgendetwas nutzen würde. Rachel hätte nicht darauf gewettet. Mrs. Bennett strahlte etwas aus, das nicht zu Widersprüchen einlud.
»Sich für Entspannung Zeit zu nehmen, ist wichtig«, sagte Rachel.
»Seine Zeit nicht mit dummen Ideen zu verplempern, ist wichtig«, steuerte Connor bei.
»Man weiß nie, ob eine Idee wirklich so dumm ist, wie sie anmutet, wenn man es nicht ausprobiert«, ergänzte Mrs. Bennett seelenruhig.
Na herrlich. Er war nicht freiwillig hier. Was Rachel betraf, hätte sie gerade nichts dagegen gehabt, wenn er gegangen wäre. Sie versuchte, das Flattern in ihrem Magen unter Kontrolle zu bringen und nicht daran zu denken, dass sie immer noch deutlich seine Berührungen auf ihrer Haut fühlte.
So einen gutaussehenden Kunden hatte sie bisher nicht gehabt. Sie bewahrte stets eine professionelle Distanz – wenn schon nicht körperlich, dann halt auf der emotionalen Ebene. Sie mochte ihre Kunden, aber sie hätte um Himmels willen nie einem davon näher kommen wollen, als es durch die Umarmungen ohnehin vorgesehen war.
Connor sagte nichts, dafür sprach sein Gesichtsausdruck Bände. Sehr, sehr finstere und unentspannte Bände. Seine Mutter hingegen sah Rachel abwartend an. Rachels Hände zitterten, als sie ihr Tee einschenkte. »Wollen Sie auch einen?«, fragte sie Connor, und er schüttelte den Kopf. »Sie können den Mantel im Flur aufhängen«, schlug sie vor.
Er folgte zwar ihrem Hinweis, aber es wunderte sie ehrlich, dass er nicht durch den Flur weiter durch ihre Tür marschierte und dann gleich ganze Treppenabsätze hinuntersprang, um von ihr wegzukommen. Sie brauchte nicht mal Schwingungen deuten zu können, um an seinem Gesicht ablesen zu können, dass er nicht hier sein wollte.
»Er ist ein wenig gestresst«, murmelte Mrs. Bennett. »Sie können ihm doch helfen?«
Ein wenig? Das war die Untertreibung des Jahrhunderts. Heute Morgen hatte sie damit gerechnet, dass er sie eiskalt erwürgen würde. Trotzdem hatte er sie überraschend sanft untersucht – und gründlich. Bei dem Gedanken daran fühlte sie sich gestresst!
»Ich hoffe es«, sagte sie in ihrem professionellsten Ton – sanft, einfühlsam, absolut ignorierend, dass ihr Selbstbewusstsein sich klammheimlich verdrückt hatte. Sie hatte es noch nie mit unfreiwilligen Kunden zu tun gehabt. Oder attraktiven. So verdammt attraktiven.
Okay, Augen zu und durch. Wenn es ihm gefiel, kam er öfter, und sie hatte eine Einnahmequelle mehr.
»Es geht dorthinein«, wies sie ihm freundlich den Weg. Er bewegte sich nicht, er warf lediglich einen Blick in den Raum. Von der Küche aus konnte man die vielen Kissen sehen, und ja, vielleicht hätte sie nicht gerade puffrote Kissen auswählen sollen, aber sie mochte Rot nun mal.
»Bitte sag mir, dass du mir keine esoterische Nutte besorgt hast«, bat er seine Mutter.
Rachel hätte beleidigt sein sollen, stattdessen musste sie die Lippen aufeinanderpressen, um nicht laut loszulachen.
»Keine Sorge, ich bin nicht esoterisch«, sprach sie, und ihm entgleisten endgültig die Gesichtszüge.
Mrs. Bennett hingegen legte die Hände um die warme Teetasse. »Ich sagte doch, sie ist keine Prostituierte«, versicherte sie. »Sie ist eine Kuschlerin!«
»Wo ist der Unterschied?«
»Sämtliche Dingdongs bleiben in der Hose«, erklärte Rachel.
Dass ihm bei der Bezeichnung nicht die Kinnlade aus dem Gesicht klappte, enttäuschte sie ja ein wenig. »Wir bleiben angezogen«, fügte sie hinzu. »Es geht nur um die Nähe, die Umarmung. Umarmungen schütten Hormone aus. Diese wiederum senken den Stresspegel. In unserer heutigen Gesellschaft ist es nicht die Norm, sich gegenseitig zu umarmen, es sei denn, es handelt sich um Eltern, Geschwister, Kinder oder Partner bzw. Ehepartner. Freunde umarmen sich höchstens zur Begrüßung, und das ist zu kurz. Manche Menschen sind durch Job, Trauma oder persönliche Verluste nicht mehr von Menschen umgeben, die sie umarmen können. Sie sind einsam, und dann komme ich ins Spiel.«
»Ich bin nicht einsam«, entfuhr es ihm.
Sie lächelte sanft. »Daran zweifle ich nicht. Warum probieren wir es nicht? Sie können jederzeit gehen, wenn es Ihnen nicht gefällt.«
»Kannst du nicht«, mischte sich seine Mutter ein. »Jedenfalls nicht ohne Gründe. Aber das zu entscheiden, liegt dann bei mir.«
»Mit Zwang sollte das nicht geschehen«, wandte Rachel ein.
Mrs. Bennett lächelte. »Von Zwang rede ich erst, wenn ich euch beide mit Ihrer Kuscheldecke aneinandergebunden habe.«
»Gott im Himmel«, murmelte er. »Schlimm genug, dass ich dir das zutraue. Natürlich nur zu meinem Besten.«
Seine Mutter zuckte mit den Schultern. »Du bist mein einziger Sohn, und die Gelegenheiten, bei denen ich übergriffig werde, sind selten, aber immer wohl überlegt.«
»Das macht es nicht besser.«
»Für mich schon.«
Connor verdrehte die Augen und schien sich keine Sekunde später zur Wohnungstür wenden zu wollen, aber dann gab er sich einen Ruck und ging in ihr Behandlungszimmer. Seine Mutter zog eine der Zeitschriften heran, die auf dem Tisch lagen. Und Rachel? Die folgte ihrem Kunden, und ihr Herz raste inzwischen so stark, dass sie sich fragte, ob eine Ohnmacht ihr nicht einiges ersparen würde.
Bleib professionell, mahnte sie sich selbst. Das war nun wirklich nicht schwer, verflucht noch eins.
Als er sich zu ihr umdrehte, konnte man seinen Blick getrost als Morddrohung verstehen.
»Meinem Ellenbogen geht es übrigens sehr gut«, sagte sie, weil ihr nichts Besseres in den Sinn kam. Gut gemacht, Rachel, erinnere ihn nur an einen weiteren Stressfaktor und daran, dass er keinen Grund hat, sich dir gegenüber freundlich zu verhalten, weil ihr euch immer noch streitet, wer eigentlich schuld ist.
»Freut mich«, erwiderte er, und wenn man sie fragte, klang er, als könnte sie getrost zur Hölle fahren.
»Wie läuft das ab?«, fragte er, ehe ihr eine gute Antwort einfiel. »Ich halte nicht viel von solchem Unsinn. Aber meine Mutter ist beseelt von dem Gedanken, mir damit helfen zu können. Weiß der Geier warum.« Seine Worte, sein Tonfall, alles stellte die absolute Ablehnung dar. Doch als Rachel ihm nicht sofort antwortete, sondern ihn lediglich ansah, wich die Finsternis in seinem Blick ein wenig, und er zeigte genau das, was er mit seiner harschen Art verbergen wollte: seine Verunsicherung.
Jeder ihrer Kunden war beim ersten Mal verunsichert. Damit unterschied sich Connor nicht von den anderen. Er war nicht anders als die anderen – selbst, wenn er George Clooney in den Schatten strippen, äh, stellen konnte.
drei
KOPFÜBER IN DIE KISSEN
Statt ihm zu antworten, hatte sich Rachel offenbar aufs Starren verlegt. Sie betrachtete ihn mit einem milden Interesse, als wäre er eine Katze, von der sie nicht wusste, wie sie in ihre Wohnung gekommen war. Sie trug immer noch die sonnengelbe Leinenhose und ein formloses, kurzärmeliges Shirt. Ihr Ellenbogen war aufgeschrammt und hatte leicht geblutet. Es hingen sogar ein paar Fasern von ihrem Wollmantel dran.
»Sie haben die Schürfwunde nicht versorgt«, sagte er. »Sie entsprechen zwar nicht unbedingt der Risikogruppe für eine Blutvergiftung, aber das heißt nicht, dass Sie sie nicht bekommen könnten. Und die Sterblichkeit liegt da bei –«
»Es läuft so ab, dass ich Sie in den Arm nehme«, sagte sie so laut, dass es ihn nicht gewundert hätte, wenn seine Mutter sie gehört hätte. »Unsere Nervensysteme werden sich aufeinander einstellen, und Dopamin wird ausgeschüttet. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Es ist nicht schlimm, wenn Sie einschlafen. Außerdem bestimmen Sie, welche Berührungen Sie möchten.«
»Keine.«