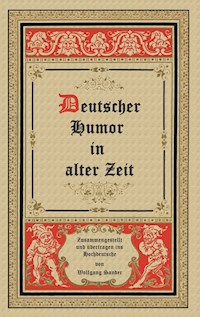
Humor in alter Zeit E-Book
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Humor bildet seit alters her einen Grundzug im Charakter der Deutschen, und es ist lehrreich und interessant, in den uns erhaltenen humorvollen Schriften die Denk- und Ausdrucksweisen einer bestimmten Epoche zu verfolgen. Der Inhalt der ausgewählten Erzählungen soll den Lesern mit einigen Texten einen Querschnitt des deutschen Humors aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert vermitteln, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Die Erzählungen zeigen jedoch den altdeutschen Humor mit all seinen Derb- und Rohheiten, die in jener Zeit weit verbreitet waren. Damals herrschte eine gewisse, naturwüchsige Derbheit, die unsere Vorfahren in ihrer oft groben Sprache zum Ausdruck brachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wolfgang Sander wurde 1927 in Halberstadt geboren. Nach der Arbeitsdienst- und Wehrmachtszeit und fast zweijähriger englischer Gefangenschaft arbeitete er zunächst als Zimmermann.
Anschließend studierte er Pädagogik, wurde Volksschul-, dann Realschullehrer. Seit seiner Pensionierung widmet er sich der Schriftstellerei.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Thomas Murner
Johann Geiler von Kaisersberg
Erasmus von Rotterdam
Martin Luther
Johann Agricola
Johannes Pauli
Jörg Wickram
Martin Montanus
Michael Lindner
Valentin Schumann
Hans Wilhelm Kirchhof
Grillenvertreiber
Otto Melander
Jakob Frey
Simon Dach
Johann Peter de Memel
Abraham a Sancta Clara
Literatur
Vorwort
Seit alters her bildet der Humor einen Grundzug im Charakter des deutschen Volkes, und es ist hochinteressant und lehrreich, in den uns erhaltenen humorvollen Schriften die Denk- und Ausdrucksweisen einer zeitlich begrenzten Epoche zu verfolgen. Wir erhalten dadurch Kenntnis von bestimmten Seiten unseres Volkslebens, von wichtigen und merkwürdigen Erscheinungen der Volksseele.
Es ist das Anliegen der vorliegenden Arbeit, einen Einblick in den deutschen Humor des 15., 16. und 17. Jahrhunderts zu vermitteln mit einigen ausgewählten Texten, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dafür ist die Kulturepoche zu umfangreich. Die ausgewählten Texte zeigen jedoch den altdeutschen Humor mit all‘ seinen Derb- und Rohheiten, die in der Sinnesart jener Zeit vorherrschend waren. Damals bestimmte eben eine gewisse naive, naturwüchsige Derbheit die literarische Szene, die unsere Altvorderen in ihrer oft groben Sprache zum Ausdruck brachten.
Es hat uns manche Mühe gekostet, die Urtexte einigermaßen lesbar ins Hochdeutsche zu übertragen, da sich nicht nur die Orthographie, auch die Wort- und Satzfügungen in eine moderne Umarbeitung oft recht schwierig gestalteten. Denn es gibt für einzelne Wendungen, Wörter und Beugungen keine den modernen Sprachformen völlig entsprechenden Analogien.
Viele der kleinen Erzählungen entsprechen weniger dem eigentlichen Humor, mehr jedoch der scherzhaften oder komischen Satire. Zwischen Humor und Satire sind die Grenzen fließend und gehen ineinander über; denn sie sind ihrem Ursprung und Wesen nach nahe verwandt. Beide richten sich gegen die gesellschaftlichen Torheiten und Auswüchse der jeweiligen Epoche.
Doch sie unterscheiden sich auch: Während der reine Humor warmherzig und liebevoll-heiter ist, ist die Satire ihrer Absicht nach vernichtend, auflösend und zersetzend. Sie ist seelenlos, speit Gift und Galle, auch wenn sie das Zwerchfell erschüttert. Im Humor steckt immer etwas Gutes, er ist human; er weiß, jedes Ding hat seine zwei Seiten („keine Rose ohne Dornen“). Witz und Humor sind fast immer auch lokal gebunden: Was in Berlin schallendes Gelächter auslöst, ist für Stuttgart oft unverständlich.
Zum Schluss wäre noch festzuhalten, dass der Humor keine vorübergehende Erscheinung ist, sondern sich immer wieder neu bildet und wohltuend auf uns Menschen wirkt.
Einleitung
Das Ende des 15. und der Anfang des 16. Jahrhunderts kann als eine Zeit der allgemeinen Wandlung und der Umwälzung angesehen werden. Diese Umgestaltungen strebten in der Ethik eine Besserung der sittlichen Zustände an, im Glaubensbereich eine Reinigung der kirchlichen Verhältnisse, in denen der Verfall traditioneller Zustände am deutlichsten zutage trat. Die Sehnsucht nach Umbildung des gesamten Lebens wurde durch einen Mann in eine bestimmte Richtung gebracht: Martin Luther.
Auch die Literatur wurde von der Bewegung ergriffen. Es waren jedoch keine klassischen Meisterwerke, sondern der überwiegende Einfluss auf die Schriftwerke wurde beherrscht von der realistischen Derbheit jener Epoche. Es sind vor allem Komik und Satire, die damals gegen veraltete, bedrückende und verwerfliche Verhältnisse polemisierten.
Besonders spiegelt sich in den alten Novellen das Selbstbewusstsein des neuen Zeitalters wider. In drastischen Ausdrücken und mit großer Rücksichtslosigkeit wurde hier das Treiben der verschiedenen Klassen der Gesellschaft, der Handwerker, der Bauern, Soldaten und Landstreicher geschildert. Sehr oft sind ihre Inhalte gegen die Pfaffen gerichtet, die sich in weltlicher Ausschweifung und Üppigkeit hervortaten und damit auch ihr Amt missbrauchten.
In einer solchen Zeit fand der Humor reiche Nahrung und fruchtbaren Boden. Bei allem Witz und Spott, bei aller Lächerlichkeit und Schalkheit wurzeln die Schwänke doch in der Wahrheit der sittlichen Motive.
Viele der lustigen Erzählungen sind in sogenannten Schwänkesammlungen zusammen getragen worden, in denen sich der Volkshumor am lebendigsten widerspiegelt.
Dazu gehören: das Büchlein Schimpf und Ernst, das der Barfüßermönch Johannes Pauli 1519 schrieb. Es liefert einen reichen Schatz der Sittengeschichte seiner Zeit. Überall stößt man auf das Treiben der niederen Stände; überall sind Scherz und Ernst in weiser Absicht gemischt. Mönche, Nonnen, Edelleute, Ärzte und Gelehrte werden bewitzelt und verspottet.
In dem Rollwagenbüchlein von Jörg Wickram finden wir eine stattliche Anzahl von Schwänken, Anekdoten und Possen, die einen unverwüstlichen Humor beinhalten. Wickram beleuchtet die unterschiedlichsten Lebensverhältnisse und wollte nicht nur unterhalten, sondern auch einen sittlichen Einfluss auf sie ausüben.
Der Wegkürzer (1557) von Martin Montanus ist eine Art Fortsetzung des Rollwagenbüchleins und enthält eine Reihe bunter Geschichten aus allen Ständen.
Der Wendunmuth (1563) von Hans Wilhelm Kirchhof ist eine Sammlung, die in humoristischer Weise gewisse Züge der Volkstradition aufs Korn nimmt und ebenfalls sittengeschichtliche Züge aufweist.
Zu erwähnen sind noch ähnliche Novellensammlungen wie das Rastbüchlein (1558) von Lindner, das Nachtbüchlein (1559) von Schumann und Joco-Seria (1617) von Melander.
Neben diesen Schwänkesammlungen entstanden im 16. Jahrhundert die sogenannten Volksbücher, die fast alle ihre Gestalt bis auf den heutigen Tag bewahrt haben. Auch in ihren Inhalten spiegelt sich der damals herrschende Volksgeist wider, der danach strebte, den unnatürlichen Verhältnissen des Mittelalters ein Ende zu bereiten. Gegen die Macht der herrschenden Klasse setzte man als Waffe List und Betrug ein, und man war stolz, mit Grobheiten die Feinheiten der Mächtigen anzugehen, mit Schlauheit und Mutterwitz, versteckt hinter Einfalt und Naivität, der geistigen Überlegenheit der Gelehrten gegenüber zu treten.
Das weitaus bekannteste dieser Volksbücher war das von Dil Ulenspiegel, in dem Eulenspiegel jeden Auftrag nach genauem Wortlaut ausführt, aber nicht sinngemäß. Er macht es niemandem recht, jedoch nicht aus Dummheit oder Bosheit. Allein der Schalk treibt ihn um, unter dessen Oberfläche sich nicht nur der Unmut des Volkes gegen kirchlichen Formalismus, sondern auch die Überlegenheit eines lebendigen Volksgeistes widerspiegeln.
Das Volksbuch von Till Eulenspiegel wurde vielfach bearbeitet, erweitert und in fremde Sprachen übersetzt.
Neben Eulenspiegel stehen die Geschichten von den Schildbürgern - auch Lalenbuch genannt - in denen die Einfalt und Großtuerei des deutschen Bürgertums verspottet werden.
Die Schildbürger, so erfährt der Suchende, waren bekannt wegen ihrer Weisheit und Klugheit, weswegen sie von Fürsten und Edelleuten vieler Länder gesucht wurden. Deshalb hielten sich die Schildbürger über lange Zeiten in fremden Ländern auf. Ihr eigenes Gemeinwesen und dessen Verwaltung haben sie während ihrer Abwesenheit ihren Frauen überlassen. Wodurch alles derart in Unordnung geriet, dass die Frauen beschlossen, ihre Männer nach Hause zu holen. Die Schildbürger folgten dem Ruf ihrer Frauen und fanden alles dermaßen durcheinander und ungeordnet, dass sie in einer großen Ratsversammlung beschlossen, künftig alle anstehenden Dinge mit und in Torheit zu erledigen. Darüber wurden sie nach einiger Zeit selber zu Toren, die sich um ihr eigenes Hab und Gut brachten.
Seitdem ist die ganze Welt voller Toren, so dass sie (die Welt) mit Fug und Recht als ein großes Schilda oder Witzenburg genannt werden kann, in dem bitterböser, derber, von Spott triefender, aber auch leiser, manchmal belehrender Humor auf die eine oder andere Weise immer wieder seinen Niederschlag findet.
Denn der Humor ist ein Produkt des Volksgeistes; wo dieser sich gehemmt oder unterdrückt fühlt, kann er nur kümmerlich wachsen und gedeihen. Das war im 17. Jahrhundert so, als Deutschland durch den 30 jährigen Krieg zerrüttet wurde und deshalb im politischen Leben und in der gesamten Gesellschaft Ohnmacht, Zerrissenheit und geistiger Stumpfsinn herrschten.
Ein gesunder Humor konnte sich in solcher Atmosphäre unmöglich entfalten und gedeihen.
Wolfgang Sander
Thomas Murner
(1475 – 1536)
Der Mönch Thomas Murner lehnte sich in seinen Geschichten an Sebastian Brant (1458-1521) an, war ihm jedoch an Sprachfertigkeit und erfinderischer Fantasie überlegen. Sein Spott war ätzend, den er über die verschiedensten Erscheinungsformen des Lasters und der Torheit über die Betroffenen ergoss. Er war zwar kein ausgesprochener Humorist, doch fehlt es in seinen Geschichten nicht ganz an Humor.
Wie Eulenspiegel einem Pferd goldene Eisen aufschlagen ließ, die der König von Dänemark bezahlen musste
Eulenspiegel war solch ein bekannter Höfling, dass seine Tüchtigkeit vielen Fürsten und anderen hohen Herren zu Gehör kam, die darüber erstaunten, was man alles über ihn erzählte. Das mochten die Herren und Fürsten gern leiden und gaben ihm Kleidung, Nahrung, Geld und sogar ein Pferd.
Eines Tages kam er zu dem König von Dänemark, der mochte ihn leiden und bat ihn, dass er etwas Abenteuerliches anstelle. Dann wolle er ihm auch sein Pferd mit dem allerbesten Hufbeschlag ausstatten. Verschmitzt fragte Eulenspiegel den König, ob er seinen Worten wirklich glauben dürfte. Der König antwortete: „Ja, auf jeden Fall“, sofern er (Eulenspiegel) nach seinen Worten tue, was er ihm sage und auftrug – „dann will ich alles halten.“
Schmunzelnd ritt Eulenspiegel zum Goldschmied und ließ sein Pferd mit goldenen Hufeisen und silbernen Nägeln beschlagen. Dann ging er zum König und wollte den Hufbeschlag bezahlt haben. „Ja“, meinte der, „nun muss ich wohl zu meinem Wort stehen“ und wies seinen Schreiber an, den Hufbeschlag gleich zu bezahlen.
Der Schreiber aber meinte, es sei ein schlechter Hufschmied gewesen, denn Eulenspiegel wäre zu einem Goldschmied gegangen und der wolle 100 dänische Kronen haben. Der Schreiber weigerte sich, diese Summe zu bezahlen, ging zum König und erzählte ihm die Geschichte. Der ließ Eulenspiegel holen und fragte ihn: „Eulenspiegel, was hast du für einen teuren Beschlag machen lassen? Wenn ich alle meine Pferde so beschlagen lassen wollte, müsste ich bald Land und Leute verkaufen. Ich habe nicht gemeint, dass du das Pferd mit Gold beschlagen lässt.“
Darauf antwortete Eulenspiegel: „Gnädiger König, Ihr sagtet, es sollte der beste Beschlag sein, und ich sollte Euren ehrenwerten Worten voll und ganz vertrauen. Deshalb meinte ich, es gibt keinen besseren Hufbeschlag als den aus Silber und Gold.“
Schmunzelnd antwortete der König: „Du bist ein schlauer Höfling, Eulenspiegel, denn du hast getan, was ich dich geheißen habe.“ Lächelnd, aber auch ein wenig beschämt, zahlte er die hundert Kronen für den Hufbeschlag.
Eulenspiegel aber ließ die goldenen Hufeisen wieder runter reißen und sein Pferd mit normalen Eisen beschlagen. Er blieb bis zum Ende seines Lebens am Hofe des Königs
Wie Eulenspiegel in der Ostermesse ein Spiel spielte, bei dem sich der Pfarrer und seine Haushälterin mit den Bauern rauften und schlugen
Als das Osterfest nahte, sagte der Pfarrer zu Eulenspiegel, seinem Messdiener: „Es ist ein Brauch, dass die Bauern in der Nacht zu Ostern ein Spiel aufführen, das beinhaltet, wie unser Herr auferstanden ist aus dem Grab.“
So kam es, dass Eulenspiegel überlegte, ob es angebracht wäre, bei den Proben und dem Spiel zu helfen. Er überlegte sich, wie das Marienspiel von den Bauern zu spielen sei. Deshalb suchte er den Pfarrer auf und sagte zu ihm: „Es gibt hier keinen Bauern, der für das Spiel genug gelehrt ist. Dazu müsst Ihr mir Eure Magd geben, die kann lesen und schreiben.“
Der Pfarrer erwiderte: „Ja, ja, nimm sie nur dafür. Es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Meine Magd ist schon öfter dabei gewesen.“
Der Haushälterin war das nur recht, sie wollte der Engel im Grab sein, wenn sie nur die Reime alle auswendig lernen konnte.
Danach suchte Eulenspiegel zwei Bauern auf und nahm sie zum Proben mit. Die drei wollten die Maria gestalten. Den einen Bauern lehrte er die Reime in Latein, darin war der Pfarrer der Herrgott, der aus dem Grab auferstehen sollte.
Als nun Eulenspiegel bei der Aufführung mit seinen zwei Bauern, die als Maria eingeübt waren, an das Grab kam, da sagte die Haushälterin, die einen Engel im Grab spielte, ihre Reime auf Latein: „Quem queritis? Wen sucht Ihr hier?“
Da erwiderte der Bauer, der die erste Maria spielte, wie es ihm Eulenspiegel beigebracht hatte: „Wir suchen eine alte, einäugige Pfaffenhure.“
Als die Haushälterin hörte, dass sie wegen ihres einen Auges so hässlich verspottet wird, wurde sie giftig und zornig auf Eulenspiegel, sprang aus dem Grab und schrie, sie wolle ihm mit den Fäusten ins Gesicht schlagen, schlug wie wild um sich und traf den einen Bauern so stark im Gesicht, dass ihm ein Auge anschwoll. Als der andere Bauer das sah, schlug er mit der Faust zu und traf die Haushälterin am Kopf, dass ihr die umgehängten Flügel wegrutschten.
Der empörte Pfarrer ließ die Fahne fallen, kam seiner Haushälterin zu Hilfe, riss den Bauern gewaltig an den Haaren, so dass sie beide in das Grab fielen.
Das aber rief alle anderen Bauern auf den Plan, sie liefen herzu, es gab mächtiges Geschrei und eine große Prügelei. Mal lagen der Pfarrer mit seiner Haushälterin unten, mal die Bauern, mal die beiden Mariengestalten, bis einige besonnene Bauern die Streithähne auseinander zogen.
Eulenspiegel aber hatte sich pfiffig aus allem rausgehalten, lief rechtzeitig aus der Kirche, verließ schleunigst das Dorf und kam nicht wieder.
Hoffentlich bekommt die Gemeinde bald einen anderen Kirchendiener.
Wie Eulenspiegel einen Wirt mit dem Klang des Geldes bezahlte
Lange Zeit lebte Eulenspiegel in einer Kölner Herberge. Da passierte es eines Tages, dass das Essen in der Küche zu spät auf das Feuer gestellt wurde, so dass es erst am späten Nachmittag fertig gewesen wäre. Es verdross Eulenspiegel doch sehr, dass er so lange fasten sollte. Der Wirt sah es ihm an und bemerkte seinen Verdruss darüber. Deshalb sagte er zu ihm: „Wer nicht warten kann, bis das Essen gar ist, der soll essen, was er hat.“ Eulenspiegel holte sich eine trockene Semmel und aß sie auf. Dann setzte er sich an den Herd und übergoss den Braten so lange, bis er gar war.
Der Tisch wurde gedeckt, das Essen darauf gestellt, der Wirt setzte sich zu den Gästen, Eulenspiegel aber blieb an dem Herd in der Küche sitzen.
Da fragte der Wirt: „Nanu, Eulenspiegel, willst du nicht mit am Tisch sitzen?“
„Nein“, entgegnete der, „ich möchte nichts essen, ich bin schon satt geworden von dem Geruch des Gebratenen.“
Dazu schwieg der Wirt und aß mit den Gästen. Nach dem Essen bezahlten alle ihre Zeche; der eine wanderte weiter, der andere blieb noch, und Eulenspiegel saß immer noch am Herdfeuer. Der Wirt kam mit dem Zahlbrett, er war zornig und sagte zu Eulenspiegel, er solle zwei Kölnische Pfennig auf das Zahlbrett legen für das Essen.
Listig fragte Eulenspiegel: „Herr Wirt, seid Ihr solch ein Mann, der Geld nimmt von einem, der Eure Kost nicht gegessen hat?“
Der Wirt jedoch meinte, er solle nur ruhig das Geld geben, auch wenn er nicht gegessen habe, so sei er doch von dem Duft des Bratens satt geworden. Und das sei so viel, als hätte er am Tisch gesessen und den Braten verzehrt. Das müsse er ihm nun auch anrechnen.
Da zog Eulenspiegel einen Kölnischen Pfennig aus der Tasche, warf ihn auf den Tisch und sagte: „Herr Wirt, hört Ihr wohl diesen Klang?“
Der Wirt antwortete: „Diesen Klang höre ich wohl.“





























