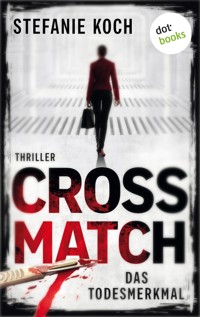Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die strahlende Côte d'Azur zeigt ihre Schattenseiten: der fesselnde Südfrankreich-Krimi »Hurenpoker« von Stefanie Koch als eBook bei dotbooks. Wenn das Spiel mit dem Feuer zur tödlichen Gefahr wird … Die Malerin Samantha ist bekannt für ihren Lebenshunger: Sie flirtet mit Männern und der Gefahr und streift des Nachts durch die dunkelsten Viertel von Marseille. Ist sie dabei nun einen Schritt zu weit gegangen? Als Samantha von einem ihrer nächtlichen Ausflüge nicht nach Hause kommt, sind ihre Freundinnen Elisabeth, Bella und Rosi zunächst sicher, dass sie bald wieder auftauchen wird, mit einem Lächeln und einer neuen, skandalösen Geschichte. Doch dann erfahren die drei von den grausam zugerichteten Frauenleichen, die man im Hafen von Marseille gefunden hat – den Opfern rivalisierender Mafiabosse, die mit Frauen handeln wie mit Waren. Ist Samantha den falschen Männern auf die Füße getreten? Es gibt für die Freundinnen nur einen Weg, das herauszufinden … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der fesselnde Kriminalroman »Hurenpoker« von Stefanie Koch wird Frankreich-Fans und die Leserinnen und Leser der Bestseller von Sophie Bonnet begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn das Spiel mit dem Feuer zur tödlichen Gefahr wird … Die Malerin Samantha ist bekannt für ihren Lebenshunger: Sie flirtet mit Männern und der Gefahr und streift des Nachts durch die dunkelsten Viertel von Marseille. Ist sie dabei nun einen Schritt zu weit gegangen? Als Samantha von einem ihrer nächtlichen Ausflüge nicht nach Hause kommt, sind ihre Freundinnen Elisabeth, Bella und Rosi zunächst sicher, dass sie bald wieder auftauchen wird, mit einem Lächeln und einer neuen, skandalösen Geschichte. Doch dann erfahren die drei von den grausam zugerichteten Frauenleichen, die man im Hafen von Marseille gefunden hat – den Opfern rivalisierender Mafiabosse, die mit Frauen handeln wie mit Waren. Ist Samantha den falschen Männern auf die Füße getreten? Es gibt für die Freundinnen nur einen Weg, das herauszufinden …
Über die Autorin:
Stefanie Koch, geboren 1966 in Wuppertal, studierte in Frankreich, arbeitete in Italien, Thailand und Bangkok und lebt heute in Düsseldorf, wo sie unter anderem als Datenschutzbeauftragte in einem Stromkonzern tätig ist. Seit 2003 veröffentlicht sie erfolgreich Thriller und Kriminalromane, sowohl unter ihrem echten Namen als auch unter dem Pseudonym Mia Winter.
Die Autorin im Internet: www.stefanie-koch.com
Bei dotbooks erschienen bereits Stefanie Kochs Thriller »CROSSMATCH – Das Todesmerkmal«, der rabenschwarze Kurzroman »TRULLA – Mord ist immer eine Lösung« sowie die erfolgreiche Krimiserie rund um den Düsseldorfer Kommissar Lavalle:
„KOMMISSAR LAVALLE – Der erste Fall: Im Haus des Hutmachers«»KOMMISSAR LAVALLE – Der zweite Fall: Die Karte des Todes«»KOMMISSAR LAVALLE – Der dritte Fall: Die Stunde der Artisten«»KOMMISSAR LAVALLE – Der vierte Fall: Der Kopf der Schlange«
***
eBook-Ausgabe August 2021
Die gedruckte Originalausgabe dieses Kriminalromans erschien bei ars vivendi und ist über den Buchhandel erhältlich. Mehr Information über das Programm von ars vivendi finden Sie hier: www.arsvivendi.com
Copyright © der gedruckten Originalausgabe 2012 by ars vivendi Verlag GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Copyright © der eBook-Ausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung von AdobeStock/Kavalenkava
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-863-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Hurenpoker« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stefanie Koch
Hurenpoker
Kriminalroman
dotbooks.
Für Nina
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein, 14.03.1879–18.04.1955
Prolog
Jérômes Handy klingelte leise, aber unüberhörbar. Er hob vorsichtig den Kopf, tastete mit der Hand den Boden ab und fand das Telefon in seinem Schuh. Noch nicht ganz wach, drückte er den Ton weg, drehte sich zu Samantha um und studierte im kalten Mondlicht ihr Gesicht. Der Mund war fest geschlossen, an den Wimpern klebte ein feiner Rest Tusche. Die Haare umrahmten ihre Stirn wie trockenes Stroh.
Seit einigen Wochen fragte er sich, ob er sie liebte. Kontakt zu ihr aufgenommen hatte er jedoch ursprünglich aus einem ganz anderen Grund. Das mit der Liebe war allmählich gekommen, und dann, eines Tages, als er sie malen sah, spürte er diesen Stich im Herzen. Wenig später – Samantha war nicht zu Hause – schlich er ins Atelier, erkannte sich in ihren Bildern wieder und erschrak. Es fühlte sich an, als habe sie ihm die Seele geklaut: Sie lag wie ein Stück rohes Fleisch in ihren Bildern: seziert und auf sonderbare Weise gewandelt. Ihre Malerei hatte etwas Magisches, das ihn anzog, ohne dass er sich dagegen wehren konnte, und jedes Mal, wenn es eine Gelegenheit dazu gab, stahl er sich ins Atelier, um sich selbst zu begegnen.
Er fühlte eine beängstigende Leere in sich aufkommen, als er spürte, dass ihr Interesse an ihm verschwand. Ob sie ihn bald wegschicken würde wie die anderen? »Verlieren«, hatte sie von oben herab gesagt, »tut nur, wer festhalten will, und es gewinnt, wer lachend loslässt.« Jérôme wusste nicht mehr, wie er bei diesem Spiel auf die falsche Seite geraten war, aber er war es, ganz eindeutig.
Seit Ende Dezember arbeitete Samantha an einer Szene vom Industriehafen. Einmal platzte er ins Atelier, als Sam eine der ermordeten Frauen ohne Gesicht malte. Er selbst kannte Fotos vom Tatort und wunderte sich, woher die Malerin ihr Detailwissen hatte. »Ich finde es, während ich male, deshalb werde ich auch ihre Gesichter wiederfinden und wer weiß, vielleicht ja auch ihre Mörder«, sagte sie damals mit ihrem zweideutigen Lächeln. Bei seinem letzten Besuch waren die Bilder der ermordeten Frauen verschwunden. »Welche Frauen?«, fragte Samantha, als er wissen wollte, was mit den Bildern geschehen war.
Die Kirchturmuhr schlug fünf. In einer halben Stunde begann sein Dienst.
»Willst du einen Kaffee?«, fragte Samantha mit vom Schlaf heiserer Stimme.
»Nein«, antwortete er, stand auf und zog die schwarze Polizeiuniform an. Er biss sich auf die Unterlippe. Er musste es jetzt sagen, sonst würde es ihn den ganzen Tag nicht mehr loslassen.
»Bitte, geh heute Nacht nicht wieder nach Marseille.«
Sie stand auf, wickelte das Bettlaken um ihren mageren Körper und grinste. »Seit wann stört dich das?«
»Ist das wichtig?«, blaffte er.
»Glaubst du, ich habe es nicht bemerkt?«, fragte sie mit so viel Spott in der Stimme, dass er seine Hand zur Faust ballte.
»Tu es nicht.«
»Jérôme, zum letzten Mal: Es geht dich nichts an.«
»Wie willst du den Flug nach München schaffen?«
Sie legte ihre sehnige Hand auf seine Wange und blickte ihm gerade in die Augen. »Du findest bitte allein hinaus.« Sie ging an ihm vorbei. Kurz danach hörte er die Tür zum Atelier.
Samantha öffnete die Flügeltür, um die Dämpfe der Lack- und Acrylfarben freizulassen. Zum Malen brauchte sie diesen intensiven Geruch, es war, als würde er die Inspiration erst ermöglichen. Sie trat auf die Dachterrasse, die einen herrlichen Ausblick auf die fast 400 Meter hohe Steilküste bot, die Cassis und das Hafenbecken umschloss. Sie reckte ihre farbverschmierten Arme in den Winterhimmel der Provence und seufzte, weil es ihr der eigenen strengen Meinung nach nie gelungen war, das besondere Licht dieser Landschaft in ihren Bildern einzufangen. Sie betrachtete das spärliche Treiben zu dieser frühen Stunde auf dem Kai. Es musste gegen acht Uhr sein. Die Ausflugsboote, die im Sommer die nie enden wollenden Ströme von Touristen in die Fjorde fuhren, lagen im sicheren Trockendock, aber die bunten Boote der Fischer zerrten, vom rauen Wind getrieben, an ihren Tauen. Für heute war ein Sturm vorausgesagt, sodass die Fischer im Hafen blieben. »Und mindestens die Hälfte von ihnen wird bereits betrunken sein«, murmelte sie vor sich hin. Der Wind vom Festland drückte einen eisigen Nebel von der Steilküste ins Dorf hinab. In weniger als einer halben Stunde würden die Häuser um den Platz herum in ein milchiges Licht getaucht sein bis zum Mittag, wenn die Sonne die Nebel auflöste.
Samantha wandte ihren Blick von der Steilküste ab und sah Lizzy über den Platz kommen, einen schweren Korb am Arm. Mit der freien Hand machte sie eine wegwerfende Bewegung zu den alten Männern in ihren dicken Jacken, die die Terrasse von Francis’ Bar bevölkerten, eine der wenigen Kneipen, die im Winter geöffnet hatten. Lizzy stellte kurz den Korb ab, stützte ihre Hände in die Hüften und rief den Männern etwas zu. Samantha konnte die Worte auf ihrer Dachterrasse nicht hören, aber durch das grölende Lachen, das zu ihr heraufdrang, wusste sie, dass es etwas Anzügliches sein musste. Lizzy schritt mit wiegenden Hüften weiter. Mindestens die Hälfte dieser alten Männer musste früher in die schöne Mulattin mit dem nussbraunen Teint der Mutter und den graublauen Augen des nordfranzösischen Vaters verliebt gewesen sein.
Als Lizzy fast den Hauseingang erreicht hatte, sprang Samantha, jeweils drei Stufen auf einmal nehmend, die Treppen der vier Etagen hinunter und riss die Tür in dem Augenblick auf, in dem Lizzy den Schlüssel ins Schloss stecken wollte.
»Mädel, schon ausgeschlafen?«
Samantha grinste, nahm einen Apfel aus dem Korb und biss hinein. »Ich habe seit fünf Uhr gearbeitet.« Sie hielt ihrer Haushälterin zum Beweis die verschmierten Hände hin.
»Musste Jérôme zur Frühschicht?«, frotzelte Lizzy, die wusste, wie gern Samantha lange schlief. Sie füllte die Espressokanne mit Wasser und frisch gemahlenem Kaffee. Hinter ihrem Rücken streckte Samantha ihr die Zunge heraus. »In welchem Zimmer wart ihr?«
»Drei A.«
Samantha nahm aus Prinzip keinen Mann mit in ihr Schlafzimmer, sondern benutzte die verschiedenen Hotelzimmer, die im Winter leer blieben. Dem Dorf war die deutsche Malerin ein Rätsel, und erst nach dem achten Wodka gewährte Lizzy den Bewohnern gelegentlich einen Blick hinter die Kulissen. Daher wussten alle, dass Samantha Mills ihrem Exmann, einem englischen Hotelier, die Blaue Rose nach zwei Ehejahren abgeluchst und ihn selbst in ein Flugzeug zurück nach England gesetzt hatte.
»Wann kommen deine Freundinnen an?«
»Sie landen gegen elf in Marseille. Schätze, so gegen Mittag sind sie hier.«
Die Espressokanne zischte und hüllte die Küche in den bitter-herben Kaffeeduft. Lizzy zündete sich eine selbst gedrehte Zigarette an, füllte beiden eine kleine Tasse, häufte in ihre drei, in Sams einen Löffel braunen Zucker, rührte und reichte ihrer Chefin mit einem Nicken die Tasse. »Der Fischhändler hat mir seine Reste mitgegeben. Willst du lieber Bouillabaisse oder die passierte Version?« Mit einem Schluck leerte Lizzy ihre Tasse und goss sich nach. »Bouillabaisse hat Bella sich gewünscht.« Samantha drehte ihre Haare in ein Einmachgummi. »Wir werden überhaupt nur Fisch essen diese Woche, Rosi mag zurzeit kein Fleisch.«
»Warum nicht?« Lizzy nahm einen Tabakbeutel aus ihrem Mantel. Sie behielt den Mantel stets an, bis die Küche warm war, und hängte ihn erst in den Abstellraum, wenn sie zu kochen begann. Sie legte den Tabakbeutel auf den gekachelten Küchentisch und packte den Korb aus.
»Rosi schreibt gerade eine Forschungsarbeit über die Virenübertragung mittels Importfleisch.«
»Hier gibt es kein Importfleisch. Paul verkauft nur das Fleisch seiner eigenen Tiere«, murrte Lizzy und kräuselte die Nase. Sie mochte es gar nicht, wenn ihre sonst freie Wahl in der Küche eingeschränkt wurde.
»Bist du da wirklich so sicher?«
Eine geringschätzige Handbewegung war die Antwort.
Neben Schalotten, Möhren, Porree und frischem Knoblauch landete die Tageszeitung auf dem Tisch. Oben rechts stand eine kleine Notiz: Mord an Marseiller Weihnachtsleichen bleibt ungeklärt. Lesen Sie weiter auf Seite 5. Samantha blätterte, in der linken Hand die kleine Tasse, zur angegebenen Stelle und erfuhr, dass weder die Identität der beiden Frauen geklärt noch eine Spur zu deren Mörder gefunden werden konnte. Die Presse bezeichnete die toten Frauen als ›Weihnachtsleichen‹, weil sie am 25. und 26. Dezember ermordet worden waren.
Ein anonymer Anruf am 27. Dezember hatte die Polizei in den Holzhafen geschickt. Die Frauen waren auf gestapeltem Holz aufgebahrt gewesen, wie für ein Verbrennungszeremoniell. Sie hatten keine Augen mehr, keine Gesichtshaut, keine Zähne, keine Fingerkuppen. Zudem gab es keine Vermisstenmeldung, weshalb die Polizei annahm, dass es sich bei ihnen um zwei Illegale handelte. Der heutige Artikel bestand überwiegend aus Anklagen gegen die Gendarmerie Nationale, die den Fall Anfang Januar übernommen hatte. Merkwürdigerweise schrieb keine auch noch so schlechte Zeitung über das, was alle dachten und Samantha wusste: über den Krieg im Hurenmilieu. Dass die Leichen mitten im Holzhafen wie zur Verbrennung bereit lagen, das sollte eine klare Warnung an den Griechen Drakon sein, den Chef der hiesigen Mafia. Jedes Kind in Marseille wusste: Wenn der Holzhafen Feuer fängt, schmilzt die Hafenstadt. Drakon hatte Samantha zwar nicht gesagt, worum es genau ging, ihr jedoch geraten, ihre Bilder über die ermordeten Huren an einem sicheren Ort zu verwahren und bis auf Weiteres nicht auszustellen. Immerhin war der Präsident des Departements im Wahlkampf vor zwei Jahren damit angetreten, die Kriminalitätsrate zu halbieren und die käufliche Liebe aus Marseille zu verbannen.
Samantha ließ die Zeitung offen liegen, sah aus dem Küchenfenster und bemerkte Julian, den Sohn des Gärtners. »Was macht der in unserem Gemüsegarten?«
»Eine Drainage legen.«
»Ich könnte ihm ein wenig helfen.«
»Er ist siebzehn.«
»Na und? Er ist hübsch.«
Lizzy verknotete ein hellblaues Kopftuch, das die Farbe ihrer Augen unterstrich, im Nacken. Sie sah Samantha an und sagte: »Wahrscheinlich hat sein Alter ihn geschickt, weil so ein grüner Junge am besten auf einem alten Fahrrad das Reiten lernt.«
Samantha schnippte mit den Fingern. »Dann solltest du vielleicht hinausgehen und ihm helfen.« Sie kicherten beide wie kleine Mädchen.
»Jacques hat gesagt, du hast neue Post von Mr Mills?«
»Dieser Postbote ist wirklich ein Tratschweib schlimmster Sorte.«
»Sei nicht so streng. Im Winter passiert einfach zu wenig. Also, was hat Mr Mills geschrieben?«
»Er behauptet jetzt, es gibt einen Zeugen, der bestätigt, dass er mir das Hotel überschrieben hat, weil ich ihm das Messer an die Kehle gehalten habe.« Samantha nahm wieder ihren Apfel, biss hinein und sprach mit vollem Mund weiter. »Elisabeth meint, damit kommt er genauso wenig durch wie mit dem angeblichen Abdruck des Messers am Hals oder der aus der Situation entstandenen zittrigen Unterschrift.«
Lizzy verstand gut, dass Mr Mills um das Hotel kämpfte, denn die Blaue Rose im Hafen von Cassis war ein paar Millionen wert und erfuhr jedes Jahr eine ansehnliche Preissteigerung. Der zähe Engländer hatte sich mit Erfolg eine eigene Hotelkette aufgebaut – ohne großen Namen dahinter, dafür jedes Haus klein, aber fein und den örtlichen Bedürfnissen angepasst. Hier in Cassis war die schönste Perle der Kette gewesen, und der Verlust bedeutete eine empfindliche Einbuße für ihn.
Obwohl Lizzy Samantha von Anfang an mochte, hatte sie Mr Mills von einer Hochzeit mit ihr abgeraten. Dem Blitzen ihrer grünen Augen verfallen, war er davon ausgegangen, wenn er Samantha den Traum eines Ateliers über den Dächern von Cassis erfüllte, würde sie sich die Zeit seiner Abwesenheit mit Malerei vertreiben und ein Ehevertrag sei unnötig. Zwei Jahre hielt die Illusion, an deren Ende er dann doch dieses Hotel verlor. Lizzy wusste nicht, wie Sam das geschafft hatte. In den letzten fünf Jahren waren seitdem zahllose Anwaltsschreiben und Liebhaber gefolgt. Letztere hatten Samantha in Cassis die Bezeichnung »deutsche Hure« eingebracht. »Künstlerschlampe«, nannte Lizzy sie, und das war durchaus wohlwollend gemeint.
Samantha warf den Rest ihres Apfels in den Kompost und stellte sich wieder ans Fenster. »Ich glaube, ein wenig Arbeit in der frischen Luft wird mir guttun.«
Die viel kleinere Lizzy trat neben sie und sagte: »Ja, Julian sieht wirklich so aus, als könnte er Hilfe brauchen.«
Kapitel 1
Wie oft vor den großen Winterstürmen hatte der Wind eine Pause eingelegt, sodass die Mittagssonne Cassis freundlich wärmte.
»Sie arbeitet wie ein Mann«, war Elisabeths erster Kommentar, als die drei Freundinnen zwei Stunden später am selben Küchenfenster standen.
»Und sie ist dreckig«, fügte Rosi hinzu, die als Virologin jeglichem Schmutz begegnete, als sei ein Mikrokosmos unbekannter Bakterien zu erobern.
»Wollen wir sie nicht begrüßen?«, fragte Bella.
»Schau dir diese hässlichen Gummistiefel an«, fuhr Elisabeth unbeirrt fort, der es völlig unverständlich war, warum Samantha so wenig auf ihr äußeres Erscheinungsbild achtete, »und die nackten weißen Beine. Man sollte wirklich nicht meinen, dass sie seit Jahren im Süden lebt.«
»Immerhin ist sie geschminkt«, verteidigte sie Bella.
Rosi schob ihr Gesicht näher an das Fenster, grinste und sagte: »Sie flirtet mit diesem Jungspund. Seht mal, wie er sie anhimmelt.«
»Ansabbert«, befand Elisabeth.
»Na, na, nicht so streng, du weißt doch: In diesem Alter können sie sich kaum kontrollieren.«
Elisabeth schüttelte den Kopf.
»Machen wir uns nichts vor«, sagte Rosi und zog dabei ihr Chanelkostüm zurecht, »sie hat sich in all den Jahren, die wir uns nun kennen, kein bisschen verändert.«
»Dem Himmel sei Dank«, bekräftigte Bella aus voller Überzeugung. In dem Moment drehte Samantha sich zu ihnen um und entdeckte ihre Freundinnen am Fenster. Als ob sie einer geheimen Choreografie folgten, hoben alle drei den rechten Arm und winkten ihr zu. Samantha ließ die Schaufel auf den ausgehobenen Lehmboden fallen und war mit zwei Schritten in der Küche.
»Ausgefallenes Designerstück – und so kleidsam«, bemerkte Elisabeth mit hochgezogenen Augenbrauen und einem strengen Blick auf die kurze, dreckverkrustete Cordhose.
»Als Rechtsanwältin konntest du deine Boshaftigkeit schon immer in charmant daherkommendem Spott verbergen.« Sie umarmten sich stürmisch und lachten.
»Es tut so gut, dich endlich wiederzusehen«, sagte Elisabeth leise an Samanthas Schulter, die ihre Hand ausstreckte, um Rosi und Bella in die Umarmung mit einzubeziehen.
Rosi löste sich als Erste, machte eine Kopfbewegung Richtung Garten und fragte: »Und, kann er was?«
»Weiß ich noch nicht«, antwortete Samantha und bröselte zu Lizzys Missfallen den Lehm an ihren Händen in das Waschbecken, bevor sie sich wusch.
»Willst du es denn wissen?«
»Vielleicht, mal sehen. Er ist hübsch.«
Elisabeth, mit neunundvierzig die Älteste unter ihnen, schüttelte den Kopf. »So gut und lange ich dich kenne: Dieses Faible für junge Männer werde ich nie kapieren. Ich bin heilfroh, dass ich mit dem langweiligen Rumgemache der Jugend nichts mehr zu tun habe.«
»Es kommt darauf an, wie du sie anleitest.« Samantha trocknete sich die Hände am Geschirrtuch und warf es ins Waschbecken.
»Es reicht mir, meine Kanzlei zu leiten. Im Bett will ich nicht auch noch die Chefin sein.«
»Ich weiß«, sagte Samantha und legte Elisabeth den Arm um die Schulter. »Kommt, ich bringe euch auf eure Zimmer.«
Bepackt mit ihren Taschen folgten sie Samantha die breite Treppe in den ersten Stock, wo die Räume lagen, die als Suiten im Hotelkatalog angepriesen wurden.
Samantha strich ihrer ältesten Freundin über die streng in einem Dutt aufgesteckten blonden Haare. »Noch kein Kurzhaarschnitt?«
Elisabeth ließ erschöpft ihre Ledertaschen auf den Boden und sich selbst in den mit rotem Samt bezogenen Sessel fallen. »Ich warte auf deine Vorgabe.«
Samantha lachte und öffnete die Tür zum Nebenzimmer, in dem Rosi und Bella schlafen würden. Das Nachbarzimmer glänzte in satten Blautönen, durch die der Hafen vor den Fenstern mit seinen blauen Booten wie eine Verlängerung wirkte. Blaue Hortensien standen in Bodenvasen, selbst im Bad. Elisabeth kam zu ihnen, als Rosi eben fragte: »Und, was liegt im Moment an?«
Samantha berichtete kurz von den Weihnachtsleichen, von denen jeder annahm, dass sie etwas mit dem Milieu in Marseille zu tun hatten. Seit einiger Zeit gab es Gerüchte, dass Russen sich in der Hafenstadt La Ciotat breitmachten, die über die ermordeten Huren jetzt auch ein bisschen vom großen Kuchen abhaben wollten. »Es waren ziemlich hässliche Morde«, endete Samantha.
Elisabeths Blick ruhte auf ihr. Die Anwältin kannte Sam am längsten und ahnte, dass ihre Freundin über die Morde weit mehr wusste, als sie gerade erzählt hatte.
Bella strich über die schillernde Seide der Vorhänge und lobte Samanthas Exmann, der für die Ausstattung der Suiten verantwortlich gewesen war. »Die verschiedenen Einrichtungen erstaunen mich immer wieder. Mr Mills hat eindeutig Geschmack.«
»Was Hotels angeht«, ergänzte Elisabeth lakonisch.
»Und Liebe zum Detail«, fügte Rosi hinzu, griff unter ihre Bluse und befreite sich mit einem Seufzer der Erleichterung von ihrem BH.
»Hat sich das eigentlich im Bett bemerkbar gemacht?«, fragte Bella, für die das Thema Sex so selbstverständlich war wie das tägliche Essen.
»Unwesentlich. Entweder war Mr Mills die Ausnahme oder das Gerücht ist schlichtweg gelogen, dass die Engländer die besten Liebhaber in Europa sein sollen.«
»Also lieber einen Latinlover?«, hakte Bella nach.
»Mhm, glaube schon. Sag mal, wie geht es deiner Mischkalkulation?« Samantha ließ sich auf das Bett neben Rosis Koffer fallen. »Mischkalkulation« war der Sammelbegriff für Bellas sechs Kinder, die höchst verschieden waren. Verschieden auch, was das Einkommen der einzelnen Väter betraf. Doch die Summe aller Unterhaltszahlungen konnte sich durchaus als gehobenes Einkommen sehen lassen, und falls einer der Herren mal nicht spurte, gab es ja Elisabeth.
»Gut. Alle Kinder sind gesund, haben regelmäßige blaue Flecken, jetzt auch die ersten auf der Seele.« Bella ließ sich neben Samantha fallen. »Kurzum, alles so, wie es sein soll. Wolf hat letztes Jahr brav sein Abitur vermasselt.«
Elisabeth machte es sich ebenfalls auf dem großen Bett bequem und sah staunend zu, mit welcher Genauigkeit Rosi ihre Kleidung aus den Koffern nahm und in den Schrank legte. »Irgendwie bekommen dir die exakten Wissenschaften nicht. Ich kenne wirklich keine andere, deren Blusen alle auf die akkurat gleiche Größe gebügelt sind. Wieso tust du das?«
Rosi zuckte mit den Schultern. »Unter Kollegen nennen wir es Übersprunghandlung.«
»Häh?« Bella rollte an die Bettkante und goss für alle ein Glas Champagner ein, der Kühler stand auf ihrem Nachttisch bereit.
»Heißt: Bügel- statt Putzwahn zum Beispiel. Oder: Eine Kollegin von mir verbraucht Unmengen Insektenvernichter, seit sie letztes Jahr mit mir an einem Artikel über die Virenübertragung mittels Nachtfalter und Schmetterlingen gearbeitet hat.«
Bella und Elisabeth verzogen das Gesicht, Sam hingegen lächelte. Sie erinnerten sich gut an Rosis Erläuterungen zu diversen Falterarten, die entweder mit einem Saugrüssel bis zu sieben Millimeter tief auch in menschliche Haut drangen oder auf mechanischem Weg den Augapfel ihres Wirts rieben, um dessen Tränenproduktion anzuregen und die Flüssigkeit zu trinken. Samantha hatte daraus eine Bildserie gemacht, die den Menschen auf perfide Weise als Nahrungsgeber der Insekten darstellte. Lediglich aus den Tränen trinkenden Faltern hatte sie ein romantisches Bild kreiert, das in Frankfurt in Rosis Büro hing. Die Virologin hatte den Namen aussuchen dürfen und es ihrem Naturell entsprechend betitelt: Pyralidae, Noctuidae und Geometridae, alles Schmetterlingsfamilien, denen diese Falter entstammten. Rosi hängte die letzte Bluse in den Schrank, klappte den Koffer zu, schob ihn unter ihr Bett und setzte sich zu den anderen.
»Immer noch eine Schwäche für Chanel?«, fragte Samantha. Rosi nahm einen Schluck, sah ihre Freundin aus schwarzen Augen an und antwortete: »Es wird jedes Jahr schlimmer. Wenn die von Chanel anfangen sollten, Nähgarn oder Klopapier herzustellen, kaufe ich das sicher auch noch. Gehen wir zum Aperitif ins Casino?«
»Klar, aber erst machen wir unseren traditionellen Spaziergang an der Steilküste entlang. Und Vorsicht, heute ist Sturm angesagt, es wäre ein Jammer, wenn eine von uns in die Tiefe flöge. Wir treffen uns in einer Stunde unten!«
Samantha leerte ihr Glas in einem Zug, sprang die Treppe wieder hinunter und ging in die Küche zu Lizzy.
»Wenn du noch ein Mal deine Hände im Gemüsebecken wäschst, haue ich dir den Spüllappen um die Ohren.«
»Schon gut. Ich hab nicht dran gedacht. Hast du uns was fürs Picknick gemacht?«
»Ihr wollt bei dem Wetter raus?« Der Wind jagte schwarze Wolken über den Himmel.
»Unbedingt. Wir sind Deutsche, wir kennen kein Wetter, nur falsche Kleidung«, rief Samantha aus, schlug die Hacken zusammen, salutierte und wich lachend Lizzys Handtuch aus.
Als Elisabeth, Bella und Rosi gerade aus ihren Zimmern traten, klingelte es unten am Hauptportal. Samantha kam in einem Jägermantel, der bis zum Boden reichte und ihre Größe betonte, aus der Küche. Sie trug den Picknickrucksack schon über der Schulter und öffnete die schwere Holztür.
»Ein Telegramm, Madame«, brüllte Jacques, der Postbote, gegen den Wind an.
»Und, was steht drin?« Samantha lächelte übertrieben süß.
»Ich habe es nicht angenommen, Madame, deshalb weiß ich es nicht.«
Samantha riss den Umschlag auf und zuckte zusammen.
Elisabeth, die die Szene von oben beobachtet hatte, fragte: »Schlechte Nachrichten?«
Samantha schüttelte den Kopf, drückte dem Postboten einen Fünf-Euro-Schein in die Hand, hielt die Tür mit beiden Händen fest und rief nach oben: »Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht wegfliegen. Kommt ihr?«
Lizzy sah vom Küchenfenster aus die vier vermummten Gestalten, die gegen den Wind ankämpften und sich zu den Falaises vorarbeiteten, wie die Franzosen die Steilküste um Cassis nennen. Als die Freundinnen auf der Treppe einer Häuserschlucht verschwanden, schlug Lizzy dreimal das Kreuz, öffnete den Topf und goss eine halbe Flasche Rosé, den es ausschließlich in Cassis gab, in die Bouillabaisse. Die Frauen unternahmen jedes Jahr diesen Ausflug, egal bei welchem Wetter, und ihr Proviant bestand immer aus Kaviar, hauchdünnen Toastscheiben, Limonen, Crème fraîche und Champagner. Oft packte Lizzy selbst gemachte Bünis, russische Buchweizenpfannkuchen, dazu. Heute hatte die Zeit jedoch nicht dafür gereicht.
Diese vier, dachte Lizzy, als sie Schalotten sehr fein hackte, die sind etwas ganz Besonderes. Da gibt es so etwas Verschworenes, Eingespieltes, Vertrautes unter den Freundinnen. Einmal, es war in dem Jahr, als Mr Mills die Blaue Rose verlassen musste, war Lizzy hinauf ins Atelier gegangen. Elisabeth, die Rechtsanwältin mit der beängstigend charismatischen Ausstrahlung, saß nackt und zu Lizzys maßlosem Erstaunen von Narben übersät Modell. Samantha malte Elisabeth jedoch nicht, sondern sie bemalte sie und ihre zahllosen Narben. Die Frauen sprachen kein Wort, dennoch waren sie eins, wie Lizzy es sich nicht hatte vors teilen können, dass es je zwischen zwei Frauen möglich sei. Elisabeths blonde Haare, die Lizzy nie offen gesehen hatte, flössen über die Schulter und endeten in einer großen Locke über dem Bauchnabel. Das grelle Sonnenlicht zeigte jede Falte, jede Delle auf der Narbenfrau, aber Samanthas Blick und Pinselstrich machten sie zum schönsten Weib der Welt. Die Malerin beschäftigte sich mit Elisabeths Haut wie mit einer edlen Leinwand. Jede Handbewegung verdichtete die Nähe der beiden, die Lizzy unheimlich war. Samantha kniete sich neben Elisabeth, streichelte ihr den Rücken, und indem sie wieder und wieder mit dem Pinsel darüberstrich, entstand wie von Zauberhand das aufgefächerte Blatt eines Farns, das sich bei jeder Bewegung wie im Wind wiegte. Teufelszeug, hatte Lizzy damals vor sich hin gesagt. Seitdem verspürte sie einen gewissen Argwohn Elisabeth gegenüber und mied sie, soweit es ging. Sie fand französische Frauen ohne jeden Zweifel schöner, weiblicher und ihrer eigenen Reize viel bewusster als ihre deutschen Pendants. Freundschaften unter Frauen hingegen schienen in Deutschland eine andere Qualität und ein anderes Ausmaß zu haben.
Lizzy schüttelte diese Gedanken ab, trank einen Schluck Rosé und widmete sich wieder der Zubereitung des Abendessens. Flambierte Gambas, serviert auf karamellisierten lauwarmen Möhrenspänen, waren der erste Gang. Dem sollte ein Tatar vom Lachs mit in Essig eingekochten Chilis und frischem Zitronenblatt folgen, weiter eine Bouillabaisse mit Rouille und geröstetem Brot, Käse der Region und Zabaione. Lizzy liebte es zu kochen, besonders für eine kleine Gruppe von Genießerinnen. Aber heute gelang es ihr nicht, sich wirklich darauf zu konzentrieren, weshalb ihr die Möhren zweimal verbrannten. Sie schälte die Gambas in die aufgeschlagene Tageszeitung, die auf dem Tisch lag. Ihr Blick fiel auf das Foto der beiden gesichtslosen Leichen, das seit Weihnachten regelmäßig veröffentlicht wurde in der Hoffnung, irgendwer würde irgendetwas an diesen Frauen wiedererkennen.
Lizzy wusste, was dahintersteckte, dafür hatte sie lange genug in Marseille gearbeitet, und sie spürte mit ihrem sicheren Instinkt, dass es bei dieser Geschichte um mehr als die Morde ging. »Und so sicher wie das Amen in der Kirche wird es weitere Morde geben, bis alles geklärt ist, worum immer es auch geht«, murmelte sie kopfschüttelnd vor sich hin und schickte ein kleines Gebet hinterher: »Mach, Chef, dass Samantha nichts damit zu tun hat! Nach ihr würde mich keiner mehr anstellen mit meinen achtzig Jahren. Und wenn Du mich nicht zu einer Sozialhilfeempfängerin machen willst, dann regelst Du das weise.«
So loyal sie Samantha ergeben war, seit die Malerin sich regelmäßig mit Drakon, dem Mafiaboss von Marseille traf, witterte Lizzy Unheil. Sie hatte früh in ihrem Leben gelernt, bestimmte Fragen besser nicht zu stellen. Eines hätte sie besonders gern gewusst und fragte doch nicht: wo Samantha in den Nächten war, als die Morde an den Frauen geschahen. Man hatte sie im Hafen gesehen, aber wo genau, das wusste keiner oder sagte niemand. Warum sollte auch die Marseiller Polizei ausgerechnet die deutsche Malerin aus Cassis nach ihrem Alibi fragen? Lizzy kippte den letzten Schluck Rosé hinunter und begann, die Rouille anzurühren. Dafür brauchte es ein gutes Gespür und ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit.
Es war nach acht, als Lizzy die Frauen vom Salonzimmer aus, wo sie gerade den Tisch deckte, kommen sah und erleichtert aufatmete. Einander untergehakt stemmten sie sich gemeinsam gegen jede Böe. Ihre Gesichter waren gerötet, als sie mit einem Schwall feuchter Winterluft durch die Tür fegten. Rosi, Elisabeth und Bella klopften sich die Mäntel ab und liefen die Treppe hoch, Samantha kam in den Salon.
»Es war herrlich, Lizzy, und der Drachenstein ist einfach wunderbar«, sagte sie mit leuchtenden Augen. »Dass wir Hunger haben, brauche ich wohl nicht zu erwähnen, oder?«
»Sobald ihr euch frisch gemacht habt, wird der erste Gang aufgetragen.«
»Gut, ich sag Bescheid. Ich glaube, du bleibst heute Nacht besser hier. Auf dem Dorfplatz hat der Sturm schon die ersten Schindeln vom Dach gerissen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, ging Samantha hoch in ihr Studio, das wie das Atelier im vierten Stock lag, und zog sich für den Abend um. Roben waren am ersten Abend Ehrensache. Als sie im Salon ankam, rekelte Rosi sich bereits in dem großen Sessel vor dem Kamin. In allen Ecken sorgten zahllose Kerzen für ein weiches, schmeichelhaftes Licht, das von den dunkelrot gestrichenen Wänden reflektiert wurde. Lizzy huschte um den Tisch und vollendete die Dekoration aus goldenen Steinen und Rosenblättern. Die antiken Stühle aus dunklem Holz mit hohen Lehnen hatte Samantha mit Blattgold bemalt.
»Trinkt ihr noch einen Aperitif?«
»Nein, danke.« Samantha setzte sich zu Rosi auf die Sessellehne. »Sobald Bella und Elisabeth da sind, legen wir los«, und ins Deutsche wechselnd fügte sie hinzu: »Ich könnte ein Schwein vertilgen.«
Rosi lachte auf, da Samantha diesen Ausdruck oft verwendete, wenn sie Lust auf einen Mann hatte. Im Casino hatte sie ihnen ausführlich von Jérômes Fertigkeiten berichtet.
»Wie geht es deinem Sohn?«, fragte Samantha.
»Gut. Sein Vater hat ihm einen Platz in Salem organisiert.«
»Elitärer Haufen.«
»Ja, aber er findet es besser als die soziale Randgruppenvereinigung bei Frankfurt, die ich als Internat ausgesucht hatte. Der gute Sohn denkt zielstrebig an seine Zukunft. Er will Arzt werden und in die Forschung gehen und sagt, dass er dafür in Salem die besseren Kontakte knüpfen kann.«
»Das weiß er alles schon mit sechzehn?«
Rosi seufzte. »Ja, das wusste er schon mit zwölf. Er weiß ebenso, wen er heiratet, wann die zwei geplanten Kinder kommen, wie lange er ins Ausland geht und dass es die Uniklinik Hannover sein wird, denn er will sich auf Transplantationen spezialisieren, ein Markt der Zukunft.«
»Zum Glück schreibt das Leben seine eigenen Geschichten.«
Rosi nickte, darüber hatten sie schon oft gesprochen. »Kommen wir lieber auf deinen hübschen Jérôme zurück. Hat der denn keine Familie?«
»Gleich zwei. Und da liegt sein Problem. Er will keine dritte Ehe. Im Winter hat er Frauenmangel. Im Sommer gibt es genug willige Touristinnen.«
Rosi zündete sich einen Zigarillo an und streckte ihre kalten Füße Richtung Feuer. »Man sollte meinen, Cassis hat genug hübsche Frauen.«
»Sicher. Wenn er sich jedoch mit einer Frau aus dem Dorf einlässt, mischt das ganze Dorf mit. Zoe, die Sekretärin in der Polizeistation, versucht ständig mit ihm anzubandeln. Jede Auseinandersetzung zwischen denen wird in den Bars anhaltend diskutiert, Wetten werden abgeschlossen, wie lange die Beziehung hält oder wie lange sie braucht, um ihn in den Bund der Ehe zu zwingen, und so weiter.«
»Und das hat der Junge zweimal probiert«, mischte sich Elisabeth ein, »sodass er jetzt die Nase voll hat.« Sie trat zu den beiden und legte Samantha die Hand auf die Schulter. »Da bist du natürlich wunderbar bequem für ihn.«
»Vorsicht«, Samantha knuffte sie in die Seite, »es ist schließlich eine Win-win-Situation. Das Schöne an Jérôme ist, dass er immer kann. Und um was es bei ihm eigentlich geht, erzähle ich euch morgen.« Sie griff nach Elisabeths Hand und fragte: »Was machen deine Töchter?«
Elisabeth winkte ärgerlich ab, nahm Rosi den Zigarillo aus der Hand, paffte ein paarmal, gab ihn zurück und setzte sich in den zweiten Sessel vor dem Kamin.
Die Tür des Salons ging auf, ein kalter Hauch, der aus der Vorhalle kam, ließ die drei frösteln. Bella stand in einem grellbunten Kleid im Rahmen und feixte. Ihr kindliches Lächeln, verbunden mit einem perfekt geschminkten knallroten Kirschmund, betonte ihre Lolita-Ausstrahlung.
»Du siehst aus wie ein Papagei«, sagte Elisabeth, und Bella prustete los.
»Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich finde, es passt zu dem bunten Haus.« Sie strich über ihren Pagenkopf und stöckelte, etwas wackelig auf den hohen Schuhen, mit denen sie ihre eins sechzig wettzumachen versuchte, zum Esstisch. Auch Elisabeth, Rosi und Samantha setzten sich, und Lizzy begann aufzutragen.
Einige wenige Gestalten bevölkerten noch Francis’ Bar. Sie schauten gelegentlich hinüber zum Hotel der deutschen Malerin. Im roten Feuerschein, der durch die hohen Fenster auf den Platz fiel, erkannten sie bloß Lizzy, die hin und her ging. Manchmal hob sich ein Schatten auf der den Fenstern gegenüberliegenden Wand ab, wenn eine der Frauen aufstand oder die Arme wild gestikulierend in die Luft warf.
Die Freundinnen tauchten ein in ihre Geschichten, während Lizzy schweigend und aufmerksam Gang um Gang auftrug, Weinflasche um Weinflasche öffnete, Holz im begehbaren Kamin nachlegte und sich wunderte, dass diese so unterschiedlichen Frauen so herzhaft miteinander lachten. Der Sturm hatte sich gelegt, sodass Lizzy um Mitternacht Samanthas Schulter drückte, Zeichen dafür, dass sie jetzt gehen würde. Als sie über den Dorfplatz schritt, schloss gerade Francis’ Bar und kegelte die letzten Gäste, ein paar Fischer aus dem Dorf, vor die Tür. Die Männer schauten zu dem erleuchteten Salon, schüttelten rados den Kopf, spuckten auf den Boden und gingen mit vom Alkohol schweren Schritten nach Hause.
Kapitel 2
»Schläft Sam noch?«, fragte Bella gähnend, als sie auf die Terrasse hinter der Blauen Rose trat. Es war einer dieser Morgen, an denen der Wind auf Süden gedreht hatte und die Temperaturen schon um zehn Uhr so mild waren, dass man draußen sitzen konnte. Lizzy hasste diese raschen Umschwünge, die ihrer Meinung nach die Menschen verwirrten, und nannte sie Hexenwinde.
»Keine Ahnung, vielleicht malt sie ja«, antwortete Rosi und wickelte sich fester in ihren Morgenrock. Ihre schwarzen Haare hatte sie bereits nach hinten gekämmt, aber die buschigen Augenbrauen, die sie von ihrem ungarischen Vater geerbt hatte, standen in alle Richtungen.
Elisabeth murmelte hinter der aufgeschlagenen Zeitung: »Weiß eine von euch, wie wir ins Bett gekommen sind?«
»Nö«, gab Bella unumwunden zu, nahm sich Kaffee und ein Croissant und setzte sich.
Sie hörten die hintere Türglocke, ein französisches Wortgefecht in der Küche, dann sprang jemand die breiten Stufen in der Hotelhalle hoch. Elisabeth runzelte die Stirn, legte ihre Zeitung zusammen und ging mit Bella und Rosi, die ihr automatisch folgten, in die Halle.
»Wer war das?«, fragte sie in hölzernem Französisch Lizzy, die ebenfalls aus der Küche gekommen war.
»Jérôme.«
»Schon nach einer Nacht ohne Sam so ein Druck?«, wunderte sich Bella.
»Sie hat doch gesagt, er kann immer«, Rosi lächelte, »und meinte wahrscheinlich, er muss immer.«
Das Poltern auf den verschiedenen Etagen hallte bis in die Eingangshalle. Nach einer Weile tauchte Jérôme am oberen Absatz der Treppe auf.
»Hoppla«, murmelte Bella, »das hat sie uns nicht gesagt«, und fuhr sich mechanisch durch die strubbeligen Haare.
»Nein, hat sie nicht«, gab Rosi ihr recht. »Warum haben wir den in all den Jahren vorher nie gesehen?«
»Er war in Marseille stationiert«, flüsterte Bella und ärgerte sich, dass sie nicht zurechtgemacht war und ihr Schlafanzug überdies mit unzähligen Engeln und Bärchen verziert.
Jérôme kam langsam die Treppe herunter.
»Wie geht das«, flüsterte Rosi, »dass eine Mischung aus Brad Pitt und Johnny Depp frei herumläuft?«
»Wie alt?«, hauchte Bella.
»Könntet ihr eure Münder jetzt wieder zuklappen?«, wies Elisabeth sie schmunzelnd an und wandte sich an den Mann mit den langen dunkelblonden Haaren, der jetzt am unteren Treppenabsatz angekommen war. »Was wollen Sie hier?«, fragte sie ihn.
Jérôme starrte sie aus seinen grauen Augen an, als hätte er Zweifel, ob Elisabeth wirklich ihn gemeint haben könnte.
»Ich suche Samantha!« Seine Stimme war scharf und schneidend.
»Sie ist nicht oben?«, fragte Lizzy. Ihr Ton verriet ihren Ärger über sein Eindringen.
»Nein, nicht im Atelier, nicht in ihrem, nicht in irgendeinem Bett der Blauen Rose.«
»Der Junge kennt sich hier aus«, sagte Rosi, die Französisch zwar ein wenig verstand, aber nicht sprechen konnte.
»Wie bitte?«, fuhr Jérôme sie an.
»Leidenschaftlich ist er also auch«, seufzte Bella und setzte ihr schönstes Sonntagslächeln auf.
Elisabeth verschränkte die Arme vor der Brust und fügte hinzu: »Jetzt weiß ich, was Samantha mit Win-win-Situation meinte.«
»Was quatschen die Weiber da?«, wollte Jérôme von Lizzy wissen, die mit den Schultern zuckte und ihm lässig antwortete: »Schon vergessen? Ich kann kein Deutsch.«
Jérôme schob Lizzy zur Seite und verschwand in der Küche. Kurz darauf knallte die Tür.
»So gut kann er nicht bumsen«, brummte Lizzy. Als Elisabeth sie fragend ansah, gab die alte Haushälterin sich einen Ruck. Die anderen folgten der zierlichen Gestalt, die energisch die Treppe vor ihnen hochging. Als sie etwas aus der Puste die vierte Etage erreichten, schlug ihnen der Geruch von Lack entgegen.
»Es ist wirklich ein bisschen wie im Himmel wohnen, oder?« Bella war wie immer bezaubert von den Glasfronten, die zu drei Seiten den Blick auf den Himmel, die Steilküste und das Meer freigaben. Pinsel standen in Gläsern mit Verdünnung, eine Leinwand war schon gespannt, aber noch unberührt. Ein paar Farbtuben lagen offen herum, die Lizzy mechanisch mit den jeweils passenden Kappen versah.
Elisabeth fiel auf, dass die fertigen Gemälde, die an der einzigen freien Wand lehnten, kräftigere Rottöne und weniger Brauntöne hatten als die Bilder vom letzten Jahr, die Samantha für sehr viel Geld an einen Amerikaner verkauft hatte. »Sie hat die Erotik hinter sich gelassen und malt den puren Sex«, sagte sie leise, mehr zu sich selbst, als sie den Stapel vorsichtig durchblätterte. »Menschenansammlungen, denen erst auf den zweiten Blick anzusehen ist, dass es sich um Beischlafszenarien handelt.« Die verrenkten Glieder, die leeren, oft nur angedeuteten Augen berührten sie und stießen sie gleichermaßen ab. An der Glasfront stand ein großes Bild, das einen Hafen zeigte. Kräne ragten wie hungrige Geier über den geöffneten Containern, alles schien überdimensional im Verhältnis zu den kleinen Menschen, die wie Insekten zwischen Kränen und Schiffen herumwuselten.
»Wo ist das?«, fragte Elisabeth.
»Im Industriehafen«, gab Lizzy zur Antwort und ging, gefolgt von Rosi und Bella, in Samanthas Schlafzimmer. Das Bett war unberührt.
»Ich habe es gestern erst frisch bezogen«, sagte Lizzy. Rosi übersetzte für Bella ins Deutsche, was sie mit ihrem Basisfranzösisch verstanden hatte.
»Für mich sieht das aus, als wäre sie mal wieder auf eine ihrer geheimen Touren gegangen«, sagte Elisabeth, die nachgekommen war. Zumindest hoffe ich das, schob sie in Gedanken hinterher.
»Muss das ausgerechnet sein, wenn wir hier sind?«, fragte Bella beleidigt.
»Künstlerfreiheit«, warf Rosi ein, die Sams Anwandlungen zwar nicht verstand, jedoch stets respektierte.
Auf Samanthas Nachttisch lagen neben Zeichenstiften und Malblöcken ihre Papiere und ihr Handy. Ihr Messer, das sie seit Kindesbeinen bei sich trug und nur zum Schlafen weglegte, fehlte.
Als die Frauen wieder am Frühstückstisch saßen, wandte sich Elisabeth an Lizzy, die frischen Kaffee brachte und offensichtlich nervös war. »Sie hat schon öfter solche Aktionen gebracht. Sicher taucht sie heute Abend gut gelaunt wieder auf.«
Lizzy nuschelte etwas Unverständliches und ließ die drei allein.
Samantha kam am Abend nicht zurück. Die Freundinnen stocherten in Lizzys Essen herum und tranken halbherzig den süßen kalten Weißwein.
»Elisabeth, hat sie dir wirklich nichts gesagt gestern Abend?«, fragte Bella.
»Es gibt keinen Grund zur Sorge«, antwortete Elisabeth entschieden. »Nur weil einer ihrer Liebhaber hier hereinstürmt und Theater macht und weil Lizzy mit sorgenvollem Gesicht herumläuft, sollten wir uns nicht verunsichern lassen. Wir kennen sie schließlich länger.« Sie schob den Teller von sich. »Sam hat das Handy und ihre Papiere hier gelassen, was bedeutet, dass sie in der Gegend ist und keine ihrer großen Touren vorhatte, die auch mal eine ganze Woche dauern können.«
»Mich würde trotzdem interessieren, warum dieser Jérôme heute Morgen schon nach ihr gesucht hat.« Rosi ließ sich nicht so leicht beschwichtigen. »Er muss das doch von ihr kennen.«
»So lange läuft das mit den beiden noch nicht, und vielleicht wollte er etwas mit ihr besprechen oder war eifersüchtig. Ich glaube nicht, dass das von Bedeutung ist«, erwiderte Elisabeth.
Da sie nicht recht wussten, was sie jetzt anfangen sollten, entschieden sie sich für einen Fernsehabend in der Hoffnung, dass wenigstens ein deutscher Sender zu finden wäre. Rosi, von allen die mit dem besten technischen Verstand, machte sich gleich an der Programmierung zu schaffen, Elisabeth öffnete eine neue Flasche Wein und Bella verkroch sich bereits unter die Kaschmirdecke auf dem großen Sofa, dem Fernseher gegenüber. Knisternd flimmerten Zeichen eines deutschen Senders über den Bildschirm, der Ton wurde lauter und endlich erklangen die vertrauten Stimmen der deutschen Tagesschau: »Unter den Vermissten sind nach Angaben der Fluggesellschaft zwei Deutsche, drei Engländer und 35 Franzosen, die sich auf dem Flug nach München befanden. Der sogenannte Cityhopper verschwand wenige Minuten nach dem Start vom Radar.« Bilder zeigten Fragmente eines Flugzeugs, die im aufgepeitschten Mittelmeer tanzten. Dann folgten Rettungsboote, Taucher, Stellungnahmen der Fluglotsen und das Ende einer jeden solchen Meldung: »… warten wir jetzt auf die Auswertung des Flugschreibers, der geborgen werden konnte. Die nachfolgenden Programme verschieben sich um circa eine halbe Stunde.«
»Och nein«, maulte Bella, schaltete ein paarmal um, aber auf allen Kanälen und in allen Sprachen wurde von dem Unglück berichtet, das sich morgens um 07:20 Uhr, wenige Minuten nach dem Start des Flugzeugs in Marseille, ereignet hatte.
»Na ja, vierzig Europäer auf einen Hops weg ist schon eine Sondersendung wert«, sagte Rosi trocken und rekelte sich vor dem Fernseher. Elisabeth verkrümelte sich mit einem Stapel Zeitungen in eine Ecke des Zimmers. Bella, die bei sechs Kindern zu Hause nicht die Ruhe zum Lesen fand und es sich inzwischen ganz abgewöhnt hatte, kannte sich mit Spielabenden bestens aus und fragte: »Mühle, Rosi?«
Nachdem sie die ersten Steine gesetzt hatten, flüsterte Bella: »Dieser Jérôme, da könnte ich glatt noch einmal schwach werden und an ein siebtes Kind denken.«
Elisabeth hatte sie trotzdem gehört und sagte: »Der hat bereits mit zwei Frauen vier Kinder.«
»Na und?«
»Herzblatt, das würde deine Mischkalkulation ungemein schwächen, seine Unterhaltszahlung wäre minimal. Außerdem kann ich dir da nicht helfen, du bräuchtest einen Anwalt, der sich im internationalen Unterhaltsrecht auskennt.«
»Das kann ja kein so großes Problem sein«, antwortete Bella beleidigt.
»Nein, es hätte jedoch den feinen Unterschied, dass der mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf Zahlung seiner Rechnungen bestehen würde.«
Bella setzte einen weiteren Stein, hatte damit die erste Mühle und tat so, als habe sie den letzten Satz nicht gehört.
»Außerdem ist eine Schwangerschaft mit dreiundvierzig kein Spaziergang«, setzte Rosi von der anderen Seite an und ließ sich den Stein wegnehmen.
»Bei meiner Fruchtbarkeit und meinem Training sollte das kein Problem sein. Das letzte Kind ist erst sechs Jahre her.«
»Eine lange Zeit«, stichelte Elisabeth hinter ihrer Zeitung weiter.
»Und nach sechs Kindern ist so eine Gebärmutter sicher ziemlich ausgeleiert, Muskel hin oder her«, behauptete Rosi und schloss ihrerseits eine Mühle, die so gebaut war, dass sie auf der einen wie der anderen Seite eine Zwickmühle hatte.
»Blanker Neid.« Bella zeigte ihr den ausgestreckten Mittelfinger.
»Und Französisch sprichst du auch nicht.«
»Herrgott noch mal«, Bella schlug auf das Spielbrett und die Steine flogen auseinander. »Ich will nicht mit ihm leben, ich will ein Kind!« Sie sprang auf und feuerte die Decke in die Sofaecke. »Ich geh nach oben, lesen!«
Elisabeth ließ die Zeitung sinken. »Du liest nicht, Bella.«
»Dann fange ich eben jetzt damit an!« Die Tür knallte gegen den Rahmen und flog zurück, sodass Rosi Bella die Treppe hinauflaufen sah, als sie die Spielsteine einsammelte. »Wieso ist sie so wütend? Es ist doch alles bestens.«
Elisabeth stand auf, schloss die Tür und antwortete: »Ihre große Liebe Ben hat sich letzte Woche fast verabschiedet. Streit und bis heute keine SMS.«
»Die wievielte große Liebe ist das jetzt?«
»Wenn ich ordentlich mitgezählt habe, die zwölfte. Spielen wir?« Elisabeth kam zum Kamin und brachte für Rosi die Flasche Whisky und ein Glas mit.
»Schach?«
»Gern.«
Sie schoben das aus einer Schieferplatte geschlagene Brett samt Tisch vor den Kamin. Auf Rosis Seite befanden sich die Zigarillos, die Whiskyflasche, ein kleines Glas und der Aschenbecher. Auf Elisabeths Seite standen die Rotweinflasche und ein schweres Kristallglas.
»Elisabeth?«
»Ja?«
Sie klopfte einen Zigarillo aus der Schachtel und lächelte Elisabeth an. »Ich habe gestern bemerkt, wie sorgenvoll du Sam angesehen hast, als sie von den Leichen erzählte. Warum?«
»Das hast du dir eingebildet.«
»Nein, ich denke nicht. Irgendwas an der Art, wie Sam darüber gesprochen hat, war seltsam.«
Elisabeth gab ihr Feuer. »Und was?«
»Es war so distanzlos. Zugleich kalt und beteiligt. Eine merkwürdige Mischung aus … ach, ich weiß auch nicht.« Rosi legte Holz nach und wechselte das Thema: »Kennst du diesen Ben?« Elisabeth und Bella lebten in ihrer Geburtsstadt Regensburg, woher sich alle vier kannten.
»Ja, es ist mal wieder einer meiner Mandanten.« Sie machte mit einem zentralen Bauern eine klassische Eröffnung.
»Ich dachte, du wolltest sie nicht mehr zu deinen Mandantenpartys einladen.«
Elisabeths Mandanten gehörten zur gehobenen Gehaltsklasse – Ärzte, Professoren, leitende Angestellte, Aufsichtsräte und manchmal Politiker –, weshalb ihre Mandantenpartys, die sie zweimal im Jahr gab, sich bei Bella großer Beliebtheit erfreuten, besonders wenn sie gerade Single war.
Rosi zog nach und schob ebenfalls einen Bauern vor.
Elisabeth reagierte sofort. So lange sie sich kannten, spielten sie Schach miteinander und konnten die Züge der jeweils anderen voraussehen. Eigentlich hätten sie gar nicht mehr spielen müssen. »Nein«, sagte Elisabeth, »ich wollte sie auch gar nicht einladen. Schließlich geht mir dann jedes Mal ein Mandant flöten, und ich habe einen weiteren Fall am Hals, den Bella nicht bezahlt.«
Sie verschoben noch ein paar Bauern, Rosi bewegte den ersten Läufer. »Und warum lädst du sie dann doch wieder ein?«
»Du weißt doch, ich hänge an Traditionen. Außerdem bringt mir das auch eine ganze Menge.«
Rosi grinste. »Verstehe. Die knallharte Rechtsanwältin mit dem sozialen Anstrich: Sie kümmert sich um eine alleinerziehende Mutter von sechs Kindern.«
»So in etwa.« Elisabeth nahm den ersten Springer, und Rosi zeigte auf das Feld, von dem sie annahm, dass er dort landen würde.
»Kennen deine Mitarbeiter Bella?«
»Der Himmel bewahre! Das würde meine soziale Aura sofort zunichtemachen.«
»Irgendwie«, sagte Rosi mit Blick auf das wärmende Feuer, »bewundere ich Bella für ihre Lebensauffassung. Wer traut sich heute schon noch so viele Kinder in die Welt zu setzen? Normalerweise gilt das als asozial.«
»Tja, für Bella sind Kinder und Männer so selbstverständlich wie das Atmen. Sie betrachtet es simpel als ihren Job, für den andere sie bezahlen.«
Rosi schmunzelte, denn Bella skandierte oft: Jeder hat seine Berufung, ich kann eben am besten Kinder machen. »Und dieser Ben?«
Elisabeth platzierte den Springer, nahm das schwere Kristallglas und lehnte sich zurück. »Ein Chirurg aus der Münchener Uniklinik. Ich habe ihn mal vertreten in einer Streitsache, eine schiefgelaufene Hüftoperation. Anfang vierzig, schmuckes Kerlchen und auf dem Weg zum Chefarzt.«
»Aber?«, fragte Rosi gedehnt.
»Aber verheiratet, ein zweijähriger Sohn.«
»So einer also.«
»Ja, exakt so einer.«
»Weiß die Chefarztanwärterehefrau schon von Bella?«
»Nein«, antwortete Elisabeth, »ich habe Bella von ihm abgeraten. Bens Frau ist eine schwache Gegnerin, und das sind die Schlimmsten, wie wir wissen. Da hat man keine Chance. Besonders wenn der Mann sich von Schwäche angezogen fühlt.«
»Hm, verstehe, und welcher Arzt tut das nicht.«
»Richtig. Zudem hat nach neun Monaten selbst ein verliebter Mann begriffen, dass Bella alles andere als so hilfsbedürftig ist, wie der Kleinmädchenaugenaufschlag jeden am Anfang glauben lässt.«
Rosi stand auf und machte sich an der Musikanlage zu schaffen. »Sorgst du dich um sie?« Leise Flamencomusik füllte den Raum.
»Nein.« Tatsächlich empfand Elisabeth Bella als kleine Schwester, für die sie gern sorgte, und Bella passte so perfekt in dieses Schema, dass Fremde die beiden oft für Schwestern hielten. »Es wird bestimmt langweilig mit denen. Er wird seine Frau verlassen wollen, weil er glaubt, Bella zu lieben. Die Ehefrau wird Depressionen bekommen und sich nicht mehr um ihr kleines Kind kümmern und an sein Helfersyndrom appellieren. Schließlich wird sie um eine Chance betteln und wenn sie gut und schnell ist, wieder schwanger werden.«
Die Tür flog auf, und Bella erschien im Schlafanzug.
»War das Buch nicht gut?« fragte Elisabeth.
»Wieso behauptest du, er glaubt, mich zu lieben? Ben liebt mich, wie er nie eine Frau geliebt hat!«
»Bella«, warnte Rosi grinsend, »wirst du diesen Text denn nie leid?«
Schmollend ließ Bella sich in einen der Sessel fallen und trank Rosis Whiskyglas leer. »Er hat den schönsten Schwanz, der mir je untergekommen ist. Kennst du das, wenn so ein Schwanz einfach passt? Ich meine, so als wäre er für dich gemacht«, sie seufzte hingebungsvoll, »einfach wunderbar.«
»Mach ihn zu deinem Dr. Schiwago«, schlug Rosi vor.
»Für Pasternak fehlt Ben die Größe«, entschied Elisabeth knapp. »Hab deinen Spaß, solange seine Frau nichts merkt. Meine nächste Mandantenparty kommt bestimmt«, schlug sie versöhnlich vor.
Rosi rollte mit den Augen.
Lizzy kam herein und verabschiedete sich für diesen Abend. Allen fiel auf, wie skeptisch sie Elisabeth betrachtete. Die Freundinnen einigten sich, dass die Haushälterin am nächsten Morgen kein Frühstück machen sollte und sie zum Mittagessen ausgehen wollten. Daher müsste Lizzy erst am Nachmittag wiederkommen. »Ich werde Samantha morgen vermisst melden«, sagte diese dann, schon die Türklinke in der Hand.
Die drei Frauen blickten einander an, dann wieder zu der in der Tür wartenden Lizzy.
»Nein, Sam würde das nicht wollen. Es gibt weder morgen noch übermorgen einen Grund dafür«, entschied Elisabeth. »Sie kennen Samantha doch schon ein paar Jahre. Von einigen Tagen bis zu einer Woche bleibt unsere Künstlerin manchmal weg. Sie braucht das.«
»Sicher«, antwortete Lizzy und dachte: Aber es ist anders als sonst. Sie beschloss, es bei Jérôme zu versuchen, und wünschte den drei Frauen eine gute Nacht.
»Ich weiß nicht, warum sich Sam diese Alte hält«, sagte Bella, »ein hübscher junger Koch wäre viel besser.«
»Im Bett vielleicht. Lizzy hingegen ist ihr treu ergeben, und welcher Mann ist das schon auf Dauer? Außerdem ist sie eine begnadete Köchin«, antwortete Elisabeth.
»Interessant«, feixte Bella, »ist es bei dir schon so weit?«
»Wie weit?«
»Wie du weißt«, Bella drehte Rosis Whiskyglas in ihren Händen, »ist Essen der Sex …«
»Sag es nicht«, drohte Elisabeth und warf ein Sofakissen nach Bella, die es geschickt auffing.
»Ladys«, Rosi nahm Bella das Glas aus der Hand und füllte es neu, »ich gehe jetzt wirklich nach oben lesen. Gute Nacht.«
»Ich komme mit, wenn du mir vorliest. Ich will nur schnell in der Küche schauen, ob es so was Leckeres wie Brühwürstchen gibt, wenn wir diese Woche schon kein Fleisch essen.«
»Brühwürstchen? Wir sind in Frankreich!«
»Brühwürstchen macht man aus Schweinekopf, Hirn, Darm, Knorpel. Erzähl mir nicht, dass ausgerechnet die Franzosen so etwas wegwerfen.« Und schon war sie in der Küche verschwunden und inspizierte den gut sortierten Kühlschrank.
Als Bella oben ins Zimmer mit einem Teller kam, auf dem Würstchen, ein paar Scheiben Käse, Salami und Erdnüsse versammelt waren, saß Rosi bereits im Bett, die Lesebrille auf der Nase. Bella setzte sich zu ihr ans Fußende und verkreuzte die Beine. »Meinst du, Sam ist sauer, weil ich sie gestern wegen ihrer Kinderlosigkeit aufgezogen habe?«
Rosi nahm die Brille ab, beugte sich nach vorn und stibitzte ein Stück Käse von Bellas Teller. »Nein, wenn eine von uns Spott gut vertragen kann, dann Sam. Außerdem hat sie nie Kinder gewollt.«
»Ja, sie ist dafür viel zu egoistisch«, sagte Bella überzeugt.
»Demnach müsstest du ein selbstloses Wesen sein.«