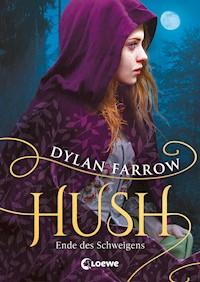
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn du die Macht hättest, die ganze Welt umzuschreiben, würdest du es tun? Shaes Leben steht Kopf. Nicht nur verfügt sie über Magie, mit der sie die Realität beeinflussen kann, auch das mythische Land Gondal soll tatsächlich existieren. Dorthin ist der Barde Ravod mit dem Buch der Tage geflüchtet. In dem mächtigen Buch ist alle Wirklichkeit festgehalten – und es kann die Welt für immer verändern. Shae muss das Buch zurückholen, ehe Ravod damit Schaden anrichtet. Doch wem kann sie auf ihrer Mission trauen? Tauche ein in den spannenden Abschluss der Jugendfantasy-Reihe! Das große Finale der Feminist-Fantasy-Dilogie. Der zweite Band der feministischen Jugendfantasy-Dilogie für Leser*innen ab 14 Jahren, in dem sich die starke Protagonistin unterdrückenden Machtstrukturen stellt. Geschickt spielt Dylan Farrow mit der Macht der Wörter und erschafft so eine packende und originelle Geschichte rund um Fake News, Me Too und Propaganda und den hochaktuellen gesellschaftlichen Diskurs "Was ist wahr?"/"Was ist Lüge?".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Aus dem Tagebuch einer abtrünnigen Bardin
Kapitel 1 – Am südöstlichen Rand …
Kapitel 2 – Es wird schnell …
Kapitel 3 – Als ich die …
Kapitel 4 – Das Tageslicht schwindet …
Kapitel 5 – Der Morgen kommt …
Kapitel 6 – Der Tunnel nimmt …
Kapitel 7 – Mein entrücktes Staunen …
Kapitel 8 – Die Konversation reißt …
Kapitel 9 – Ravod macht einen …
Kapitel 10 – »Das … das ist …
Kapitel 11 – Von all den …
Kapitel 12 – Vergeblich versuche ich, …
Kapitel 13 – Die Straßen von …
Kapitel 14 – Erst als ich …
Kapitel 15 – Die Metalltür fällt …
Kapitel 16 – In dieser Nacht …
Kapitel 17 – Einige Stunden später …
Kapitel 18 – Schon als wir …
Kapitel 19 – Ich kenne dieses …
Kapitel 20 – Im Laufe der …
Kapitel 21 – Kennan beugt sich …
Kapitel 22 – Nachdem wir den …
Kapitel 23 – »Wie nett von …
Kapitel 24 – In den Trainingsanlagen …
Epilog
Danksagung
Für Mom & Sue
AUS DEM TAGEBUCH EINER ABTRÜNNIGEN BARDIN
14. SONNE IM 9. MOND
Martin ist tot. Ich habe es gestern von der Karawane erfahren: Er wurde im Wald vor dem Dorf Valmorn gefunden, in seiner Brust ein unverwechselbarer goldener Dolch. Bei unserem letzten Gespräch sagte ich ihm, er wäre paranoid. Ich machte mich darüber lustig, dass er sich ständig nach allen Seiten umsah. Heute denke ich, dass womöglich ich selbst die Verrückte war, weil ich glaubte, wir könnten uns gegen das Hohe Haus stellen und dann einfach im Volk untertauchen und ein normales Leben führen. Ich war so voller Zuversicht.
Der Verräter, diese dreckige Ratte, hat ihn umgebracht, das weiß ich.
Die Kaufleute werden uns nicht mehr unterstützen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln, es ist zu gefährlich. Von Anfang an hat sie nur Martins Geld dazu bewegt, uns zu helfen. Und mit einem Schlag ist das Netz aus sicheren Unterkünften, das wir so mühevoll aufgebaut haben, ausgelöscht.
Ich denke heute an unsere fröhliche kleine Rebellenbande zurück. Wir waren so zufrieden mit uns selbst, unseren Träumen, Plänen und Verschwörungen … Die Welt ist einsamer ohne sie. Jetzt sind nur noch zwei von uns übrig.
Hoffentlich geht es Victor gut. Vielleicht sollte ich … nein. Wenn die Möglichkeit besteht, dass sie meinen Aufenthaltsort kennen und seinen nicht, würde das die Barden direkt zu ihm führen – oder schlimmer noch: die Krankheit.
Vielleicht hatte Martin am Ende doch recht. Ich muss auf der Hut bleiben, sogar paranoid sein. Meinen Freunden, die jetzt nicht mehr da sind, habe ich einen Eid geleistet. Ich werde nicht sterben, ehe ich nicht für die endgültige Zerstörung des Hohen Hauses gesorgt habe.
Ich sollte Aster verlassen. Hier gibt es keine Unterkunft mehr, die ich betreuen müsste. Und selbst wenn es eine gäbe, wäre niemand mehr da, der sie benutzen würde. Die Täuschung des Hohen Hauses ist zu tief in den Menschen verwurzelt. Niemand will an einen Ort fliehen, von dem man nicht glaubt, dass es ihn gibt.
Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Bedeutet das, wir haben verloren? War alles, wofür wir gekämpft haben, alle Opfer, die wir gebracht haben, für nichts und wieder nichts?
Seit zwei Stunden starre ich nun auf meine eigenen Worte, die Buchstaben verschwimmen im Kerzenlicht vor meinen Augen. Ich hätte diese Zeit nutzen können, um meine Sachen zu packen und mich in die Nacht davonzustehlen.
Das ist albern. Ich weiß, warum ich noch hier bin. Es hat keinen Zweck, es noch länger zu leugnen. Ich warte darauf, dass ein gewisser junger Zimmermann an meine Tür klopft und mich zum Bleiben überredet.
Was bin ich doch für eine Närrin.
21. SONNE IM 9. MOND
Ich habe beschlossen zu bleiben, was auch immer geschehen mag.
Ist das die beste Entscheidung? Wahrscheinlich nicht. Aber zum ersten Mal seit Jahren weiß ich wieder, was es bedeutet zu leben, statt nur zu überleben. Ich habe hier etwas gefunden, das alles übertrifft, was ich in meiner Zeit im Hohen Haus kennengelernt habe – das sogar die Kameradschaft mit meinen Freunden übertrifft und den Kampf für eine gerechte Sache. Meine Entscheidung hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Oder vielleicht hat sie mir eher gezeigt, wer ich wirklich sein will.
Ich verwische meine Spuren gründlich. Das mache ich seit Jahren. Soll Cathal – oder der Verräter Niall – ruhig versuchen, mich hier aufzuspüren. Soll er seine Barden schicken und seine selbst gemachte Krankheit. Ich werde tun, was getan werden muss, damit ich vorbereitet bin und dieses neue Leben schützen kann, das ich mir aufgebaut habe – frei vom Hohen Haus, von der Beschwörung und den Intrigen. Frei davon, über eine leere Unterkunft zu wachen.
Je länger ich darüber nachdenke, umso besser gefällt mir die Idee. Es war doch immer die Freiheit, um die es eigentlich ging, oder nicht?
Und damit beschließe ich diese Aufzeichnung. Ich werde sie an einem sicheren Ort verstecken müssen. Eines Tages wird jemand die Wahrheit erfahren wollen, aber im Augenblick habe ich andere Prioritäten.
Ich werde heiraten.
8. SONNE IM 11. MOND
Ich weiß nicht, warum ich dieses vermoderte alte Tagebuch nach so langer Zeit wieder ausgrabe. Oder warum es so tröstlich ist, diese Worte zu lesen, meine eigene Handschrift zu sehen und den Stift wieder aufs Papier zu setzen. Vielleicht brauche ich in diesem ganzen Wahnsinn eine Art Verbundenheit. Auch wenn ich weiß, dass es unglaublich gefährlich ist, gerade jetzt.
In den zehn Jahren zwischen diesem Eintrag und dem letzten liegen große emotionale Höhen und Tiefen. Ruhe, Glückseligkeit, Freude, Stolz, ebenso wie Schmerz, Leid und Trauer, für die ich keine Worte habe.
Mein Mann ist tot. Mein Sohn ist nicht mehr da.
Das Haus, das ich erbaut habe, liegt in Schutt und Asche. Es hat mich all meine Kraft gekostet, die Fassung zu bewahren, als ich die Barden herannahen sah. Jemand aus dem Dorf muss ihnen einen Tipp gegeben haben. Aber ich habe ihre Gesichter nicht erkannt – und sie meines ebenso wenig. Ich war mir sicher, dass …
Es hat keinen Zweck zu spekulieren. Am Ende hat Cathal die Flecken hergeschickt. Er muss gehofft haben, mich so aus meinem Versteck zu treiben. Er hat Angst vor … irgendetwas. Oder vielleicht plant er … irgendetwas. Bei diesem Mann kann man sich nie sicher sein. Das war schon damals so, als ich ihm noch vertraute.
Am wahrscheinlichsten ist: Er weiß, dass ich noch lebe, aber nicht, wo. Seine letzten Drohungen verfolgen mich. Er wird nie aufhören zu suchen. Und jetzt fürchte ich nicht nur um meinetwillen, was er finden wird, wenn er Erfolg hat.
Ich betrachte meine Tochter, die auf einer Liege an unserem Lagerfeuer schläft. Dieses ernste, dickköpfige, süße, neugierige Mädchen. Sie hat kein Zuhause. Die verängstigten Dorfbewohner wollen uns nicht in den Ort lassen, damit wir sie nicht »infizieren«. Am liebsten würde ich sie alle anbrüllen – sie haben keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Sie klammern sich an ihren Aberglauben, doch die Jahre des Blutvergießens und des Verrats haben mich gelehrt, dass diese Gesetze, die sie so sehr in Ehren halten, nichts weiter sind als die Erdichtung eines Verrückten.
Dann mache ich mir wieder bewusst, dass mir niemand glauben würde, selbst wenn ich die ganze schmutzige Wahrheit erzählen würde. Sie würden mich und meine Tochter nur noch mehr verstoßen. Oder mir die Zunge herausschneiden, wie sie es so gern mit jenen tun, die sich nicht strikt an die Regeln halten. Narren, alle miteinander.
Nichts davon ist jetzt wichtig. Meine einzige Sorge gilt meiner kleinen Tochter. Ich habe einst geschworen, ich würde nicht sterben, bis ich für die Vernichtung des Hohen Hauses gesorgt hätte. Heute Nacht ändere ich diesen Eid ab. Ich werde dafür sorgen, dass sie sicher ist. Vielleicht wird sie eines Tages bereit sein, die Wahrheit zu erfahren und fortzuführen, was meine Kameraden und ich vor langer Zeit begonnen haben.
Ich weiß, was ich tun muss.
KAPITEL 1
Am südöstlichen Rand von Montane liegt ein kleines Dorf namens Valmorn. Es besteht aus zwei Straßen, die sich im Zentrum kreuzen und mit Wohnhäusern und Geschäften gesäumt sind, und ist von kärglichen Bauernhöfen umgeben. An der Kreuzung der beiden Straßen steht eine große Textilmanufaktur, in der die meisten Einwohner fieberhaft arbeiten, um den nächsten Zehnten ans Hohe Haus zu entrichten, in der Hoffnung, dass im Gegenzug ihr Leid ein wenig gelindert werde. Das Dorf ist ebenso wenig ungewöhnlich wie das, aus dem ich komme. Vieles hier kommt mir nur allzu bekannt vor.
Valmorn liegt jenseits des gefürchteten Ödlands, von dem die Menschen hier nicht wissen, dass es den Großteil des Landes ausmacht. Nur die wagemutigsten Reisenden werden es je zu Gesicht bekommen.
Jedenfalls betrachte ich mich gern als wagemutige Reisende. Das klingt etwas eleganter als »verängstigte Flüchtende« oder »schändliche Aufwieglerin«, was ich ebenfalls beides bin.
Von Osten her bläst ein kalter, feuchter Wind über die Hügelkuppe, von der aus man das Dorf überblicken kann. Er kriecht mir in den Hemdkragen und über den Rücken bis zu dem Fleckchen abgestorbenen Grases, auf dem ich sitze. Schaudernd schüttle ich ihn ab und ziehe mir meinen schwarzen Mantel enger um die Schultern. Es ist nur Wind, aber es kommt mir vor wie eine wortlose Warnung.
Ich halte den Blick auf die Ortschaft gerichtet, nicht auf meine Begleiterin, die neben mir auf und ab läuft. Ich brauche sie nicht anzusehen, um zu wissen, dass sie die geisterhaft bernsteinfarben leuchtenden Augen verdreht, als wäre meine Reaktion auf die Kälte Ausdruck einer inneren Schwäche.
Ich versuche mir vorzustellen, wie diese Aussicht sein könnte ohne die Zeichen von Tod, Furcht und Krankheit, die hier lange vor meiner Zeit eingepflanzt worden sind. In den Straßen würde es vor Menschen wimmeln, die nur dafür arbeiten, ihr Heim zu verschönern, anstatt eine ferne Macht zu besänftigen, der sie vollkommen egal sind. Die Häuser wären in leuchtenden Farben gestrichen und mit Blumenkästen voller Blüten und Kräutern behängt, statt mit dem graubraunen Staub des Ödlands verkrustet und von abgestorbenem Weinlaub überwuchert zu sein.
Ein leises Pfeifen neben mir lässt mich erschrocken hochfahren. Ich kreische und hechte zur Seite. Als ich mich umdrehe, bohrt sich nur Zentimeter neben der Stelle, an der ich gesessen habe, ein kleines Wurfmesser in die Erde.
Ich sehe zu meiner Gefährtin hinüber, weil ich fürchte, dass uns ein Angriff droht, doch sie lacht nur bellend.
»Wenn du weiter so vor dich hinträumst, wirst du nicht mehr lange leben«, sagt sie. Die leuchtenden Augen und weißen Zähne bilden einen scharfen Kontrast zu ihrer dunklen Haut. Ein breites Grinsen legt sich auf ihr Gesicht. Natürlich war das ihr Werk. Seit wir uns kennen, macht es ihr Spaß, mich zu ärgern, zu bedrohen und zu beleidigen. Ich atme tief durch, um dem Drang zu widerstehen, sie anzuschreien.
»Bei jemandem, mit dem ich zusammen reise, sollte ich nicht um mein Leben fürchten müssen«, bringe ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Genau diese Art von Naivität wird dein Leben beträchtlich verkürzen.«
»Ich bin nicht mehr deine Schülerin, Kennan.« Ihr abfälliger Ton regt mich auf. »Und selbst wenn ich es wäre, würde meine Existenz nicht allein dem Zweck dienen, dass du dein krankes Vergnügen daraus ziehen kannst, mich zu quälen.«
Kennan zieht enervierend ruhig eine Augenbraue hoch. »Sind wir ein bisschen empfindlich?«
»Ich schwöre dir …«
»Beruhigt euch, alle beide.« Eine mir sehr willkommene Stimme weht von der Hügelkuppe zu uns herüber, als zwei vertraute Gestalten, beladen mit nicht weniger willkommenen Vorräten, auf uns zulaufen. »Kann man euch nicht mal zehn Minuten lang allein lassen, ohne dass ihr euch an die Gurgel geht?«
»Entschuldige, Fiona.« Es ist fast, als würde ich mich bei einem verärgerten Elternteil entschuldigen, nicht bei einer besorgten besten Freundin.
»Ich werde mich nicht entschuldigen«, sagt Kennan, was niemanden überrascht.
»Es geht hier doch nicht um Schuld.« Mads nimmt seinen schweren Rucksack von den breiten Schultern und stellt ihn auf den Boden. »Wir müssen etwas essen und wir brauchen einen Plan. Das ist im Augenblick wichtiger.«
»Sehe ich genauso.« Ich nicke, erleichtert über die Ablenkung von dem Streit mit Kennan. »Habt ihr im Ort etwas erfahren?«
»Nicht viel mehr als in den letzten Dörfern, durch die wir gekommen sind.« Fiona verzieht das engelsgleiche Gesicht. »Sie sagen, am Ortsrand habe ein verrückter alter Einsiedler gelebt, der sei aber schon vor Ewigkeiten gestorben.«
»An den Flecken?«, frage ich und streiche unwillkürlich mit den Fingerspitzen über mein Handgelenk.
Fiona und Mads schütteln den Kopf und wechseln einen vielsagenden Blick. Ich will gerade nachfragen, als Mads von sich aus erzählt: »Er wurde ermordet. Ein Stich ins Herz mit einem goldenen Dolch.«
Mir gefriert das Blut in den Adern. Der Wind frischt wieder auf, etwas kälter als vorher.
Für einen Sekundenbruchteil sehe ich das Bild in meinem Kopf, nur dass es nicht das Haus irgendeines alten Einsiedlers ist, sondern mein Zuhause. Und die Leiche ist die meiner Mutter. Der Boden ist voller Blut. Der Geruch ist überwältigend. Die Stille ohrenbetäubend.
Meine Beine zittern.
»Shae.« Eine Hand legt sich sanft auf meine Schulter und holt mich zurück auf den Hügel vor Valmorn. Fionas freundliche grüne Augen blicken mich fest an. »Es ist okay. Du bist in Sicherheit.«
Ich ergreife Fionas Hand, drücke sie und nehme ihre Körperwärme auf. Ich konzentriere mich auf ihr vertrautes Gesicht – hohe Wangenknochen, hellblonde Augenbrauen, die kleine Stupsnase, das Lächeln voller Zuversicht – und lasse mich von ihr in die Realität zurückholen. Allmählich kehre ich zurück und weiß wieder, wie man atmet.
»Das ist alles?« Kennan trommelt gereizt mit den Fingerspitzen auf den verschränkten Armen. »Da hätte ich ja in der Hälfte der Zeit doppelt so viel herausgefunden.«
»Das behauptest du ständig«, sagt Mads, hockt sich neben seinen Rucksack und fängt an, ihn auszupacken. »Aber das ändert nichts daran, dass du eine Bardin bist und das den Leuten auffallen würde, zumal du Fragen stellst, an die man sich erinnern wird, wenn das Hohe Haus auf der Suche nach uns unausweichlich hier vorbeikommt.«
Kennan weiß, dass er recht hat, doch sie rümpft nur die Nase und wendet den Blick ab.
Ich gehe mit Fiona zu Mads. Die Vorräte, die sie auftreiben konnten, sind mager, aber ich weiß, dass sie alles gegeben haben, womöglich auch ihr restliches Geld, um überhaupt so viel zu bekommen.
Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll, als ich mich wieder auf die rissige Erde setze und zusehe, wie Mads und Fiona eine Bestandsaufnahme machen. Dankbarkeit vermischt sich auf unangenehme Art mit Schuldgefühlen. Die beiden sind hier, weil sie mir helfen wollen. Aber dafür mussten sie alles zurücklassen, was sie kannten und liebten.
Anders als ich haben sie Familien zu Hause in Aster. Fionas Vater und ihr Bruder sind wahrscheinlich krank vor Sorge, und Mads’ Eltern müssen ihn furchtbar vermissen. Ich kann mich nicht mal zu der Frage durchringen, ob ihre Eltern wissen, dass sie meinetwegen fortgegangen sind – der Lieblingsausgestoßenen des Dorfes.
»Wir haben Essen für etwa drei Tage – wenn wir es uns gut einteilen«, stellt Mads fest. Vor ihm befinden sich unser Wasservorrat in Feldflaschen, ein wenig beeindruckendes Türmchen Dosenbohnen und ein paar kümmerliche Streifen Trockenfleisch.
»Wir wissen immer noch nicht, wie lange wir unterwegs sein werden«, sagt Fiona. Mit sorgenvoll gefurchter Stirn sieht sie mich an.
Ich kann ihre Angst gut verstehen. Auch ich fürchte mich. Unwillkürlich taste ich nach meiner Tasche, in der unser einziger Wegweiser liegt: eine herausgerissene Seite aus dem Buch der Tage.
Bei unserer Flucht aus dem Hohen Haus wirkte dieses Stück Papier beseelt, als wäre es lebendig. Worte und Bilder verwoben sich auf der Oberfläche miteinander und wiesen uns den Weg. In knapp zwei Wochen führte es uns zu zwei sicheren Unterkünften. Doch je länger unsere Reise dauerte, umso träger wurden die Bewegungen der Bilder, und die Worte verblassten. Die Unterkunft, von der wir gerade kommen, haben wir durch pures Glück gefunden.
Je weiter wir reisen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir diese Seite wieder mit dem Rest des Buchs zusammenführen können. Der Dieb könnte inzwischen überall sein. Ohne einen Hinweis auf seine Beweggründe kann ich nur blind dem Weg folgen, der vor mir liegt.
Was hast du vor, Ravod?, frage ich mich. Lästigerweise geht er mir ständig durch den Kopf. Er ist irgendwo da draußen und er hat das Buch der Tage bei sich.
Wenn er damit die Realität hätte umschreiben wollen, hätte er das inzwischen wohl getan, denke ich. Es ist ein seltsames Gefühl, ihm so etwas zuzutrauen. Andererseits hätte ich aber auch nie geglaubt, dass er das Buch stehlen würde. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich ihm ein paar sehr deutliche Worte zu sagen haben. Und ich hoffe sehr, das ist alles, was ich dann tun muss.
Ich nehme die Seite heraus und betrachte sie, wobei ich hoffe, dass man mir meine Besorgnis nicht zu deutlich ansieht. In einer Ecke befindet sich ein dunkler Fleck – mein Blut –, den ich nie lange ansehen kann. Davon abgesehen ist es ein normales Stück abgerissenes Papier mit einem blassen Symbol für ein Haus, umgeben von Bäumen, und einem einzigen Wort: Osten.
»Wir müssen weiter Richtung Osten.« Mit so viel Zuversicht in der Stimme, wie ich aufbringen kann, füge ich hinzu: »Wenn wir nach Bäumen Ausschau halten, müsste dort irgendwo die nächste Unterkunft sein.«
Ich brauche nicht aufzusehen, um zu wissen, dass Kennan die Augen verdreht.
»Du klingst so vertrauenswürdig wie ein billiger Wahrsager auf einem Basar.«
Ich sehe sie blinzelnd an und weiß nicht recht, ob ich wütend oder überrascht sein soll, dass sie schon jetzt den nächsten Streit anfängt.
»Kennan, das bringt uns nicht weiter«, sagt Fiona. »Wir sind alle angespannt. Wir müssen zusammenhalten.«
Kennan sieht Fiona mit einem starren Blick an, den ich nur zu gut aus der Zeit kenne, als sie im Hohen Haus meine Ausbilderin war. Reflexhaft springe ich auf und bin bereit, meine Freundin zu verteidigen, sollte ihr auch nur ein einziges ihrer goldblonden Haare gekrümmt werden.
»Was uns nicht weiterbringt, ist, in einer so großen Gruppe zu reisen, ohne unser Überleben sichern zu können«, faucht Kennan. Diesen Sermon hat sie schon oft von sich gegeben: dass eine fähige Einzelperson mehr Erfolg hätte als drei unbeholfene Kinder.
»Wir kommen nicht schnell genug nach Gondal – falls das überhaupt existiert – und was für vier Personen eine Dreitagesration ist, würde bei einer einzelnen zwei Wochen lang reichen.«
Ich weiß, dass es nicht falsch ist, was sie sagt, trotzdem starre ich sie ungläubig an. Sie würde uns tatsächlich einfach so zurücklassen.
»Hör mal.« Ich zwinge mich, ruhig zu bleiben. Ich kann nicht glauben, dass ich hier die Friedenswächterin spiele, aber bei Kennan helfen selbst Fionas Diplomatiekünste nicht weiter. Ich muss wenigstens versuchen, unsere ungleiche Truppe zusammenzuhalten. »Du bist die Fähigste von uns, Kennan, das steht außer Frage. Aber für uns alle steht bei dieser Reise etwas auf dem Spiel und wir haben es alle verdient, sie zu Ende zu bringen. Also statt diese Diskussion noch einmal zu führen, lass uns lieber essen und wieder auf die Straße kommen, solange es noch hell ist.«
Kennan sieht abwechselnd mich und Fiona an, bevor sie sich gnädig abwendet.
»Sie weiß ganz genau, wie einschüchternd sie wirkt, das muss ich ihr lassen«, flüstert mir Fiona zu.
Ich nicke. »Oh, ich auch, glaub mir.«
Wenn das alles vorbei ist, will ich nie wieder kalte Bohnen aus der Dose essen. Wir sind ein paar Stunden Richtung Osten gelaufen und ich habe den Geschmack immer noch im Mund. Viel besser hätten sie wahrscheinlich auch nicht geschmeckt, wenn wir ein Feuer gemacht hätten, um sie zu erwärmen, und Mads hat das gute Argument vorgebracht, dass ein Lagerfeuer weithin sichtbar gewesen wäre.
Dass vom Hohen Haus nirgends etwas zu hören oder zu sehen ist, bereitet mir allmählich Sorgen. Je länger wir unterwegs sind, ohne in einen Hinterhalt zu geraten, umso stärker wird das bedrohliche Gefühl, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Ein Blick zu meinen Mitreisenden sagt mir, dass ich damit nicht allein bin.
Die Sonne über uns schwindet und der flache staubige Boden weicht totem Gestrüpp und seltsam knorrigen Büschen. Neben mir höre ich Fiona jedes Mal genervt murren, wenn ihr Rock an den Dornen hängen bleibt. Als wir eine Gruppe verdorrter Bäume erreichen, hat sie das lästige Kleidungsstück über den Knien zusammengeknotet. Ihre langen, hellen Beine sind voller Kratzer.
In meinem ganzen Leben habe ich Fiona noch nie klagen gehört und offenbar hat sie auch jetzt nicht vor, damit anzufangen. Meinen besorgten Blick tut sie mit einem freundlichen Lachen ab.
»Das erste Opfer, das dieses Abenteuer fordert, wird wohl mein Rock sein!« Sie klingt unbeschwert, verzieht aber den Mund, als sie an mir vorbeigeht.
Ich weiß, dass Widerrede zwecklos ist, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Also laufe ich neben Mads weiter, der den Blick über die Umgebung schweifen lässt.
»Eine Gegend wie diese habe ich noch nie gesehen, nicht mal in den bewaldeten Gebieten zu Hause in den Bergen«, sagt er nachdenklich. »Da werden wir auf jede Menge Schwierigkeiten stoßen.«
»Um die kümmern wir uns, wenn es so weit ist«, erwidere ich. Allerdings teile ich seine Einschätzung leider. Je weiter wir gehen, desto dichter werden die abgestorbenen Bäume und das Unterholz und es dunkelt schnell. Von Mads sehe ich nur noch die Umrisse seiner großen, muskulösen Gestalt. Seine blauen Augen hat die Düsternis verschluckt.
Er sieht auf eine raue Art gut aus und er ist sich dessen durchaus bewusst. Seine Attraktivität war in unserer unglückseligen Beziehung nie ein Hindernis, doch als ich seinen Heiratsantrag ablehnte, war mir klar geworden, dass ein größeres Problem zwischen uns stand: Unser Temperament und unsere Erwartungen waren einfach zu verschieden.
Nun, da sich unsere Wege wieder gekreuzt haben, lässt sich der frühere Funke zwischen uns nicht so leicht wieder entfachen. Wobei er sich auch schon beim ersten Mal nicht so recht entfachen lassen wollte. Und eigentlich sehe ich auch keinen Grund, warum ich es versuchen sollte – ich finde es vollkommen in Ordnung so, wie es ist.
Mads löst den Blick von den Bäumen, sieht mich mit einem leichten Stirnrunzeln an und sagt in meine Gedanken hinein: »Je schneller wir die sichere Unterkunft finden, desto besser.«
Ein dunkles Heulen, irgendwo aus den Tiefen des Waldes, jagt mir einen Schauer über den Rücken. Welche Raubtiere hier auch leben, sie werden vier verirrte Reisende sicher sehr appetitlich finden.
»Was war das?« Fiona fährt mit einem Ruck zu uns herum.
»Wölfe«, sagt Mads. »Wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor sie ausschwärmen, um uns einzukreisen.«
Kennan wendet das Messer, das sie vorhin nach mir geworfen hat, zwischen den Fingern. Leise sagt sie: »Dann sollten wir einen Zahn zulegen, was?«
Ausnahmsweise sind wir uns mal einig und so schlagen wir uns tiefer in den Wald. Das Dämmerlicht hüllt die Bäume in einen matten Schimmer, sodass sie aussehen wie gebleichte Knochen, die aus der Erde aufragen. Mir schlägt das Herz gegen die Rippen.
Ich nehme die Buchseite aus der Tasche und starre im letzten schwindenden Licht verzweifelt darauf. Die Tinte auf dem Papier formt sich zu einem blassen, sinnlosen, wenig hilfreichen Klecks.
»Was hat das zu bedeuten?« Fionas Kopf taucht über meiner Schulter auf, sie zeigt auf das Blatt.
Seufzend schüttle ich den Kopf. »Es hat überhaupt nichts zu bedeuten.«
»Nein, nein, es sieht aus wie eine Hand.« Fiona sieht genauer hin. »Und sie zeigt auf etwas.«
Ich kneife die Augen zusammen und schnappe nach Luft, als ich sehe, dass sie recht hat. Der Tintenfleck hat die Form einer Faust angenommen, von der aus ein Finger nach rechts weist. Allerdings ist auf dem Papier nichts, das uns verraten würde, worauf dieser Finger gerichtet ist.
»Nutzloses Stück Müll«, fauche ich das Papier an und stecke es wieder in die Tasche, um dann verärgert mit dem rechten Arm die Zeigegeste zu imitieren. »Wie soll denn ein ausgestreckter Finger …«
Ich stoße scharf die Luft aus. Wenn man an meinem Finger entlang in die sich verdichtende Finsternis blickt, zeichnet sich ein großer Schatten vor den Bäumen ab.
Ein neuerliches Heulen dringt aus dem Gebüsch, lauter als zuvor. Die Wölfe kommen näher.
»Hier drüben!«, rufe ich den anderen zu und zeige auf den Bereich rechts von dem Pfad, den wir uns gebahnt haben. Mads und Fiona folgen mir, ohne zu zögern. Kennan blickt skeptisch in Richtung der Bäume, auf die ich zuhalte, doch ein Rascheln im Gebüsch ganz in der Nähe treibt sie eilig wieder zu uns. Gegen ein Rudel Wölfe fühlt selbst sie sich in Gesellschaft sicherer.
Die Wölfe kommen näher. Ich kann sie in den Sträuchern hören und renne so schnell ich kann durch die Dornenranken, die sich an meinen Beinen festkrallen. Vor mir nehmen die Umrisse einer kleinen, reetgedeckten Hütte Gestalt an. Die Unterkunft!
In den Büschen um uns herum zeigen sich die ersten dürren, ausgehungerten Wölfe. Sie knurren bedrohlich. Mads erreicht die Tür als Erster, stößt sie auf und ruft uns zu, wir sollen uns beeilen. Ein Wolf schnappt nach Fiona. Ich ergreife ihre Hand und zerre sie mit zusammengebissenen Zähnen durch die Dornen, die an meiner Kleidung zerren und mir die Haut aufreißen.
Der erste Wolf setzt zum Sprung an, als wir die Tür erreichen. Nacheinander stürzen wir uns in die Dunkelheit im Inneren der Hütte und Mads knallt im letzten Augenblick die Tür hinter uns zu. In der Schwärze dahinter verstummt das Heulen der Wölfe.
KAPITEL 2
Es wird schnell klar, dass die sichere Unterkunft schon lange verlassen ist, und wahrscheinlich spukt es hier. Es ist so dunkel, dass ich absolut nichts sehen kann. Die Bodendielen knarzen. Draußen höre ich die Wölfe umherstreifen und ein durchdringender Gestank nach Fäulnis brennt mir in der Kehle, während ich im Dunkeln herumtaste. Das Erste, was meine Finger berühren, ist Fionas Arm. Sie schreit auf.
»Da ist irgendwas!«
Wenigstens bin ich nicht allein mit dem Gefühl, dass dieser Ort von einem ruhelosen Geist bewohnt wird.
»Schon gut, ich bin’s nur«, beruhige ich sie. Fiona greift nach meiner Hand, um sich zu vergewissern, dass ich ein Wesen aus Fleisch und Blut bin, und lacht schwach.
»Das hier ist wohl besser, als von Wölfen gefressen zu werden«, sagt Fiona. Ihr Ton klingt zwar unbeschwert, aber sie lässt meine Hand nicht los.
»Genug gelacht«, sagt Kennan irgendwo in der Dunkelheit. »Sucht euch einen Platz zum Ausruhen, wir brechen im Morgengrauen wieder auf. Wenn ich schon in diesem heruntergekommenen Schuppen schlafen muss, will ich nicht auch noch von eurem ewigen Geschnatter gestört werden.«
Während sie das sagt, stolpert Mads im Dunkeln über etwas. Er flucht heftiger, als ich es ihm zugetraut hätte. Dann höre ich ihn wieder aufstehen.
»Alles okay da drüben?« Ich wage mich weiter in die Finsternis vor und ziehe Fiona mit mir.
»Ich glaube, ich habe eine Laterne gefunden«, sagt er.
Ich höre, wie er in seiner Tasche kramt, dann das Geräusch eines Streichholzes. Im nächsten Augenblick springen Funken auf den Docht einer Öllampe über. Fiona quiekt vor Freude und klatscht in die Hände. Das Licht reicht bis in die Ecke des Raums, in der Kennan mal wieder die Augen verdreht. Mads sieht es entweder nicht oder er ignoriert es. Er hängt die Laterne an einen Haken an der Wand. »Viel Wärme wird sie nicht spenden und es ist nur noch für wenige Stunden Öl da, aber es ist besser als nichts.«
»Ich übernehme die erste Wache«, sage ich. »Ich will mich hier umschauen. Legt ihr euch schlafen.«
Es kommen keine Einwände von den anderen, alle suchen sich ein Fleckchen und machen es sich bequem.
Ich kämpfe gegen meine Erschöpfung an. Vor den anderen wollte ich nicht zugeben, dass ich mich vor dem Einschlafen fürchte. Wegen ein paar schlimmer Träume brauche ich sie nicht zu beunruhigen. Aber es sind intensive, lebhafte Träume, die die extremsten Gefühle aus allen Winkeln meiner Psyche hervorzerren. Manchmal kann ich mich an sie erinnern, manchmal nur an die Angst, die sie hinterlassen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich auf dieser Reise schon keuchend aus dem Schlaf hochgeschreckt bin.
Fiona hat mich bereits ein paarmal auf meine unruhigen Nächte angesprochen, aber ich konnte sie davon überzeugen, dass ihre Sorge unbegründet ist. Die Albträume werden nicht davon verschwinden, dass ich Fiona von ihnen erzähle. Und wie ich Fiona kenne, würde es sie nur verrückt machen, dass sie das Problem nicht lösen kann. Bei Mads und Kennan weiß ich nicht, ob sie es überhaupt mitbekommen haben. Mit den beiden wäre es viel schwieriger, darüber zu sprechen. Mads war noch nie ein sonderlich emotionaler Typ. Und Kennan ist Kennan.
Aber um ehrlich zu sein, macht mir der Schlaf weniger Sorgen als die Krankheit, die unter meiner Haut lauert. Cathals Abschiedsgeschenk: die Flecken.
Der Gedanke an Cathal tut immer noch weh. Noch so eine Sache, von der ich nicht sicher bin, wie lange ich sie noch in Schach halten kann. Früher oder später wird mich der Schmerz des Verrats bei lebendigem Leib auffressen – wenn mich die Krankheit nicht zuerst dahinrafft. Mit stetigen Beschwörungen halte ich sie bisher unter Kontrolle; meine Adern sehen nur wenig dunkler aus als normalerweise.
Im Moment noch.
Gähnend recke ich die Hände über den Kopf. Ich muss mich auf irgendetwas anderes konzentrieren. Mads hat gesagt, in der Laterne ist nur für wenige Stunden Öl. Also werde ich die Hütte durchsuchen, solange es noch möglich ist. Auf Zehenspitzen nehme ich die Laterne vom Haken.
Ich weiß nicht, wonach ich suche, aber Geheimnisse verstecken sich gern an den unwahrscheinlichsten Orten.
Schnell mache ich eine Bestandsaufnahme meiner unmittelbaren Umgebung. Die Hütte ist kaum größer als das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und unterscheidet sich wenig von den anderen sicheren Unterkünften, in denen wir bisher waren. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine einfache Hütte im Wald. Aber in diesen Wänden steckt eine Geschichte, das spüre ich. Nach allem, was passiert ist, bin ich ziemlich gut darin, solche Dinge wahrzunehmen. Darin, einem höheren Instinkt zu vertrauen und nicht dem äußeren Anschein der Dinge.
Ich nutze die Informationen, die ich habe, und rufe mir die Geschichte in Erinnerung, soweit ich sie kenne. Die Person, die hier gelebt hat, war Teil eines Netzwerks, das Menschen half, die vor dem Hohen Haus nach Gondal flohen. Auch meine Mutter gehörte zu diesem Netzwerk.
Die meiste Zeit meines Lebens hat sie nicht gesprochen. Nachdem mein Bruder Kieran an den Flecken gestorben war, sprach sie kein Wort mehr. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, verstehe ich das. Ich habe immer geglaubt, sie hätte Angst, und vielleicht hatte sie das auch, aber es war alles noch viel komplexer.
Ich überlege, ob sich die beiden gekannt haben, wer meine Mutter für den Bewohner oder die Bewohnerin dieses Hauses gewesen sein mag. Vielleicht war es ein abtrünniger Barde, genau wie sie. Vielleicht war sie sogar irgendwann einmal hier zu Besuch. Ich starre in das schwache Licht, als könnte ich darin die Phantome dieser Menschen erblicken, als könnte ich sie durch die bloße Kraft meiner Verzweiflung irgendwie dazu bewegen, mir ihr Wissen preiszugeben.
Doch so angestrengt ich auch starre, ich sehe nicht mehr als die verfallende Einrichtung eines unglaublich alten, muffigen Hauses. Was noch von den Möbeln übrig ist, ist zerbrochen und mit Staub überzogen. An einigen Stellen wachsen Flechten auf dem Holz. Das Haus wurde robust gebaut, aber lange wird es nicht mehr stehen.
Ich kneife die Augen zusammen. Ein hohes Regal, ganz hinten in der Ecke, scheint vom Zahn der Zeit seltsam verschont geblieben zu sein. Ich bemühe mich, so wenig wie möglich zu knarzen, um die anderen nicht zu wecken, während ich vorsichtig näher trete und die Laterne höher halte, um besser sehen zu können.
Was sich einmal in diesem Regal befunden haben mag, ist jetzt fort. Da es in der Nähe eines rostigen Herds steht, schätze ich, dass der rebellische Barde hier seine Lebensmittel aufbewahrt hat. Einige auf dem Boden verstreute Kochutensilien bestätigen diese Vermutung. Offenbar ist Mads vorhin über einen Blechkrug gestolpert.
Ganz hinten im Regal entdecke ich auf Augenhöhe eine merkwürdige Metallvorrichtung, die aussieht wie der Henkel eines Bechers. In einem vollen Regal wäre sie gut versteckt gewesen.
Ich greife mit einem Finger um das kalte, verrostete Metall und wackle ein bisschen. Es gibt leicht nach, so als wäre es nicht ganz fest im Holz verankert. Wenn ich an dem Griff ziehe, wird wahrscheinlich das Regal auf mich kippen.
Stattdessen versuche ich, ihn anzuheben. Nichts. Drücken führt zum selben Ergebnis. Ich versuche, ihn wie einen Türknauf zu drehen.
Klick.
In der Wand, gedämpft durch das Holz, ist ein leises Geräusch zu hören und das Regal schwingt sanft in meine Richtung auf. Eine Geheimtür.
Aber dahinter liegt kein Raum, sondern nur eine etwas zurückgesetzte, verputzte Wand, auf die spezielle Symbole und Markierungen gemalt sind. Eigentümlich, aber zugleich vertraut. Das Licht ist so schwach und die Farben sind so verblasst, dass ich praktisch die Nase gegen das Wandbild drücken muss, um die Zeichen zu entziffern.
Es ist eine Landkarte. Die gleiche wie die aus dem Buch der Tage, der ich folge. Und genau wie im Buch ist mit dem Symbol eines Sichelmonds ein Weg markiert – das Netz aus Unterkünften. Die Markierungen bilden einen Pfad von Süden nach Osten. Das Haus meiner Mutter war der nördlichste Punkt dieses Weges und dieses Haus hier ist die vorletzte Unterkunft vor dem Ende des Pfads.
Die Karte ist auf eine geheimnisvolle Art schön. Die Farben und Formen fließen beeindruckend ineinander. Die Person, die hier gelebt hat, muss viele Stunden lang daran gearbeitet haben. Es ist nicht nur eine Darstellung der geografischen Gegebenheiten, sondern ein Kunstwerk.
Ich zeichne den Weg mit dem Finger nach, folge dem Pfad, präge ihn mir ein. Wir müssen weiter Richtung Südosten, durch den Wald bis zum äußersten Rand von Montane. Hinter der letzten sicheren Unterkunft, symbolisiert durch den Sichelmond, ist auf der Karte eine leuchtende goldene Sonne verzeichnet.
Das muss Gondal sein.
»Netter Fund.«
Kennans Stimme hinter mir lässt mich zusammenzucken. Als ich mich wieder gefangen habe, bin ich doppelt überrascht, dass das tatsächlich wie ein Lob klang.
»Irgendwann erschreckst du mich noch mal zu Tode«, knurre ich und drehe mich zu ihr um. Kennans bernsteinfarbene Augen glühen regelrecht in dem matten Licht.
»Wahrscheinlich.« Sie nickt knapp. »Du hast ja schließlich ein verblüffend schwaches Herz.«
»Und du bist ein …« Ich breche ab, weil ich höre, wie Fiona im Schlaf etwas murmelt und sich bewegt. Wie immer fällt es mir schwer, mich von Kennan nicht provozieren zu lassen. Ich atme tief durch und senke die Stimme, in der Hoffnung, diese Unterhaltung noch in eine irgendwie nützliche Richtung zu lenken.
»Schau dir die Karte an. Wenn wir Kurs nach Südosten nehmen, kommen wir zum Waldrand und sind auf halbem Weg zur letzten Unterkunft.«
Kennan tritt näher an die Karte heran. »Siehst du diese Markierungen? Sie sind anders als die, die für das Ödland stehen. Das Gelände wird sich verändern.« Sie deutet auf das Gebiet hinter dem Wald, und richtig: Anstelle der geraden Linie, die das Ödland symbolisiert, ist da eine gewellte Linie mit einigen senkrechten Strichen in unregelmäßigen Abständen.
Ich habe schon einiges von Montane gesehen. Bisher war fast alles davon Gebirge, Ödland oder abgestorbener Wald. Ich weiß nicht, was es sonst geben könnte.
»Gut zu wissen«, sage ich. »Wir brauchen jede Information, die wir kriegen können.«
»Und jeden Vorteil«, fügt Kennan hinzu und wirft mir über die Schulter einen vielsagenden Blick zu. »Jetzt können wir diese Karte vernichten.«
Bei ihren Worten bildet sich ein Knoten in meinem Inneren. »Was? Warum?«
Kennan sieht mich mit schief gelegtem Kopf an, ganz offensichtlich sucht sie nach Worten, die meine Dummheit beschreiben. Es kostet mich Mühe, ihrem Blick standzuhalten.
»Es ist eine Karte.« Sie sagt das, als spräche sie mit einem kleinen Kind. »Sie zeigt Leuten, wo sie hinmüssen. Uns, ja. Aber auch denen.«
Den Barden. Sollten sie uns bis hierher gefolgt sein und würden die Karte lesen, dann wüssten sie genau, wo wir hingehen. Es ist ein gutes Argument, aber ich kann das unbehagliche Gefühl nicht abschütteln, das mich bei der Vorstellung, diese Karte zu zerstören, überkommt.
»Dann verstecken wir sie wieder«, entgegne ich. »Ich habe sie auch nur durch einen Zufall gefunden.«
»Dieses Risiko willst du eingehen?« Kennan verschränkt die Arme vor der Brust. »Was ist, wenn sie uns folgen? Und uns bei der nächsten Unterkunft in einen Hinterhalt locken? Uns umbringen? Oder Schlimmeres?«
»Und wenn wir es zerstören, sind wir dann besser als das Hohe Haus? Wir würden diese Informationen vollständig auslöschen, genau wie sie es tun.« Meine geballten Fäuste zittern. »Das fühlt sich nicht richtig an.«
Kennan schweigt und für einen Augenblick glaube ich, ich hätte sie umgestimmt, doch dann schüttelt sie den Kopf.
»Ich lasse nicht dich darüber entscheiden, ob ich zur Märtyrerin werde«, sagt sie.
»Warte, Kennan!« Die Worte bleiben mir beinahe im Hals stecken. »Es gibt noch eine andere Möglichkeit.«
»Irgendwie lustig, dass du das in Erwägung ziehst, nach dem, was du Niall angetan hast.«
Mein Mund klappt zu. Kälteschauer überlaufen mich, als ich daran zurückdenke, dass ich vor nicht allzu langer Zeit die Existenz eines Menschen ausgelöscht habe. Ich kann es rechtfertigen, so viel ich will, aber letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen, es zu tun.
»Woher …« Mein Stimme ist nur ein brüchiges Flüstern. Ich räuspere mich, versuche es erneut und scheitere.
»Woher ich das weiß?«, bringt Kennan den Satz für mich zu Ende. »Du hast jede Nacht im Schlaf dafür um Vergebung gebeten. So oft, wie du darüber sprichst, überrascht es mich, dass es nicht schon ganz Montane weiß.«
Ich versuche vergeblich, den Kloß in meinem Hals hinunterzuschlucken. Kein Wunder, dass sich Fiona Sorgen macht.
Kennan beachtet mich nicht mehr, sondern geht auf die Karte zu und streicht mit den Fingerspitzen über die Oberfläche. Eine kaum hörbare Beschwörung kommt von ihren Lippen. Die Oberfläche des Wandbilds fängt an abzublättern, sich zu lösen, Risse zu bilden. Fäulnis kriecht darüber und verzerrt das Bild, bis es vollkommen unleserlich geworden ist.
Anschließend hält Kennan einen Moment inne, betrachtet die Wand mit zusammengezogenen Brauen, spreizt die Finger und fährt sich genervt durch die Haare. Dabei löst sich eine einzelne schwarze Locke aus ihrem ansonsten perfekt ordentlichen Haarknoten. Für einen Moment streift so etwas wie eine Sorgenwolke ihre Züge.
Sie ist schlau. Aus Bardensicht ist das eine meisterhafte Beschwörung. Ihre Worte allein könnten das Fresko nicht zerstören, zumindest nicht dauerhaft. Stattdessen hat sie die Jahre des Verfalls beschleunigt, indem sie dem bereits vorhandenen Moder befahl, es für sie zu zerstören.
Trotzdem hinterlässt die Vernichtung der Karte einen bitteren Nachgeschmack. Sie war das Einzige auf dieser Welt, das von ihrem Erschaffer geblieben war. Jetzt ist sie fort, genau wie er. Als hätte er nie existiert.
Ich weiß nicht, warum ich mich einem Menschen, dem ich nie begegnet bin, so sehr verbunden fühle. Vielleicht liegt es daran, dass wir dasselbe erreichen wollen. Der einzige Unterschied ist – bisher –, dass er gescheitert ist.
Ich habe furchtbare Angst, dass mich dasselbe Schicksal erwartet.
Kennans Worte verfolgen mich in meine ohnehin schon unruhigen Träume. Tintenblaue Adern winden sich in meinem Inneren, durchbrechen meine Haut und ranken sich in die Finsternis, sodass ich wie eine Fliege in einem Spinnennetz gefangen bin. Die Erwähnung von Nialls Namen beschwört ihn aus meinem Unterbewusstsein herauf, er ist verblichen und verzerrt, aber kein bisschen weniger angsteinflößend. Es überrascht mich nicht, dass ich ihn nicht deutlich erkennen kann – er existiert nicht mehr. Durch meine Schuld.
Ich schreie die geisterhafte Gestalt in meinem Kopf bis zur völligen Erschöpfung an. Er war ein Mörder. Ein Monster. Er hat es nicht verdient zu leben. Ich habe das Richtige getan.
Oder nicht?
Die einzige Antwort, die ich erhalte, ist Nialls Geist, der mit einem goldenen Dolch auf mich losgeht und ihn mir in die Brust stößt.
Ich erwache mit hämmerndem Herzen und schweißgebadet. Bis zum Sonnenaufgang kämpfe ich gegen das Schlafbedürfnis meines Körpers an. Als Kennan die anderen zum Aufbruch scheucht, bin ich gleichermaßen erschöpft und erleichtert.
Ich murmle eine Beschwörung, um die Krankheit zurückzudrängen, wie ich es jeden Tag tue, seit wir unterwegs sind, und kämpfe mich auf die Füße. Die Beschwörung fällt mir ein bisschen schwerer als sonst, aber ich verdränge den Gedanken und schiebe es auf die Müdigkeit.
Graues Tageslicht sickert durch die Bäume und die Wölfe haben sich zurückgezogen. Im Wald ist es unheimlich still, nur das Krächzen der Krähen in den knorrigen Baumkronen und das Knirschen unserer Schritte im Unterholz ist zu hören.
So früh am Morgen hat keiner von uns die Energie zu reden. Es überrascht mich, als Mads mich einholt und sich räuspert, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen.
»Hey, Sprosse.« Irgendwie wirkt es beruhigend, diesen vertrauten Spitznamen zu hören.
»Hey«, erwidere ich.
»Kann ich dich mal was fragen?«
Als ich den Kopf drehe, muss ich gähnen. Zum Glück sind Mads und ich so vertraut miteinander, dass er das nicht persönlich nehmen wird.
»Klar.«
»Ich …« Seine Stimme wird plötzlich brüchig und er spricht leise weiter. »Ich habe gestern Abend dein Gespräch mit Kennan mitgehört.«
Ich atme tief die kalte, feuchte Morgenluft ein. Davor hatte ich mich gefürchtet.
Mads war dabei. Er hat gesehen, was mit Niall passiert ist. Aber wir waren so sehr damit beschäftigt, um unser Leben zu laufen, dass wir nicht darüber gesprochen haben. Irgendwie hatte ich wohl gehofft, wir würden es nie tun.
Vieles ist anders gekommen, als ich gehofft habe. Ich habe gelernt, mich anzupassen.
»Du willst wissen, was mit dem Barden im Hohen Haus passiert ist.« Ich spreche die Frage an seiner Stelle aus.
Mads runzelt die Stirn. »Die Sache ist die«, sagt er, »ich erinnere mich daran, dass wir uns durchs Hohe Haus gekämpft haben. Ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, es ist alles noch recht frisch. Ich erinnere mich, dass jemand da war. Und dann nicht mehr. Aber es ist komisch. Wie vernebelt. Als wäre ich eingeschlafen und hätte das Ende des Kampfes geträumt.«
Das ist wohl nur logisch. Ich habe nichts weniger getan, als Niall aus dem Dasein herauszuschreiben, aus dem Buch der Tage. Alle Spuren von ihm werden nach und nach aus der Welt verblassen, einschließlich Mads’ Erinnerung an ihn. Wenn Kennan sich noch an ihn erinnert, müssen Barden irgendwie dagegen immun sein, Personen zu vergessen, die mithilfe von Beschwörungen ausgelöscht wurden.
»Ich werde es dir erklären, so gut ich kann.«
Ich versuche, die Geschichte kurz zu halten. Schließlich sind wir noch müde, stapfen durch den Wald und haben keine Ahnung, wer alles mithören könnte. Aber ich erzähle ihm von Niall – dass er ein Barde war, dass er meine Mutter ermordet und es Kennan angehängt hat. Dass er uns umbringen wollte, als wir aus dem Hohen Haus geflohen sind. Bevor ich mir auf die Zunge beißen kann, trägt mich die Geschichte so weit, dass ich beschreibe, wie ich während des Kampfs mein Blut auf der Seite im Buch der Tage zu einer Beschwörung benutzt habe, um ihn auszulöschen.
Mads nimmt die Informationen schweigend auf. Er hat die Stirn in Falten gelegt und richtet den Blick konzentriert auf etwas, das ein Stück jenseits des Erdbodens liegt. Ich kenne Mads mein ganzes Leben und diese Art des Nachdenkens ist typisch für ihn.
Sie ist eine der vielen Eigenschaften, die ihn eigentlich zu einem guten Heiratskandidaten gemacht hatten. Das scheint schon so lange zurückzuliegen. In Anbetracht unseres unbeschwerten, freundschaftlichen Umgangs kommt es mir beinahe komisch vor, je etwas anderes in Betracht gezogen zu haben.
»Hältst du mich für einen schlechten Menschen?« Die Worte sind kaum mehr als ein Flüstern. Ich weiß nicht, welche Antwort ich von ihm hören möchte.
Mads sieht mich mit einem Blick an, den ich sehr gut kenne. Er versucht, eine heikle Wahrheit auszusprechen. Genauso hat er ausgesehen, als er zum ersten Mal etwas probierte, das ich gekocht hatte. »Ich bin kein Barde oder so. Aber wenn du ihn mit der Seite aus dem Buch der Tage auslöschen konntest, könntest du ihn dann nicht auf dieselbe Weise eines Tages zurückholen, wenn du wolltest?«
»Ich … Vielleicht?« Ich zögere. »Ich weiß es nicht. Aber …«
»Worauf ich hinauswill«, unterbricht mich Mads, als er die Unsicherheit in meiner Stimme bemerkt. Er legt mir sanft seine große Hand auf die Schulter, damit ich stehen bleibe. »Du hast deine Entscheidung getroffen. Das war eine schwere Aufgabe für dich und du musstest sie unter großem Druck treffen. Dass du damit zu kämpfen hast, sagt viel über dich aus.« Er beugt sich ein wenig vor und zieht die Augenbrauen hoch, um sicher zu sein, dass ich ihn ansehe. »Unter uns, als dein Freund: Ich bin mit dir einer Meinung, dass dieser Kerl offenbar der letzte Dreck war und bekommen hat, was er verdiente.«
Ich bringe ein winziges Lächeln zustande. »Danke, Mads.«
»Na klar.«
Plötzlich werden wir von einem Ausruf des Ekels unterbrochen. Vor uns verzieht Fiona heftig das Gesicht und ruft: »Was ist das?«
Mads und ich wechseln einen Blick und beschleunigen unsere Schritte, um sie einzuholen. Kennan und Fiona sind am Waldrand stehen geblieben und blicken auf eine weite, in morgendliches Licht getauchte Ebene.
Kennan hatte recht. Die Landschaft hat sich verändert.
Als Erstes trifft mich der Gestank. Faulige Abfälle, noch schlimmer als der Moder in der verlassenen Unterkunft. So weit das Auge reicht, erstreckt sich vor uns übel riechendes Wasser, durchsetzt mit schlammiger Erde und verfaulender Vegetation.
»Widerwärtig«, bemerkt Kennan mit einer Grimasse.
»Außerhalb von Montane sollte es besser sein, nicht … so.« Fiona hält sich mit dem Ärmel die Nase zu.
»Wir haben keine Wahl«, sage ich und versuche mir nicht anmerken zu lassen, wie schlecht mir ist. »Wir müssen durch dieses Moor, um zur nächsten sicheren Unterkunft zu kommen.«
Etwas zischt an meinem Ohr vorbei. Dann noch einmal, dicht an Kennans Arm. Sie springt zur Seite und sieht mich mit aufgerissenen Augen an, denn wir wissen beide, was das bedeutet.
Armbrustbolzen.
Ein Hinterhalt.
KAPITEL 3
Als ich die Barden sehe, die uns einkesseln, zittere ich am ganzen Leib. Schreie sind zu hören, klingen aber weit entfernt. Ich bin in meinem bebenden Körper gefangen und unfähig, mich zu rühren.
Mads zieht Fiona und mich hinter einen umgekippten Baumstamm, bevor die nächste Salve Geschosse niedergeht. Der Baumstamm ruckelt heftig, als er auf der anderen Seite mehrfach getroffen wird. Die Luft, die ich angehalten hatte, entweicht aus meiner Lunge und ich komme wieder zu Sinnen.
»Bleib unten!«, befiehlt Kennan, die mit einem Satz über den Baumstamm zu uns springt. »Wartet, bis sie nachladen, dann rennt.«
»Und was ist mit dir?«, frage ich und zucke zusammen, als der Baum erneut vibriert.
»Die Beschwörung ist hier aus irgendeinem Grund schwächer«, sagt Kennan. »Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe euch Rückendeckung.«
»Nein.« Ich schüttle den Kopf. »Ich bleibe bei dir.«
Kennan sieht mich mit einem Blick an, den ich nicht recht deuten kann. Schließlich nickt sie knapp.
»Mach mir alles nach und komm mir nicht in die Quere.«
Ich nicke ebenfalls.
Fiona neben mir sieht noch verängstigter aus, als ich es bin. Sie war noch nie in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt. Noch nie habe ich ihre Augen so weit aufgerissen und so voller Angst gesehen. Mit aller Kraft packt sie mich am Ärmel.
»Bitte sei vorsichtig, Shae«, flüstert sie.
Die letzten Bolzen schlagen in den Baumstamm ein, dann legt sich für einen kurzen Moment Stille über das Moor. In der Ferne höre ich, wie die Barden ihren Bogenschützen befehlen nachzuladen.
»Los«, sage ich zu Mads und Fiona und sehe ihnen nach, als sie loslaufen, ehe ich mich wieder zu Kennan umwende.
Sie steht auf und klettert mit der für sie typischen Ausstrahlung tödlicher Macht auf den Baumstamm. Im hellen Morgenlicht, das sie einhüllt, sieht sie aus, als würde sie leuchten. Vom schlammigen Boden aus gleicht sie einer der heroischen Bardenstatuen, die ich im Hohen Haus gesehen habe.
»Bereit?« Kennans Blick ist fest auf die Angreifer gerichtet, doch ihre Frage richtet sich an mich. Ich hole tief Luft.
Als ich zu ihr auf den Baumstamm komme, sehe ich, dass wir von einem halben Dutzend Barden umzingelt sind, acht weitere halten sich im Hintergrund und haben ihre Waffen auf uns gerichtet. Ich bin nicht gerade überzeugt von unseren Erfolgschancen, doch Kennan wirkt so ruhig wie eh und je.
Die Feinde kommen näher und nun kann ich erkennen, dass viele von ihnen die Lippen bewegen und Beschwörungen sprechen, um sich leichter durch den Schlamm bewegen zu können, der ihnen um die Waden schwappt. Trotzdem kostet es sie Mühe.
Offenbar stimmt es, was Kennan gesagt hat: Die Beschwörungen sind hier schwächer. Das würde erklären, warum die Flecken in meinen Adern nachgelassen haben und warum es schwieriger gewesen ist, sie mit meiner Gabe zurückzudrängen.
Neben mir hat Kennan begonnen, ihrerseits eine Beschwörung zu murmeln. Die Worte kommen tief aus ihrer Kehle und tragen ein sonores Murmeln in die Luft.
Ich erinnere mich an ihre Anweisung, ihr alles nachzumachen. Einzeln haben wir gegen eine Gruppe voll ausgebildeter Barden kaum eine Chance, selbst wenn diese ebenfalls geschwächt sind. Unsere einzige Möglichkeit ist, gemeinsam zu tun, was wir allein nicht könnten.
Ich atme tief durch, rufe mir meine Ausbildung ins Gedächtnis und spreche selbst eine Beschwörung aus – nicht gegen den Feind, sondern eine Stärkung für Kennan.
Das Wasser vor uns beginnt sich zu kräuseln. Die Barden geraten ins Straucheln und verlieren die Konzentration, als die vereinte Kraft von Kennans und meiner Beschwörung das Gewebe der Wirklichkeit verändert. Im nächsten Moment rutscht der Erste von ihnen in den Sumpf, dann der Nächste. Dann ein Dritter. Sie schlagen um sich, ehe sie im Wasser verschwinden. Ein paar Blasen steigen auf, das ist alles.
Die anderen Barden sind jetzt aus dem Konzept gebracht. Die Gruppe, die uns am nächsten ist, will kehrtmachen und sich neu ordnen, doch einer der drei fällt unserer vereinten Beschwörung zum Opfer und versinkt im Morast.
Die Bogenschützen zerstreuen sich. Ich spüre eine Spannung in der Luft und drehe mich zu Kennan um.
»Bleib, wo du bist«, sagt sie. »Sie wollen uns trennen.«
Sie haben allerdings immer noch den Vorteil der Waffen mit der größeren Reichweite. Binnen sehr kurzer Zeit haben sie uns umzingelt. Da wir noch in der Unterzahl sind, bin ich nicht überzeugt, dass uns eine vereinte Beschwörung vor ihren Armbrustbolzen schützen kann. Sie haben nur deshalb noch nicht geschossen, weil sie noch versuchen, unsere Fähigkeiten einzuschätzen.
Ich versuche erfolglos, den Kloß in meinem Hals hinunterzuschlucken. Eine unheimliche Stille legt sich über das Moor. Mein stoßweise gehender Atem scheint im Umkreis von Meilen das einzige Geräusch zu sein. Ich sehe abwechselnd Kennan und die Barden an.
Plötzlich erklingt ein schriller Pfiff. Mein Blick hetzt in alle Richtungen, um den Ursprung des Geräuschs zu finden. Überrascht stelle ich fest, dass unsere Feinde dasselbe tun.
Bevor ich dem Geräusch auf den Grund gehen kann, folgt ihm ein noch lauteres Kreischen.
So schnell, dass man ihn mit bloßem Auge fast nicht sehen kann, stößt ein Falke vom Himmel herab und greift einen der Barden an. Die Schreie des Vogels vermischen sich mit denen des Barden, als dieser vergeblich versucht, die Klauen von seinem Gesicht abzuwehren. Einer seiner Kameraden legt die Armbrust an und schießt auf das Tier.
Doch der Vogel hat seinen Auftrag erledigt und fliegt davon, während der Barde in den Schlamm sinkt. Ein Bolzen steckt in seinem blutenden Gesicht.
Wieder drehe ich mich zu Kennan um. Zum ersten Mal sieht sie vollkommen verwirrt aus. Aber sie blickt in die entgegengesetzte Richtung.
Eine große Gestalt in einem groben schwarzen Umhang, das Gesicht unter einer dunklen Kapuze verborgen, hat das Durcheinander genutzt, um sich von hinten an den anderen Barden heranzuschleichen. Ich kann den Bewegungen der Gestalt kaum folgen, nur das Blitzen von Stahl ist zu sehen. Im nächsten Augenblick fällt der Barde ins schlammige Wasser.
Kennan stürzt sich in das Handgemenge. Durch die Verwirrung hat sich der Kampf zu unseren Gunsten gedreht.
Es scheint nur Sekunden zu dauern, bis wir wieder allein sind. Nur dass wir jetzt von faulig stinkendem Moorwasser durchtränkt, schlammig und außer Atem sind.
Ich bin noch immer beim Baumstamm und habe das Gefühl, wenn ich mich bewegen würde, wüssten meine Beine vielleicht nicht mehr, wie sie mich tragen sollen. Aus dem Augenwinkel sehe ich Fiona zu Mads und Kennan laufen. Alle drei sind am Leben und unverletzt.
Die beißende Kälte einer Klinge an meinem Hals lenkt mich von diesem Gedanken ab und gleich darauf packt mich eine Hand von hinten am Hemdkragen.
»Dein Name«, sagt eine tiefe, heisere Stimme hinter mir.
In dem wilden Gedankenstrudel, der darauf folgt, kommt es mir ziemlich blöd vor, den Mann im Umhang für einen Freund gehalten zu haben, nur weil er gegen unsere Feinde gekämpft hat.
Fiona analysiert die Situation, zieht scharf die Luft ein und sieht sich nach Mads und Kennan um, die sich nicht vom Fleck rühren. Mads wirkt entmutigter als Kennan, die den anderen mit ausgestrecktem Arm signalisiert, sich ruhig zu verhalten.
Das ist wahrscheinlich am besten so. Eine falsche Bewegung und der Fremde könnte mir die Kehle aufschlitzen.
»Ich frage noch ein einziges Mal, bevor ich die Geduld verliere, Kindchen«, sagt die Stimme. Jedes Wort wird langsam und betont ausgesprochen. »Wer bist du?«
»Ich heiße Shae«, sage ich in der vagen Hoffnung, dass ich in den Augen des Fremden menschlicher erscheine, wenn er meinen Namen kennt. Namenlose Barden zu töten scheint ihm nichts auszumachen.
»Shae«, wiederholt er langsam und ruhig. Der Dolch verschwindet von meiner Kehle.
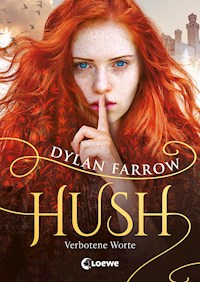














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













