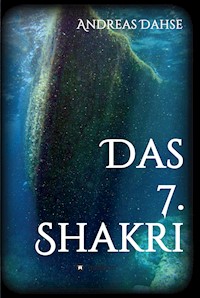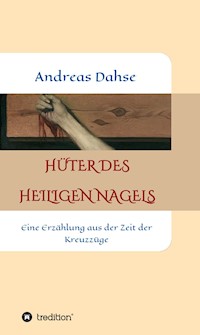
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte vom guten Ritter Rüdiger von Sonneberg, welcher von unserer lieben Stadt Bamberg auszog mit dem Kreuzzug des Kaisers Heinrich ins Heilige Land, wo er viele Schlachten geschlagen und zu Ruhm und Ehren gekommen, auch wohl erlangte er den Heiligen Nagel vom Kreuze des Erlösers. Als dessen Hüter sich würdig zu erweisen, unterwarf er sich vielerlei Prüfungen Gottes, welche ihn bis ins ferne Land Indien verschlugen und Nöte, Elend und Gefahren über ihn brachten. Aufgeschrieben in seinen eigenen Worten von seinem unwürdigen Diener, Bruder Bertram von Kronach, der getreulich gearbeitet nach dem Diktat seines Herrn, nichts hinzugefügt hat und nichts hinweggenommen und auch nichts verändert, weder an Inhalt noch in der Rede, das schwöre ich bei meiner unsterblichen Seele im Namen des barmherzigen Gottes. Amen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andreas Dahse
Hüter des Heiligen Nagels
Eine Erzählung aus der Zeit der Kreuzzüge
© 2017 Andreas Dahse
Verlag und Druck: tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-2450-5
Hardcover:
978-3-7439-2451-2
e-Book:
978-3-7439-2452-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Titelbild: Ausschnitt aus „Die Kreuzigung Christi“ von Diego Velazquez
Vorwort
Dieses Buch ist ein Roman. Es erzählt die fiktive Geschichte eines fiktiven Ritters, doch eingebettet in reale Geschehnisse. Den Kreuzzug Heinrichs VI. hat es wirklich gegeben, auch den Kampf der Mewar gegen das Sultanat von Delhi und Persönlichkeiten wie Rainald Garnier und Jaitra Singh sind historisch belegt. Trotzdem entspringt die Geschichte der Fantasie ihres Autors, und wo es für ihren Fortgang nötig war, wurden die historischen Fakten an die Erzählung angepasst, nicht anders herum. Ein Fakt aber ist unbestreitbar und kann von Jedermann überprüft werden:
Im Bamberger Dom, links vom Hauptaltar, gibt es eine Kapelle, die Nagelkapelle genannt wird, einen Raum für Gottesdienste und stille Andachten. Benannt ist er nach einer Reliquie, einem Nagel, der vom Kreuze Jesus stammen soll und der seit dem 14. Jahrhundert im Dom verwahrt wird. Wie und wann der Nagel dorthin kam, ist heute in Vergessenheit geraten.
Ein Kapitel vor dem ersten Kapitel: Worin Bruder Bertram schildert, wie er den Ritter Rüdiger kennengelernt
An einem Septembertage im Jahre unseres Herrn 1237, das genaue Datum ist mir entfallen, kam ein fremder Ritter in unsere Stadt Bamberg gezogen. Nun ist Bamberg eine große und bedeutsame Stadt, die auch schon Kaiser in ihren Mauern beherbergte, und erst im Mai selbigen Jahres hat unser geliebter Bischof Ekbert von Andechs-Meranien, den Gott nur kurz darauf zu sich berief, den neuen Dom geweiht, wobei gar viele Bischöfe und Edle in unserer Stadt weilten; der fremde Ritter erregte trotzdem Aufsehen unter den Bürgern.
Er ritt auf einen mächtigen Rappen, führte einen Maulesel als Lasttier mit sich und trug fremdartige Kleidung: Hose und Wams aus Leder, dazu einen langen ledernen Mantel und auf dem Kopf einen breitkrempigen Hut, der Ähnlichkeit mit einem Pilgerhut hatte, doch war er kein Pilger. Zwar führte er weder Rüstung noch Harnisch mit sich, doch hing ein mächtiges Schwert an seinem Sattel und auf dem Rücken trug er einen unten gerundeten Schild mit einem Wappenzeichen, auf dem ein fränkisches Langschwert ein heidnisches Sarazenenschwert in der Mitte zerschlägt. So erzählten mir die Leute, denn ich selbst habe seinen Einzug nicht mit eigenen Augen gesehen und lernte ihn erst später kennen.
Weiter erzählte man sich, wie er durch die Stadt wanderte und bei allen Baumeistern nach einem Steinmetz namens Martin fragte, den aber keiner kenne und nach dessen Söhnen, die Michael und Roland hießen. An diese konnten sich noch einige erinnern, es waren zwei brave Männer, auch Steinmetze beide, die am Dom mitgebaut hatten, wobei einer von ihnen bei einem Unfall verstorben, der andere aber mitsamt seiner Familie in eine ferne Stadt gezogen sei, um dort an einer Kathedrale zu arbeiten.
Ich selbst weilte zu dieser Zeit auch erst seit kurzem in Bamberg, wohin mich Bischof Ekbert berief, der nach der Weihe des Doms für diesen nach Brüdern suchte, die des Schreibens und Lesens, vor allem aber des Rechnens kundig waren. Und da ich - Gott verzeihe mir diese Prahlerei - alle drei Künste vorzüglich beherrschte, sandte mich mein Abt, ungeachtet meiner Jugend, zu ihm und ich wurde Sekretarius des Domkapitel und darüber hinaus verrichtete ich alle Arbeiten, die ein junger Mönch, der gerade erst dem Novizenstand entwachsen war, eben verrichten musste.
So polierte ich, einige Tage nachdem der Ritter in Bamberg eingetroffen war, eben die kunstvollen Kupferbeschläge an der Marienpforte, als eben jener Ritter den Dom betrat und mich anredete. Er trug nun ein schlichtes Gewand aus festem Tuch, das aber gut gearbeitet war und als er seinen Hut abnahm, konnte ich im warmen Licht des Nachmittags erkennen, dass er die Hälfte seines Lebens schon lange überschritten hatte. Sein Haupthaar, obschon noch dicht, war doch komplett ergraut und in seinem kurz gestutztem Bart stritten sich weiß und braun um die Vorherrschaft. Unzählige Furchen durchliefen sein Gesicht, das durch Wind und Wetter gebräunt und ledrig wirkte und über die Stirn und die rechte Wange zog sich eine lange, rötliche Narbe. Seine Augen aber, von einem kühlen Grau, waren die eines Mannes, der in seinem Leben mehr schreckliche Dinge gesehen hat, als ein Mensch sehen sollte. Als er mir gerade ins Gesicht sah, erschauderte ich, nicht aus Angst für mich selbst, sondern eher aus Mitgefühl für ihn.
„Gott zum Gruße, Bruder”, sagte er mit rauer Stimme. „Ich bin Rüdiger von Sonneberg, soeben aus dem Heiligen Land zurückgekehrt und ich wünsche mit einem eurer Domherren zu sprechen, da ich dem Dom ein Geschenk von besonderer Bedeutung darbringen möchte.”
Ich war ob dieser Rede irritiert, denn es geschieht nicht alle Tage, dass jemand erscheint und ohne Anmeldung und Vorrede einen Domherren zu sprechen wünscht, diese Arroganz machte mich daher zunächst auch etwas ungehalten.
„Der HerrDomicellariusist im Gebet und darf nicht gestört werden. Wenn Ihr eine Schenkung für Gottes Haus habt, so könnt Ihr sie auch mir überreichen, ich versichere Euch, das ich sie in die rechten Hände weiterleite.”
Da wich er einen Schritt zurück und ich sah, wie seine linke Hand sich um den Beutel krampfte, den er am Gürtel trug. Diese Bewegung war so entschieden, das mir klar wurde, was auch immer er bei sich trug, er würde es mir nicht geben. Und ich sah auch, dass ihm an jener Hand der kleine Finger fehlte.
„Ausgeschlossen!” sagte er da auch schon. „Es handelt sich um eine Reliquie von allerhöchstem Wert für die gesamte Christenheit, unzählige Männer sind dafür gestorben. Sie ist es wert, nur dem Papst persönlich überreicht zu werden oder zumindest einem Bischof!”
Das klang recht prahlerisch, aber der Ausdruck in seinen Augen... Nein, ich war mir sicher, er prahlte nicht, dieser Beutel barg wirklich etwas Besonderes. Und würde ich ihn jetzt abweisen, entginge unserem Gotteshaus womöglich wirklich ein kostbares Stück der Verehrung. Außerdem war ich, Gott möge mir verzeihen, selbst schrecklich neugierig auf diese Reliquie.
„So folgt mir denn”, antwortete ich und führte ihn durch das Kirchenschiff zu den Gemächern der Kapitulare, wo, wie ich wusste, Vikar Bonifacius gerade eine Liste der Stiftsgüter zusammenstellte. Er war ein milder, gutmütiger Mann und wenn sich die Reliquie des Ritters wider Erwarten als Schwindel oder Fälschung erweisen sollte, so wäre er mir sicher nicht sehr böse deswegen. Doch wer kann sich mein Erschrecken vorstellen, als ich, nachdem wir in seine Kammer gerufen wurden, unseren Bischof selbst vorfand, der mit Bonifacius die Liste durchging. Poppo von Andechs-Meranien war ein Mann von über siebzig Jahren, doch wenn auch seine Haare dahingegangen waren und seine Augen nicht mehr besonders gut, so verfügte er doch noch immer über einen messerscharfen Verstand und es war mit ihm, wie man im Volksmund sagt, nicht gut Kirschenessen.
„Verehrter Herr Bischof”, murmelte ich erschrocken, „verzeiht, ich hatte nicht erwartet Euch hier zu treffen...”
Doch da fühlte ich mich beiseite geschoben und Ritter Rüdiger betrat frech die Kammer.
„Edler Herr Bischof, es trifft sich gut, das ich Euch hier finde, ja ich würde sogar sagen, es ist Gottes Fügung!” Mit diesen Worten verneigte er sich elegant um dann fortzufahren: „Ich bin der Ritter Rüdiger von Sonneberg, kürzlich aus dem Heiligen Land zurückgekehrt mit dem einzigen Ziel, dem Dom meiner alten Vaterstadt eine der wertvollsten Reliquien, die man sich vorstellen kann, zum Geschenk zu machen.”
Ich wollte eingreifen, dem Bischof erklären, das der Ritter mit einem einfachen Mönch nicht vorliebnehmen wollte, aber Poppo winkte ab und bot dem Ritter huldvoll die Hand. Niederkniend küsste dieser des Bischofs Ring.
„Lass ihn reden. Also mein Sohn, welcherart Reliquie möchtest du uns darbringen? Und wie bist du in ihren Besitz gelangt?”
Mich schienen die Herren ganz vergessen zu haben, und eigentlich hätte ich jetzt leise hinausschlüpfen müssen, es schickt sich ja nun wirklich nicht für einen einfachen Mönch, ein Gespräch der Edlen zu belauschen, aber andererseits hatte der Bischof mich nicht entlassen und vielleicht bedurfte er ja noch meiner Dienste. Und wie gesagt, war ich furchtbar neugierig.
Der Ritter öffnete, noch immer auf Knien, seinen Beutel und entnahm ihm ein kleines, längliches Kästchen, aus Goldblech gearbeitet. Er öffnete es und holte einen in Tuch gehüllten Gegenstand heraus, den er dem Bischof reichte. Poppo nahm ihn misstrauisch an und begann dann, mit seinen zitternden Händen das Tuch abzuwickeln. Er tat das ziemlich umständlich und ich hielt es vor Aufregung kaum mehr aus, am liebsten hätte ich angeboten, ihm zu helfen, aber ich fürchtete schrecklich, seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, am Ende hätte er mich noch hinausgeworfen. In einem solchen Augenblick!
Endlich war das Tuch abgewickelt und sank zu Boden. In der Hand des Bischofs lag ein dunkler, fast schwarzer Stift, etwa so lang wie der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn man die Hand weit spreizt, an einem Ende spitz, am anderen breiter. Er sah aus wie ein alter, nachlässig geschmiedeter Nagel.
Ein Nagel!
Ein Nagel, der eine Reliquie sein sollte! Ein eiskalter Schauder lief über meinen Rücken, eine Gänsehaut fuhr über meinen ganzen Körper und ich hielt den Atem an, als ich erkannte,wasich da zu sehen bekam.
„Ein Nagel?” fragte Poppo mit gedehnter, geradezu drohender Stimme. „Willst du uns gar erzählen, mein Sohn, dass dieser Nagel einer von denen ist...”
„...mit denen unser Herr ans Kreuz geschlagen wurde, jawohl Herr Bischof, genau so verhält es sich!” fiel ihm Herr Rüdiger ins Wort.
Eine tiefe Stille breitete sich aus in der Kammer. Erwartungsvoll von Seiten des Ritters, skeptisch, fast unwillig auf der Seite des Bischofs. Bonifacius saß unschlüssig in der Mitte zwischen ihnen und blickte zweifelnd von einem zum anderen und ich stand neben der Tür, wagte kaum zu atmen und schon gar nicht, mich zu rühren und hätte doch nur zu gern den Nagel mit meinen eigenen Händen berührt. Man denke sich,derNagel, der mit dem Blut unseres Herrn in Berührung gekommen war, der Christus durch den Leib, nun ja, durch die Glieder gefahren war, durch sein Fleisch und seine Sehnen! Er war mit dem Allerheiligsten in Berührung gekommen, was wir kennen, ja jetzt verstand ich, warum Herr Rüdiger mir diese Reliquie nicht aushändigen wollte.
„Woher”, hallte da Poppos Stimme drohend durch den Raum wie ein Donnergrollen an einem Sommerabend, „woher willst du wissen, dass dies tatsächlich einer der Nägel vom Kreuze Jesu ist? Welche Beweise hast du für deine Behauptung?”
Das klang fast wie eine Anschuldigung, als versuche der Ritter einen Betrug mit uns. Doch mochte ich das nicht recht glauben, dazu erschien er mir als zu ehrenhaft in seinem Wesen. Dem Vikar Bonifacius ging es wohl ebenso, denn er mischte sich nun zum ersten Mal in das Gespräch ein und sagte begütigend: „Du musst wissen, mein Sohn, das uns oft wertvolle Reliquien angeboten werden, von denen sich die meisten als Fälschung entpuppen. Wenn uns nun jemand ein so kostbares Kleinod bringt wie du, ist es da nicht unsere Pflicht, unserem Herrn wie auch allen Gläubigen gegenüber, die Echtheit des Stückes zu überprüfen?”
„Das verstehe ich, Herr” antwortete Rüdiger, „und ich will Euch gerne erzählen, wie ich in den Besitz des kostbaren Nagels gelangt bin, doch es ist eine lange Geschichte, die sich auf den Knien nicht besonders gut erzählt.”
„Dann setze dich”, sagte der Bischof großmütig und sehr behutsam legte er den Nagel auf den Tisch vor sich. Bonifacius zog einen der Schemel für den Ritter heran und sagte dann zu meinem Erstaunen, denn offenbar war er sich meiner Anwesenheit die ganze Zeit bewusst: „Bruder Bertram, hol uns etwas Wein und drei Becher. Wenn die Geschichte wirklich so lang ist, wird sich der Ritter zwischendurch die Kehle befeuchten wollen. Und für dich Pergament und eine Feder, ich möchte, dass du dir Notizen machst und die Geschichte danach ins Reine schreibst.”
„Ich eile, Herr Vikar”, rief ich und hatte meine liebe Not damit, nicht ganz so begeistert zu klingen, wie ich mich fühlte. Nun hatte ich also den heiligen Nagel nicht allein mit eigenen Augen gesehen, ich sollte auch seine Geschichte erfahren und indem ich sie aufzeichnete, selbst Teil von ihr werden! Ich flog durch den Dom, mit einer Eile, die der Würde dieses Baus gänzlich unangemessen war, aber ich wollte nichts verpassen. Schon war ich zurück, mit dem Wein, den Bechern, und ein paar Blatt Papier nebst einem angespitzten Stückchen Blei, womit man schnell und einfach Notizen niederschreiben kann.
Herr Rüdiger wartete, bis alle bereit waren und auf sein Gesicht schlich sich ein Ausdruck von Traurigkeit.
„Meine Herren”, begann er schließlich. „Das, wovon ich euch erzählen will, ist keine sehr erbauliche Geschichte. Es ist die Lebensgeschichte von einem, der Abenteuer, Ruhm und Reichtum suchte und nur Not, Elend und Tod fand und dem in allem Unglück nur eines die Kraft und Ausdauer gab, die er zum Überleben brauchte, und das ist dieser heilige Nagel hier. Also hört die Geschichte meines Leben’s...”
Kapitel I: Herrn Rüdigers Kindheit und Jugend in Bamberg
Mein Vater Martin war ein freier Mann, doch einfacher Steinmetz, aus einem kleinen Ort im Itzgründischen, mit Namen Sonneberg, ungefähr vier Tagesmärsche im Norden. Er verließ diesen Ort mit seiner ganzen Familie und kam nach Bamberg, da er darauf hoffte, hier bessere Arbeit zu finden. Und so wurde ich, als das jüngste seiner drei Kinder, etwa um das Jahr 1180 herum in Bamberg geboren. Meine beiden älteren Brüder, Michael und Roland, waren brave Jungen, die ihren Vater ehrten und nach ehrlicher Arbeit strebten, ich aber, das muss ich zu meiner Schande gestehen, hatte den Kopf voller Flausen. Vielleicht kam es, weil meine Mutter bei der Geburt ihres vierten Kindes starb, einem Mädchen, das wir mit ihr begruben. Da war ich etwa drei Jahre alt.
Fortan mussten meine Brüder sich um mich kümmern, denn mein Vater hatte zu arbeiten. Ältere Brüder aber haben ihre eigenen Vorstellungen von Zeitvertreib und kleine Hosenscheißer, die an ihren Rockzipfeln hängen, gehören nun mal nicht dazu. So blieb ich oft allein, bis ich lernte, so lange zu quengeln und zu drohen, Vater alles zu verraten, das sie mich mitnahmen. Ich merkte rasch, dass die Bande, mit der sie durch die Straßen zogen, mich eigentlich nicht dabei haben wollte, ich war ihnen zu klein, und um das auszugleichen und akzeptiert zu werden, wurde ich ein rechter Rabauke. Ich spielte Streiche, die übler waren als ihre, kletterte auf höhere Bäume und klaute dreister Obst und Brot auf dem Markt, was wohl daran liegt, das kleine Kinder noch keinen Sinn für Gefahr und für richtig und falsch haben. Bald galt ich überall als Tunichtgut und die Nachbarsfrau, die meinem Vater den Haushalt besorgte, sagte immer wieder, dass es mit mir kein gutes Ende nehme.
Mein Vater war kein großer Mann, aber breit in den Schultern und mit starken Armen. Sein Leben lang hatte er Steine bearbeitet und sie in die Form gebracht, in der er sie haben wollte. Seine Hände waren schwielig und hart, das bekam ich oft zu spüren. Wenn man einen Stein in eine Form zwingen will, muss man härter sein als der Stein, das wusste er und so behandelte er auch seine Söhne, Zärtlichkeit war nicht sein Ding. Trotzdem glaube ich, liebte er uns, er wusste nur nicht, wie er es zeigen sollte, er kannte nun mal nichts anderes als Steine.
Bei meinen Brüdern fruchtete seine Art, er beschlug und schliff sie zu tüchtigen Handwerkern, ehrlichen, anständigen Bürgern, die mit ihrer Hände Arbeit sich und ihre Familien ernähren konnten, aber bei mir... Es gibt auch Steine, die sehen aus wie alle anderen, aber in ihnen steckt eine unsichtbare Spannung und wenn man versucht, sie zu behauen, dann geht das wohl eine Zeitlang gut, aber irgendwann macht es krack, und der Stein zerspringt. So ein Stein war ich.
Als ich acht oder zehn war, nahm er mich mit zur Baustelle zum Arbeiten, da waren meine Brüder schon geschickte Steinmetzen. Ich musste als Kleinster die Handlangerdienste verrichten, Wasser holen, den Dreck wegkehren, Werkzeug heranschaffen. Später, als ich kräftiger wurde, musste ich auch Männerarbeit leisten: Steine schleppen, auf dem Gerüst arbeiten und auch wohl Blöcke grob zurechthauen. Eines Tages wurde mir auf einmal klar, das war’s jetzt. Der Rest deines Lebens wird so aussehen. Morgens zur Arbeit, den ganzen Tag Steine behauen und stapeln, schwere Arbeit, die die Hände hart werden lässt und den Rücken krumm, und abends mit kargen Lohn nach Hause gehen, wo eine Frau und ein paar schreiende Kinder warten. Und das Tag um Tag, Jahr um Jahr, ohne Ausweg, ohne Hoffnung auf etwas Besseres. Da bekam ich meinen ersten Sprung.
Ich hatte einen Freund, Rollo, den nannten sie Rollo den Taugenichts, denn er hasste die Arbeit noch mehr als ich. Er war bei all den braven Bürgern geächtet, denn seine Mutter, die Waschfrau war, galt als ein liederliches Frauenzimmer, man munkelte, das sie für Geld zu allem bereit sei. Ob das stimmte weiß ich nicht, Rollo gegenüber sprach man besser nicht davon, wollte man nicht riskieren, ein paar Zähne zu verlieren. Fest stand, das niemand wusste, wer sein Vater war. Dieser Rollo trieb sich überall in der Stadt herum, wo die Möglichkeit bestand, etwas „abzustauben” und das waren hauptsächlich der Markt und größere Baustellen.
Ich traf ihn das erste Mal, als ich noch mit meinen Brüdern und ihren Freunden unterwegs war. Sie konnten Rollo nicht leiden, hauptsächlich wohl aus Neid, weil sie unbewusst ahnten, dass diese Zeit des Herumtollens und der Streiche nur ein kurzes Zwischenspiel in ihrem Leben war, ehe sie in die Tretmühle von Arbeit, Familie und „in Armut alt werden” geraten würden, was bei Rollo nicht der Fall war. Er würde ewig herumlungern können, denn keiner würde einen wie ihm Arbeit oder gar eine Lehrstelle geben. Daran, dass die meisten Rollos als Erwachsene entweder als Bettler mit abgeschlagener rechter Hand oder gar als Krähenfutter am Galgen endeten, dachten sie natürlich nicht. Jedenfalls beschlossen die Jungs, ihn aufzulauern und zu verdreschen, einfach so, zum Spaß, und so geschah es auch. Als sie sich auf ihn stürzten, schob mich mein ältester Bruder Michael zur Seite und sagte streng: „Du bleibst hier stehen, ich will nicht, das du in dem Getümmel aus Versehen vielleicht noch ein paar Schläge abkriegst.”
Dann stürzte er sich in das Gefecht, doch das nahm einen anderen Verlauf als erwartet. Rollo war stärker und geschickter als seine Angreifer, und skrupelloser. Er schlug und trat ohne zu zögern dahin, wo es wirklich weh tat, und bald lag die Hälfte der Angreifer am Boden, auch meine Brüder, und die anderen rannten auf und davon. Natürlich dachte dabei keiner an den kleinen Hosenscheißer, der zitternd daneben stand. Als sie weg waren und Rollo als einziger noch stand, zwischen einer Handvoll Jungen, die sich wimmernd am Boden wanden, fiel sein Blick auf mich und er stapfte auf mich zu. Ein großer Junge mit wildem, blonden Haar, vor Schmutz starrend, in ein viel zu großes, zerlumptes Hemd gehüllt, das ihn bis zu den Knien reichte und mit einem Strick um seinen mageren Körper gehalten wurde, barfuß und ohne Hosen und mit Augen, die Funken zu sprühen schienen. Da wusste ich, das weglaufen keinen Zweck hatte und das ich bald neben meinen Brüdern liegen würde. Ich bekam wahnsinnige Angst, aber auch Wut. Natürlich hatte ich keine Chance gegen ihn, aber ich wollte nicht als Feigling zu Boden gehen. Also brüllte ich auf und stürmte gegen ihn an, meine kleinen Fäuste hämmerten auf ihn ein. Einen Augenblick wirkte er verblüfft, einen weiteren belustigt, dann stieß er mich weg, das ich auf meinen Hosenboden plumpste und nur noch wütend zu ihm aufsehen konnte. Gleich tritt er dir ins Gesicht, dachte ich noch, aber da grinste er ein Grinsen, das war gleichzeitig dreckig, höhnisch und doch auch anerkennend.
„Mut hast du, du kleine Kröte”, sagte er. „Mehr als alle deine Freunde zusammen. Aber mach das nicht noch mal, sonst geht es dir dreckig.”
Danach spuckte er aus, drehte sich um und ging. Bei mir aber hatte er damit gewonnen, und fortan war er mein Held. Wann immer die Leute über ihn schimpften, fand ich ihn toll und wenn sie sagten, das es mit ihm ein schlimmes Ende nähme, da fühlte ich mich ihm verbunden.
Als ich wieder mit ihm zu tun bekam, war ich schon Handlanger auf der Baustelle. Es war die Erweiterung einer Kirche, ich weiß nicht mehr welcher, aber ein gewaltiger Holzbalken, der hoch droben in die Wände eingelassen werden sollte, war falsch geschnitten und wohl drei Fuß zu lang. Der Meister der Zimmerer trug mir auf, die große Säge zu holen und gab mir den Schlüssel zu dem Schuppen, in dem die kostbareren Werkzeuge unter Verschluss lagen. Direkt neben dem Schuppen wurden die gewaltigen Fensterbögen gemeißelt und geschliffen, da war ein Lärm, dass man sein eigen Wort nicht verstand und schon gar nicht das Klappern des Schlüssels in dem riesigen Schloss. Ich stieß die Tür auf, trat in den Schuppen - und stand Rollo gegenüber, der mich erschrocken anstarrte. In einer Hand hielt er einen Sack, mit der anderen holte er gerade ein paar Meißel aus dem Regal. Hinter ihm klaffte ein Loch in der Schuppenwand, wo er zwei Bretter herausgebrochen hatte.
So war er vom Lausbuben doch noch zum richtigen Dieb geworden. Ich hätte jetzt schreien und Alarm schlagen müssen, aber wenn sie ihn erwischten, würde die Strafe sehr hart ausfallen, ihm vielleicht sogar die Hand kosten. Das wollte ich nicht, zumal ich die Arbeit hier selber hasste. Und während er mich noch entgeistert anstarrte, hatte ich nun ein dreckiges Grinsen im Gesicht. Langsam trat ich an das Regal, nahm die Säge, ging ebenso langsam rückwärts wieder zur Tür und schloss sie von außen wieder zu. Das hatte nur ein paar Augenblicke gedauert und keiner von uns sagte ein Wort, aber es war ein Wendepunkt in meinem Leben, denn während ich wieder auf den Turm hochstieg, fühlte ich Traurigkeit darüber, dass er ein Dieb geworden war. Dieb sein ist kein Beruf, in dem man es weit bringen kann, es sei denn man ist von Adel und hat mächtige Freunde, aber ein armer Schlucker wie Rollo würde früher oder später gefasst und in Schmach und Elend enden. Auch ich hatte keine Lust auf harte und wenig einträgliche Arbeit, aber, das wurde mir in diesem Augenblick klar, auf ein Leben als Dieb noch weniger. Was ich wollte, das… ja, was wollte ich eigentlich? Darüber hatte ich bisher nicht ernsthaft nachgedacht. In meinen Tagträumen sah ich mich als furchtlosen Ritter hoch zu Ross, mit Rüstung und Schwert an der Spitze meiner Männer, wie ich Siege in Schlachten errang, Schätze erbeutete und schönen Fürstentöchtern das Herz raubte. Das dies für einen armen Handwerksburschen reine Wunschträume waren, das war mir schon klar, doch darüber wollte ich nie nachdenken. Aber jetzt, mit der Säge auf dem Weg den Turm hinauf, erkannte ich es in voller Klarheit: Es gab nur zwei Wege für einen wie mich: den Weg Rollos, der zu einem Leben in Angst und Schande führt, oder den meines Vaters, der eine reine Seele aber einen leeren Geldbeutel beschert. Und war da sonst gar nichts mehr, keine dritte Möglichkeit?
Ich könnte in ein Kloster gehen, aber die warteten bestimmt nur auf einen Kerl wie mich. Außerdem lebten auch die Mönche in Armut, und noch dazu war ihr Leben stinklangweilig und sie lernten nie die Liebe kennen. Nicht das ich sie gekannt hätte, aber ich kam doch langsam in das Alter, wo Mädchen begannen, interessant zu werden und man sich als Junge fragte, wie es denn unter ihren Kitteln aussehen mochte. Nein, das Kloster schied aus. Der letzte Weg, der einen wie mir noch blieb, war der des Kriegers. Aber sehr verlockend schien das auch nicht. In unserer Straße wohnte ein alter Kriegsknecht, dessen Körper von Narben gezeichnet war und der auf dem linken Bein hinkte, weil ihn eine eiserne Keule das Knie zerschmettert hatte. Mehr als zwanzig Jahre, erzählte er einmal, habe er für seinen Herrn gekämpft und dabei immer von der Hand in den Mund gelebt und am Ende stand er dann mit einer kleinen Abfindung da, ohne Land, ohne Haus.
„Der Krieg nur den Fürsten nährt”, pflegte er zu sagen, „am gemeinen Mann er zehrt.”
So richtig schön war das auch nicht.
Derlei Gedanken ließen mich den ganzen Tag nicht mehr los und ich war mit mir selbst und der Welt so recht unzufrieden und hockte am Abend missmutig auf einer Mauer, um der Sonne beim Sinken zuzusehen, als sich jemand neben mich setzte. Es war Rollo. Bei unserem ersten Zusammentreffen kam er mir gewaltig groß vor, doch jetzt fand ich, das wir fast gleich groß waren, er hatte mir nur zwei oder drei Jahre voraus, denn an seinem Kinn spross schon der erste Flaum. Eine Weile saßen wir so da und keiner sagte etwas, bis er schließlich anfing.
„Danke, dass du mich nicht verraten hast.”
„Hmmm.”
„Warum eigentlich nicht?”
„Was?”
„Warum hast du mich nicht verraten?”
Ich zögerte, weil ich nicht so recht wusste, was ich sagen sollte. Das er mir leid getan hatte?
„Ich wollte nicht, dass sie dich schnappen. Die sind nicht zimperlich beim Bestrafen.”
„Das kannst du laut sagen.”
„Außerdem hasse ich diese Arbeit. Nur Dreck und schwere Steine und selbst als guter Geselle kann man kaum davon leben.”
„Warum machst du es dann?”
„Was sollte ich sonst tun? Klauen?“ (Das ‚so wie du’ sparte ich mir). „Das ist doch auch kein Leben, immer aufpassen, nicht erwischt zu werden. Und reich wird man davon wohl auch nicht.”
Das letzte war eine Feststellung, denn so wie er neben mir saß, barfuß und in Lumpen, konnte es kein einträgliches Geschäft sein.
„Stimmt schon”, gab er dann auch zu, „aber es gibt ein paar Leute, die sahnen richtig ab, weil sie solche wie mich die Drecksarbeit machen lassen. Aber du glaubst doch nicht, dass ich mein ganzes Leben lang nur irgendwelchen Kram klauen will?” Er spuckte aus, als widere ihn diese Vorstellung selber an und ich war erneut verblüfft. Ich hätte nie gedacht, das sich jemand wie Rollo Gedanken um seine Zukunft machte.
„Keine Ahnung. Nicht?”
„Natürlich nicht du Blödmann! Ich muss nur noch warten, bis ich alt genug bin, eine Waffe zu führen, dann verdinge ich mich bei einem Ritter als Kriegsknecht!”
Die gleiche Idee hatte ich heute auch gehabt. Ich erzählte ihm von dem alten Söldner, aber er winkte nur verächtlich ab. „Ja, hier in Bayern oder im ganzen Reich, da ist freilich nichts mehr zu holen. Alles ist schon verteilt und hat seinen Besitzer. Aber in der Fremde, da kann man noch sein Glück machen.”
„Wo willst du denn hin?”
„Ins Heilige Land natürlich! Da kann sich ein jeder Ritter der genug Mumm hat, sein eigenes Königreich erobern und die brauchen gute Soldaten! Und gegen die Heiden kämpfen ist nicht so schwer wie gegen christliche Krieger. Und ein gutes Werk tut man außerdem, denn man kämpft ja für Gott. Und deshalb darf man ja seine Beute behalten. Schon mancher armer Schlucker ist als gemachter Mann zurückgekehrt!”
Ich kannte keinen, aber so überzeugt, wie er es sagte, glaubte ich ihm auf Anhieb. Ins Heilige Land also. Ich erkannte verblüfft, das Rollo Taugenichts, der Dieb und Herumtreiber, einen richtigen Plan hatte für sein Leben, und ich nur ein allgemeines Gefühl der Unzufriedenheit. Das Heilige Land, dachte ich noch einmal, ganz andächtig. Je länger ich darüber nachdachte, desto verlockender klang das alles.
„Aber wie willst du dort hin kommen?”
„Hast du das nicht gehört? Es gibt harte Kämpfe im Königreich Jerusalem. Sie fechten dort gegen einen wilden Sarazenenfürsten, den sie Salomin nennen.”
Davon hatte ich gehört. Der angelsächsische König Richard selbst war gegen ihn gezogen, und keiner konnte den anderen schlagen. So schlossen sie einen Friedensvertrag und Richard kehrte nach Hause zurück. Doch sofort nach seinem Abzug brachen die Sarazenen den Frieden und setzten ihre Angriffe fort. So jedenfalls erzählte es unser Herr Pfarrer. Nur der Name des Sarazenen klang anders.
„Saladin. Nicht Salomin.”
„Ist doch egal. Jedenfalls wird es über kurz oder lang einen neuen Kreuzzug geben, das kannst du mal glauben. Und wenn es soweit ist, bin ich mit dabei und erschlage so viele Ungläubige, das Gott mir meine Klauerei vergibt, weil er ja weiß, dass ich das nur aus Hunger tue und nicht zum Spaß.”
Ich staunte ihn an. Dass er sich so viele Gedanken gemacht hatte über sein Leben und was er tun konnte um es zu ändern. Und ich haderte nur immer mit dem Schicksal.
Das Heilige Land. Ich hatte keine Ahnung, wo das wohl sein mochte, weit weg jedenfalls, aber es klang in meinen Ohren auf einmal sehr verheißungsvoll.
In den Wochen und Monaten darauf trafen wir uns öfter und wurden Freunde. Meinem Vater durfte ich darüber freilich nichts erzählen, wenn es nach ihm gegangen wäre, würden Leute wie Rollo nicht nur aus der Stadt, sondern gleich aus dem Land gejagt werden. So trafen wir uns heimlich nach Feierabend und malten uns aus, wie wir gemeinsam nach Jerusalem ziehen würden. Es dauerte gar nicht mehr lange, da stand für mich felsenfest, dass ich ein Kreuzfahrer werden würde. Als ich das aber einmal unvorsichtigerweise in meiner jugendlichen Schwärmerei zu Hause erzählte, gab es Ärger.
„Bist du verrückt?” brüllte mein Vater. „Willst du dein Leben wegwerfen in fremden Ländern und erschlagen werden für den Ruhm der Fürsten? Wir sind freie Bürger und ehrbare Handwerker, darauf sollst du stolz sein, und dich nicht einem Ritter verkaufen!”
Es war klar, dass ich mit ihm nicht darüber reden brauchte und dass er mich nie würde ziehen lassen; so blieb mir nur, wegzulaufen, wenn es so weit war.
Inzwischen aber ging das Leben weiter. Mein ältester Bruder Michael brachte ein Mädchen nach Hause, die Tochter eines Zimmermanns, mit dem mein Vater bekannt war, ein gutes und freundliches, wenngleich nicht hübsches Mädel. Die Ehe war zwischen den Eltern ausgemacht, noch bevor die Brautleute davon erfuhren.
Dann gab es die Bekanntmachung, den 1185 abgebrannten Dom neu zu errichten. Schon eine ganze Weile fanden Aufräum- und Abrissarbeiten statt, als nun aber der Neubau beschlossene Sache war, setzte mein Vater Himmel und Hölle in Bewegung um uns dort unterzubringen.
„Denkt doch nur”, sagte er beim Abendmahl, „wenn wir dort Arbeit fänden. Dann hättet ihr ausgesorgt für euer ganzes Leben.”
Meine Brüder nickten beifällig, die Vorstellung schien ihnen zu gefallen, ich aber erschrak. Das wäre ja genau das Leben, das ich verabscheute. Jahre, Jahrzehnte an ein und demselben Bau arbeiten, nie etwas anderes tun, nie rauskommen aus dieser engen Stadt und die Fremde sehen, nie ein Abenteuer erleben, alt werden beim Steineklopfen für ein einziges Gebäude. Das erschien mir als schreckliches, todlangweiliges Los.
„Du schaust nicht sehr glücklich aus”, sagte Vater zu mir und da beging ich die Dummheit, ihm zu sagen, was ich dachte.
„Langweilig?” brüllte er. „Unsere Arbeit ist dir langweilig? Das Brot, das du isst, haben wir mit dieser langweiligen Arbeit bezahlt! Bist du denn wirklich so blöd, nicht zu begreifen, dass dies das Beste ist, was dir je widerfahren kann?!”
„Denk, doch, Brüderchen”, setzte Michael hinzu, „über Jahre hinweg ein sicheres Auskommen. Du kannst ohne Sorge eine Familie gründen. Was willst du denn mehr?”
Ja, dachte ich bei mir, in dieser Familie wird mich niemand je verstehen, ich bin wohl aus der Art geschlagen. Also redete ich ab sofort nie mehr davon, sondern tat still, gleichwohl ohne jede Begeisterung meine Arbeit und träumte vom Kreuzzug.
Am Tag nach der Hochzeit meines Bruders erreichte mein Vater für uns alle eine Anstellung beim Dombau. Von meinem Lohn, der recht karg ausfiel, musste ich den größten Teil als Kostgeld abgeben, vom Rest sparte ich mir etwas zusammen was mir auf der Reise ins Heilige Land, wie ich annahm, gute Dienste tun würde: Einen zweischneidigen Dolch mit langer spitzer Klinge. Als ich ihn zu Hause stolz präsentierte, bekam ich vom Vater eine schallende Ohrfeige.
„Verschwender!” brüllte er. „Du Tunichtgut! Einen Dolch wir ein feiner Herr hat er sich gekauft! Was willst du damit, du Dummbeutel? Ein Brotmesser, ja, das wäre was Rechtes gewesen!”
Ich erwiderte kein Wort und lief gekränkt weg. An diesem Tag zersprang mein innerer Stein endgültig und ich wartete nur noch inbrünstig auf den Tag, an dem ich alt genug wäre, um bei einem Heer aufgenommen zu werden.
„Dauert nicht mehr lang”, tröstete mich Rollo. „Die Leute erzählen sich, das der Kaiser zu Ostern das Kreuz genommen hat. Bald geht es los.”
Das war im Jahre 1195 und tatsächlich wollten die Gerüchte über einen deutschen Kreuzzug nicht verstummen. Auf dem Reichstag in Bari, im fernen Land Italien, sollte Kaiser Heinrich VI. das Gelübde abgelegt haben, einen Kreuzzug zu unternehmen. Was die Leute zunächst noch flüsterten und mutmaßten, wurde im Sommer zur Gewissheit. Der Kaiser reiste durch das Reich und lud die Adligen und Ritter zur Teilnahme ein. Am Ende des folgenden Jahres sollte der Zug beginnen.
Es war ein Jahr, in dem nicht nur die Erfüllung meiner Träume näher rückte, das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater verschlechterte sich fast von Tag zu Tag. Auch mein zweiter Bruder Roland fand ein Mädchen, die Tochter einer ehrbaren Witwe, und zog nach der Hochzeit zu ihr und ihrer Mutter, so das Vater und ich allein in unserer Kammer hausten. Ich konnte und wollte meinen Unmut über mein Handwerk, das ja eigentlich das seine war und für das ich mich nie begeistern konnte, nicht länger verbergen. Und er warf mir bei jeder Gelegenheit vor, was für ein undankbarer und nutzloser Kerl ich doch sei und stellte meine Brüder als leuchtendes Beispiel hin. Ja, das waren seine guten Jungen, die hatten es zu was gebracht im Leben, ehrbare fleißige Handwerker waren sie mit guten Frauen, nicht solche Herumtreiber wie ich, über den er nur Klagen hörte. Ich hätte mir die Ohren zuhalten können vor Wut.
Heute, mit der Lebenserfahrung von mehr als 40 Jahren in der Fremde, glaube ich, das er spürte, wie ich ihm entglitt und er nur nicht wusste, wie er mich halten konnte. Er glaubte wohl, wenn er mir das Vorbild meiner Brüder nur oft genug vor Augen führte, so würde ich früher oder später werden wie sie. Dass er die Kluft zwischen uns damit nur vertiefte, merkte er wohl gar nicht. Ich jedenfalls konnte es kaum erwarten, bis die Werber für das Kreuzzugsheer zu uns nach Bamberg kamen. Doch als es dann geschah, war alle Entschlossenheit dahin und eine große Unsicherheit kam über mich.
Es war im Herbst 1196. Der Sommer war lange geblieben in diesem Jahr und ihm folgten warme Septembertage. Die Wälder rund um die Stadt hatten sich in bunte Gewänder gehüllt und alle Menschen genossen die milden Tage. Auf der Dombaustelle wuchsen die ersten Mauern aus dem Fundament empor und man konnte den Grundriss schon erahnen. Fast gegen meinen Willen verspürte ich manchmal Stolz, wenn ich das sah. An jenem Tag rüsteten wir den ersten Torbogen ein, als am frühen Nachmittag ein Pfiff ertönte, der mir nur zu bekannt war: Das zwischen mir und Rollo vereinbarte Zeichen, das wir uns dringend treffen mussten. Ich sah mich um und tatsächlich entdeckte ich ihn außerhalb der Baustelle halb hinter einem Schuppen verborgen, von wo er mir zuwinkte. Ich schlich mich unter einem Vorwand davon und eilte zu ihm. Rollo war sehr aufgeregt, und er trug Sachen, die ich an ihm noch nie gesehen hatte, ein fast sauberes Hemd, Beinlinge und sogar Bundschuhe, Neben sich hatte er ein großes, sorgfältig geschnürtes Bündel liegen.
„Es ist soweit!” zischte er aufgewühlt und ich erschrak.
„Was ist soweit?” fragte ich mit zitternder Stimme.
„Was wohl, Dummkopf! Der Kreuzzug! Draußen vor der Stadt lieg ein Heerzug, na, aber wenigstens eine Streitmacht, die auf dem Weg nach Italien ist um ins Heilige Land überzusetzen. Und sie werben noch Knechte an!”
„Jetzt schon? Aber es war doch immer von Weihnachten die Rede.”
„Sie wollen das Alpengebirge überqueren bevor der Winter kommt. Die Reisige dienen einem Ritter namens Wulfgram oder so, der in Bamberg Quartier bezogen hat. Aber sein Heer bleibt nur bis morgen, dann ziehen sie weiter. Los, hol deine Sachen, dann können wir uns heute noch einschreiben!”
Ein ziemlicher Schrecken überfiel mich. Wie hatte ich mir diesen Tag herbeigesehnt, wenn Vater mal wieder mit mir zürnte, wie oft war ich in meiner Vorstellung ohne Furcht und Reue davongelaufen, und jetzt, da der Augenblick gekommen, hatte ich plötzlich nicht die Kraft dazu.
„Ich kann nicht. Jetzt nicht.”
Rollo blickte mich überrascht an und dann glitt ein Schatten der Trauer und Verachtung über sein Gesicht.
„Ich verstehe. Das waren also alles nur große Töne die du gespuckt hast, aber wenn‘s drauf ankommt, kneifst du! Dann ist dir das sichere Brot des Steineklopfers lieber als der Braten in der Fremde. Hätt’ ich mir ja denken können! Du bist genau wie alle anderen!”
„Erzähl doch nicht sowas! Natürlich komme ich mit. Ich kann nur jetzt noch nicht. Wenn mein Vater heute Abend nämlich merkt, dass ich weg bin, marschiert er gradewegs ins Heerlager und holt mich zurück. Ich muss warten bis heute Nacht. Wenn er schläft kann ich mich wegschleichen und morgen in aller Frühe, wenn die Stadttore öffnen, komme ich ins Lager.”
„Gut. So machen wir‘s”, flüsterte er und drückte mir verschwörerisch die Hand. „Ich verschwinde jetzt und ich werde dem Hauptmann sagen, das da noch einer kommt. Aber wehe, du drückst dich. Dann ziehe ich alleine los.”
„Ich komme, versprochen”, flüsterte ich zurück, aber so ganz sicher war ich meiner nicht.
Am Abend betrachtete ich mir vom Tor aus das Lager. Bewaffnete Heerhaufen durften Bamberg nicht betreten, daher hatten sie auf einem Feld vor der Stadt ein paar Zelte aufgeschlagen und Laubhütten errichtet, zwischen denen kleine Kochfeuer brannten. Zwischen den größten Zelten wehte an einer langen Stange ein weißes Banner mit dem Kreuz. Dieses Heer war eher bescheiden, alles in allem mochte es sechzig Mann oder so umfassen und vielleicht zwanzig Pferde. Aber das war ja nur der Anfang. Wie kleine Rinnsale würden die einzelnen Gruppen nach Italien fließen und sich dort vereinen, bis ein unaufhaltsamer Strom entstand, der die Heiden hinwegschwemmen würde.
„Da gehen sie hin, die Narren!” keifte hinter mir ein altes Mütterchen, das gleichfalls stehengeblieben war, und spuckte verächtlich aus. „Wie die dummen Lämmer zur Schlachtbank. Narren allesamt!”
„Ist es Narretei, das Grab unseres Herrn und Erlösers den Sarazenen zu entreißen?” fragte ich ärgerlich zurück. Sie lachte höhnisch auf. „Er ist doch auferstanden, unser lieber Herr Jesus. Ein leeres Grab ist’s, um was diese Dummköpfe sich da schlagen. Narren allesamt.” Und brummelnd und schimpfend ging sie weiter. Ich kehrte nach Hause zurück, aufgewühlt und unsicher wie lange nicht mehr, und als Vater noch mal ausgegangen war, machte ich mich ans Werk und packte alle meine Kleidung in einen Sack, dazu Löffel, Becher und Essschale, eine Decke und was ich sonst noch zu brauchen glaubte. Dazu meinen Dolch und dann legte ich noch Vaters große Axt bereit, ich brauchte ja eine Waffe, um die Heiden zu bekämpfen. Bei alledem glaubte ich aber selbst nicht recht daran, dass ich wirklich gehen würde. Hatte Vater am Ende nicht vielleicht doch recht? Die Arbeit war zwar hart aber seit wir am Dom mitbauten, hatten wir immer etwas Essen im Hause, und so schlecht war dieses Leben ja nun doch nicht. Am Ende hätte ich vielleicht doch noch gekniffen, wenn Vater nicht betrunken zurückgekommen wäre.
„Du...du bist zu diesen Taugenichtsen da draußen geschlichen!” grollte er drohend. „Kein Wort! Man hat dich gesehen! Unnützer Bengel! Sieh doch deine Brüder, was das für Kerle sind! Mit anständigen Frauenzimmern alle beide! Und Michael, der macht mich nächstes Frühjahr zum Großvater. Das ist ein braver Junge! Aber du bringst nur Schande über mich!”
Sein Geschimpfe verkam zu einem unverständlichen Gemurmel, als er auf sein Lager kroch und einschlief. Ich hielt die ganze Zeit die Fäuste geballt und - obschon ich mich bereits als Mann wähnte - stiegen mir die Tränen in die Augen. Nur ein gutes Wort, nur eine versöhnliche Geste, und ich hätte meine Pläne hingeschmissen und wäre bei ihm geblieben. Aber so machte er es mir leicht.
Mitten in der Nacht stand ich leise auf, es war dunkel in unserer Kammer, nur ein Flecken Mondlicht schien durch das kleine Fensterchen. In seinem Schein zog ich mich an, schulterte mein Bündel und schob die Axt in den Gürtel. An der Tür blieb ich noch mal stehen und blickte zurück. Vater war ein dunkler Buckel auf seinem Lager, kaum von der Finsternis drumrum zu unterscheiden. Er schnarchte laut und ungleichmäßig. Dann ging ich. Ich sollte ihn nie wiedersehen.
Kapitel II: Wie Herrn Wulfgrams Männer die Alpen überquerten
Still und leer lagen zu dieser frühen Stunde die Gassen der Stadt vor mir. Nur hier und da krähte ein Hahn, bellte ein Hund, und die einzige Bewegung kam von den Ratten, die über die Straße huschten. Aus einer Backstube fiel ein Streifen Licht auf die Gasse.
Langsam marschierte ich zum Stadttor, ich hatte noch jede Menge Zeit, bis es geöffnet wurde und meine größte Sorge war, das Vater dort auftauchte, weil er nach mir suchte. Aber als ich im ersten Licht des frühen Morgens dort eintraf, lehnten nur zwei gelangweilte Nachtwächter an dem mächtigen Türriegel und ein Stück neben ihnen saß eine kleine dunkle Gestalt am Boden und schaute mir mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung entgegen. Es war ein junger Bursche, vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich, in ziemlich abgerissener Kleidung und mit einem Bündel neben sich. Noch ein Ausreißer?
Als ich nah genug war, das er mich erkennen konnte, atmete er erleichtert auf und winkte mir zu, mich neben ihn zu setzen.
„Willst du auch zum Kreuzzugsheer?” raunte er. „Ich auch. Ich heiße Josef.”
Da fiel mir ein, wer er war: Der Gehilfe eines Schusters, ein armer Tropf, der von seinem Meister schlecht verköstigt und noch schlechter bezahlt, dafür aber umso reichlicher mit Schlägen bedacht wurde. Kein Wunder, das er weggelaufen war, und das er so ängstlich nach der Stadt zu Ausschau hielt. Sicher hatte er ein bisschen was mitgehen lassen.
Nicht das es mir anders ging, jeden Augenblick erwartete ich, meinen Vater wutschnaubend um die Ecke kommen zu sehen. Der Boden brannte uns beiden unter den Füßen.
Endlich aber ging die Sonne auf, die Nachtwächter verließen ihren Posten und die Tagwache öffnete mühsam das riesige Tor. Draußen standen schon ein paar Leute, die hereinwollten, hauptsächlich Bauern, die ihr Gemüse auf dem Markt anbieten wollten. Wir zwängten uns an ihnen vorbei und waren draußen.
Im Heerlager war schon tüchtig was los. Männer rollten ihre Bündel zusammen, bauten Zelte ab oder kochten sich ihr Morgenmahl. Ich lief am Rand des Lagers entlang und hielt Ausschau nach Rollo.
„Schleich dich!” rief mir einer der Kerle missmutig zu. „Hier gibt’s nichts zu klauen.”
„Ich suche einen Freund, der sich gestern einschreiben wollte”, versuchte ich mein Glück, aber er spuckte nur gelangweilt aus und rührte weiter in seinem Kessel.
Also suchte ich weiter und Josef hing an meinen Fersen wie ein junger Hund. Und dann brüllte es auf dem Platze: „Rüdiger!”
Rollo kam angeschossen, ein breites Grinsen im Gesicht.
„Ich wusste, du lässt mich nicht hängen!” rief er und boxte mir vor Begeisterung in den Bauch, das mir die Luft wegblieb.
„Und wer ist das?”
„Mein Name ist Josef. Ich möchte mich gerne als Kriegsknecht einschreiben”, sagte dieser artig, als wenn er einen Hauptmann vor sich hätte.
„Zwei sind besser als einer. Kommt mit!”
Erst während wir durch das Lager gingen, fiel mir das Schwert auf, das er, in einer ziemlich schäbigen Scheide, auf dem Rücken trug.
„He, wo hast du das denn her?”
„Ha!” antwortete er stolz, „das hab ich schon ziemlich lange. War das Beste, was ich je geklaut hab. Besser als deine Axt jedenfalls.”
Dann standen wir vor einem Tisch, der direkt neben dem Banner aufgestellt war, und an dem ein Mönch und ein recht edel aussehender Herr in Lederkleidung saßen. Der Herr trug einen weißen Überwurf über seine Kleidung, den auf Brust und Rücken ein rotes Kreuz zierte. Vor ihm auf dem Tisch stand eine ziemlich stabil aussehende Schatulle. Der Mönch hatte lediglich ein beschriebenes Pergament und eine Feder vor sich liegen.
„Herr Hauptmann”, sprach Rollo beflissen, „ich bringe Euch, wie versprochen, meinen Freund und noch einen weiteren Freiwilligen.”
Der Hauptmann warf uns einen gelangweilten Blick zu. „Noch zwei Küken. Wie alt seid ihr?”
„Siebzehn, Herr Hauptmann”, antwortete ich eilig, mich dabei wohl mindestens ein Jahr älter machend als ich war.
„Achtzehn... glaube ich”, murmelte Josef und setzte dann schnell noch ein „Herr Hauptmann” hinzu.
„Siebzehn, was?” Die Stimme des Hauptmanns troff geradezu vor Hohn. „Ach, ist ja auch egal. Ihr wollt also unserem Herrn ins gelobte Land folgen. Habt ihr Kampferfahrung? Also nicht. Habt ihr wenigstens Waffen?”
Ich zeigte ihm Axt und Dolch, er knurrte nur, sagte aber nichts, doch als Josef ein Messer aus seinem Bündel zog, das nun wirklich mehr nach Küchenmesser als nach Kriegswaffe aussah, schlug er sich vor Lachen auf die Schenkel, und die Umstehenden stimmten mit ein.
„Damit willst du gegen die Sarazenen ziehen? Dann kannst dich ihnen auch gleich nackt darbieten. Ihr braucht ordentliche Waffen, wenn ihr mehr als einen Tag überleben wollt. Die Axt ist schon ganz gut, aber zu unhandlich. Ein Schwert als Nahkampfwaffe ist das Beste. Und auf jeden Fall einen ordentlichen Spieß. Ohne den seid ihr verloren. Na, bis wir in Italien sind, habt ihr noch etwas Zeit, da könnt ihr euch unterwegs noch was Vernünftiges besorgen. Weiter: Seid ihr gute Christen oder am Ende gar Juden oder noch was Schlimmeres? Gut. Letzte Frage: Seid ihr Freie oder Leibeigen?”
„Freie Bürger der Stadt Bamberg, Herr”, gab ich zur Antwort.
„So, ihr freien Bürger, dann nennt dem Herrn Kaplan eure Namen, damit er sie in die Musterrolle schreiben kann.”
Das taten wir dann auch und der Mönch schrieb sie säuberlich in eine Liste, in der schon einige Namen standen, hinter jedem die Kreuzchen des Betreffenden.
„Macht euer Zeichen” verlangte der Kaplan und wir setzten unsere eigenen Kreuzchen auf das Pergament. Mir war ganz feierlich dabei zumute.
„Jetzt noch das wichtigste: Der Treueeid. Legt eure rechte Hand über das Herz... über das Herz du Trottel, nicht auf den Bauch, und sprecht mir nach.
Ich - sagt jetzt euren Namen - schwöre hiermit feierlich im Namen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, den Ritter Wulfgram von Ansbach als Herrn anzunehmen in Treue und Ergebenheit bis in den Tod. Ich will ihm folgen, wohin er mich führt und für ihn und seine Sache streiten mit all meiner Kraft, so wahr mir Gott helfe. Amen!”
Schon früher hatte ich den einen oder anderen Schwur geleistet, aber niemals war mir so feierlich und ehrfürchtig zumute wie in diesem Augenblick. Ich fühlte, tief in mir, das sich mein Leben soeben gewandelt hatte.
„Gratuliere”, sagte der Hauptmann gelangweilt. „Ihr gehört jetzt zu uns.” Er öffnete die Schatulle und zählte uns eine Handvoll Münzen ab.
„Euer Handgeld. Versauft und verhurt nicht gleich alles, davon müsst ihr euch eure Verpflegung und eure Ausrüstung kaufen und das nächste gibt’s erst wieder zum nächsten Vollmond .”
„Was ist mit mir, Herr Hauptmann?” fragte Rollo schelmisch.
„Mit dir, du hast deins doch erst gestern gekriegt, Was willst du denn noch, Bürschlein?”
„Na, ich dachte an ein Werbegeld, hab ich euch doch zwei tapfere und starke Recken gebracht.”
„Werbegeld? Zieh bloß Leine, bevor ich dir das Fell versohle!” grollte der Hauptmann, aber man konnte sehen, das er sich dabei das Lachen verkneifen musste. Dann aber brüllte er mit Donnerstimme: „Feldwaibel! Feldwaibel Rottach!”
Ein vierschrötiger Mann bahnte sich seinen Weg durch das Gewühl, breit, groß und kräftig, einer, den man nicht zum Feind haben möchte.
„Ihr habt gerufen, Hauptmann?” Seine Stimme passte zur Gestalt.
„Da sind zwei Neue, weise sie ein.”
Der Feldwaibel maß uns mit einem Blick, aus dem abgrundtiefe Abneigung sprach.
„Die Frischlinge, Hauptmann? Mit Verlaub, wird das ein Kinderkreuzzug oder was?”
„Ach komm, du warst doch auch mal jung, Rottach. Ich glaube, aus denen wird noch was. Sieh nur zu, das sie uns bis Messina nicht verrecken und das Kämpfen lernen.”
„Also kommt mit”, sagte der Feldwaibel resigniert und führte uns in eine Ecke des Lagers, wo schon eine ganze Reihe junger Männer, die allesamt nicht nach erfahrenen Soldaten aussahen, ihre Bündel packten.
„Das ist unser Ferkelhof”, grollte er. „Da in dem Topf ist noch was Brei, fresst ihn auf und dann macht euch nützlich. Wir wollen bald los.”
Um die Mitte des Vormittags setzte sich unser Zug in Bewegung. Er war doch um einiges größer, als ich gedacht hatte, denn mir war am gestrigen Abend der Tross entgangen, der etwas von den Kriegern entfernt lagerte.
Nach kurzer Zeit war Bamberg hinter den Wegbiegungen verschwunden und ich atmete endlich auf. Jetzt erst schien die Gefahr gebannt, das Vater mich noch erwischte und meine Entscheidung war nun unwiderruflich. Nun, da keine Unsicherheit mich mehr in die eine oder andere Richtung zog, fühlte ich mich frei und zufrieden und geriet in eine wahre Hochstimmung. Gierig sog ich alle Eindrücke dieser neuen Lebensweise in mich auf.
An der Spitze des Zuges ritt der Hauptmann, zusammen mit fünf anderen Herren, die den weißen, kreuzgeschmückten Überwurf trugen: Vasallen des Ritters Wulfgram, Freie, die ein Lehen von ihm erhalten hatten, einen Gutshof zum Beispiel, und ihm daher dienstverpflichtet waren. Die meisten von ihnen wären lieber zu Hause bei Weib, Kindern und Besitz geblieben, als ihrem Herrn in die Fremde zu folgen, aber ihnen blieb da keine Wahl.
Dahinter kamen zehn oder zwölf berittene Kriegsknechte, gut gerüstet und bewaffnet, unter ihnen auch der Feldwaibel Rottach, der das Banner trug. Sie waren die Elite unter den Kriegern des Ritters, die als erfahrene und erprobte Kämpfer schon lange in seinem Dienst standen. Ihnen folgten die Fußsoldaten, gut fünfundzwanzig Veteranen und vielleicht fünfzehn Frischlinge, Ferkel oder Küken, wie sie uns nannten, und den Abschluss bildete der Tross. Der bestand aus ein paar schweren, vierrädrigen Wagen, die von mächtigen Kaltblütern gezogen wurden, Dienern und Knechten. Dazu noch einige Ersatzpferde für die Reiter, Ochsen, Schweine und Hühner, von kleinen Jungs gehütet und geführt. Selbst drei liederliche Frauenzimmer fanden sich dabei, die freizügig gekleidet gingen und sich einen Spaß daraus machten, uns Jünglinge mit anzüglichen Bemerkungen zu verwirren und in Verlegenheit zu bringen. Ich wusste schon, was diese Frauen taten, in Bamberg gab es auch welche von ihrer Zunft, und wenngleich ich noch nie den Mut - und das Geld - aufbrachte, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, so tat ich doch so, als wäre ich mit Frauen bestens vertraut. Josef aber schien in dieser Hinsicht noch gänzlich unerfahren, ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf, wenn sie ihre Röcke lüpften und die Beine entblößten und wenn sie ihn neckten, was sie gern taten, denn er war ein dankbares Opfer, glühte sein Kopf wie ein Kohlenfeuer.
So marschierten wir also gen Süden, auf eine Reihe hoher Berge zu, die sich die Alpen nannten, und über die wir hinweg mussten, um nach Italien zu gelangen. Ich hatte keinerlei Vorstellung von ihrer Größe und den Strapazen dieser Überquerung und auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Jeder von uns Frischlingen wurde einem erfahrenen Krieger zugeteilt, denen wir zur Hand gehen mussten, was heißt, dass wir in der Sache ihre Diener waren, wenn es galt, das Lager aufzugschlagen, Essen zu bereiten, die Sachen zu waschen und zu flicken und ihre Streiche und groben Scherze zu ertragen. Die waren wirklich nicht zimperlich und auch bei ihnen galt Josef als bevorzugtes Opfer. Der arme Kerl musste wirklich leiden, aber er trug es mit Gleichmut, oder jedenfalls tat er so. Im Gegenzug brachten sie uns das Kämpfen bei und wiesen uns ins Kriegerleben ein, zeigten, wie man am besten sein Bündel schnürte, damit es beim Marsch nicht drückte, wie man seine Schuhe auspolsterte um auch lange Strecken ohne Schmerzen zu laufen und vor allem, wie man die Waffen gebraucht.
Mein Mentor wurde Oswin Sturkopf genannt und er war wohl doppelt so alt wie ich und hatte schon in vielen Schlachten gekämpft. „Halt dich nur an den alten Oswin”, pflegte er zu sagen, wenn er guter Laune war, „und du kommst heil aus jeder Schlacht heraus.”
Auf seinen Rat hin kürzte ich den Griff meiner Axt, damit sie handlicher würde und lernte, wie ich mir damit einen Schwertkämpfer vom Leibe halten konnte. Die wichtigste Waffe eines Fußsoldaten aber war, wie der Hauptmann gesagt hatte, der Spieß; das erkannten wir schnell. Damit konnte man einen Gegner bekämpften, ohne in die Reichweite seines Schwertes zu geraten, man konnte Reiter von ihren Pferden holen oder diese zu Fall bringen. Ohne diese Waffe, das war klar, würde man uns in der ersten Schlacht massakrieren. Deshalb opferten Rollo, Josef und ich einen Großteil unseres Handgeldes für drei ordentliche, feste Spieße mit stählerner Spitze, die sogar den Zuspruch des Feldwaibels fanden.
„Vielleicht wird doch noch mal was aus euch”, knurrte er.
Meinen neuen Herrn, Ritter Wulfgram von Ansbach, sah ich erst eine Woche nach meinem Eid. Er und zwei Begleiter blieben noch ein paar Tage länger in Bamberg, auf ihren schnellen Pferden bereitete es ihnen keine Mühe, den Heerzug immer wieder einzuholen. Wulfgram war ein hagerer, schweigsamer Mann mit außerordentlich buschigen Augenbrauen, was ihm einen düsteren Ausdruck verlieh. Er war ein hervorragender Reiter, der sein Pferd allein mit der Kraft seiner Schenkel dirigieren konnte und er genoss den Respekt seiner Männer. Tatsächlich hätte ich es schlechter treffen können mit meinem Dienstherrn.
Nach ein paar Tagen begann der Herbst, sich von seiner schlechten Seite zu zeigen, es wurde nasskalt und windig und am Morgen lagerte ein kalter, klammer Nebel über den Wiesen und Feldern, ein erster Vorgeschmack auf das was noch kommen sollte.
An irgendeinem Tage, als ich gebeugt unter meiner Last dahintrottete und alles schon zu gleichförmiger Routine verkommen war, packte mich Rollo am Arm.
„Sieh doch!”
Ich sah hoch und blieb stehen, wie jedermann im Zug. Wir hatten wohl gerade einen flachen, kaum wahrnehmbaren Hügel erklommen und über eine große, braune Weide hinweg bot sich dem Auge ein freier Blick über das Land. Da waren große Wälder kahler Bäume, dazwischen gesprengt ein paar braune, abgeerntete Felder und kleine Weiler. Dahinter aber, ganz blau erscheinend, ragten gewaltige Berge empor. Zuerst hielt ich sie für Wolken, aber nein, ihre Form war zu zerklüftet und sie blieben unverändert. Hinter diesen ersten, blauen Bergen ragten weitere, noch höhere und blauere empor und hinter diesen noch gewaltigere, die so fern sein mussten, das sie mir fast durchscheinend und auf wunderbare Weise leicht und schwebend vorkamen. Und, irrte ich mich hierin oder nicht, auf ihren Gipfeln schien Schnee zu liegen.
Eine ganze Weile standen wir schweigend vor diesem Bild. Nie zuvor hatte sich mir ein solcher Anblick geboten. Die unendliche Weite, die sich da auftat, lies mich schwindeln. Noch nie hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, wie groß die Welt wohl sein könnte, aber nun ergriff mich das unbewusste Gefühl, das sie wohl sehr groß sein musste, größer als ein Mensch es fassen konnte. Eine heilige Ehrfurcht vor der Großartigkeit Gottes, der dies alles und noch viel mehr an einem einzigen Tag, ich glaube am Dritten, erschaffen hat, lies mich erschaudern.
„Ja, ja”, riss mich da Oswin aus meiner erhaben Stimmung, „da sind sie, die Alpen. In ein paar Tagen sind wir da und dann geht der Spaß los: Steile Pässe, Kälte, Wind und Schnee, Steinschlag und Lawinen und nix zu fressen. Warts nur ab, Frischling, noch vor dem nächsten Vollmond wirst du dir wünschen, du wärst daheim geblieben.”
Vier oder fünf Tage später, an einem Samstag, erreichten wir schon früh am Nachmittag eine kleine Stadt und errichteten das Lager. Wie immer in solchen Fällen, wollte der Hauptmann seinen Werbertisch aufstellen lassen, aber Ritter Wulfgram wehrte ab.
„Wir haben genug Leute”, hörte ich ihn sagen. „Bis Messina ist’s noch weit und bis dahin muss ich sie alle durchfüttern und ihren Sold zahlen.”
„Da haben wir wohl Glück gehabt”, murmelte ich zu Josef, mit dem ich eben aus dem Wald kam, wo wir Reisig für unsere Hütte geschlagen hatten. Nach uns wurden nur noch Fünf andere geworben
„Hm”, knurrte Josef. „Mir wär’s lieber, da wären noch ein paar gekommen. Vielleicht würden sie mich dann in Ruhe lassen.”
Er tat mir leid. Erst an diesem Morgen hingen seine Schuhe an den Ästen eines hohen Baumes, ziemlich weit außen, und unter dem Gejohle des Lagers musste er hochklettern, vorsichtig zu ihnen balancieren und sie herunterpflücken.
„Das wird schon werden”, versuchte ich zu trösten. „Wenn wir erst mal eine Weile dabei sind, gibt sich das.”
„Ach, es ist ja nicht so schlimm”, wehrte er ab in einem bemüht forschem Tonfall. „Zu Hause war es schlimmer.”
Inzwischen fanden sich in unserem Lager eine Reihe von Bürgern und Bauern ein, die Lebensmittel brachten und oh Wunder, sie wollten kein Geld dafür.
„Ihr zieht ins Heilige Land um für unser aller Seelenheil zu kämpfen”, sagte ein älterer Bauer, als ich mich für die Eier bedanken wollte, die er mir gab. „Das ist das wenigste, womit wir es vergelten können.”
Er sprach einen seltsamen Dialekt, den ich nur schwer verstand, und alle anderen redeten ebenso. Wir mussten schon sehr weit von zu Hause entfernt sein.
„Was meint ihr, Leute”, fragte Rollo, „das Essen, das sie uns gebracht haben, reicht sicher zwei Tage. Da könnten wir uns doch heute Abend mal ein paar Humpen Bier leisten. Morgen ist außerdem Sonntag, da ziehen wir nicht weiter.”
„Ich glaube nicht, dass sie uns am Abend in ihre Stadt lassen”, gab ich zu bedenken.
„Das brauchen wir auch nicht. Ich habe gesehen, wie sie ein paar Fässer zum Tross geschafft haben. Na, Lust?”
„Ich weiß nicht...” Josef sah regelrecht ängstlich aus. „Schade um das schöne Geld.”
„Ach komm schon”, stieß Rollo ihn verschwörerisch den Arm in die Seite. „Bea ist mit Sicherheit auch dort.”
Bea, eigentlich Beatrice, obwohl auch das vermutlich nur ein „Künstlername” war, gehörte zu den Huren, die den Zug begleiteten, eine hagere Frau mit leichtem Überbiss. Mein Fall war sie nicht, aber Josef schien sich regelrecht in sie verliebt zu haben, in ihrer Gegenwart bekam er regelmäßig einen hochroten Kopf und kein Wort heraus und dennoch versuchte er immer wieder, in ihre Nähe zu kommen, nur um dann wie ein Tölpel dazustehen und sie anzustarren.
„Na gut“, stimmte er schließlich zögerlich zu. „Aber nur auf ein Bier.”
Im Trosslager standen vier große Fässer, ein paar mächtige Feuer wurden entzündet, denn sie Sonne verschwand zu dieser Jahreszeit schon früh unter dem Horizont, und dann wurde es nicht nur recht schnell finster, sondern auch empfindlich kalt. Kisten, Fässer und ein paar Baumstämme mussten als Sitzgelegenheiten herhalten und nach und nach fand sich das gesamte Lager ein, bis auf den Ritter. Wulfgram schien kein Freund von Zeltlagern zu sein, mit Sicherheit hatte er sich bei einem der Stadtväter einquartiert. Auch seine Vasallen fehlten, die saßen sicherlich beim Wein in ihren Zelten. Dabei verpassten sie wirklich was, das Bier war dunkel und würzig, malzig und sogar leicht süßlich, dazu verdammt kräftig. Alle sprachen ihm reichlich zu und die Stimmung wurde immer gelöster. Saßen Veteranen und Frischlinge zu Anfang noch getrennt, so vermischte sich das irgendwann und schließlich tauchten auch die Frauenzimmer auf und begannen, die halbbetrunkenen Männer zu umgarnen. Sie waren jetzt zu viert, irgendwann in den letzten Tagen war noch ein strohblondes Mädchen zu ihnen gestoßen, ein junges, aber recht dralles Ding, das trotz seiner Jugend ihr Geschäft schon meisterlich beherrschte und die mit einer Dreistigkeit und Schamlosigkeit zu Werke ging, dass mir schier die Augen aus dem Kopf fielen. Ich war damals ja noch Jungfrau und kannte nur jene Lust, die ich mir mit meinen eigenen Händen bereiten konnte, daher übten diese Frauen eine eigenartige Faszination auf mich aus; obschon ich wusste, dass