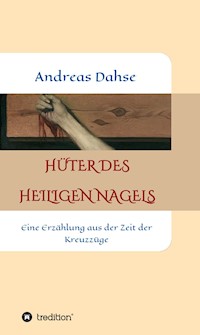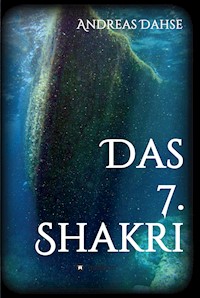
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Max Schrödinger in seinem Philippinen-Urlaub nur ein paar gemütliche Tauchgänge machen, doch als er beim Auftauchen feststellen muss, das sein Touristenboot von einer Gruppe schwerbewaffneter Männer gekapert wurde, verwandelt sich die Vergnügungsreise in einen Horrortrip. Von den Kidnappern dazu gezwungen, eine halbe Tonne Rauschgift aus einem versunkenen Boot zu bergen, erkennt er, dass sein Leben in höchster Gefahr ist und macht sich unter Wasser davon. Dabei stößt er auf das Wrack eines vor langer Zeit gesunkenen Kriegsschiffs und darin auf ein geheimnisvolles kleines Objekt, das er an sich nimmt. Von diesem Augenblick an scheint er zum meistgejagten Mann auf den Philippinen zu werden. Rauschgiftschmuggler, korrupte Polizisten und mysteriöse Männer in schwarzen Geländewagen versuchen ihn zu töten. Seine einzige Chance scheint Sky zu sein, eine rätselhafte junge Thailänderin, die zur geheimen Bruderschaft der Shakri Narubeth gehört. Von ihr erfährt er, dass es sich bei dem gefundenen Objekt um das letzte, lang verschollene Shakri handelt, ein uraltes Artefakt, dem eine schreckliche Macht innewohnt. Auf einer actionreichen Jagd von den Philippinen über Thailand bis nach Ägypten muss Schrödinger schließlich erkennen, dass nicht nur sein Leben auf dem Spiel steht, sondern die Existenz der gesamten Menschheit. Und es gibt nur einen Menschen, der die Katastrophe aufhalten kann: ihn selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Dahse
Das 7. Shakri
© 2021 Andreas Dahse
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-22903-7
Hardcover:
978-3-347-22904-4
e-Book:
978-3-347-22905-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die Ereignisse, von denen ich hier berichten will, trugen sich vor gut drei Jahren zu. In der Zwischenzeit habe ich zwar mit Niemandem darüber gesprochen, aber zweimal versucht, sie zu Papier zu bringen, beziehungsweise, sie in meinen Laptop zu tippen. In beiden Fällen blieb es bei dem Versuch, denn der eigene Text erschien mir beim Lesen unglaubwürdig und völlig verrückt, obwohl ich mich – soweit ich mich erinnern kann – exakt an die Wahrheit hielt.
Dann, vor kurzer Zeit, erhielt ich von einem ehemaligen französischen Mitglied der Shakri Narubeth, der, sei es aus alter Gewohnheit oder als Hobby, die entsprechenden Veröffentlichungen seiner Regierung weiter verfolgt, die Nachricht, dass der als vermisst geltende Vincent Legrelle nun offiziell für tot erklärt und seine Akte geschlossen wurde. Zwei magere Sätze, die einen Menschen völlig unbemerkt in die totale Vergessenheit schieben; und dieses Ende hat er nicht verdient. Obwohl ich Vincent kaum kannte (wir sind uns nur drei Mal begegnet und jedes Mal versuchten wir, uns gegenseitig umzubringen) brachte mich diese E-Mail dazu, mich wieder hinzusetzen und den Bericht zu vollenden. Mittlerweile ist es mir auch egal, ob ich für einen Spinner oder einen Phantasten gehalten werde, ich kenne die Wahrheit, auch wenn ich keinen materiellen Beweis vorzeigen kann. Und alle noch lebenden Menschen, die meine Worte bezeugen könnten, gehören zu den Shakri Narubeth und die werden, auch wenn sich die Bruderschaft mehr oder weniger aufgelöst hat, nie gegen ihr Gelübde zur Geheimhaltung verstoßen. Nur drei kurze internationale Pressemitteilungen kann ich, quasi als Indizienbeweis, anführen:
Die Erste berichtet über die Ermordung europäischer Tauchtouristen durch Drogenschmuggler in der philippinischen Sulu-See und anschließende Feuergefechte zwischen den Banditen und den Sicherheitskräften in einer Polizeistation und auf einem Privatflugplatz der Insel Bohol, bei der die Schmuggler getötet wurden.
In der Zweiten, einen Tag später, geht es um einen Überfall einer terroristischen Splittergruppe auf einen Tempel im Norden Thailands, bei dem mehrere Mönche getötet wurden und die dritte Nachricht schließlich, nochmal zwei Tage später, erzählt von der Schändung eines fünftausend Jahre alten ägyptischen Beamtengrabes aus der Zeit der ersten Pharaonen durch Ausländer, die unter dem Schutz des ägyptischen Militärs gestanden haben sollen. Das Verteidigungsministerium dementierte umgehend.
Jede diese Nachrichten steht für sich, es gibt scheinbar keinerlei Zusammenhänge zwischen ihnen (es hat sich auch nie jemand die Mühe gemacht, einen herstellen zu wollen) und doch gehören sie untrennbar zusammen und waren der Auftakt für jene bizarren Geschehnisse, an deren Ende die Menschheit, ohne es zu wissen, so dicht vor ihrer völligen Auslöschung stand wie nie zuvor. Und der Auslöser für diese Ereignisse und der einzige Mensch auf dem Planeten, der sie bis zum Ende bewusst miterlebt hat und darüber berichten kann, bin ich.
Tag 1 - 12 Kilometer über Indien
Die Speisekarte war auf cremefarbenen Karton gedruckt, das „Menue“ auf der Titelseite in goldenen Lettern. Und obwohl sie recht kurz war – es gab nur je drei Vor- und Hauptspeisen und vier Desserts, las sich das Ganze wie aus einem Sternerestaurant stammend. Nach einiger Überlegung entschied ich mich für geräucherte Entenbrust auf einem Gurkenbett mit Sesambrot und Dijon-Senf, Rinderfilet in Rosmarinsoße, gedünstetem Kürbis und pfannengebratenen Gnocchi und zum Abschluss für Kokosnuss-Pannacotta mit Ananaskompott. Dazu passend ein Còte de Castillon Bordeaux.
Schon in einem Gasthaus auf festem Boden wäre ein solches Menü nicht zu verachten, dieses Restaurant aber flog in zwölf Kilometern Höhe mit fast tausend Stundenkilometern über Indien dahin. Ich saß in einem Airbus A 380 einer großen arabischen Airline auf dem Weg nach Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Und um den Luxus komplett zu machen, in der Business-Class. Vor drei Tagen hatte mir die Fluggesellschaft eine Mail geschickt mit dem Angebot, für etwa 380 Euro die Etappe von Dubai bis Manila in der Business zu fliegen. Das war zwar eine Menge Kohle, aber als einmaliges Erlebnis konnte ich mir das schon mal gönnen. Und – ich hatte Urlaub. Warum sollte der nicht schon im Flugzeug beginnen?
Und so stieg ich also beim Boarding ziemlich aufgeregt und voller Vorfreude durch den vorderen Eingang in den Flieger und fand mich im Obergeschoß des gewaltigen Vogels wieder, oder im „Upperdeck“, wie einer der Stewards es nannte, als er mich willkommen hieß. Die Sitze waren gigantisch, richtige kleine Abteile mit einer Minibar am Platz und einem Bildschirm, der fast so groß war wie mein Fernseher zu Hause. Per Knopfdruck verwandelten sie sich in völlig flache Betten, so lang, dass ich mit meinen 1,85 Metern bequem grade liegen konnte. Noch während ich meinen Platz untersuchte, kam eine der Stewardessen, eine junge, verdammt hübsche Asiatin, mit einem Tablett voller Gläser vorbei, hieß mich noch einmal willkommen und bot mir ein Glas Champagner an. So will ich jetzt immer fliegen, dachte ich, während ich es mir wohlig bequem machte und durch das Filmangebot zappte.
Und nun flogen wir schon gut zwei Stunden, das riesige Flugzeug mit seinen zwei Passagierdecks und vier Triebwerken lag wie ein Brett in der Luft, ich hatte mein Essen ausgewählt und beschloss, mal nachzusehen, wie hier wohl die Toiletten beschaffen waren. Die befanden sich im Heck, ich ging also nach hinten, vorbei an den höchstens zur Hälfte belegten Sitzen. Etliche Passagiere schauten einen Film, manche schliefen und die meisten von ihnen sahen gar nicht so aus wie man sich Business-Class-Reisende vorstellt. Einen Anzug oder gar Krawatte trug jedenfalls keiner und ich sah auch nur einen jungen Mann, der an seinem Laptop zugange war. Dann ließ ich die Kabine hinter mir und stand in einer Bar. In der ganzen Breite des Rumpfes und ungefähr fünf Meter in der Tiefe gab es keine Sitze, statt dessen in der Mitte dieses Raumes einen hufeisenförmigen Tresen und dahinter einen Glasschrank mit diversen Flaschen Hochprozentigen, und nicht die billigsten Sorten. Da gab es Hennessy, 12 Jahre alten schottischen Jura-Whisky, Woodford Reserve Bourbon und noch einiges mehr. Entlang der Wände zogen sich zwanglose Sitzgruppen und an der Rückwand hing ein riesiger Monitor, auf dem man die genaue Position des Flugzeuges sehen konnte und darunter, auf einem Schränkchen, standen Schalen mit Knabberkram.
Einige der anderen Passagiere standen oder saßen schon herum und ließen es sich gut gehen; der Barkeeper strahlte mich an und sagte: „Willkommen in unserer Onboardlounge, Sir. Was darf ich Ihnen anbieten?“
Auf der Theke lag eine Cocktailkarte, nach kurzem Überfliegen entschied ich mich für einen Mojito und während der Keeper sich an die Arbeit machte, pickte ich mir ein paar eingelegte Oliven aus einer der Snackschalen und überlegte dabei, dass es doch verdammt dekadent war, was ich hier machte. Aber mein schlechtes Gewissen hielt sich in Grenzen, ganz im Gegenteil, ich fand, richtig reiche Leute, die immer so reisen konnten, hatten es echt gut.
Mir gegenüber lehnte ein Mann, vielleicht Mitte Fünfzig, recht gepflegt aussehend, in Jeans und Polohemd, der mir grinsend dabei zusah, wie ich mit dem Smartphon ein Foto schoss. Dann nahm er sein Glas und kam zu mir herüber.
„Schon ganz angenehm so zu fliegen, was?“ fragte er auf Deutsch. Woran mochte er meine Herkunft wohl erkannt haben? Sah man mir den Deutschen so deutlich an?
„Auf jeden Fall“, gab ich zurück, bemüht, einen möglichst weltmännischen Eindruck zu machen. Er trank den Rest seines Whiskys aus, stellte das Glas auf die Theke und gab dem Keeper einen Wink, es nachzufüllen. „Fliegen Sie beruflich nach Manila?“
„Nein, das ist eine Urlaubsreise“, antwortete ich. „Ich flieg zum Tauchen runter.“
„Sie Glücklicher.“ Er hob sein Glas und prostete mir zu.
„Das heißt also, dass Sie beruflich unterwegs sind?“ Ich hatte nichts gegen eine kleine Unterhaltung um die Zeit totzuschlagen.
„Ja, ich arbeite für das Entwicklungshilfeministerium.“ Er schwenkte sein Glas und ließ den Scotch darin hin und her schwappen, dabei grinste er mich fast ein wenig beschämt an. „Sie sehen hier Ihre Steuergelder bei der Arbeit.“
Offenbar hatte er nichts dagegen, über seine Arbeit zu reden. Und, na ja, ich traf auch nicht alle Tage auf einen Regierungsmitarbeiter und es interessierte mich schon, wofür die in Berlin unsere Steuern verpulverten, außer für Business-Class-Reisen. Und so erzählte er mir, dass er Unterstaatssekretär sei und damit beauftragt, mit der Stadtverwaltung von Manila über den Ausbau der MRT-Linien zu verhandeln.
Ich nickte verstehend. Seit über zehn Jahren flog ich zum Tauchen nach Südostasien und wechselte mich zwischen Thailand, den Philippinen und Indonesien ab, einiges lernte man da kennen, auch die Bahn in Metro-Manila. MRT hieß soviel wie Mass Rapid Transit, war die Stadtbahn der gigantischen Metropole und so ziemlich die einzige Alternative zum Straßenverkehr.
„Unser Ministerium möchte die Filipinos beim Ausbau der Bahnlinien unterstützen um den Autoverkehr zu reduzieren. Wenn Sie schon mal in Manila waren, dann werden Sie ja wissen, wie verstopft die Straßen sind und dass sie dort ständig kurz vor dem totalen Verkehrskollaps stehen. Hinzu kommen die Lärmbelästigung und die Luftverschmutzung. In den letzten Jahren hat die Zahl von Lungen- und Augenerkrankungen enorm zugenommen, vor allem bei Kindern.“
Damit mochte er wohl recht haben. In Manila mit dem Auto unterwegs sein zu müssen, war eine Zumutung, die Straßen rund um die Uhr permanent verstopft und die Luft durch die Abgase hauptsächlich der alten Busse und Trucks regelrecht verpestet. Wer einmal einen Tag auf Manilas Straßen verbracht hatte, für den war unsere deutsche Feinstaubdiskussion das reinste Luxusproblem.
Allmählich kam mein Gegenüber in Fahrt. Wenn ich ihn richtig verstand, dann wollte Deutschland wohl bei der Finanzierung zusätzlicher Linien helfen unter der Voraussetzung, das deutsche Unternehmen am Bau beteiligt wurden. Irgendwann gerieten die Verhandlungen aber ins Stocken, weil China mit ähnlichen Vorschlägen zu wesentlich besseren Konditionen auftrat.
„Diese Chinesen, nein, diese Chinesen…“ murmelte er ziemlich resigniert und dann erzählte er mir über die Bauvorhaben der Chinesen in aller Welt. In den letzten Jahren war die Volksrepublik wohl mit großen Infrastrukturprojekten auf allen Kontinenten in Erscheinung getreten. Chinesische Firmen bauten mit chinesischen Arbeitern Straßen und Brücken in Afrika, Lithiumbergwerke in Bolivien und Bahnstrecken auf dem Balkan, alles zu Konditionen, die für die betreffenden Länder zunächst sehr lukrativ waren, aber nur dem Ziel dienten, diese Staaten wirtschaftlich und auf lange Sicht auch politisch an China zu binden.
„Aber jetzt“, fuhr er mit neuer Zuversicht fort, „tut sich eine Möglichkeit für uns auf. Die Chinesen sind auf den Phills in Ungnade gefallen.“
„Wie das?“
„Es gibt zwischen beiden Ländern Streit wegen eines unbewohnten Atolls. Sie haben deswegen sogar schon Kriegsschiffe in Marsch gesetzt.“
Irgendwann hatte ich mal was darüber gelesen, aber es interessierte mich damals nicht besonders. Es ging um winzige Inselchen, eigentlich nur Felsen im Meer, die von beiden Staaten beansprucht wurden. Die Chinesen hatten wohl eine davon besetzt und dort eine Station oder eine Basis errichtet, worauf die Filipinos mit der Entsendung von Kriegsschiffen reagierten. Ich wusste allerdings nicht, was daraus geworden war.
Er winkte ab. „Ist im Sande verlaufen. Beide Seiten haben ein paar Mal in die Luft geschossen, dann sind die Filipinos abgezogen und haben eine Petition beim UN-Sicherheitsrat eingereicht. Und da wird sie wohl noch heute liegen.“
„Um was ging es dabei überhaupt? Haben diese Inseln strategische Bedeutung oder so?“
„Fischereirechte. Wer die Inselgruppe als sein Territorium beansprucht, kann seine Hoheitsgewässer bis dahin ausdehnen und den Nachbarn das Fischen dort untersagen. Aber nun genug der öden Politik. Was haben Sie denn vor in Ihrem Urlaub?“
Ich erzählte ihm, dass ich tauchen wolle und das fand er faszinierend. Hätte er früher auch mal probiert, sich unter Wasser aber nicht wohlgefühlt. Wir redeten noch eine ganze Weile über die besten Tauchgebiete, die die philippinischen Inseln zu bieten hatten und tranken dabei das eine oder andere Glas. Ich schwärmte von den Möglichkeiten zum Wracktauchen, grade das reizte mich am meisten.
„Und wo soll es diesmal hingehen?“ fragte er schließlich.
„Bohol. Ich werde von Alona Beach aus Tagestouren machen.“
Er kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. Mittlerweile schien er durch mehrere Gläser Scotch schon recht angeschlagen zu sein, zumal der Barkeeper beim Einschenken nicht sparsam war.
„Das sind die südlichen Visayas. Sulu-See, richtig? Ziemlich heiße Gegend.“
„Inwiefern?“
„Wegen der Abu Sayaf und ihrer Umtriebe.“
„Aber die sitzen doch auf Mindanao. Ich habe noch nie gehört, dass es auf den Visayas mit denen Ärger gibt.“
Tatsächlich hatte ich erst kurz vor meinem Abflug auf der Homepage des Auswärtigen Amtes nachgeschaut, ob es für mein Ziel Reisewarnungen gab. Das Ministerium riet allerdings nur von Reisen nach Mindanao und Südpalawan ab, alle anderen Gebiete galten als sicher, soweit heute überhaupt noch eine Gegend als sicher gelten kann. Die Abu Sayaf waren, wie ich wusste, eine islamistische Untergrundorganisation, die gegen die Regierung kämpfte und auch schon mal Ausländer entführte, die sich in ihren Machtbereich wagten. Der aber erstreckte sich nur auf Mindanao und die südlich davon gelegenen kleinen Inseln, nicht auf die Visayas, wie man die Inselgruppe im Zentrum der Philippinen nannte. Mein Gesprächspartner nickte dazu.
„Aber“, sagte er dann und hob bedeutsam den Zeigefinger, „der neue Präsident hat dem Drogenschmuggel und der Korruption den Kampf angesagt und er greift verdammt hart durch.“
„Was hat das mit der Abu Sayaf zu tun?“
„Die finanzieren sich zum Teil über den Drogenhandel. Und viele Schmuggler, denen die Politik eigentlich völlig egal ist, rennen ihnen jetzt die Türen ein, weil sie sich Schutz gegen die Polizei versprechen. Die meisten Schmuggelrouten führen nun mal durch die Sulu-See und in derem Süden hat die Abu Sayaf das Sagen. Auch viele korrupte Beamte und ganze Behörden der Visayas sympathisieren inzwischen mit ihnen, weil sie vor ihrem eigenen Präsidenten mehr Angst haben als vor den Terroristen.“
„Ich hab davon noch nie gehört.“
„Kein Wunder, die Visayas sind für die Tourismusindustrie die wichtigste Ecke des Landes. Da hält die Regierung schön den Deckel drauf um niemanden zu beunruhigen.“
Er verstummte, trank den Rest seines Whiskys und zuckte mit den Schultern. „Na ja, wahrscheinlich werden Sie in Ihren paar Urlaubswochen gar nichts davon mitkriegen. Genießen Sie Ihre Ferien, aber seien Sie trotzdem vorsichtig, das kann nie schaden.“
Er stellte sein Glas recht hart auf den Tresen und trat leicht schwankend zurück. „Ich glaub ich geh auf meinen Platz zurück. War schön, Sie kennengelernt zu haben.“
Nachdenklich schaute ich ihm hinterher, dann bat ich den Barkeeper um einen neuen Mojito. Was ich da grade gehört hatte, passte nun ganz und gar nicht mit meinen Erfahrungen auf den Philippinen zusammen. Erst vor zwei Jahren war ich auf einer vierzehntägigen Motorradtour durch den Norden Luzons bis zum äussersten Zipfel der Insel, nach Santa Ana, gefahren und auf dem Rückweg durch die Berge der Cordillera Central, weit weg von den so viel beschworenen „ausgetretenen Touristenpfaden“ und hatte sicher acht oder neun Tage keinen anderen Europäer zu Gesicht bekommen. Trotzdem fühlte ich mich niemals unsicher oder gar bedroht, im Gegenteil, die Einheimischen waren die Freundlichkeit in Person, alle winkten mir zu und versuchten mit mir ins Gespräch zu kommen, soweit ihre paar Brocken Englisch reichten. Die meisten Unterhaltungen liefen allerdings immer nach dem gleichen Muster ab: Wie heißt du? Woher kommst du? Bist du verheiratet? Nein? Meine Schwester auch nicht, sie steht auf europäische Männer….
Der Barkeeper schob mir das frisch gefüllte Glas zu.
„Das ist der letzte“, sagte er dabei. Ich war baff. Sah ich schon so betrunken aus? Oder war auch in der Business-Class die Anzahl der Drinks limitiert? Der Barkeeper musste mein erstauntes Gesicht wohl richtig interpretiert haben, denn er grinste und zuckte entschuldigend mit den Schultern.
„Der letzte Mojito, danach müssen Sie auf was anderes umsteigen. Uns ist leider die Minze ausgegangen…“
Es war bereits dunkel, als wir Manila erreichten. Im Landeanflug zog die Maschine noch eine weite Kurve über der Stadt und ich konnte durch das Fenster das endlose Lichtermeer unter mir sehen. Bis an den Horizont leuchtete es in den verschiedensten Mustern und dazwischen erstreckten sich die von Autoscheinwerfern funkelnden Straßen wie die Adern eines strahlenden, weitverästelten Blutkreislaufs, eines Kreislaufs, der permanent kurz vor dem Infarkt stand. Wenigstens in dieser Hinsicht hatte der Entwicklungshilfemann recht. Manila war ein Moloch. Zusammen mit ihren Vororten bildete die Stadt eine riesige, zusammenhängend bewohnte Fläche, die sich Metro Manila nannte und wo etwa dreizehn Millionen Menschen lebten, oder vielleicht auch noch mehr. Genau wusste das niemand. Deutlich konnte man den achtspurigen Roxas-Boulevard sehen, der sich am Ufer der Bucht entlang zog. Auf einer Seite leuchteten die Hochhäuser der Hotels und Banken, auf der anderen lag das dunkle Wasser des Meeres. Weit draußen in der Bucht strahlten die Scheinwerfer von Fischerbooten. Dann sank die Maschine immer tiefer, schüttelte sich noch ein oder zwei Mal und setzte schließlich mit kaum merkbarem Stoß auf. Keine schlechte Leistung für einen solchen Giganten, der auch mit fast leeren Tanks sicher noch seine 350 Tonnen auf die Waage brachte und eine tolle Leistung der Piloten. Vor allem aber – das musste der Ingenieur in mir sein - empfand ich Hochachtung vor den Leuten, die dieses Flugzeug entworfen hatten. Meine eigene Arbeit, die Entwicklung von Lüftungs- und Klimaanlagen, empfand ich dagegen auf einmal als den langweiligsten und ödesten Job der Welt.
Eine knappe Stunde später konnte ich den Flughafen endlich verlassen und kaum war ich durch die großen Doppeltüren gegangen, schlug mir eine dicke, feuchtwarme Luft entgegen, die mich sofort einhüllte und ich konnte deutlich fühlen, wie sich eine dünne Schweißschicht auf meiner Haut bildete. Das war nicht einmal unangenehm, im Gegenteil, ich liebte diese einmalige, unverwechselbare Tropenluft. Seit jeher fühlte ich mich von den Ländern am Äquator magisch angezogen, dem kalten, klaren Norden konnte ich noch nie etwas abgewinnen.
Ich nahm ein Taxi ins Hotel, dass ich über eine Online-Plattform reserviert hatte. Es sollte, nach eigener Werbung, in „unmittelbarer Flughafennähe“ liegen, trotzdem kurvte der Fahrer noch fast dreißig Minuten durch die vollen Straßen und vor dem Fenster zog das Panorama einer philippinischen Großstadt vorbei: heruntergekommene, eng aneinander geschmiegte Gebäude, deren Erdgeschoß so gut wie immer ein Geschäft enthielt, eingesponnen von einem chaotischen Netz aus kreuz und quer verlaufenden Stromleitungen, die sich an den Leitungsmasten zu gewaltigen Knäueln verhedderten, der Alptraum jedes deutschen Elektrikers. Die schmalen Bürgersteige vollgestellt mit kleinen Buden und Ständen, an denen man vom selbstgemachten, knallbunten Wassereis bis zu Hello-Kitty-Handyhüllen alles kaufen konnte, was man in Manila halt so braucht. Dazwischen wuselten Menschen ohne Ende, von kleinen Kindern, die um diese Zeit eigentlich längst schlafen sollten, über dicke Frauen mit Einkaufstaschen, gehetzt wirkenden Geschäftsleuten und gelangweilten Jugendlichen bis zu uralten Opas in schmuddeligen Unterhemden und Anzughosen. Es schien nicht die beste Gegend der Stadt zu sein, aber das kann in Manila täuschen. Schließlich stoppte das Taxi vor einem unscheinbaren Schild mit der schon etwas verwitterten Aufschrift „Harry’s Hotel“.
Von innen sah das Hotel ein wenig besser aus, sauber jedenfalls und die junge Frau hinter der Rezeption lächelte freundlich und war sehr bemüht, die umständliche Eincheckprozedur möglichst rasch über die Bühne zu bringen. Jedem, der über die deutsche Bürokratie klagt, sei empfohlen, mal eine Nacht in Manila zu verbringen. Zuerst wird der Reisepass kopiert, in der Zeit füllt man als Gast ein Anmeldeformular aus, wo nicht nur Name, Alter und Heimatadresse abgefragt werden, sondern auch Beruf, Notfallkontakte und manch anderes mehr. Meist muss man im Voraus bezahlen und erhält dann eine Rechnung, die noch mal mit einem großen PAID-Stempel abgestempelt wird. Außerdem wird ein „Deposit“ verlangt, falls man ein Handtuch klauen sollte. Auch dafür gibt es eine abgestempelte Quittung. Am Ende wird die Passkopie noch mal fein säuberlich in ein Buch abgeschrieben und dann alle Zettel (von denen es je zwei Kopien gibt) zusammengetackert. Die Ausgabe für das Hotel verschwindet in einer Schublade, der Gast bekommt seine zusammen mit seinem Pass, dem Zimmerschlüssel und einem kleinen Papierschnipsel mit dem WLAN-Code über den Tisch geschoben.
Die ganze Zeit über lehnte ein gelangweilt aussehender Angestellter an der Rezeption und sah uns herablassend zu. Als ich nun, da er immer noch keine Anstalten machte, sich zu bewegen, meine Tasche mühsam über die Schulter wuchtete (sie wog ziemlich genau zwanzig Kilo und davon waren allein vierzehn Kilo Tauchausrüstung) und mich nach dem Lift umsah, deutete er mit einer müden Kopfbewegung nach hinten, wo sich wohl die Aufzüge befanden.
Immerhin war das Zimmer besser als erwartet, die Klimaanlage recht leise, das Bett bequem und es gab ausreichend Schränke und Ablagen, auch zwei Flaschen Wasser und einen Toaster. Was genau der sollte, begriff ich nicht ganz, vielleicht hatten sie ihn übrig gehabt und glaubten, er würde das Zimmer irgendwie aufwerten.
Ich machte mich frisch und verließ das Hotel auf der Suche nach etwas zu essen. Die nette Lady an der Rezeption hatte mir schon bedauernd mitgeteilt, dass ihr Restaurant geschlossen sei, es gäbe aber genug andere in der Umgebung. Mein erster Eindruck von der heruntergekommenen Gegend schien mich nicht getrogen zu haben. Alles war schmutzig und verkommen, die Luft roch nach verbranntem Plastik. Ein paar Obdachlose in extrem verdreckten und zerschlissenen Klamotten lagen in Nischen und Hauseingängen. Die ersten erleuchteten Spelunken an denen ich vorbeikam, führten zwar das Wort Restaurant im Namen, schienen aber eher Rotlichtbars zu sein. Vor einer lungerte eine ältere, dicke Frau in einem recht schäbigen Kleid herum, die mich direkt am Handgelenk packte. Das musste eine sogenannte Mama-san sein, in Deutschland würden wir „Puffmutter“ sagen.
„He Honey“, gurrte sie mit heiserer Stimme auf Englisch, „come in, we have beautifull girls.“
Sie zog mich heftig zur Tür und aus reiner Neugier warf ich einen Blick hinein. In dem Schuppen, der von innen nicht besser aussah als von außen, gab es ein paar Sitzecken mit rotbezogenen Sesseln und eine Theke. Die „wunderschönen Mädchen“, die dort gelangweilt auf Kundschaft warteten, hatten ihre beste Zeit schon hinter sich. Das war ja nun gar nicht das, was ich suchte. Ich machte mich los, was nicht so einfach war, denn die Dicke schien nicht gewillt, ihren einzigen potentiellen Kunden gehen zu lassen und ich musste sie regelrecht ein Stück hinter mir herziehen, ehe sie losließ.
Ich ging bis an die nächste Straßenecke und es wurde nicht besser, im Gegenteil. Hinter der Kreuzung wurde ich von einer grell geschminkten Gestalt in Minirock und High-Heels angesprochen, die definitiv keine Frau war und da beschloss ich umzukehren, bevor ich an noch üblere Typen käme. Ein paar junge Männer, die gelangweilt herumhockten und rauchten, sahen mich sowieso schon auf eine Art an, die mir gar nicht gefiel. Nicht das ich Angst bekam, das war ja nun nicht meine erste Reise hierher, aber wie der Typ vom Entwicklungshilfeministerium sagte, Vorsicht kann nie schaden. Ich drehte also um und stellte erstaunt fest, dass die Jugendlichen verschwunden waren und die eben noch so aggressive Mama-san verdrückte sich gerade in ihre Bar. Gleich darauf sah ich den Grund: Ein großer Pickup der philippinischen Polizei kam in Schrittgeschwindigkeit die Straße entlang und aus den geöffneten Seitenscheiben schauten zwei grimmig blickende Beamte. Neben mir bremsten sie ab und warfen mir einen äußerst missbilligenden Blick zu. Ich rechnete fast damit, kontrolliert zu werden; ein Europäer, der vor einer Rotlichtbar in einem solchen Viertel rumsteht… Aber sie hielten nicht und sagten auch nichts, sondern setzten ihre Streife fort. Als der Pickup hinter der Kreuzung verschwand, kehrten Mama-san und die Jugendlichen zurück. Diese Scheu vor der Polizei gab mir zu denken, mir fiel die Unterhaltung im Flugzeug wieder ein. Hatten die hier wirklich alle Dreck am Stecken oder griff die Polizei tatsächlich so hart durch wie man hörte? Es gab ja Gerüchte, sie würden mittlerweile erst schießen und dann fragen. Jedenfalls war mir der Appetit gründlich vergangen.
Tag 2 – Bohol, Philippinen
Am nächsten Morgen schlug der Jetlag erbarmungslos zu. Nachdem ich mich den größten Teil der Nacht schlaflos im Bett gewälzt hatte, schlief ich gegen sechs Uhr endlich ein, um nur eine Stunde später vom Wecker aufgeschreckt zu werden. Ich träumte gerade irgendwas, was ich sofort beim Aufwachen vergaß, aber mitten aus einem Traum gerissen zu werden ist für mich die übelste Art des Erwachens. Es dauerte auch eine ganze Weile, bis ich mich aufraffen konnte, ins Bad zu schlurfen. Aber leider musste ich zurück zum Flughafen, mein Inlandsflug nach Tagbilaran auf der Insel Bohol ging um elf und angesichts des Verkehrs sollte ich wohl mindestens zwei Stunden vorher hier losfahren.
Die Dusche gab nur ein dünnes, kaltes Rinnsal her, aber das machte mich wenigstens wach. Unten bat ich die Rezeptionistin – die gleiche wie am Abend vorher – mir ein Taxi zu rufen und war recht froh, das Hotel verlassen zu können. Die Inlandsflüge gingen von einer langen, schmalen Halle aus ab, in der sich hunderte von Menschen drängten, ganze Familien mit vier, fünf Kindern und Handgepäckmengen, die man in Europa wohl als Sperrgepäck einchecken müsste. Ich drängte mich durch die Massen bis zu meinem Ausgang, kaufte unterwegs noch einen Becher Kaffee und kam gerade an, als der Flug aufgerufen wurde. Die meisten Passagiere waren Einheimische; meist alle einen Kopf kleiner als ich hatten sie rechte Schwierigkeiten, ihre gewaltigen Taschen und Koffer in den Gepäckfächern zu verstauen. Ich half dem einen oder anderen, quetschte mich in meine enge Sitzreihe und war froh, dass der Flug nur eine Stunde dauern sollte. Neben mir kam ein älterer Herr unter, der scheinbar an Flugangst litt, er sprach kein Wort, schwitzte ganz fürchterlich und beim Start betete er, lautlos und inbrünstig. Dabei schien die Maschine, eine Boeing 737, in gutem Zustand und die Stewardessen, eine hübscher als die andere, machten ihren Job sehr professionell. Ich hatte einen Fensterplatz kurz vor der Tragfläche erwischt und konnte nun auch einen Blick bei Tageslicht auf Manila werfen. Ein unüberschaubares Häusermeer, unter einer dunstigen, schwärzlichen Glocke liegend. Dann drehte die Maschine nach Süden ab und steuerte auf das Meer hinaus. Ich lehnte mich im Sessel zurück und freute mich auf das, was mich erwartete.
Dies war meine vierte Reise auf die Philippinen. Vorher war ich bereits in Puerto Galera auf der Insel Mindoro und im Norden Luzons gewesen, auf Busuanga mit der unter Wracktauchern bekannten Bucht von Coron, war von dort nach El Nido auf Palawan gefahren und ich hatte Cebu und Malapascua besucht. Alles, bis auf den Norden Luzons, um zu tauchen, denn die Tauchgebiete, die das Land zu bieten hat, sind einmalig und die Heimat phantastischer Kreaturen. Von winzigen, nur wenige Millimeter großen Pygmäenseepferdchen bis hin zu Walhaien bieten diese Inseln alles, was das Herz eines Tauchers höher schlagen lässt. Hinzu kommen zahllose Wracks aus dem letzten Weltkrieg, in dem sich Amerikaner und Japaner erbitterte Schlachten in den Gewässern rund um Luzon und Leyte geliefert hatten. Zum ersten Mal kam ich in der Bay of Coron damit in Berührung. In dieser weiten, geschützten Bucht im Südwesten der Insel Busuanga versteckten sich im Spätsommer 1944 mehrere japanische Frachter unter dem Schutz eines einzelnen Kriegsschiffs, eines Wasserflugzeug-Mutterschiffs, vor der anrückenden amerikanischen Flotte. Zwei Jahre zuvor hatte die japanische Armee die Amis von den Philippinen vertrieben, mehrere tausend Soldaten gefangen genommen und eine Terrorherrschaft errichtet. Wie die Nazis in Europa zwangen die Japaner ihre Gefangenen zu Todesmärschen und Bauprojekten, und auch die einheimische Bevölkerung litt entsetzlich. Kein Wunder, das die Filipinos zu den Amerikanern hielten und ihnen die Ankerplätze der japanischen Schiffe verrieten. Im September 1944 erschien eine Staffel Sturzkampfbomber vom Typ Curtiss SB2C, von den Piloten „Helldiver“ genannt, über der Bucht und versenkte fast alle der vor Anker liegenden Schiffe. Die Amerikaner verloren dabei zwei Maschinen, eine machte eine Bruchlandung am Strand, die Besatzung überlebte. Einheimische Fischer brachten sie vor den Japanern in Sicherheit und schmuggelten sie zurück zu ihrer eigenen Flotte. Heute kann man dieser Geschichte in der Helldiver-Bar nachspüren, einer urigen kleinen, offenen Kneipe direkt am Meer, an deren einer Wand noch der verbogene Propeller des Flugzeuges hängt und daneben eines der Maschinengewehre und die originale Lederjacke des Piloten.
Soweit war ich mit meinen Erinnerungen gekommen, als die Maschine in den Sinkflug überging. Ich schreckte hoch, warf einen Blick aus dem Fenster und sah unter mir kleine felsige Inseln, die aus dem unglaublich türkisfarbenen Wasser ragten. Dann rauschten wir über ein paar Auslegerboote hinweg und schließlich über einen weißen Brandungsstreifen, gefolgt von hügeligem, grünbewachsenen Land. Hier und da konnte man Dörfer sehen, durch ein Netz aus schmalen Straßen miteinander verbunden. Die Häuser schienen alle sehr flach zu sein, mit Dächern aus bunt bemaltem Wellblech. Dicht unter dem Flieger huschte ein Sportplatz vorbei und ein Busdepot voller farbenfroher Jeepneys, buntbemalter und chromverzierter Kleinbusse im Design alter Weltkriegsjeeps, und dann setzten wir mit quietschenden Reifen auf.
Der Flughafen war klein, alt und hatte den Charme eines Parkhauses. Heute ist er, wenn ich recht informiert bin, geschlossen und es gibt einen neuen internationalen Airport ein paar Kilometer weiter südlich. Meine Unterkunft hatte versprochen mich abzuholen und sie hielten Wort. Am Ausgang des Ankunftsgebäudes, zwischen zahllosen Angehörigen, Taxifahrern und anderen Abholern stand auch ein kleiner alter Mann, der ein T-Shirt mit dem Logo des „Banana Garden Resort“ trug und ein Schild mit der Aufschrift „Max Schrodinger“ hochhielt. Dass die Pünktchen über dem „ö“ fehlten, nahm ich nicht weiter tragisch, mit Umlauten haben sie im Englischen von jeher ihre Probleme. Auf der Ladefläche eines Pickups (den Sitzplatz neben sich bot er, ganz Gentleman, einer Spanierin an, die ins Nachbarhotel wollte) verfrachtete er mich an den südlichsten Zipfel der Insel, nach Alona Beach. Hier gab es kleine offene Bars und Restaurants, Massageläden und Tauchshops, die sich entlang der schmalen, staubigen Straße aufreihten. Ein wenig zurückversetzt lagen Hotels aller Preisklassen. Es wimmelte von Tricycles, kleinen Motorrädern mit Beiwagen, die ebenso bunt bemalt waren wie die Jeepneys und als Transportmittel für alles Mögliche dienten, von einem Dutzend Reissäcken bis hin zur Großfamilie.
Mein Banana Garden Resort lag in einer engen, unbefestigten Seitengasse. Rechts erhob sich die Bruchsteinmauer eines anderen Hotels, links ein hoher Zaun. Der passt hier nie durch, dachte ich noch, als das kleine alte Männchen den Pickup in die Gasse zwängte. Aber obschon sie kaum breiter schien als das Auto und der Alte so winzig war, dass er fast schon zwischen Armaturenbrett und Lenkrad hindurchsehen musste, fädelte er passgenau ein und holperte in Schrittgeschwindigkeit die Gasse entlang. Ich stellte mich hin, hielt mich an der Dachreling fest und schaute über das Fahrerhaus hinweg. So zu fahren machte mir von jeher Spaß, zumindest bei humaner Geschwindigkeit. Ich konnte von dem exponierten Platz aus über die Zäune in verwilderte Gärten sehen und auf den Hof eines Mopedverleihs, wo ein paar Halbwüchsige mit Eimern voller Seifenwasser dabei waren, einen Motorroller in „Hello Kitty“-Lackierung zu waschen. Dann tauchte voraus ein ganzer Wald aus Bananenstauden auf und der Fahrer schaffte es irgendwie, sich durch eine schmale Lücke auf den Hof des Resorts zu zwängen. Dort war im Leben nicht genug Platz zum Wenden, zumal auch noch eine Reihe von Mopeds hier parkten. Ich hatte keine Ahnung, wie er hier wieder rauskommen wollte, aber er muss es wohl geschafft haben, denn als ich später das Resort verließ, war der Pickup weg. Zunächst aber checkte ich ein und bezog einen kleinen, gemütlichen Bungalow aus Bambus, der mit mehreren anderen in einem wuchernden tropischen Garten stand. Umgeben wurde das Ganze von einer lebenden Mauer aus zwei, drei Meter hohen Bananenpflanzen. Meine Hütte war recht schlicht, es gab keine Klimaanlage, aber einen großen Ventilator an der Wand und ein Moskitonetz über dem Bett. Ich hatte ein Badezimmer und eine kleine Veranda mit einer Hängematte. Im Hauptgebäude, ebenfalls aus Bambus gebaut, waren die Rezeption, ein offenes Restaurant und eine kleine Cocktailbar untergebracht. So ließ es sich aushalten, zumal ich kaum mehr bezahlen musste als für eine Nacht auf einem deutschen Campingplatz.
Am Nachmittag, nach einem Willkommensbier in der Hängematte, machte ich mich mit meiner kompletten Tauchausrüstung auf dem Weg zur Tauchbasis. Ich hatte im Internet eine Reihe von Tagestouren bei den „Eazy-Divers“ gebucht (sie schrieben sich wirklich mit Z um sich von den „Easy-Divers“ mit S abzuheben, die wohl auch irgendwo einen Shop hatten). Letzten Endes spielte es aber eigentlich keine Rolle, bei welcher Basis man buchte, alle hatten so ziemlich das gleiche Programm und auch die Preise lagen eng beisammen, man sollte nur sehen, dass man eine erwischte, die auf europäisches Publikum zugeschnitten war. Basen, die auf asiatische Gäste spezialisiert sind, haben meist keine Angebote für Einzelreisende und Individualisten, ihre Kundschaft kommt gruppenweise und macht alles im Kollektiv. Sie tauchen gemeinsam und abends sitzen sie alle zusammen in der Basis beim Abendessen und tragen auch noch alle die gleichen Tourshirts. Für mich eine gruselige Vorstellung.
Der Weg zur Tauchbasis führte mich einen kleinen Hügel hinab an den Strand. Nach links und rechts führte ein unbefestigter Weg aus feinem Sand direkt am Wasser entlang. Auf einer Seite leckten die trägen Wellen der tropischen Sulusee an einen blendend weissen Sandstrand und unter dem Schatten der Kokospalmen rekelten sich die Touristen, auf der anderen Seite drängten sich Restaurants, Kneipen, Souvenirshops, Tattoostudios und Tauchgeschäfte. Die Eazy-Divers waren schon von weitem an der überlebensgroßen Figur eines Tauchers in einem jener vorsintflutlichen Gummianzügen mit Eisenschuhen und den großen runden Bronzehelmen zu erkennen. An der Außenwand des Gebäudes schwammen recht naiv aber farbenfroh gemalte Hammerhaie mit Mantarochen und riesigen Clownsfischen harmonisch durcheinander. Zumindest die beiden ersten Arten würde ich hier wohl kaum zu Gesicht bekommen.
Der Chef des Ladens war ein Holländer und nannte sich schlicht Tamme, ein hagerer, zäh aussehender Mann mit langen, dunkelblonden Haaren, die er im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Sein Gesicht war von der Sonne gebräunt und voller kleiner Runzeln, so dass es mir sehr schwerfiel, sein Alter zu schätzen. Er konnte ebensogut Ende Dreißig wie Mitte Fünfzig sein. Nach dem üblichen Papierkram – Formulare ausfüllen, Haftungsausschluss unterschreiben, das Brevet vorzeigen (das ist der Nachweis der eigenen Qualifikation, ich war damals Master Diver mit knappen vierhundert Tauchgängen) – begann er mir den Ablauf eines Tauchtages zu schildern. Er sprach ein gutes Deutsch mit einem Akzent, der mich an Rudi Carrell, dem legendären holländischen Entertainer, erinnerte.
„Wir treffen uns morgens so gegen halb Neun hier im Shop“, begann er, „und fahren dann mit einem unserer Boote raus. Es ist immer noch Nebensaison, ihr werdet also nicht besonders viele auf dem Boot sein und eine Menge Platz haben. Bis vier Gäste fährt ein Guide mit, ab fünf Leuten haben wir zwei…“
Es gab zwei Tauchgänge pro Tag, dazwischen Mittag auf dem Boot und zwischen drei und vier Uhr nachmittags wären wir wieder hier. Das alles kannte ich, so gut wie alle Tauchtagestouren auf den Philippinen und in Thailand liefen nach dem gleichen Schema ab. Ich hätte ihm sogar sagen können, was seine Crew als Mittagessen servieren würde: Reis oder Nudeln mit Hühnchen. Das arme Geflügel leidet unter dem Pech, das es quasi von Jedem gegessen wird und in keiner Religion als Unrein oder sonstwie verboten gilt und daher das perfekte Fleischgericht für internationale Gäste abgibt.
„Hast du noch Fragen?“ beendete Tamme seinen Vortrag.
„Ja, habt ihr hier Wracks?“
Bedauernd schüttelte er den Kopf. „Leider nein, da musst du nach Subic oder Coron-Bay fahren.“
„Schade. Ich liebe Wracks. Gab es denn während des Weltkrieges hier keine Gefechte zwischen den Japanern und den Amis?“
„Nicht das ich wüsste“, antwortete er nach kurzer Überlegung. „Hier in diesem Inselgewirr ist mir keine Seeschlacht bekannt. Es gibt ein paar Fischerboote, die bei einem extremen Taifun vor ein paar Jahren gesunken sind, aber die waren aus Holz und sind sicher schon weg.“
Das glaubte ich ihm sofort. Die warmen tropischen Gewässer in diesen Breiten wimmelten von Leben, nicht nur von Fischen, sondern auch von Unmengen winziger Krebse und Würmer. Bei Tag schienen diese Tierchen unsichtbar, vielleicht verkrochen sie sich auch irgendwo, nachts aber wimmelte es im Lichtstrahl der Taucherlampe von zigtausenden dieser durchsichtigen, nur wenige Millimeter langen Viecher und man kam sich vor, als schwämme man in einer Würmersuppe. Diese Biester zersetzten jedes organische Material binnen kürzester Zeit und auch vom festesten Holzboot waren nach zwei, drei Jahren nur noch die Nägel übrig.
Ich verstaute dann noch meine Ausrüstung in einer Plastikbox, die er mit meinem Namen beschriftete. Die Angestellten des Shops würden sie morgens aufs Boot bringen und abends wieder zurück. Zum Schluss traten wir vor den Laden und er zeigte mir seine beiden Boote, die etwa fünfzig Meter vor dem Strand vor Anker lagen, mitten in einer ganzen Flotte ähnlicher Fahrzeuge, die sich nur durch ihre Größe und Bemalung unterschieden. Sie hießen „Eazy 1“ und „Eazy 2“.
Während wir noch hinüberschauten, kam hinter all den verankerten Booten ein Stahlkutter hervor, grau gestrichen, mit einer großen weißen Nummer am Bug und fuhr langsam den Strand entlang.
„Coast Guard?“ fragte ich.
Tamme schüttelte den Kopf. „Der ist von der Navy. Die treiben sich in letzter Zeit häufiger hier rum. Angeblich jagen sie Drogenschmuggler, aber ich hab noch nie gehört, dass sie jemanden erwischt haben.“
Die Warnung aus dem Flugzeug fiel mir wieder ein. War das wirklich erst gestern gewesen? „Habt ihr hier Drogenprobleme?“
„Überhaupt nicht!“ Die Antwort kam schnell und entschieden, vielleicht zu schnell.
„Ein paar kleine Dealer vielleicht hier und da“, relativierte er sich schließlich selbst. „Du solltest die Finger davon lassen, wenn dir einer Stoff anbietet, die Bullen sind nicht zimperlich, wenn sie dich damit erwischen, und wenn es auch nur ein Joint ist.“
„Keine Angst, aus dem Alter bin ich raus“, beruhigte ich ihn und verabschiedete mich. Auf dem Rückweg suchte ich mir schon mal ein paar Restaurants aus, die für ein Abendessen in Betracht kamen, schaute in den einen oder anderen Laden und blickte auch mal den hübscheren Mädchen hinterher. Am Strand standen eine Reihe von Liegen und einheimische Frauen boten Massagen an. Auch die würde ich mir in den nächsten Tagen gönnen, aber nicht am Strand zwischen all den Leuten.
Kurz vor dem Dunkelwerden kehrte ich in mein Hotel zurück und bereitete schon mal alles für Morgen vor. Viel war dafür nicht zu tun: Ich stopfte mein Handtuch in eine wasserdichte Umhängetasche, dazu Sonnencreme und – für alle Fälle – Pillen gegen Seekrankheit und baute meine Unterwasserkamera zusammen. Das war eine normale Kompaktkamera in einem durchsichtigen Plastikgehäuse. Statt eines oder zweier Unterwasserblitze, die mir zu groß und teuer waren, hatte ich an einem gebogenen Arm meine Taucherlampe befestigt. Die hatte einen einstellbaren Lampenkopf, vom scharf gebündelten Strahl bis zum breit streuenden Lichtkegel, und lieferte wenigstens für Videoaufnahmen im Nahbereich ein brauchbares Licht. Als ich fertig wurde, war es draußen schon stockdunkel. Unmengen von Grillen und Zikaden zirpten und schnarrten um die Wette, es hörte sich an, als wäre da eine ganze Armee mit Elektrorasierern zugange. Ich liebte diese Melodie, egal ob in Südostasien oder Südamerika, egal ob Urwald oder nur ein verwilderter Garten, das unaufhörliche Geräusch der Insekten machte mir die Exotik meiner Umgebung nur um so bewusster. Und erinnerte mich daran, mich gut mit Mückenschutzmittel einzureiben. Um noch Essen zu gehen fehlte mir mittlerweile die Lust, aber Hunger hatte ich schon. Also ging ich in das kleine offene Restaurant des Resorts, das mit urigen Bambusmöbeln ausgestattet und mit scheinbar selbstgebauten Lampen eher spärlich erleuchtet war. Es saßen nur zwei Leute drinnen, ein Backpackerpärchen, die mich kaum zur Kenntnis nahmen, weil sie sich viel zu sehr mit ihren Smartphones beschäftigten. Das ist auch so was, dass ich nie verstehen werde: Da sitzen sie in einem tropischen Garten unter einem irrsinnigen Sternenhimmel, ringsum pulsiert das Leben, und sie vertiefen sich in Facebook.
Ich aß ein Pork Adobo, das ist so eine Art Nationalgericht: Schweinefleisch und Zwiebeln in einer braunen Sojasoße mit Reis. Neben der mit raffinierten Gewürzen und mit exotischen Zutaten spielenden Thai-Küche war das geradezu primitive Hausmannskost, aber trotzdem lecker. Dazu ein San-Miguel-Bier und zum Abschluss ein Gläschen lokalen Rums. Der war weitaus milder als erwartet und getreu dem Motto „Auf einem Bein kann man nicht stehen“ genehmigte ich mir auch noch einen zweiten. Dann kehrte ich, mit der nötigen Bettschwere versehen, in meine Hütte zurück, kroch unter das Moskitonetz und ließ mich von den Grillen draußen in den Schlaf zirpen.
Tag 3 – Bohol, Philippinen
Die Zeit um den Sonnenaufgang herum ist in den Tropen die schönste Zeit des Tages, wenn man dafür nur nicht so früh aufstehen müsste. Es ist ein Augenblick der Stille und des Friedens, alles hält inne: Der Wind schläft ein, alle Tiere verstummen, die Luft ist erfrischend und rein und doch noch immer so weich wie nirgends sonst auf der Welt.
Durch diese Stimmung schritt ich langsam Richtung Strand, meine Tasche über der Schulter. Die See lag spiegelglatt bis zum Horizont, wo Himmel und Meer in einem blassblauen Dunst miteinander verschmolzen. Ein einsamer alter Mann fegte vor seinem Laden Blätter davon und ein magerer schwarzer Hund beäugte mich misstrauisch. Direkt am Strand gab es ein Café, einen kleinen Laden mit vier Tischen und einer Reihe Plastikgartenstühlen, die im Freien standen und der rund um die Uhr geöffnet hatte. Ich setzte mich und orderte einen großen Milchkaffee, dann drehte ich den Stuhl etwas nach Osten. Dort, hinter den verankerten Booten, die völlig unbeweglich auf dem Wasser lagen, hing der Dunst so dicht in der Luft, dass ich die Horizontlinie nicht erkennen konnte. Wo hörte das Meer auf, wo begann der Himmel?
Ein barfüßiges junges Mädchen, ein Kind noch, brachte den Kaffee und stellte ihn schüchtern lächelnd vor mir ab. Und dann erschien in der gleichförmigen blassblauen Ferne ein rötlicher Schein. Der Dunst begann zu leuchten und ein glänzender hellroter Streifen erschien. Über ihn erstrahlte alles in einem diffusen roten Licht, unter ihm glitzerte es in scharf umgrenzten Reflexen. Da war die Teilung in Meer und Himmel. Der Streifen wurde breiter, zeigte oben schon seine Rundung und in weniger als zwei Minuten stieg die Sonne fast senkrecht hinter dem Horizont empor. Schon konnte man ihre Wärme auf dem Gesicht spüren, der Dunst löste sich auf und aus dem unscharfen roten Schein wurde grelles weißes Licht, vor dem man die Augen abwenden musste. Ein Windhauch strich heran, eine erste Welle plätscherte vernehmlich an den Strand und die Welt setzte sich wieder in Bewegung, der Zauber verflog. Der magere schwarze Hund nieste geräuschvoll, schaute mich vorwurfsvoll an und verschwand. Was mochte ein philippinischer Straßenhund wie er wohl den ganzen Tag über anstellen? Eine Weile grübelte ich über diese Frage nach, dann darüber, wie viele Millionen dieser stapelbaren Plastikgartenstühle es wohl auf der Welt geben mochte. Sicher waren sie das meistproduzierte Möbelstück auf dem ganzen Globus. Und dann wurde es auch schon langsam Zeit, mit meinem Tageswerk zu beginnen. Ich zahlte und ging die paar Meter zum Tauchshop.
Die „Eazy 1“ war schon an den Strand herangezogen und lag vielleicht sechs, sieben Meter vom Ufer entfernt. Ein junger Bursche watete gerade durch das flache Wasser zu ihr hinaus, auf jeder Schulter eine silberne Druckluftflasche balancierend. Die Ladentür stand offen und als ich eintrat, kam mir ein untersetzter, kräftiger Einheimischer mit einem breiten, offenen Gesicht entgegen. Er war nicht mehr der Jüngste, vielleicht Ende Dreißig, hatte eine Stoppelfrisur und als er mich sah, setzte er ein breites Grinsen auf, bei dem er ein prächtiges, aber auch ziemlich gelbes Gebiss entblößte.
„Guten Morgen, ich bin Roberto“, begrüßte er mich und presste meine Hand wie ein Schraubstock zusammen. „Du musst Max sein.“
Er sprach meinen Namen sehr amerikanisch aus: Mecks, aber das war ich schon gewohnt. Ich erwiderte den Händedruck so gut ich konnte.
„Deine Kiste ist schon an Bord“, fuhr er fort. „Hast du alles, was du brauchst? Auch einen Computer?“
„Alles außer Blei und Tank“, beruhigte ich ihn.
„Gut, dann mach‘s dir gemütlich. Dauert noch ein paar Minuten. Da hinten steht Kaffee, wenn du magst.“
Neben dem Tischchen mit der Kaffeekanne saßen schon zwei Leute, die ganz offensichtlich ebenfalls mit von der Partie waren. Ein Pärchen, noch ziemlich jung, Mitte Zwanzig, schätzte ich. Sie trug ein kurzes, ärmelloses Kleid mit Blumenmuster, er ein Arsenal-T-Shirt und Bermudas. Ich schlenderte hin und begrüßte die Beiden. Sie kamen aus England, Sheila und Louis. Sheila erfüllte, rein optisch, auch alle Klischeevorstellungen: Helle Haut, Sommersprossen, rotblonde glatte Haare, die ihr bis weit in den Rücken fielen. Sie war recht stämmig, ohne jedoch dick zu sein, aber ihr rundes Kinn deutete darauf hin, dass dies nur noch eine Frage der Zeit war. Louis hingegen hätte ich eher für einen Spanier oder Italiener gehalten. Er war hochaufgeschossen aber mager, hatte ein hageres Gesicht mit weit vorspringendem Adamsapfel, schwarze lockige Haare und stark behaarte Arme und Beine. Wir machten ein wenig Smaltalk, woher, wohin, und ich fand die beiden eigentlich ganz nett.
Dann kam Tamme in Begleitung zweier älterer Männer herein und alle drei unterhielten sich auf Holländisch. Die beiden Neuankömmlinge mochten schon über Sechzig sein, einer war ein kleiner Dicker mit rundem, lachendem Gesicht, der Typ Mensch, der einem sofort sympathisch ist, den man aber eigentlich nicht ganz ernst nimmt. Der andere war größer, mit einem gepflegten grauen Bärtchen und er wäre trotz Shorts und T-Shirt von einer gewissen Eleganz gewesen, liefe er nicht mit stark gebeugten Rücken und hängenden Schultern herum. Aber ich sollte nicht so kritisch sein, stach ich doch keineswegs als Adonis unter diesen Menschen heraus. Ich war zu der Zeit bereits jenseits der vierzig und wenn ich es auch mit viel Mühe schaffte, mein Normalgewicht zu halten, war die Zeit des Waschbrettbauches doch schon lange vorbei. Auch meine Haare ließen mich mehr und mehr in Stich, so dass ich die verbleibenden immer kürzer schnitt, wodurch mein Gesicht recht hager wirkte. Eigentlich fand ich nur mein Kinn wirklich markant und männlich, aber das war meine eigene Meinung. Jedenfalls würde ich in Hollywood wohl nicht zu den Favoriten für die Heldenrolle zählen.
„Das sind Arne und Hans, zwei Landsleute von mir“, stellte Tamme vor. „Ihr seid heute also fünf Leute auf dem Boot und habt zwei Guides. Ich schlage vor, Arne, Hans und Max tauchen mit Roberto und Sheila und Louis mit Gino.“
Ich drückte meinen beiden Tauchpartnern die Hand und dann winkte uns Roberto auch schon raus und die ganze Gruppe folgte ihm brav zum Strand. Die „Eazy 1“ lag jetzt etwa zehn Meter vom Ufer ab, wir zogen unsere Flip-Flops aus und wateten durch das warme Wasser zu ihr hin.
Das Boot war eine typische philippinische Banka, ein Holzschiff mit schlankem Rumpf und zwei Auslegern aus Baumstämmen, die so lang waren wie die Wasserlinie und mit drei Querträgern am Rumpf befestigt. Alles war sorgfältig mit Nylonseilen verschnürt und an drei niedrigen Masten abgespannt, dadurch besaß die ganze Konstruktion eine gewisse Elastizität, die sie auch brauchte, wenn sie von den Wellen nicht zerschlagen werden wollte. Durch die Ausleger konnte man das eigentliche Deck wesentlich breiter als den Rumpf bauen, der gesamte Vorderteil des Bootes war mit blaugestrichenen Holzplanken gedeckt und an beiden Seiten zogen sich der Länge nach weiße Sitzbänke hin. Im Rücken dieser Bänke verlief je ein etwas höher angebrachtes, waagerechtes Brett, in das Löcher für die Presslufttanks gesägt waren. Die Tanks staken da drin wie Bierflaschen in ihrem Kasten. Der ganze Bereich wurde von einer Plastikplane als Sonnenschutz abgedeckt. Hier würden wir Passagiere uns aufhalten. Dahinter befand sich der Steuerstand, ein hölzernes Häuschen mit einem LKW-Lenkrad und diversen Schaltern und Hebeln, die alle sehr selbstgebaut wirkten. Das einzige wirklich professionell aussehende Gerät war ein GPS-Empfänger mit einem handgroßen Farbmonitor. Der Skipper, ein älterer, dünner Mann mit recht schadhaftem Gebiss in ölverschmierten Klamotten, saß auf einer Art Barhocker hinter seinem Steuer. Dahinter schloss sich eine kleine Küche an und am Heck ragte ein hölzernes Toilettenhäuschen auf.
Außer dem Skipper gab es noch einen vielleicht fünfzehnjährigen Jungen, der als Matrose, Smutje und Maschinist gleichermaßen agierte und den ganzen Tag über kaum ein Wort sprach. Und dann natürlich Gino, den zweiten Guide, einen jungen Filipino, der sich auf eine drollige Art sehr cool und lässig gab. Er trug seine langen Haare wie Tamme zu einem Pferdeschwanz gebunden und stolzierte mit nacktem Oberkörper herum, den zahlreiche Tattoos zierten. Allerdings waren sie alle nicht von Meisterhand gestochen und auch nicht zusammengehörend. Da gab es Irgendwelche chinesischen Schriftzeichen, abstrakte Muster und dann einen Kraken mit riesigen Augen, der aussah, wie aus einem Walt-Disney-Film.
Wir kletterten über eine abklappbare Holzleiter an einem der Auslegerarme an Bord, schmissen die Sandalen in eine Kiste – auf diesen Booten geht man barfuß – und schauten in unseren Boxen nach, ob alles da war. Roberto kam als letzter an Bord. Er trug ein kleines rotes Notfallköfferchen bei sich und ein Klemmbrett mit Namensliste, auf der er uns alle abhakte. Bei fünf Leuten ein recht beherrschbarer Job. Immerhin erkannte ich an der Art, wie er alles kontrollierte und prüfte, dass er wohl wusste was er tat und seine Aufgaben im Griff hatte. Auf seinem Wink hin startete der Skipper den Motor, der wohl in einem früheren Leben einen LKW bewegt hatte; Gino und der Junge holten den Anker ein, zogen die Leiter hoch und lotsten die Banka dann zwischen den anderen Booten hindurch in freies Wasser. Währenddessen gab Roberto einige Verhaltenstipps und dann bauten wir unsere Ausrüstung zusammen. Kernstück war die Tarierweste, auch Jackett oder im Englischen kurz BCD genannt. Im Prinzip ist das ein Rucksacktragegestell, an dem mit einem Spanngurt der Presslufttank befestigt wird.