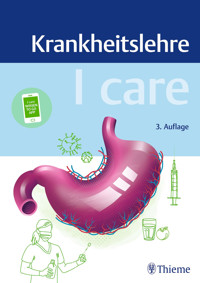
I care Krankheitslehre E-Book
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
I care – Einfach leichter lernen
Mit der Nummer 1 für die Pflegeausbildung
Du willst in deiner Pflegeausbildung durchstarten und sicher durch die Prüfungen kommen? Mit I care hast du alles, was du brauchst – detailliert in deinem Lehrbuch und kompakt in der kostenlosen Lern-App.
Warum I care Krankheitslehre?
- Alles drin: Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie von Krankheiten speziell für dich als Pflegefachkraft aufbereitet.
- Lernen leicht gemacht: Mindmaps, Infografiken und WISSEN TO GO-Boxen zum Schnelllernen geben dir den perfekten Überblick zu den wichtigen Krankheitsbildern.
- Sicherheit im Alltag: Fallbeispiele mit typischen Krankheits- und Therapieverläufen bereiten dich optimal vor.
- Immer dabei: Dein Buch gibt’s auch digital. Einfach Code eingeben auf icare.thieme.de.
- Kostenlose Lern-App: Digitale Lernkarten mit deinem persönlichen Lernerfolg sowie Videos zu Pflegehandlungen hast du in der I care WISSEN TO GO App.
Auf deine Ausbildung zugeschnitten!
- alles nach Plan – erfüllt die Inhalte nach PflAPrV und gemäß PflBG
- aus deiner Sicht geschrieben – verständlich und praxisnah formuliert
- schnell und effektiv lernen – mit Zusammenfassungen für einfaches Wiederholen und Anwenden
Neu im angesagten Farbschnitt – so hast du Lehrbücher noch nie gesehen.
Die Themen in I care Krankheitslehre:
- Grundlagen zur Gesundheits- und Krankheitslehre
- organübergreifende Erkrankungen
- alle wesentlichen Krankheitsbilder eines Organsystems
- Leitsymptome und Medikamentenlehre pro Organsystem
- plus Fachwortlexikon, Laborwerte, Kurzporträts der verschiedenen klinischen Fachabteilungen
Neu in der 3. Auflage:
- vollständige Überarbeitung nach aktuellen Leitlinien
- praxisnäher mit Fokus auf den Berufsalltag und pädiatrischen Erkrankungen
- neue Themen: genetische und chromosomale Störungen, Strom- und Strahlenschäden, Narkose sowie Intoxikationen
Tipp:
Die optimale Ergänzung zu I care Pflege und I care Anatomie, Physiologie! Die Bücher sind perfekt aufeinander abgestimmt, aber auch einzeln nutzbar. Mit dem LernPaket sparst du 20 Euro und erhältst zusätzlich ein gratis Herz-Pop-up zum Basteln und Lernen der Herzanatomie.
Orientieren, verstehen, merken – I care ist dein Erfolgsrezept in der Pflegeausbildung und Prüfungsvorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3419
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
I care Krankheitslehre
3., überarbeitete Auflage
1422 Abbildungen
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort
Teil I Grundlagen und übergreifende Prinzipien
1 Gesundheitslehre versus Krankheitslehre
1.1 Gesundheit und Krankheit
1.2 Gesundheitswissenschaft (Public Health)
1.2.1 Themengebiete
1.2.2 Prävention
1.2.3 Gesundheitsförderung
1.2.4 Rehabilitation
1.2.5 Aufgaben der Pflege
1.3 Und dennoch ein Buch über Krankheitslehre?
2 Allgemeine Krankheitslehre
2.1 Grundlagen
2.1.1 Definition und Bedeutung
2.1.2 Einteilung und Klassifikation von Krankheiten
2.1.3 Systematische Beschreibung von Krankheiten
2.2 Ursachen von Zell- und Gewebeveränderungen
2.2.1 Allgemeines
2.2.2 Anpassungsreaktionen von Geweben
2.2.3 Gewebeschädigung durch innere Prozesse
2.2.4 Dekubitus
2.2.5 Schädigungen durch Kälte
2.2.6 Verbrennungen und Verbrühungen
2.2.7 Verätzungen
2.2.8 Hitzenotfälle
2.2.9 Stromunfälle
2.2.10 Schäden durch ionisierende Strahlung
2.3 Chromosomen und chromosomale Störungen
2.3.1 Grundlagen
2.3.2 Chromosomale Störungen
2.3.3 Autosomale Trisomien
2.3.4 Gonosomale Störungen
2.4 Genetik und genetisch bedingte Erkrankungen
2.4.1 Grundlagen
2.4.2 Erbgänge
2.4.3 Autosomal-dominante Erkrankungen
2.4.4 Autosomal-rezessive Erkrankungen
2.4.5 X-chromosomale Erkrankungen
2.5 Medizinische Diagnostik
2.5.1 Grundlagen
2.5.2 Klinische Untersuchung
2.5.3 Labordiagnostik
2.5.4 Elektrokardiogramm (EKG)
2.5.5 Sonografie
2.5.6 Röntgenuntersuchungen
2.5.7 Magnetresonanztomografie
2.5.8 Nuklearmedizinische Bildgebung
2.5.9 Endoskopie und Endosonografie
2.5.10 Laparoskopie
2.5.11 Biopsie
2.6 Medizinische Therapie
3 Grundlagen
3.1 Einführung
3.2 Grundbegriffe
3.2.1 Arzneimittel
3.2.2 Phytotherapie
3.2.3 Homöopathie
3.3 Pharmakodynamik
3.3.1 Wirkung über Rezeptoren
3.3.2 Andere Wirkmechanismen
3.4 Pharmakokinetik
3.4.1 LADME-Modell
3.4.2 Besonderheiten bei bestimmten Patientengruppen
3.5 Umgang mit Arzneimitteln
3.5.1 Rechtliche Grundlagen
3.5.2 Verkäuflichkeit
3.5.3 Aufbewahrung und Lagerung
3.5.4 Applikation von Arzneimitteln
4 Grundlagen zu Tumorerkrankungen
4.1 Grundbegriffe
4.1.1 Einteilung von Tumoren
4.1.2 Nomenklatur von Tumoren
4.2 Tumorentstehung
4.2.1 Disposition und auslösende Faktoren
4.2.2 Tumorentwicklung
4.2.3 Metastasierung
4.2.4 Staging
4.2.5 Grading
4.3 Symptome und Diagnostik
4.3.1 Symptome
4.3.2 Diagnostik
4.4 Therapie bösartiger Tumoren
4.4.1 Grundlagen
4.4.2 Operative Therapie
4.4.3 Zytostatische Chemotherapie
4.4.4 Strahlentherapie
4.4.5 Radionuklidtherapie
4.4.6 Hormontherapie
4.4.7 Zielgerichtete Tumortherapie
4.4.8 Begleitende Therapie in der Onkologie
4.4.9 Palliativmedizin
4.5 Verlaufskontrolle und Nachsorge
5 Grundlagen des Immunsystems
5.1 Auffrischer Immunsystem
5.1.1 Überblick
5.1.2 Leukozyten
5.1.3 Humorale Anteile
5.1.4 Lymphatische Organe
5.1.5 Entzündung
5.2 Störungen des Immunsystems
5.2.1 Immundefektsyndrome
5.2.2 Allergien
5.2.3 Autoimmunerkrankungen
5.3 Therapeutische Optionen
5.3.1 Grundlagen
5.3.2 Glukokortikoide
5.3.3 COX-Hemmer
5.3.4 Substanzen zur Behandlung allergischer Reaktionen
5.3.5 Zytostatika
5.3.6 Monoklonale Antikörper
5.3.7 Weitere Substanzen
5.3.8 Plasmapherese
5.3.9 Phytotherapie
6 Grundlagen der Infektiologie
6.1 Infektionserreger
6.1.1 Grundlagen
6.1.2 Bakterien
6.1.3 Viren
6.1.4 Pilze
6.1.5 Parasiten
6.1.6 Prionen
6.2 Infektionskrankheiten
6.2.1 Grundbegriffe
6.2.2 Infektionskette
6.2.3 Infektionsdiagnostik
6.2.4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und Meldepflichten
6.3 Infektionsprophylaxe
6.3.1 Überblick
6.3.2 Persönliche Hygiene
6.3.3 Isolierungsmaßnahmen
6.3.4 Vorgehen bei Kontamination
6.3.5 Immunisierung
6.4 Antiinfektiöse Medikamente
6.4.1 Antibiotika – Überblick
6.4.2 Antibiotikaklassen
6.4.3 Virostatika
6.4.4 Antimykotika
6.4.5 Antiparasitäre Medikamente
7 Schmerzen und Schmerztherapie
7.1 Grundlagen
7.1.1 Schmerzwahrnehmung
7.1.2 Schmerzarten
7.2 Schmerzdiagnostik
7.3 Schmerztherapie
7.3.1 Überblick
7.3.2 Nicht medikamentöse Schmerztherapie
7.3.3 Medikamentöse Schmerztherapie
7.3.4 Phytotherapeutika
7.3.5 Lokal- und Regionalanästhesie
7.3.6 Allgemeinanästhesie
8 Notfallsituationen
8.1 Einführung
8.2 Prinzipien der Ersten Hilfe
8.3 Häufige Notfälle und deren Versorgung
8.4 Wunden und Blutungen
8.4.1 Wundarten
8.4.2 Wundversorgung
8.5 Bewusstseinsstörungen
8.6 Intoxikationen
8.6.1 Grundlagen
8.6.2 Aufnahme des Giftes
8.6.3 Erstmaßnahmen
8.6.4 Weitere Versorgung und Entgiftung
8.7 Schock
8.7.1 Pathophysiologie
8.7.2 Symptome und Diagnostik
8.7.3 Therapie
8.8 Herz-Kreislauf-Stillstand und kardiopulmonale Reanimation (CPR)
8.8.1 Herz-Kreislauf-Stillstand
8.8.2 Kardiopulmonale Reanimation
8.9 Atemwegsmanagement
8.9.1 Freimachen und Freihalten der Atemwege
8.9.2 Sichern der Atemwege
8.9.3 Beatmung
Teil II Spezielle Krankheitslehre
9 Herz
9.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
9.1.1 Anatomie des Herzens
9.1.2 Blutversorgung des Herzens
9.1.3 Physiologie des Herzens
9.2 Wichtige Leitsymptome
9.2.1 Akute Thoraxschmerzen
9.2.2 Palpitationen
9.2.3 Synkope
9.2.4 Ödeme
9.2.5 Obere Einflussstauung
9.2.6 Weitere Leitsymptome
9.3 Diagnostik
9.3.1 Anamnese und klinische Untersuchung
9.3.2 Apparative Untersuchungen
9.4 Erkrankungen
9.4.1 Koronare Herzkrankheit (KHK)
9.4.2 Akutes Koronarsyndrom (ACS)
9.4.3 Herzinsuffizienz
9.4.4 Herzrhythmusstörungen
9.4.5 Erkrankungen des Endokards
9.4.6 Erkrankungen des Myokards
9.4.7 Perikarditis
9.4.8 Angeborene Herzfehler
9.4.9 Erworbene Herzklappenfehler
9.4.10 Myokardkontusion
9.5 Wichtige Medikamente
9.5.1 RAAS-Inhibitoren
9.5.2 Kalziumkanalblocker
9.5.3 β-Blocker
9.5.4 Sympathomimetika
9.5.5 Herzglykoside
9.5.6 PDE-III-Hemmer
9.5.7 Antiarrhythmika
9.5.8 Antianginosa
9.5.9 Weitere Substanzgruppen
9.5.10 Phytotherapeutika
10 Kreislauf- und Gefäßsystem
10.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
10.1.1 Kreislauf und Gefäße
10.1.2 Blutdruck
10.1.3 Lymphgefäßsystem
10.2 Wichtige Leitsymptome
10.2.1 Schmerzen und Missempfindungen in den Beinen
10.2.2 Ulcus cruris
10.2.3 Weitere Leitsymptome
10.3 Diagnostik
10.3.1 Anamnese und klinische Untersuchung
10.3.2 Apparative Untersuchungen
10.4 Veränderungen des Blutdrucks
10.4.1 Arterielle Hypertonie
10.4.2 Hypertensive Entgleisung
10.4.3 Arterielle Hypotonie
10.5 Erkrankungen der Arterien
10.5.1 Atherosklerose
10.5.2 Subclavian-Steal-Syndrom
10.5.3 Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
10.5.4 Akuter peripherer arterieller Verschluss
10.5.5 Karotisstenose
10.5.6 Karotis- und Vertebralisdissektion
10.5.7 Aortenaneurysma
10.5.8 Akutes Aortensydnrom
10.5.9 Raynaud-Syndrom
10.5.10 Thrombangiitis obliterans
10.6 Erkrankungen der Venen
10.6.1 Tiefe Venenthrombose (TVT)
10.6.2 Varikosis und chronisch-venöse Insuffizienz (CVI)
10.6.3 Thrombophlebitis
10.7 Erkrankungen der Lymphgefäße
10.7.1 Lymphödem
10.7.2 Lymphangitis
10.7.3 Erysipel
10.8 Gefäßtumoren
10.8.1 Gutartige Gefäßtumoren
10.8.2 Kaposi-Sarkom
10.9 Vaskulitiden
10.9.1 Allgemeines
10.9.2 Riesenzellarteriitis (RZA) und Polymyalgia rheumatica (PMR)
10.9.3 Takayasu-Arteriitis
10.9.4 Kawasaki-Syndrom
10.9.5 Polyarteriitis nodosa
10.9.6 Granulomatose mit Polyangiitis
10.9.7 IgA-Vaskulitis
10.9.8 Morbus Behçet
10.10 Wichtige Medikamente
10.10.1 Antihypertensiva
10.10.2 Rheologika
10.10.3 Substanzen zur Beeinflussung des Gerinnungssystems
10.10.4 Phytotherapeutika
11 Atmungssystem
11.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
11.1.1 Überblick
11.1.2 Anatomische Strukturen
11.1.3 Physiologie der Atmung
11.1.4 Atmung im Lebensverlauf
11.2 Wichtige Leitsymptome
11.2.1 Dyspnoe
11.2.2 Nasenbluten
11.2.3 Husten und Auswurf
11.2.4 Akute Thoraxschmerzen
11.2.5 Zyanose
11.2.6 Mundgeruch
11.3 Diagnostik
11.3.1 Anamnese
11.3.2 Klinische Untersuchung
11.3.3 Apparative Untersuchungen
11.4 Grundlagen der Pathophysiologie
11.4.1 Ventilation, Diffusion und Perfusion
11.4.2 Respiratorische Partial- und Globalinsuffizienz
11.5 Erkrankungen der oberen Atemwege
11.5.1 Choanalatresie
11.5.2 Septumdeviation
11.5.3 Sinusitis
11.5.4 Adenoide Vegetationen
11.5.5 Tonsillitis und Pharyngitis
11.5.6 Diphtherie
11.5.7 Laryngitis
11.5.8 Influenza
11.5.9 Rekurrensparese
11.5.10 Tumoren der oberen Atemwege
11.5.11 Strangulationsverletzungen
11.6 Erkrankungen der unteren Atemwege
11.6.1 Akute Tracheobronchitis
11.6.2 COVID-19
11.6.3 Bronchiolitis
11.6.4 Pertussis
11.6.5 Asthma bronchiale
11.6.6 Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
11.6.7 Bronchiektasen
11.6.8 Atelektasen
11.6.9 Mukoviszidose
11.6.10 Aspiration
11.6.11 Ertrinkungsunfälle
11.6.12 Bronchialkarzinom
11.6.13 Lungenmetastasen
11.6.14 Atemwegsverletzungen
11.7 Erkrankungen des Lungenparenchyms
11.7.1 Infektionen
11.7.2 Interstitielle Lungenerkrankungen und Lungenfibrose
11.7.3 Akutes Lungenversagen
11.7.4 Lungenkontusion
11.8 Erkrankungen des Lungenkreislaufs
11.8.1 Lungenembolie
11.8.2 Pulmonale Hypertonie
11.8.3 Lungenödem
11.9 Störungen der Atmungsregulation
11.9.1 Hyperventilation
11.9.2 Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS)
11.10 Erkrankungen der Pleura
11.10.1 Pneumothorax
11.10.2 Pleuraerguss
11.10.3 Pleuritis
11.10.4 Pleuramesotheliom
11.11 Inhalative Intoxikationen
11.11.1 Kohlenmonoxidvergiftung
11.11.2 Kohlendioxidvergiftung
11.11.3 Reiz- und Rauchgase
11.12 Wichtige Medikamente
11.12.1 Medikamente bei obstruktiven Lungenerkrankungen
11.12.2 Medikamente zur Behandlung allergischer Reaktionen
11.12.3 Medikamente bei Husten
11.12.4 Substanzen bei pulmonal-arterieller Hypertonie
11.12.5 Phytotherapeutika
12 Verdauungssystem
12.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
12.1.1 Überblick
12.1.2 Verdauungskanal
12.1.3 Pankreas
12.1.4 Leber und Gallenwege
12.1.5 Verdauung und Ernährung
12.1.6 Bauchwand und Leistenkanal
12.2 Leitsymptome
12.2.1 Mundgeruch
12.2.2 Dysphagie
12.2.3 Übelkeit und Erbrechen
12.2.4 Akutes Abdomen
12.2.5 Diarrhö
12.2.6 Obstipation
12.2.7 Ileus
12.2.8 Aszites
12.2.9 Ikterus und Cholestase
12.3 Diagnostik
12.3.1 Anamnese
12.3.2 Klinische Untersuchung
12.3.3 Bildgebende Verfahren
12.3.4 Endoskopie und Endosonografie
12.3.5 Weitere apparative Untersuchungen
12.3.6 Invasive Maßnahmen
12.4 Erkrankungen der Mundhöhle
12.4.1 Zähne und Zahnfleisch
12.4.2 Mundsoor
12.4.3 Mundhöhlenkarzinom
12.4.4 Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
12.5 Erkrankungen der Speicheldrüsen
12.5.1 Akute bakterielle Sialadenitis
12.5.2 Tumoren der Speicheldrüsen
12.6 Erkrankungen des Ösophagus
12.6.1 Ösophagusatresie
12.6.2 Motilitätsstörungen des Ösophagus
12.6.3 Ösophagusdivertikel
12.6.4 Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD)
12.6.5 Ösophaguskarzinom
12.6.6 Ösophagusperforation
12.6.7 Weitere Erkrankungen des Ösophagus
12.7 Erkrankungen des Magens
12.7.1 Hypertrophe Pylorusstenose
12.7.2 Gastritis
12.7.3 Gastroduodenale Ulkuskrankheit
12.7.4 Magenkarzinom
12.7.5 MALT-Lymphome
12.7.6 Folgezustände und Komplikationen nach Magenoperationen
12.8 Erkrankungen des Darms
12.8.1 Darmerkrankungen in der frühen Kindheit
12.8.2 Malassimilation
12.8.3 Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien
12.8.4 Infektiöse Durchfallerkrankungen
12.8.5 Pseudomembranöse Kolitis
12.8.6 Lebensmittelvergiftungen
12.8.7 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
12.8.8 Appendizitis
12.8.9 Durchblutungsstörungen des Darms
12.8.10 Reizdarmsyndrom
12.8.11 Divertikelkrankheit
12.8.12 Kolorektale Polypen
12.8.13 Kolorektales Karzinom
12.9 Erkrankungen der Analregion
12.9.1 Analatresie
12.9.2 Hämorrhoidalleiden
12.9.3 Weitere Erkrankungen der Analregion
12.10 Gastrointestinale Blutungen
12.10.1 Häufigkeit und Ursachen
12.10.2 Leitsymptome
12.10.3 Diagnostik und Therapie
12.11 Erkrankungen der Leber
12.11.1 Hepatitis
12.11.2 Fettleber
12.11.3 Leberzirrhose und Leberinsuffizienz
12.11.4 Komplikationen der Leberzirrhose
12.11.5 Akutes Leberversagen (ALV)
12.11.6 Gutartige Lebertumoren
12.11.7 Bösartige Lebertumoren
12.12 Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege
12.12.1 Gallengangsatresie
12.12.2 Gallensteinleiden
12.12.3 Weitere Cholangitiden
12.12.4 Karzinome der Gallenwege
12.13 Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse
12.13.1 Akute Pankreatitis
12.13.2 Chronische Pankreatitis und Pankreasinsuffizienz
12.13.3 Tumoren des Pankreas
12.14 Erkrankungen der Bauchdecke, des Bauchfells und des Zwerchfells
12.14.1 Fehlbildungen der Bauchdecke und des Zwerchfells
12.14.2 Bauchwandhernien
12.14.3 Rektusdiastase
12.14.4 Peritonitis
12.14.5 Hiatushernien
12.15 Wichtige Medikamente
12.15.1 Protonenpumpeninhibitoren (PPI)
12.15.2 Analgetika
12.15.3 Spasmolytika
12.15.4 Antiemetika
12.15.5 Laxanzien
12.15.6 Antidiarrhoika
12.15.7 Gallensäuren
12.15.8 Bauchspeicheldrüsenenzyme
12.15.9 Immunsuppressiva
12.15.10 Phytotherapeutika
13 Niere und ableitende Harnwege, Wasser- und Elektrolythaushalt
13.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
13.1.1 Überblick
13.1.2 Niere
13.1.3 Ableitende Harnwege
13.1.4 Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt
13.2 Wichtige Leitsymptome
13.2.1 Blasenentleerungsstörungen
13.2.2 Hämaturie
13.2.3 Störungen der Harnmenge
13.2.4 Proteinurie
13.2.5 Flankenschmerzen
13.2.6 Weitere Leitsymptome
13.3 Diagnostik
13.3.1 Anamnese
13.3.2 Klinische Untersuchung
13.3.3 Laborunteruntersuchungen
13.3.4 Bildgebende Verfahren
13.3.5 Weitere diagnostische Methoden
13.4 Erkrankungen der Nieren
13.4.1 Fehlbildungen
13.4.2 Schädigungen der Glomeruli
13.4.3 Tubulointerstitielle Nephritis
13.4.4 Niereninsuffizienz
13.4.5 Hypertensive Nephropathie
13.4.6 Nierenarterienstenose
13.4.7 Nierentumoren
13.4.8 Nierentrauma
13.5 Erkrankungen der ableitenden Harnwege
13.5.1 Fehlbildungen
13.5.2 Harnwegsinfektionen
13.5.3 Urolithiasis
13.5.4 Verletzungen der ableitenden Harnwege
13.5.5 Harnröhrenstriktur
13.5.6 Harninkontinenz
13.5.7 Karzinome der ableitenden Harnwege
13.6 Störungen des Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalts
13.6.1 Störungen des Wasser- und Natriumhaushalts
13.6.2 Störungen des Kaliumhaushalts
13.6.3 Störungen des Kalziumhaushalts
13.6.4 Störungen des Magnesiumhaushalts
13.6.5 Störungen des Säure-Basen-Haushalts
13.7 Wichtige Medikamente
13.7.1 Diuretika
13.7.2 Kristalloide Infusionslösungen
13.7.3 Natriumbikarbonat
13.7.4 Kationenaustauscher
13.7.5 Substanzen zur Behandlung von Miktionsstörungen
13.7.6 Phytotherapeutika
14 Hormonsystem und Stoffwechsel
14.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
14.1.1 Hormonsystem
14.1.2 Störungen des Regelsystems
14.2 Wichtige Leitsymptome
14.2.1 Gynäkomastie
14.2.2 Wachstumsstörungen
14.2.3 Polyurie und Polydipsie
14.2.4 Blutungsstörungen, Hirsutismus
14.3 Diagnostik
14.3.1 Anamnese
14.3.2 Klinische Untersuchung
14.3.3 Apparative Untersuchungen
14.4 Hypothalamus und Hypophyse
14.4.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
14.4.2 Diabetes insipidus
14.4.3 Schwartz-Bartter-Syndrom
14.4.4 Hypophysenvorderlappeninsuffizienz
14.4.5 Tumoren im Bereich der Hypophyse
14.5 Schilddrüse
14.5.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
14.5.2 Leitsymptome
14.5.3 Entzündungen der Schilddrüse
14.5.4 Tumoren der Schilddrüse
14.6 Nebenschilddrüsen
14.6.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
14.6.2 Hypoparathyreoidismus
14.6.3 Hyperparathyreoidismus
14.7 Nebennieren
14.7.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
14.7.2 Cushing-Syndrom
14.7.3 Primärer Hyperaldosteronismus
14.7.4 Nebennierenrindeninsuffizienz
14.7.5 Adrenogenitales Syndrom
14.7.6 Phäochromozytom
14.8 Sexualhormone und Pubertät
14.9 Weitere endokrine Tumoren
14.9.1 Neuroendokrine Neoplasien
14.9.2 MEN-Syndrome
14.10 Stoffwechselstörungen und ernährungsbedingte Erkrankungen
14.10.1 Angeborene Stoffwechselerkrankungen
14.10.2 Diabetes mellitus
14.10.3 Notfälle des Glukosestoffwechsels
14.10.4 Übergewicht, Adipositas und metabolisches Syndrom
14.10.5 Lipidstoffwechsel
14.10.6 Hyperurikämie und Gicht
14.10.7 Eisenspeicherkrankheit
14.10.8 Kupferspeicherkrankheit
14.10.9 α1-Antitrypsin-Mangel
14.10.10 Systemische Amyloidosen
14.10.11 Porphyrien
14.10.12 Vitaminhaushalt
14.10.13 Spurenelemente
14.11 Wichtige Medikamente
14.11.1 Hypothalamus und Hypophyse
14.11.2 Nebennieren
14.11.3 Schilddrüse
14.11.4 Medikamente bei Diabetes mellitus
14.11.5 Lipidsenker
14.11.6 Medikamente bei Hyperurikämie
14.11.7 Medikamente zur Gewichtsreduktion
15 Blut und Immunsystem
15.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
15.1.1 Blut
15.1.2 Blutgerinnung
15.1.3 Immunsystem
15.2 Wichtige Leitsymptome
15.2.1 Blässe
15.2.2 Purpura
15.2.3 Lymphknotenschwellung
15.2.4 Splenomegalie und Hypersplenismus
15.2.5 Erhöhte Infektanfälligkeit
15.2.6 B-Symptomatik
15.3 Diagnostik
15.3.1 Anamnese
15.3.2 Klinische Untersuchung
15.3.3 Blutuntersuchungen
15.3.4 Biopsien
15.3.5 Weitere Untersuchungen
15.4 Erkrankungen der Erythrozyten
15.4.1 Überblick: Anämien
15.4.2 Blutungsanämie
15.4.3 Eisenmangelanämie
15.4.4 Megaloblastäre Anämien
15.4.5 Hämolytische Anämien
15.4.6 Weitere Anämieformen
15.4.7 Polyglobulie
15.5 Hämatologische Neoplasien
15.5.1 Akute Leukämien
15.5.2 Maligne Lymphome
15.5.3 Myeloproliferative Neoplasien (MPN)
15.5.4 Myelodysplastisches Syndrom (MDS)
15.6 Gerinnungsstörungen
15.6.1 Hämorrhagische Diathesen
15.6.2 Erhöhte Thromboseneigung
15.7 Erkrankungen des Immunsystems
15.7.1 Immundefekte: Allgemeines
15.7.2 Leukopenien und Agranulozytose
15.7.3 HIV-Infektion und AIDS
15.7.4 Allergien
15.7.5 Autoimmunerkrankungen
15.8 Milz
15.8.1 Überblick
15.8.2 Milzruptur
15.8.3 Splenektomie
15.9 Wichtige Therapieverfahren
15.9.1 Medikamente mit Wirkung auf Erythrozyten
15.9.2 Medikamente mit Wirkung auf das Gerinnungssystem
15.9.3 Hämatopoetische Wachstumsfaktoren
15.9.4 Medikamente zur Beeinflussung des Immunsystems
15.9.5 Transfusion von Blutprodukten
15.9.6 Transplantationen (TX)
16 Bewegungssystem
16.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
16.1.1 Bewegungsapparat
16.1.2 Kopf
16.1.3 Wirbelsäule
16.1.4 Thorax
16.1.5 Obere Extremität
16.1.6 Becken
16.1.7 Untere Extremität
16.2 Wichtige Leitsymptome
16.2.1 Schmerzen
16.2.2 Schwellungen
16.2.3 Deformitäten
16.2.4 Bewegungseinschränkungen
16.2.5 Gangstörungen
16.2.6 Blutungen
16.3 Diagnostik
16.3.1 Klinische Untersuchung
16.3.2 Begutachtung
16.3.3 Apparative Diagnostik
16.4 Therapie am Bewegungssystem
16.4.1 Konservative Therapie
16.4.2 Operative Therapie
16.4.3 Rehabilitation
16.5 Traumatologie
16.5.1 Distorsionen und Luxationen
16.5.2 Frakturen allgemein
16.5.3 Amputationen
16.5.4 Verletzungen der oberen Extremität
16.5.5 Verletzungen der unteren Extremität
16.5.6 Kopfverletzungen
16.5.7 Verletzungen von Hals und Wirbelsäule
16.5.8 Thoraxtrauma
16.5.9 Bauchtrauma
16.5.10 Polytrauma
16.6 Orthopädische Erkrankungen
16.6.1 Gelenkerkrankungen
16.6.2 Störungen des Knochenstoffwechsels
16.6.3 Osteitis und Osteomyelitis
16.6.4 Knochentumoren
16.6.5 Orthopädische Erkrankungen von Thorax und Wirbelsäule
16.6.6 Orthopädische Erkrankungen der oberen Extremität
16.6.7 Orthopädische Erkrankungen an Hüfte und Oberschenkel
16.6.8 Orthopädische Erkrankungen am Knie
16.6.9 Orthopädische Erkrankungen am Fuß
16.7 Entzündlich-rheumatische Erkrankungen
16.7.1 Grundlagen
16.7.2 Rheumatoide Arthritis
16.7.3 Juvenile idiopathische Arthritis
16.7.4 Rheumatisches Fieber
16.7.5 Spondylitis ankylosans
16.7.6 Psoriasis-Arthritis
16.7.7 Reaktive Arthritis
16.7.8 Kollagenosen
16.7.9 Fibromyalgie-Syndrom
16.8 Wichtige Medikamente
16.8.1 Intraartikuläre Glukokortikoide
16.8.2 Beeinflussung des Knochen- und Kalziumstoffwechsels
17 Nervensystem
17.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
17.1.1 Grundlagen
17.1.2 Zentrales Nervensystem
17.1.3 Peripheres Nervensystem
17.1.4 Funktionelle Systeme und höhere Leistungen
17.1.5 Entwicklung im Lebensverlauf
17.2 Wichtige Leitsymptome
17.2.1 Schmerzen
17.2.2 Lähmungen
17.2.3 Bewegungsstörungen
17.2.4 Sensibilitätsstörungen
17.2.5 Meningismus und Nervendehnungszeichen
17.2.6 Neuropsychologische Ausfälle
17.2.7 Weitere Leitsymptome
17.3 Diagnostik
17.3.1 Anamnese
17.3.2 Klinisch-neurologische Untersuchung
17.3.3 Apparative Untersuchungen
17.4 Anlage- und Entwicklungsstörungen
17.4.1 Plötzlicher Kindstod (SIDS)
17.4.2 Neuralrohrdefekte
17.4.3 Infantile Zerebralparese
17.5 Intrakranielle Druckerhöhung
17.5.1 Akute Druckerhöhung
17.5.2 Chronische Druckerhöhung
17.6 Durchblutungsstörungen und Blutungen des Gehirns
17.6.1 Schlaganfall
17.6.2 Zerebrale Ischämie
17.6.3 Hirnblutungen
17.6.4 Sinusvenenthrombose
17.7 Entzündliche Erkrankungen
17.7.1 Meningitis
17.7.2 Enzephalitis
17.7.3 Hirnabszess
17.7.4 Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
17.7.5 Poliomyelitis
17.7.6 Multiple Sklerose (MS)
17.7.7 Chronisches Fatigue-Syndrom
17.8 Epileptische Anfälle und Epilepsie
17.8.1 Grundlagen
17.8.2 Symptome
17.8.3 Diagnostik
17.8.4 Therapie
17.8.5 Epilepsiesyndrome und spezielle Situationen
17.9 Bewegungsstörungen
17.9.1 Parkinson-Syndrom
17.9.2 Chorea Huntington
17.9.3 Restless-Legs-Syndrom (RLS)
17.9.4 Essenzieller Tremor
17.9.5 Orthostatischer Tremor
17.9.6 Tic-Störungen
17.10 Demenzen
17.11 Motorische Degenerationen
17.11.1 Amyotrophe Lateralsklerose
17.11.2 Spinale Muskelatrophien
17.12 Tumoren des Nervensystems
17.12.1 Hirntumoren
17.12.2 Spinale Tumoren
17.12.3 Neurinome
17.12.4 Neuroblastom
17.13 Verletzungen des ZNS
17.13.1 Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
17.13.2 Misshandlungsbedingtes Schädel-Hirn-Trauma
17.13.3 Verletzungen des Rückenmarks
17.14 Erkrankungen peripherer Nerven
17.14.1 Nervenwurzel-Syndrome
17.14.2 Plexusläsionen
17.14.3 Periphere Nervenläsionen
17.14.4 Polyneuropathien (PNP)
17.15 Muskelerkrankungen und neuromuskuläre Übertragungsstörungen
17.15.1 Muskelerkrankungen
17.15.2 Störungen der neuromuskulären Übertragung
17.16 Kopf- und Gesichtsschmerzen
17.16.1 Spannungskopfschmerzen
17.16.2 Migräne
17.16.3 Cluster-Kopfschmerzen
17.16.4 Trigeminusneuralgie
17.17 Wichtige Medikamente
17.17.1 Migränetherapie
17.17.2 Medikamente bei Parkinson-Syndrom
17.17.3 Antikonvulsiva
17.17.4 Weitere Substanzen
18 Sinnesorgane: Auge und Ohr
18.1 Auffrischer: Anatomie und Physiologie des Auges
18.1.1 Aufbau des Auges
18.1.2 Sehvorgang
18.2 Leitsymptome der Augen
18.2.1 Das tränende Auge
18.2.2 Das trockene Auge
18.2.3 Das rote Auge
18.2.4 Seheindrücke
18.2.5 Augenschmerzen
18.2.6 Sehverschlechterung und Blindheit
18.2.7 Pupillenveränderungen
18.2.8 Nystagmus
18.3 Diagnostik bei Augenerkrankungen
18.3.1 Anamnese
18.3.2 Klinische Untersuchung
18.3.3 Prüfung der Sehfunktion
18.3.4 Optische und bildgebende Verfahren
18.3.5 Tonometrie
18.3.6 Untersuchungen der Tränenorgane
18.3.7 Schieldiagnostik
18.4 Erkrankungen der Augen
18.4.1 Erkrankungen der Lider
18.4.2 Erkrankungen der Bindehaut
18.4.3 Erkrankungen der Hornhaut
18.4.4 Erkrankungen der Aderhaut
18.4.5 Erkrankungen der Lederhaut
18.4.6 Erkrankungen der Tränenorgane
18.4.7 Erkrankungen der Linse und des Glaskörpers
18.4.8 Glaukom
18.4.9 Erkrankungen der Netzhaut
18.4.10 Erkrankungen des Sehnervs
18.4.11 Erkrankungen der Augenhöhle
18.4.12 Verletzungen der Augen
18.4.13 Fehl- und Alterssichtigkeit
18.4.14 Schielen
18.5 Wichtige Medikamente
18.5.1 Mydriatika
18.5.2 Medikamente bei Glaukom
18.5.3 Tränenersatzmittel
18.5.4 Glukokortikoide
18.5.5 VEGF-Hemmstoffe
18.6 Auffrischer: Anatomie und Physiologie der Ohren
18.6.1 Aufbau
18.6.2 Physiologie der Ohren
18.7 Leitsymptome der Ohren
18.7.1 Schwerhörigkeit
18.7.2 Schwindel
18.7.3 Nystagmus
18.7.4 Ohrenschmerzen
18.7.5 Tinnitus
18.8 Diagnostik bei Erkrankungen des Ohrs
18.8.1 Anamnese und klinische Untersuchung
18.8.2 Hörprüfungen
18.8.3 Gleichgewichtsuntersuchungen
18.9 Erkrankungen des Ohrs
18.9.1 Erkrankungen des äußeren Ohrs
18.9.2 Erkrankungen des Mittelohrs
18.9.3 Erkrankungen des Innenohrs und des Hörnervs
18.10 Wichtige Medikamente
18.10.1 Antivertiginosa
18.10.2 Glukokortikoide
18.10.3 Abschwellende Nasentropfen und -sprays
19 Haut, Haare und Nägel
19.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
19.1.1 Haut
19.1.2 Haare
19.1.3 Drüsen der Haut
19.1.4 Nägel
19.2 Wichtige Leitsymptome
19.2.1 Effloreszenzen
19.2.2 Urtikaria
19.2.3 Angioödem
19.2.4 Juckreiz
19.2.5 Exantheme
19.2.6 Nagelveränderungen
19.2.7 Veränderungen der Haare
19.3 Diagnostik
19.3.1 Anamnese
19.3.2 Klinische Untersuchung
19.3.3 Apparative Untersuchungen
19.4 Erkrankungen der Haut und der Nägel
19.4.1 Ekzeme
19.4.2 Psoriasis vulgaris
19.4.3 Immunologisch bedingte Hauterkrankungen
19.4.4 Akne und verwandte Erkrankungen
19.4.5 Bakterielle Hauterkrankungen
19.4.6 Pilzerkrankungen der Haut
19.4.7 Virale Hauterkrankungen
19.4.8 Parasitäre Hauterkrankungen
19.4.9 Arzneimittelreaktionen
19.4.10 Benigne Hauttumoren
19.4.11 Semimaligne und maligne Hauttumoren
19.4.12 Weitere Hauterkrankungen
19.5 Therapeutische Grundlagen
19.5.1 Interventionelle Verfahren
19.5.2 Medikamente
20 Geschlechtsorgane
20.1 Geschlechtsidentitäten und ihre Entwicklung
20.1.1 Somatisches Geschlecht
20.1.2 Pubertätsentwicklung und ihre Störungen
20.1.3 Varianten der Geschlechtsentwicklung
20.2 Geschlechtsunabhängige Leitsymptome
20.2.1 Dyspareunie
20.2.2 Libidoverlust
20.2.3 Hypogonadismus
20.3 Empfängnisverhütung
20.3.1 Überblick
20.3.2 Natürliche Kontrazeption
20.3.3 Mechanische und chemische Methoden
20.3.4 Hormonelle Kontrazeption
20.3.5 Intrauterine Kontrazeption
20.3.6 Sterilisation
20.3.7 Postkoitale Kontrazeption
20.4 Unfruchtbarkeit
20.4.1 Grundlagen
20.4.2 Therapeutische Optionen
20.5 Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)
20.5.1 Überblick
20.5.2 Gonorrhö
20.5.3 Syphilis
20.5.4 Feigwarzen
20.5.5 Ulcus molle, Lymphogranuloma venereum
20.6 Medikamente zur Beeinflussung der Geschlechtsorgane
20.6.1 Weibliche Sexualhormone und ihre Antagonisten
20.6.2 Männliche Sexualhormone und ihre Antagonisten
20.6.3 Hormone des Hypothalamus und der Hypophyse
20.6.4 HER2-Hemmstoffe
20.6.5 α1-Rezeptorenblocker
20.6.6 PDE-5-Hemmer
20.6.7 Phytotherapeutika
20.7 Weibliche Genitalien
20.7.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
20.7.2 Leitsymptome der weiblichen Geschlechtsorgane und der Mamma
20.7.3 Diagnostik der weiblichen Geschlechtsorgane und der Mamma
20.7.4 Erkrankungen der Vulva und Vagina
20.7.5 Erkrankungen des Uterus
20.7.6 Erkrankungen der Adnexe
20.7.7 Erkrankungen der Brustdrüse
20.7.8 Hormonell bedingte Störungen
20.8 Männliche Genitalien
20.8.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
20.8.2 Leitsymptome der männlichen Geschlechtsorgane
20.8.3 Diagnostik der männlichen Geschlechtsorgane
20.8.4 Erkrankungen der Prostata
20.8.5 Erkrankungen der Hoden und Nebenhoden
20.8.6 Erkrankungen des Penis
21 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
21.1 Auffrischer Anatomie und Physiologie
21.1.1 Schwangerschaft
21.1.2 Geburt
21.1.3 Das Neugeborene
21.1.4 Ernährung im 1. Lebensjahr
21.1.5 Wochenbett
21.2 Leitsymptome in der Schwangerschaft
21.3 Diagnostik und Betreuung
21.3.1 Überblick
21.3.2 Anamnese
21.3.3 Beratung bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft
21.3.4 Klinische Untersuchung
21.3.5 Apparative Untersuchungen
21.4 Schwangerschaftsabbruch
21.5 Geburtshilfliche Maßnahmen
21.5.1 Geburtshilfliche Operationen
21.5.2 Geburtshilfliches Schmerzmanagement
21.6 Probleme in der Schwangerschaft
21.6.1 Extrauteringravidität (EUG)
21.6.2 Magen-Darm-Beschwerden
21.6.3 Erkrankungen von Leber und Gallenwegen
21.6.4 Schwangerschaftsbedingte Hauterkrankungen
21.6.5 Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen und HELLP-Syndrom
21.6.6 Vena-cava-Kompressionssyndrom
21.6.7 Diabetes mellitus bei Schwangeren
21.6.8 Infektionen bei Schwangeren
21.6.9 Alkoholembryofetopathie
21.6.10 Störungen der Plazenta
21.6.11 Fetofetales Transfusionssyndrom
21.6.12 Fruchtwasserstörungen
21.6.13 Störungen des Schwangerschaftsablaufs
21.6.14 Tumorerkrankungen in der Schwangerschaft
21.7 Probleme und Komplikationen bei der Geburt
21.7.1 Lageanomalien
21.7.2 Haltungsanomalien
21.7.3 Einstellungsanomalien
21.7.4 Armvorfall
21.7.5 Protrahierte Geburt und Geburtsstillstand
21.7.6 Mütterliche Geburtsverletzungen
21.7.7 Postpartale Blutungen
21.7.8 Fruchtwasserembolie
21.7.9 Nabelschnurkomplikationen
21.8 Probleme bei Neugeborenen
21.8.1 Atemwegskomplikationen
21.8.2 Stoffwechselstörungen
21.8.3 Störungen von Blut und Gerinnungssystem
21.8.4 Darmerkrankungen bei Neugeborenen
21.8.5 Geburtsverletzungen beim Kind
21.8.6 Neugeboreneninfektionen
21.8.7 Fehlbildungen mit Relevanz in der Erstversorgung
21.9 Probleme im Wochenbett
21.9.1 Milchstau
21.9.2 Rückbildungsstörungen
21.9.3 Wochenbettinfektionen
21.9.4 Postpartale Harninkontinenz
21.9.5 Thromboembolien
21.9.6 Psychische Komplikationen
21.10 Wichtige Medikamente
21.10.1 Medikamentöse Therapie in Schwangerschaft und Stillzeit
21.10.2 Wehenförderung
21.10.3 Wehenhemmung
22 Psyche
22.1 Einführung
22.2 Leitsymptome, Diagnostik
22.2.1 Psychopathologie
22.2.2 Anamnese
22.2.3 Untersuchungen
22.2.4 Klassifikationssysteme in der Psychiatrie – Vom triadischen System zu ICD und DSM
22.3 Besonderheiten in Kindheit und Alter
22.3.1 Psychische Störungen in der Kindheit
22.3.2 Psychische Störungen im Alter
22.4 Wichtige psychische Störungen
22.4.1 Neuromentale Entwicklungsstörungen
22.4.2 Schizophrenie und andere primär psychotische Störungen
22.4.3 Affektive Störungen
22.4.4 Angst- oder furchtbezogene Störungen
22.4.5 Zwangsstörung und verwandte Störungen
22.4.6 Spezifisch Belastungs-assoziierte Störungen
22.4.7 Dissoziative Störungen
22.4.8 Fütter- oder Essstörungen
22.4.9 Ausscheidungsstörungen
22.4.10 Somatische Belastungsstörung oder Störungen der Körpererfahrung
22.4.11 Störungen durch Substanzgebrauch oder Verhaltenssüchte
22.4.12 Persönlichkeitsstörungen
22.4.13 Neurokognitive Störungen
22.4.14 Weitere psychische Störungen
22.5 Suizidalität
22.6 Weitere Themen im Zusammenhang mit der Psyche
22.6.1 Schlaf und Schlafstörungen
22.6.2 Akute Belastungsreaktion
22.6.3 Burnout
22.7 Therapieverfahren in der Psychiatrie
22.7.1 Grundlagen
22.7.2 Wichtige Medikamente
22.7.3 Grundlagen der Psychotherapie
22.7.4 Biologische Therapieverfahren
23 Organübergreifende Infektionen
23.1 Leitsymptome
23.1.1 Fieber
23.1.2 Exanthem
23.1.3 Lymphknotenschwellungen
23.2 Diagnostik
23.3 Sepsis
23.3.1 Grundlagen
23.3.2 Symptome
23.3.3 Diagnostik
23.3.4 Therapie und Prognose
23.3.5 Prävention
23.4 Bakterielle Infektionen
23.4.1 Scharlach
23.4.2 Borreliose
23.4.3 Botulismus
23.4.4 Tetanus
23.4.5 Legionellose
23.4.6 Listeriose
23.4.7 Milzbrand
23.4.8 Toxische Schocksyndrome (TSS)
23.4.9 Typhus und Paratyphus
23.4.10 Weitere bakterielle Infekte
23.5 Virale Infektionen
23.5.1 Masern
23.5.2 Mumps
23.5.3 Röteln
23.5.4 Varizellen und Herpes zoster
23.5.5 Infektiöse Mononukleose
23.5.6 CMV-Infektionen
23.5.7 Ringelröteln
23.5.8 Exanthema subitum
23.5.9 Tollwut
23.5.10 Mpox
23.5.11 Virale hämorrhagische Fieber
23.5.12 Weitere virale Infektionen
23.6 Pilzinfektionen
23.6.1 Kandidose
23.6.2 Aspergillose
23.7 Parasitosen
23.7.1 Erkrankungen durch Protozoen
23.7.2 Erkrankungen durch Würmer
Teil III Anhang
24 Anhang
24.1 Fachwortlexikon
24.2 Abkürzungen
24.3 Laborwerte
24.4 Einheiten
24.5 Auf Station
24.5.1 Innere Medizin
24.5.2 Chirurgie
24.5.3 Orthopädie und Unfallchirurgie
24.5.4 Pädiatrie
24.5.5 Gynäkologie und Geburtshilfe
24.5.6 Urologie
24.5.7 Dermatologie
24.5.8 Ophthalmologie
24.5.9 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
24.5.10 Neurologie
24.5.11 Psychiatrie
24.5.12 Psychosomatik
24.5.13 Intensivmedizin
24.5.14 Geriatrie
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Access Code
Wichtige Hinweise
Alle Inhalte jetzt kostenlos auch im Internet nutzen !
Schnellzugriff zum Buch
Impressum
Teil I Grundlagen und übergreifende Prinzipien
1 Gesundheitslehre versus Krankheitslehre
2 Allgemeine Krankheitslehre
3 Grundlagen
4 Grundlagen zu Tumorerkrankungen
5 Grundlagen des Immunsystems
6 Grundlagen der Infektiologie
7 Schmerzen und Schmerztherapie
8 Notfallsituationen
2 Allgemeine Krankheitslehre
2.1 Grundlagen
2.1.1 Definition und Bedeutung
Definition
Krankheitslehre
Krankheitslehre beschreibt, systematisiert und klassifiziert Krankheiten. Sie ist als einheitliche „Sprache“ die Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit aller Beschäftigter im Gesundheitssystem.
Die Systematik der Krankheitslehre ruht auf 3 Säulen:
Krankheitskriterien, die auf der unmittelbaren Erfahrungsebene beschreibbar sind
Konzept des Organismus als biopsychosoziales System, in dem Prozesse stattfinden, die von Krankheitsursachen über eine pathogenetische Kettenreaktion zu pathologischen, also krankhaften Manifestationen führen
klinische Erfahrung, dass Krankheitsprozesse Typen und Muster bilden, die sich einem System aus definierten Krankheitseinheiten zuordnen lassen
2.1.2 Einteilung und Klassifikation von Krankheiten
Einteilung von Krankheiten
Zuordnung zu medizinischen Fachrichtungen, z.B. Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie
Zuordnung zu Organen bzw. Organsystemen: Haben Sie verstanden, wie ein Organ bzw. Organsystem anatomisch aufgebaut ist und physiologisch funktioniert, fällt es oft leicht zu verstehen, worin die Problematik bei Erkrankungen besteht. Daher gehen wir im Abschnitt zur Speziellen Krankheitslehre überwiegend nach dieser Systematik vor.
Viele Erkrankungen betreffen nicht nur einzelne Funktions- oder Organsysteme, sondern können sich nahezu im ganzen Körper manifestieren, z.B. Tumoren, Fehlfunktionen des Immunsystems und Infektionen. Entsprechend sind die Therapieansätze in diesen Fällen systemübergreifend. Medikamente werden bei der Behandlung vieler unterschiedlicher Erkrankungen eingesetzt. Ähnliches gilt für Schmerzen, die bei vielen Erkrankungen ein wichtiges und zu behandelndes Symptom sind. Diese übergreifenden Themen werden in den Grundlagenkapiteln besprochen.
Zuordnung nach der Pathogenese: z.B. Infektion, Tumor, degenerative Erkrankung
Klassifikationssysteme Damit Diagnosen vergleichbar sind, müssen unterschiedliche Beurteiler, auch in unterschiedlichen Ländern, zum gleichen Ergebnis kommen (Reliabilität), und die Diagnosen müssen tatsächlich vorhandenen Krankheiten entsprechen (Validität). Um dies zu gewährleisten, wurden operationalisierte („messbar machende“) Klassifikationssysteme geschaffen, in denen Diagnosekriterien definiert sind und in denen Diagnosen in Gruppen zusammengefasst werden. Ein wichtiges Klassifikationssystem ist die ICD-Klassifikation (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Derzeit ist in Deutschland noch die Version 10 im Gebrauch. Parallel wird die Version 11 übersetzt, ihre Freigabe steht noch aus. Diese international verwendete Klassifikation von Krankheiten und Diagnosen liegt dem DRG-System (Diagnosis Related Groups) zugrunde, das in Deutschland zur Abrechnung mit den Krankenkassen genutzt wird.
2.1.3 Systematische Beschreibung von Krankheiten
Für einen Überblick siehe ▶ Abb. 2.1.
Definition Die Definition bestimmt den jeweiligen Begriff möglichst eindeutig.
Pathologie Die Pathologie beschreibt die pathologischen (krankhaften) Befunde und strukturellen Veränderungen, die bei einer Erkrankung entstehen, z.B. ein polypös (blumenkohlartig) ins Darmlumen wachsender, bösartiger Tumor bei einem Kolonkarzinom. Unterschieden werden makroskopische, mit freiem Auge sichtbare und mikroskopische, nur unter dem Mikroskop erkennbare Befunde.
Pathophysiologie Die Pathophysiologie beschreibt die pathologischen Prozesse, die bei einer Erkrankung im Körper ablaufen, z.B. bei einem ▶ Ileus: Eine Unterbrechung der Darmpassage führt zu einem Aufstau von Darminhalt und in weiterer Folge zu einer Überdehnung der Darmwand. Die Folgen sind eine ischämische Schädigung, ein vermehrter Flüssigkeitseinstrom ins Darmlumen und letztlich eine Hypovolämie bzw. ein Schockgeschehen.
Ätiologie Die Ätiologie nennt die Ursachen und auslösenden Faktoren einer Erkrankung sowie das Zusammenwirken der Risikofaktoren ( ▶ Abb. 2.2). Ist die Ursache einer Erkrankung nicht (vollständig) bekannt, wird sie als essenziell oder idiopathisch bezeichnet (z.B. essenzielle Hypertonie). Risikofaktoren beeinflussen den Organismus ungünstig und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ursache (z.B. ein Sturz) die Pathologie (z.B. eine Fraktur) tatsächlich auslöst.
Innere (endogene) Faktoren oder Dispositionen beschreiben die individuelle Anfälligkeit für Erkrankungen, z.B.:
geschlechtsbedingte Disposition: Frauen haben ein höheres Risiko für Mammakarzinome als Männer.
genetische Disposition: Aufgrund einer bestimmten genetischen Konstellation ist z.B. die Wahrscheinlichkeit, einen Diabetes mellitus Typ 2 zu entwickeln, deutlich gegenüber dem Durchschnitt erhöht.
altersbedingte Disposition: Bei vielen Störungen sind bestimmte Altersgruppen häufiger betroffen als andere.
äußere (exogene) Risikofaktoren, z.B.:
konsumbedingte und Lebensstil-assoziierte Risikofaktoren: u.a. Rauchen, Konsum von Alkohol und/oder Drogen, Ernährungsstil, verminderte körperliche Aktivität
umweltbedingte Risikofaktoren: z.B. Luftverunreinigungen, Klimaveränderungen
psychosoziale Risikofaktoren: z.B. Armut, beengte Wohnverhältnisse, Stress, Depression, Erschöpfung
Beispiel
Zusammenwirken endogener und exogener Risikofaktoren
Sind z.B. Verwandte ersten Grades an Brustkrebs erkrankt, besteht eine genetische Disposition und damit ein endogener Risikofaktor. Zusätzliche exogene Risikofaktoren sind z.B. Kinderlosigkeit, Alkoholkonsum und Strahlenbelastung.
Primäre Ursachen liegen im betroffenen Organsystem selbst, sekundäre Ursachen außerhalb dieses Organsystems.
Pathogenese Die Pathogenese beschreibt die Krankheitsentstehung, d.h. die Abfolge der Veränderungen, die zur Entwicklung der Symptome führen. Beispiel ▶ Furunkel: Die Ätiologie ist eine Infektion durch Staphylococcus aureus. Ein Risikofaktor ist z.B. mangelnde Hygiene. Die Pathogenese lautet: Infektion eines Haarfollikels → Entzündung → Austritt neutrophiler Granulozyten → Gewebeeinschmelzung → Eiter mit Abszessbildung
Krankheitsbeschreibung.
Abb. 2.1 Die hier gezeigten Begriffe finden Sie in der Beschreibung fast aller Erkrankungen.
Ätiologie.
Abb. 2.2 Beispiele für äußere und innere Risikofaktoren.
Symptome Symptome sind die für eine Erkrankung typischen Krankheitszeichen. Leitsymptome sind sehr typische Symptome der Erkrankung, die wichtige Hinweise zur Diagnosefindung geben (z.B. akute linksthorakale Schmerzen bei akutem Koronarsyndrom). Ein Syndrom oder Symptomkomplex beschreibt das gleichzeitige Vorkommen verschiedener Symptome in typischen Kombinationen.
Blitzlicht Pflege
Symptome
Das Ziel der Patientenbeobachtung ist es, Veränderungen des Gesundheitszustandes anhand von Symptomen frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren: Wie zeigen sich die Symptome einer Erkrankung beim jeweiligen Patienten? Wie entwickelt sich ein bestehendes Symptom? Entwickeln sich weitere Symptome? Was kann ich als Pflegefachperson tun, um die Symptome zu lindern?
Diagnose Bei der Diagnosestellung werden Symptome und Befunde einem bestimmten Krankheitsbild zugeordnet:
Bei einer gesicherten Diagnose lassen sich die Symptome und Befunde mit größtmöglicher Sicherheit einem Krankheitsbild zuordnen. „Größtmögliche Sicherheit“ bedeutet, dass auch gesichert erscheinende Diagnosen im Verlauf überprüft/hinterfragt und ggf. Korrekturen vorgenommen werden sollten.
Bei einer Verdachtsdiagnose, d.h. bei Verdacht auf eine bestimmte Erkrankung, werden zur Diagnosesicherung weitere Untersuchungen benötigt.
Eine Ausschlussdiagnose wird nur gestellt, wenn alle anderen möglichen Diagnosen ausgeschlossen wurden. Beispiel ▶ Reizdarmsyndrom: Neben bestimmten Kriterien, die erfüllt sein müssen, müssen für die Diagnosestellung andere Darmerkrankungen ausgeschlossen werden.
Diagnostik Die Diagnostik fasst alle Verfahren zusammen, die zur Abklärung der Erkrankung durchgeführt werden. Siehe dazu das Kapitel ▶ „Medizinische Diagnostik“.
Differenzialdiagnosen Diese Diagnosen könnten sich möglicherweise auch hinter den vorliegenden Symptomen verbergen. Beispielsweise können ▶ akute Thoraxschmerzen auf einen Herzinfarkt, aber z.B. auch auf eine Lungenembolie oder einen Pneumothorax hinweisen.
Blitzlicht Pflege
Pflegediagnose
Als Pflegefachperson erheben Sie als Teil des Pflegeprozesses Pflegediagnosen: Dies sind systematische klinische Beurteilungen der Reaktionen eines Patienten auf aktuelle oder potenzielle Gesundheitsprobleme und/oder Lebensprozesse. Sie sind die Grundlage für die Auswahl pflegerischer Maßnahmen, die auf das Pflegeziel zugeschnitten sind. Das in Deutschland derzeit am häufigsten genutzte Klassifikationssystem für Pflegediagnosen ist die Einteilung der NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).
Prognose Die Prognose ist eine allgemeine Vorhersage über Verlauf, Dauer und Heilungschancen einer Krankheit, z.B. wie wahrscheinlich eine Erkrankung akut oder chronisch verläuft oder wie hoch die Sterblichkeit der Betroffenen ist. Prognostische Aussagen sind statistisch ermittelte Mittelwerte und erlauben keine genaue Vorhersage des individuellen Verlaufs. Ein häufig zur Prognose bösartiger Erkrankungen verwendeter prognostischer Wert ist die 5-Jahres-Überlebensrate: Wie viel Prozent einer Patientengruppe lebt 5 Jahre nach der Diagnosestellung noch?
Therapie Siehe ▶ „Medizinische Therapie“.
WISSEN TO GO
Allgemeine Krankheitslehre
Die Krankheitslehre beschreibt, systematisiert und klassifiziert Krankheiten. Krankheiten werden u.a. nach verschiedenen Organen/Organsystemen oder medizinischen Fachbereichen (z.B. Innere Medizin, Chirurgie) klassifiziert. Die ICD-Klassifikation ist eine international gültige Systematik von Krankheiten und Diagnosen, an der sich die Abrechnung nach DRG orientiert.
Krankheiten werden i.d.R. durch folgende Begriffe beschrieben: „Definition“, „Pathologie“, „Pathophysiologie“, „Ätiologie“, „Pathogenese“, „Symptome“, „Diagnose“, „Differenzialdiagnose“, „Therapie“ und „Prognose“.
2.2 Ursachen von Zell- und Gewebeveränderungen
2.2.1 Allgemeines
Die gleichen Pathomechanismen können an verschiedenen Organen ablaufen. So gibt es u.a. Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) oder der Gallenblase (Cholezystitis). Es gibt Gefäßverschlüsse im Gehirn (Schlaganfall) und am Herzen (Herzinfarkt). Folgende grundlegende Prozesse sollten Sie kennen:
Anpassungsreaktionen von Zellen und Geweben, z.B. durch Zunahme der Zellzahl oder Zellgröße, Reparation oder Degeneration
angeborene Entwicklungsstörungen:
Agenesie: Ein Gewebe oder Organ ist nicht angelegt, z.B. bei ▶ Agenesie einer Niere.
Aplasie: Ein Gewebe oder Organ entwickelt sich trotz vorhandener Anlage nicht, z.B. beim ▶ Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom.
Atresie: In einem Hohlorgan entwickelt sich kein Lumen, z.B. bei ▶ Ösophagusatresie.
Hypoplasie: Ein angelegtes Gewebe oder Organ entwickelt sich nur unzureichend, z.B. Lungenhypoplasie bei ▶ angeborenen Zwerchfelldefekten.
Abweichungen der Anzahl von ▶ Chromosomen
▶ Genetische Defekte beeinträchtigen die Funktion von Proteinen.
▶ Zell- und Gewebeschädigung durch innere Prozesse, z.B. Entzündungen, Durchblutungsstörungen oder Ablagerungen
Infektionen durch Mikroorganismen
Zell- und Gewebeschädigungen durch äußere Einflüsse, z.B. Gewalteinwirkung, ▶ Druck, ▶ Kälte, ▶ Hitze, ▶ Strom, ▶ ionisierende Strahlung
Neuwachstum von Zellen und Geweben, d.h. ▶ Tumorentstehung
Immunpathologie: Störungen des Immunsystems, z.B. ▶ Autoimmunreaktionen, ▶ Allergien
▶ Intoxikationen: Vergiftungen
WISSEN TO GO
Grundlegende Pathomechanismen
Anpassungsreaktionen, z.B. durch Zunahme der Zellzahl oder -größe
angeborene Entwicklungsstörungen, z.B. Fehlen (Agenesie) oder Unterentwicklung eines Organs (Hypoplasie)
abweichende Chromosomenzahl
genetische Defekte
Schädigungen durch innere Prozesse, z.B. Entzündungen, Durchblutungsstörungen
Infektionen durch Mikroorganismen
Schädigungen durch äußere Einflüsse, z.B. Gewalteinwirkung, Kälte, Hitze, Strom, ionisierende Strahlung
Neuwachstum (Tumorentstehung)
Immunpathologie, z.B. Autoimmunreaktionen
Intoxikationen (Schädigungen durch Giftstoffe)
2.2.2 Anpassungsreaktionen von Geweben
Zellen und Gewebe passen sich an, wenn z.B. dauerhaft mehr oder weniger Leistung von ihnen verlangt wird, bei Zerstörung und Erneuerung von Zellen oder bei chronischer Einwirkung von Giftstoffen.
2.2.2.1 Veränderungen der Größe oder Zahl der Zellen
Hypertrophie und Hyperplasie Je nach Gewebe führt eine stärkere Beanspruchung zu einer Zunahme der Anzahl der Zellen eines Gewebeverbandes oder zu einer Vergrößerung der Zellen ( ▶ Abb. 2.3):
Hypertrophie





























