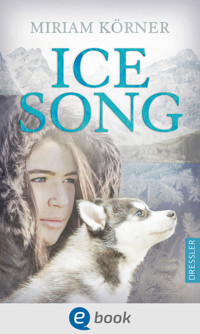
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als die 15-jährige Emmylou in Churchill, der Welthauptstadt der Eisbären, ankommt, will sie nur eines: wieder weg. Hier in der kanadischen Arktis ist es viel zu kalt, zu karg, zu weit ab von allem. Doch dann trifft sie Barnabas, einen jungen Inuk, der seine Schlittenhunde für den nervenaufreibenden Arctic Quest trainiert, ein Rennen, das Hund und Mensch alles abverlangt. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den kleinen Welpen des Rudels. Und nicht nur der lässt ihr Herz schneller schlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Herzklopfen und Husky-Rennen in arktischer Wildnis
Als die 15-jährige Emmylou in Churchill, der Eisbären-Hauptstadt der Welt, ankommt, will sie nur eins: wieder weg. Die Arktis ist ihr zu kalt, zu karg, zu weit ab vom Schuss. Doch dann trifft sie Barnabas, einen jungen Inuk, der seine Schlittenhunde für das nervenaufreibende Arctic Quest trainiert – ein Rennen, bei dem es um alles geht. Sie begleitet ihn auf seinen Touren und verliebt sich Hals über Kopf in den kleinen Welpen des Rudels – und nicht nur der lässt ihr Herz schneller schlagen …
Für Maria und Gregor
Kapitel 1
Der Zug ruckelt durch eine endlose Einöde. Weit und breit sind weder Häuser noch Straßen, noch sonst irgendwelche Zeichen menschlichen Lebens zu sehen – abgesehen von Telefonmasten aus Holz, die dem Verfall bedenklich nahe sind. Kärgliche Fichten, matschiger Schnee, Zuggleise. Kilometer um Kilometer, Stunde um Stunde gleitet die ungastliche Landschaft an mir vorbei.
Ein tiefer Seufzer entfährt mir. Kitty schaut von ihrem Zugmagazin auf, als wäre mein Seufzen eine Einladung zum Reden. Ist es aber nicht. Kitty ist übrigens die Person, die allein durch die unwiderrufliche Tatsache, dass sie mich zur Welt gebracht hat, dazu berechtigt ist, meine Mutter zu sein. Und sag mir nicht, dass keine halbwegs normale Erwachsene mit dreiunddreißig Jahren noch immer den Namen Kitty benutzt. Mir ist das klar.
»Emmylou …« Kitty lehnt sich zu mir, versucht, Blickkontakt aufzunehmen. Ich drehe mich zum Fenster.
Was denn, will ich fragen, aber ich habe, seit wir in Calgary in den Zug gestiegen sind, nicht mehr mit ihr gesprochen, und das war vor sechsundvierzig Stunden und fünfzehn Minuten – ohne Zeitverschiebung. Je länger wir nicht miteinander reden, desto schwieriger wird es, das Schweigen durchzuhalten.
»Willst du was essen?«, fragt Kitty.
Eindeutig eine Fangfrage. Wenn ich Ja sage, können wir einfach in den Speisewagen gehen und uns vormachen, dass alles in Ordnung ist. Will ich aber nicht. Ich habe genug von der Heuchelei.
»Na, komm schon, Emmylou. Irgendwann musst du doch eh wieder mit mir reden.« Sie beugt sich zu mir, um mir durch die Haare zu wuscheln. Ich ducke mich weg.
»Wenn du so sein willst, bitte. Ich bin im Speisewagen, falls du es dir doch noch anders überlegst.« Kitty wirft ihre Zeitschrift auf den Sitz, schlüpft in ihre Schuhe und stolziert den Gang hinunter. Mir fällt auf, dass sie abgenommen hat. Sie wirkt irgendwie zerbrechlicher. Das hat sie allerdings nicht davon abgehalten, unsere Sachen zu packen, unsere Koffer die Treppe aus unserer Einzimmerwohnung hinunterzuschleifen und uns in ein neues Leben zu katapultieren.
Ich strecke meine Beine auf Kittys Sitz aus und blättere durch ihre Zeitschrift, und dann – weil es einfach nichts Besseres zu tun gibt – zähle ich die Telefonmasten. Es hat denselben Effekt, wie Schafe vor dem Einschlafen zu zählen.
Als ich aufwache, frage ich mich, ob der Lokführer den Zug heimlich zurückgefahren hat. Die gleiche Sumpflandschaft mit vereinzelten Bäumen, der gleiche Schneematsch, die gleichen Telefonmasten.
Sumpf-Express. So nennen die Leute hier ihren Zug. Wirklich. Express, ha! Ich könnte schneller mit dem Fahrrad fahren, wenn es eine Straße gäbe, auf der man fahren könnte. Gibt es aber eindeutig nicht. Keine Straße führt nach Churchill hinein oder aus Churchill heraus. Nur ein einsames, ewig langes Bahngleis.
Nicht mal ein Vogel sitzt in den kahlen Büschen neben den zugefrorenen Tümpeln. Verkümmerte Fichten stehen in Gruppen zusammen wie kleine Inseln in einem Meer aus Schnee. Dunkle Wolken hängen so niedrig, dass sie fast den Boden berühren.
Ich stelle mir vor, wie ich durch den Sumpf laufe. Was, wenn plötzlich ein Eisbär ganz lässig auf mich zukommt, während ich verzweifelt versuche, mich aus dem Matsch zu befreien?
Ich wende mich von der trostlosen Landschaft ab. Ein paar Reihen vor mir spiegelt sich das Gesicht eines Jungen im Fenster. Ich schätze ihn auf fünfzehn oder sechzehn. Vielleicht ein bisschen älter als ich. Ob er auch gerade an einen Ort geschleift wird, an dem er nicht sein will?
Sein Haar ist dunkel, fast schwarz, sein Gesicht rundlich, und seine Augen sind schmal, als würde er in die Sonne blinzeln. Er sieht aus, als ob er aus einem anderen Land käme. Vielleicht … oh! Ich bin ja blöd. Ich wette, er ist Eskimo. Nein, das sagt man ja nicht mehr. Inuit? Oder wie heißt es, wenn es nur einer ist?
Schlagartig wird mir klar, dass wir gerade unterwegs in die Arktis sind, was die immer weniger und kleiner werdenden Bäume erklärt. Und die Anwesenheit von Eisbären und Inuit in Churchill.
Ich rücke ein wenig nach vorne und versuche, die Reflexion des Jungen im Fenster besser zu erkennen. Was sieht er wohl, wenn er aus dem Fenster schaut? Sieht die Welt anders aus, wenn man hier oben im hohen Norden aufwächst? Sieht er Dinge, die ich gar nicht wahrnehme?
Der Junge dreht den Kopf. Für den Bruchteil einer Sekunde treffen sich unsere Blicke. Ich gucke schnell weg. Besser keine Freundschaften schließen. Wir werden eh nicht lange bleiben.
Es ist gerade mal drei Tage her, dass ich mich von Maya verabschiedet habe.
»Weißt du, was ihr seid, deine Mutter und du? Ihr seid Drifter«, sagte sie, während ich versuchte, meine ganzen Habseligkeiten in die zwei verschlissenen, übergroßen Koffer zu quetschen.
Drifter. Mir gefällt, wie sich das Wort anhört. Besser als Herumtreiber.
Ich ließ das Packen sein und warf mich auf die Matratze, stellte mir vor, dass ich inmitten eines blauen Meeres triebe. Mein Bett war ein Floß, das mich zu neuen Horizonten in der Ferne trug …
»Erde an Emmylou! Hörst du mir überhaupt zu?« Maya ließ sich neben mich plumpsen. Als ich die Augen öffnete, war da keine Sonne, nur das grelle Licht der nackten Glühbirne, die mein Zimmer für achtzehn Monate, zwei Wochen und fünf Tage erleuchtet hatte. Ein neuer Rekord.
»Wir bleiben doch in Kontakt?« Maya lehnte sich zu mir rüber.
»Na klar«, sagte ich und rückte von ihr weg. Ich wusste schon, dass ich es nicht tun würde. In Kontakt bleiben, meine ich. In Wahrheit lassen wir uns nicht einfach treiben. Wir rennen davon. Nee, nicht wir. Kitty. Kitty rennt davon. Ich weiß nur nicht, wovor.
»Hier. Du musst ja hungrig sein wie ein Bär.« Kitty reicht mir ein Sandwich mit Eiersalat und einen Apfelsaft im Tetra Pak, komplett mit Strohhalm wie für Kindergartenkinder.
Ich seufze laut und vernehmlich. Nur noch zwei Jahre. Zwei Jahre, einen Monat und acht Tage, um genau zu sein. Dann bin ich achtzehn. Das Dumme ist, dass ich wirklich hungrig bin. Und Apfelsaft war schon immer mein Lieblingsgetränk.
Der Zuglautsprecher knackt, und die Stimme des Zugführers füllt das Abteil.
»Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren Ziel- und Endbahnhof. Herzlich willkommen in Churchill, Manitoba. Die lokale Temperatur beträgt minus neun Grad. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt und bedanke mich …« Der Lautsprecher knackt wieder, und die Stimme des Zugführers geht im Kreischen der Bremsen unter.
Meine Handflächen werden auf einmal ganz feucht. Plötzlich will ich nicht, dass die Zugfahrt schon zu Ende ist. Will nicht wieder an einem Bahnhof aussteigen und nicht wissen, wohin wir von hier aus gehen. Will nicht morgens verwirrt aufwachen: Wo bin ich? Warum bin ich hier? Die Frage nach dem Warum ist die einfachere: Wohin auch immer Kitty geht, folge ich. Fragen nicht erlaubt. Ziel- und Endbahnhof? Definitiv nicht in ihrem Vokabular.
»Emmylou! Sieh doch! Ein Eisbär!« Kitty drückt ihre Hand gegen das Zugfenster.
»Wo?«, frage ich und breche damit meinen Schweigeschwur.
Ein weißes Etwas läuft die Schotterpiste neben den Schienen entlang. Mein Herz fängt wie wild an zu klopfen, bis ich bemerke, dass es gar kein Bär ist.
»Das ist doch bloß ein Hund, Kitty.« Ein großer weißer Hund, der in einem Film über Polarexpeditionen mitspielen könnte. Dickes Fell und hochstehende Ohren.
»Na gut.« Kitty lacht. »Hätte aber durchaus einer sein können. Churchill, Manitoba, Eisbären-Hauptstadt der Welt. Mensch, Emmylou, das wird bestimmt ein echtes Abenteuer.«
»Was? Von einem Bären gefressen zu werden? Wenn du mich unbedingt loswerden willst, gibt es einen einfacheren Weg.« Ich warte auf ihre Reaktion, aber es dauert eine Weile, bevor sie versteht, was ich meine.
Ihr Grinsen verschwindet schlagartig. »Das meintest du doch gar nicht. Da steckte doch dieses Mädchen dahinter.«
»Maya.«
»Was?«
»Meine Freundin. Maya.«
»Ja, ja. Maya.« So wie sie ihren Namen sagt, hört es sich an, als hätte Maya ihr irgendwas Schlimmes angetan. Dabei hat sie doch nur rechtliche Emanzipation im Internet recherchiert und geguckt, was wir machen müssten, damit ich alleine leben kann.
»Das kann ich dir gleich sagen, Emmylou. Die Chance, von einem Eisbären gefressen zu werden, ist auf jeden Fall größer als die Chance, dass ich dieses Formular unterschreibe. Liegt an dir, was du daraus machst. Wenn du mir unbedingt die Ohren volljammern musst, gut, dann mach das halt.«
»Ich dir? Wer jammert denn hier? Lief doch alles gut, bis …« Ja, bis wann denn eigentlich? Ich versuche, an die Wochen und Tage vor dem Umzug zurückzudenken, aber da ist nichts. An einem Tag war alles in bester Ordnung und am nächsten eben nicht. Auf einmal waren wir auf einer Rutschpartie ins Abwärts, und da war nichts, was uns aufhalten konnte.
»Diesmal wird alles anders, Emmylou, das verspreche ich dir. Wir machen einen Neustart. Hier kennt uns kein Mensch – keine Vorurteile, keine falschen Annahmen über uns, einfach nur ein sauberer, neuer Start. Das ist doch super, oder? Wirst schon sehen.«
Der Zug hält neben einem alten Fachwerkhaus. Ein hölzernes Schild hängt am Balken des Vordachs. Churchill steht da drauf. Sonst nichts. Ich guck aus dem gegenüberliegenden Zugfenster. Durch den fallenden Schnee sehe ich, wie der Fluss graues, matschiges Eis an einem riesigen grauen Hafengebäude vorbei Richtung Meer schiebt.
Als wir aus dem Zug steigen, kommt eine Frau in einem übergroßen roten Daunenparka auf uns zugeeilt. Zumindest glaube ich, dass es eine Frau ist. Ein Pelzkragen verdeckt ihr Gesicht.
Lass mich bitte kein totes Tier um mein Gesicht tragen müssen, flehe ich lautlos in den Himmel.
»Bist du Kitty?« Die Frau schielt unter dem Pelz hervor und streckt Kitty ihre Hand entgegen.
»Du bist Walters Frau?«, fragt Kitty und schüttelt die Hand von Totes-Tier-im-Gesicht. In dem Moment bläst der Wind die Kapuze herunter, und ich sehe, dass sie nur ein paar Jahre älter ist als ich.
»Ich bin Marie. Walter ist mein Boss. Ich arbeite hier während der Eisbärensaison«, sagt sie und verschluckt das H beim Sprechen. Französin? »Walter ist mit dem Tundra Crawler unterwegs, deswegen hat er mich geschickt. Das ist euer ganzes Gepäck? Der Wagen ist um die Ecke.« Marie schnappt sich den schwereren meiner beiden Koffer. Ein kalt-nasser, nach Fisch riechender Wind wirbelt um uns herum, sobald wir aus dem Windschatten des Gebäudes heraustreten.
»Und wie heißt du?«, fragt Marie und zieht ihre Kapuze hoch.
»Emmylou.«
»Hübscher Name. Tu parles français?«
»Nee.«
»Schade. Außer mir spricht keine der Bedienungen Französisch. Also muss ich mich immer um die französischsprachigen Gäste kümmern. Ist das dein erster Job als Bedienung?«
»Wie bitte?«
»Du bist doch zum Arbeiten hier, non? Walter hat gesagt, ich soll die zwei Neuen abholen.«
»Ich bin nur mit meiner Mutter hier.« Ich werfe Kitty einen Seitenblick zu.
»Also, ich dachte«, sagt Kitty, »jetzt, wo du doch Schule zu Hause machst und keinen festen Zeitplan hast … Außerdem, also, das Hotel bietet nur Unterkunft für Mitarbeiter an. Da habe ich mir gedacht …«
»… dass ich als Kellnerin arbeite?!« Ich fühle einen Kloß im Hals. Gleichzeitig bin ich wütend auf mich selbst. Wieso trifft mich das so hart? Kenne ich sie denn immer noch nicht?
»Sag mal, ist es dir einfach scheißegal, was ich will?«, lege ich los.
»Natürlich nicht«, sagt Kitty, aber es sind nur Worte. Abgenutzt und leer.
»Wieso sind wir dann hier? Willst du mir das mal verraten? Calgary war doch okay. Selbst die Schule war nicht so schlimm, aber du …« Ich breche ab. Der Junge vom Zugfenster läuft am Gleis entlang, in der einen Hand ein Hockeybag, mit der anderen versucht er, drei Lebensmittelkisten hochzuhieven.
Ein alter Mann in einem abgetragenen blauen Parka und Bommelmütze kommt ihm zu Hilfe und trägt dann zwei der Kisten. Sie verlassen das Gleis, folgen den Zugschienen. Es passiert alles wortlos und so natürlich, als wären sie ganz in ihrer eigenen Welt.
»Ähm … also, hier ist der Wagen«, sagt Marie und schiebt die Tür eines weißen Transporters auf. Sleepy Bear Lodge steht mit schwarzen Buchstaben auf der Seite. Sie wendet sich an mich: »Mach dir mal keine Sorgen. Wird dir schon gefallen. Du triffst hier Leute aus der ganzen Welt. Und gerade sind auch ganz viele Eisbären rund um Churchill. Ein toller Ort für Abenteuer. Superbe.« Sie lächelt mich an.
Ich lächele nicht zurück. In einem Satz hat sie drei Dinge erwähnt, die ich wirklich nicht in meinem Leben brauche: Leute, Eisbären und Abenteuer.
Marie kutschiert den Transporter vom Parkplatz. Der Junge und der Alte überschreiten die Schienen Richtung Fluss. Wohin gehen die wohl? Ich kann da keine Häuser sehen, nur Bruchbuden jeglichen Formats und jeder Farbe. Wohnen die da etwa? Ich verdrehe mir den Nacken, bis sie außer Sicht sind.
Marie weist uns auf Galerien, Restaurants und Touristenläden hin, die sich alle an der Hauptstraße entlang drängeln. »Das hier ist das beste Bistro der Stadt.« Vor dem metallverkleideten Bistro liegt ein Fischerboot aus Holz, als wäre es auf dem Parkplatz auf Grund gelaufen. Im Boot sitzt ein Eisbär aus angemaltem Sperrholz. »Und hier könnt ihr Souvenirs kaufen. Und Inuit-Kunst. Skulpturen aus Karibugeweihen, Steindrucke und T-Shirts.«
Kitty starrt stur aus dem Fenster, sagt nichts. Das ist ihre Art, mir ein schlechtes Gewissen zu machen.
Marie parkt den Transporter vor einem zweistöckigen Blockhauskomplex. Handgemalte Schilder, die zwischen den Pfosten der Veranda hängen, werben für das Sleepy Bear Restaurant. Suppen. Salate. Moschusochsen. Saibling.
»Voilà. Da sind wir«, sagt Marie und schnappt sich zwei unserer Koffer. Sie hält die schwere, rustikale Holztür für uns auf und schiebt uns dann an der Rezeption vorbei auf eine Holztreppe zu.
Drinnen ist alles aus Massivholz. Die Treppenstufen, das Geländer, die Türen zu den Gästezimmern. Oben angelangt, führt Marie uns an einer Nische mit zwei Holzstühlen und einem Bücherregal vorbei. Am Ende eines langen, schmalen Korridors weist sie auf eine Tür.
»Euer Zimmer. Es gibt keine Zimmernummern. Ihr müsst euch also euren Zimmernamen merken.« Sie deutet auf das Holzschild an unserer Tür. Aurora borealis. Nordlicht. Marie schiebt den Türriegel auf.
Das Zimmer hat ein Giebelfenster, das zur Straße zeigt. Davor steht ein Beistelltisch mit einem einzigen Stuhl. Zwei gegen die Wände gequetschte Betten stehen sich gegenüber. Kitty lässt ihren Koffer auf das linke Bett fallen.
»Ich lass euch dann mal ein bisschen auspacken und führe euch später herum, d’accord?« Marie wartet nicht auf eine Antwort, kann nicht schnell genug wegkommen. Na, da haben wir ja was gemeinsam.
Kapitel 2
»Mensch, Emmylou, es sind doch nur vier Tische besetzt. Wie konntest du denn deren Bestellungen verwechseln?«
Kitty guckt mich an, als ob ich ein Glas Milch nicht von einer Cola unterscheiden könnte. Natürlich kann ich das. Ich kann mir halt nur nicht merken, ob die Milch für das Kind mit der Rotznase am Tisch neben dem Kamin ist oder für das Mädchen mit den blonden Zöpfen am Tisch in der hinteren Ecke.
»Woher soll ich denn noch wissen, wer den Saibling bestellt hat und wer Fish’n’Chips und wer den Römersalat mit extra Speck wollte und wer das Gleiche ganz ohne Speck?«
»Schreib es auf.« Kitty zieht ihren Notizblock aus der Schürze, die sie über ihrem schwarzen Minirock Größe extrakurz trägt.
»Wenn du es doch so viel besser kannst, warum machst du es dann nicht?« Ich ziehe meinen Notizblock aus der Jeans und werfe ihn Kitty zu. Der Block ist leer, bis auf ein unleserliches Gekritzel auf der ersten Seite. Ich kann nicht so schnell schreiben, wie die Leute reden, außerdem verpasse ich dann, was der nächste Gast sagt. Also dachte ich, es wäre leichter, es einfach im Kopf zu behalten. Ist nicht der Fall.
»Du könntest ja wenigstens so tun, als ob du dir Mühe geben würdest.«
»Ich gebe mir Mühe, obwohl ich den Job noch nicht mal wollte.« Ich checke die Uhr neben dem Kamin. In zwanzig Minuten ist meine Schicht zu Ende, und dann fängt Kittys offiziell an. Ich löse den Knoten meiner Schürze.
»Darum geht es also. Du stellst dich dumm an, weil du sauer auf mich bist?«
»Ich stelle mich nicht dumm an!«
»Was dann? So ein paar Bestellungen aufnehmen kann ja wohl jeder.«
»Darum geht es doch gar nicht.«
»Worum geht es denn?«
»Es geht darum, dass …«, fange ich an, aber ich weiß schon lange nicht mehr, worum es wirklich geht. Das ist immer so. Kitty dreht die Dinge so in meinem Kopf herum, dass ich am Ende nicht mehr weiß, wieso wir uns eigentlich streiten.
Ich stürme aus dem Restaurant und stoße mit Walter zusammen.
»Hallo, junge Frau – wie war dein erster Tag?« Walters Stimme hört sich wohlwollend und freundlich an, aber es interessiert meinen Boss nicht wirklich, wie mein Tag war. Er will nur, dass alles reibungslos abläuft.
»Danke, gut«, murmele ich.
»Gut, gut. War da was mit dem schwarzen Minirock nicht in Ordnung, den ich dir gegeben habe?«
Super. Das hat mir gerade noch gefehlt. Noch ein Erwachsener, der besser weiß, wie ich mich benehmen und was ich anziehen soll. Ich stelle mir vor, wie er mich sieht: abgetragene Jeans, Kapuzenpullover zwei Nummern zu groß, Haare nur flüchtig gekämmt. Na, so viel besser sieht er doch auch nicht aus mit seinen Cargohosen und dem beigen Pullover. Ich zwinge mich zu einem Lächeln und schiebe mich an ihm vorbei.
Im Dachzimmer setze ich mich auf mein Bett und angle mein Handy aus dem Rucksack. Ob Maya mir wohl getextet hat? Kein Empfang. Ich scrolle durch alte Nachrichten.
Schick mir eine SMS, wenn du angekommen bist. Und lass dich nicht von ihr verrückt machen, ja? Mayas letzte Nachricht.
Zu spät, antworte ich.
Die Nachricht wird gesendet, sobald der Dienst verfügbar ist, kommt die automatische Antwort, und die Dachkammer fühlt sich noch ein wenig enger an. Ich ziehe mir einen weiteren Pullover über, quetsche mich in meine Winterjacke und leihe mir Kittys Schal aus.
Kalter Wind weht mir schweren, nassen Schnee ins Gesicht, als ich die Tür der Sleepy Bear Lodge aufstoße. Ich wickle den Schal enger um Ohren und Nase. Er riecht nach billigem Parfüm und Make-up. Vielleicht sollte ich doch den Parka anziehen, den Walter uns geliehen hat? Teil unserer neuen Uniform: rote Daunenjacke mit totem Tier um die Kapuze für draußen, schwarzer Minirock und Bluse für drinnen. Nein, danke.
Ich ziehe mir die Kapuze über den Kopf und stecke meine kalten Hände in die Hosentaschen. Ich bin fast die Einzige, die zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs ist. Kleinbusse transportieren Touristen wie eine Horde Schulkinder. Es gibt hier kaum mehr als ein Dutzend Straßen. Was gibt’s denn auch zu sehen außer Eisbären? Aber die sind ja wohl nicht hier, oder? Geht deshalb keiner zu Fuß?
Hinter mir höre ich plötzlich das knirschende Geräusch von schweren Fußstapfen im Schnee. Ich springe zur Seite, ducke mich, um den Angriff abzuwehren.
Ein Mann lächelt mich an und wischt sich dann das Schnee-Rotz-Gemisch aus dem Bart. »Dachtest du, ich wäre ein Bär? Hätte durchaus sein können. Die Eisbären kommen direkt in die Stadt. Also besser nicht allein hier rumlaufen.«
»Danke«, antworte ich, unsicher, ob er das ernst meint oder nur mit meiner Angst spielt. Schließlich läuft er doch auch allein die Straße runter. Oder können Bären die Angst an Touristen riechen?
Ich ziehe mir die Kapuze vom Kopf, damit ich besser sehen kann, drehe mich immer häufiger um. War da nicht was Weißes? Hör auf damit, Emmylou. Du machst dich doch selbst verrückt.
Ich wünschte, Maya wäre hier. Ich stelle mir vor, wie sie »Bär« hinter einem ahnungslosen Touristen schreien würde, und dann würden wir schnell wegrennen, während der arme Tourist sich von dem Schock erholt. Mit Maya eine Straße entlangzugehen, wo Eisbären auf einen lauern könnten, wäre was ganz anderes, als allein hier zu sein.
Die Namen der Geschäfte hören sich alle gleich an: Polar Bear Inn, Polar Bear Tours, Great White Bear Gallery. Eine wahre Touristenstadt. Das Trinkgeld sollte hier gut sein, und viel mehr interessiert Kitty sowieso nicht. Touristen steigen aus einem Bus, der Tundra Crawler Adventures anpreist. Ein Foto von einem Eisbären, der auf seinen Hinterbeinen steht und sich dem Fenster eines riesigen Off-Road-Geländewagens entgegenstreckt. Die schwarzen Räder sind fast so groß wie der Bär. Der Tundra Crawler selbst ist nirgendwo zu sehen. Gut so. Das heißt, dass die Bären vielleicht doch nicht so nah sind. Der Busfahrer winkt mir zu. Es ist Walter, mein Boss. Ich winke zurück und biege dann schnell in eine Seitenstraße ab, um ihn und die Menschenmenge zu vermeiden.
Ist das schon der Stadtrand? Auf der einen Straßenseite sind graue Häuser, auf der anderen kahles, baumloses Land. Richtung Fluss stehen Lagergebäude mit verrammelten Fenstern und abblätternder Farbe.
Der Hafen liegt still. Keine Schiffe oder sonst irgendwelche Aktivität. Eine Schotterpiste führt an Lager- und Hafengebäuden vorbei. Cape Merry steht auf dem Hinweisschild, das auf die Landzunge zwischen Fluss und Meer hinweist. Soll ich rechts zurück in die Stadt oder links zum Kap? Kitty oder Eisbären? Ich drehe mich nach links.
Die Schneeflocken auf meinem Schal schmelzen und verwandeln sich in nasskalte Pampe. Kälte kriecht durch meine Jacke und tief unter meine Haut. Die Luft riecht nach Fisch. Wie das Meer.
Die Schotterstraße schlängelt sich um Felsbrocken herum, die so aussehen, als ob jemand sie vor ewig langer Zeit über das Land gestreut hätte. Warte mal. War es nicht genau so? Sind das nicht Findlinge, die von den Gletschern während der letzten Eiszeit zurückgelassen wurden? Ich kann mich kaum noch an meinen letzten Geologieunterricht erinnern. Ist aber auch egal. Geologieunterricht gehört der Vergangenheit an. Wie Schule überhaupt. Wenigstens hat Kitty nachgegeben, als ich ihr gesagt habe, ich will nur noch Homeschooling machen. Ich bin es leid, immer wieder die Neue zu sein, die überall war und nirgends zu Hause ist.
Die Straße geht steil bergauf, und zu meiner Linken kann ich den Fluss sehen. Es muss wohl Ebbe sein. Das Ufer ist mit Steinen gesäumt, die normalerweise unter Wasser sind. Eis hängt an den Steinen und bildet fantastische Skulpturen, durch die sich der aufsteigende Nebel windet.
Am Cape Merry befinden sich verfallene Steinwälle und auf der gegenüberliegenden Flussseite die Ruinen eines alten Forts. Kanonenschießscharten starren wie leere Augen über den Fluss hinweg. Hinter der Landzunge liegt das Meer mit einem Strand aus gebrochenem Eis, klar wie Glas.
Plötzlich habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich drehe mich um. Zwischen den grauen Steinen ist was Helles. Ein Bär? Er bewegt sich nicht, aber ich habe nicht vor, hier zu stehen und zu warten, bis er es tut. So schnell ich kann, renne ich zurück Richtung Stadt. Als ich mich traue, mich kurz umzudrehen, kann ich das helle Etwas nicht mehr von den anderen Findlingen unterscheiden. Von einem Bären ist weit und breit keine Spur.
Ein schwarzer Kleinlastwagen hält neben mir an. Die Fahrertür fliegt auf, und ein Mann mit obligatorischem roten Daunenparka steigt aus dem Wagen. Auf dem Beifahrersitz liegt ein Gewehr.
»Was machst du denn hier so ganz alleine?«, fragt er mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ich … ich …«, stammle ich.
»Hast du das Schild nicht gesehen?«
»Welches Schild?«
Er geht ein paar Schritte runter von der Straße und richtet dann ein grünes Schild, das der Wind umgeblasen haben muss, wieder auf. Eisbärengefahr! Stopp! Nicht weitergehen!
»Ist da wirklich ein Bär? Hier?« Ich drehe mich in alle Richtungen.
»Wir haben gerade einen vom Kap verjagt. Kam von der anderen Flussseite, als meine Patrouille vorbeikam.«
»Patrouille?« Erst jetzt sehe ich das Manitoba-Naturschutz-Emblem an der Seite seines Wagens.
»Polar Bear Patrol.« Er geht zum Beifahrersitz, schließt das Gewehr in einen Waffenkoffer und hält dann die Tür für mich auf. »Normalerweise lasse ich keine Touristen mitfahren, aber wer weiß, wie lange der schon nichts gegessen hat.« Er grinst mich an.
»Normalerweise steige ich auch nicht bei Fremden ins Auto.« Ich grinse zurück und klettere in den Wagen.
»Wohin?«
»Sleepy Bear Lodge. Hat der Eisbär eigentlich jemanden angegriffen?«
»Wir hatten schon seit drei Jahren keine Attacke mehr.«
»Oh.« Super, Emmylou. Da sitzt ein Naturschutzbeauftragter neben dir, der gerade einen Eisbären verjagt hat und dir von einer Attacke erzählen könnte, und alles, was dir einfällt, ist »oh«?!
»Was passiert, wenn der Bär wiederkommt?« Schon besser.
»Dieser Bär ist jetzt zum zweiten Mal zu nah an der Stadt aufgetaucht. Wenn er nicht aufpasst, dann landet er im Gefängnis.«
»Im Gefängnis?«
»Polar Bear Jail. Am anderen Ende der Stadt.«
»Echt? Cool!«
»Nee, so toll ist das nicht. Die halten die Bären fest, bis sie im Helikopternetz auf das Meereis ausgeflogen werden können. Kein Futter. Nur Wasser. Wir wollen ihren Aufenthalt so ungemütlich wie möglich machen, damit sie nicht wiederkommen. Grüß Walter.« Er hält vor dem Hotel, und ich steige aus. Bevor ich die Tür zumache, beuge ich mich noch mal zu dem Naturschutzbeauftragten.
»Kann ich das Bärengefängnis mal sehen?«
»Das geht nicht. Keiner darf da rein. Wir versuchen, den Kontakt mit Menschen so gering wie möglich zu halten. Darum geht es ja schließlich.«
Ich habe noch tausend weitere Fragen, aber der Wagen rollt schon langsam davon.
Neben dem Hoteleingang kündigt eine schwarze Tafel mit weißer Kreideschrift die nächste Tundra Crawler Tour an. Um die Tafel herum hängen Fotos von Bären, die sich den kamerabeladenen Touristen hoch oben in den Off-Road-Fahrzeugen entgegenstrecken. Auf einem Foto ist eine Bärenmutter mit zwei Jungen, die durch die Tundra läuft. Im Hintergrund ein Hauch von Polarlichtern und ein ganzer Zug von Tundra Crawlern. Was hat der Naturschutzbeauftragte gerade gesagt? Den menschlichen Kontakt vermeiden?
Im Eingangsbereich zwischen Toilette und Restaurant stoße ich mit Kitty zusammen.
»Wie läuft dein Tag?«, fragt sie.
»SUPER«, antworte ich. Ich will gerade noch ergänzen, dass es hier NICHTS zu tun gibt, außer darauf zu warten, von einem fleischfressenden Eisbären gefressen zu werden, als Kitty ihr Kitty-Lächeln lächelt.
»Na, siehst du. Wusste ich doch, dass du dich hier ganz schnell eingewöhnst.«
Im Ernst?
Kapitel 3
Einen Vorteil hat es, als Kellnerin zu arbeiten: Kitty und ich haben entgegengesetzten Schichtdienst. Wenn sie nicht bei der Arbeit ist, dann bummelt sie durch die Touristenläden oder trinkt Kaffee in einem der Hotelrestaurants. Sie findet immer schnell neue Freunde. Und verliert sie oft genauso schnell. Wenn wir doch mal beide gleichzeitig im Zimmer sind, dann tue ich so, als würde ich fürs Homeschooling lernen.
Was sich übrigens als gar nicht so einfach herausstellt, wie ich dachte. Das erste Problem: Ich habe keinen Internetanschluss. Kein Scherz. Ich muss zur Bücherei im Gemeindezentrum gehen, um ins Internet zu kommen. Genau das wollte ich doch vermeiden. Wieder einmal die Neue zu sein. Wenigstens kann ich so tun, als wäre ich nur eine Touristin. Für eine Weile wenigstens. Oktober und November ist Hauptsaison hier. Die Bären hängen in der Gegend herum, bis das Meereis dick genug ist, dass sie aufs Eis hinauskönnen, um zu machen, was auch immer Bären da draußen halt machen. Danach wird es ruhiger in Churchill. Vielleicht fühlt Kitty bis dahin den Drang, wieder umzuziehen. Fünf Jahre, sieben Monate und elf Tage war ihre persönliche Bestzeit. Das war, als wir noch eine komplette Familie waren. Dad, Kitty, ich, Oma Millie und Toby, unser Hund.
Drei Wochen, vier Tage und fünf Stunden ist die kürzeste Zeit, die wir an einem Ort verbracht haben. Wir sind neun Mal umgezogen, seitdem Dad uns verlassen hat. Im Durchschnitt macht das ein Jahr, einen Monat, zwei Wochen und dreieinhalb Tage. In Statistik war ich schon immer gut. Bis jetzt sind wir neun Tage und acht Stunden hier. Kitty könnte sich noch selbst unterbieten.
»Emmylou, richtig?« Die grauhaarige Bibliothekarin registriert meine Bücher. Na super. Jetzt bin ich erst neun Tage, acht Stunden und ein paar Minuten hier, und die Bibliothekarin kennt schon meinen Namen. »Bist du neu in Churchill?«
»Auf der Durchreise«, murmle ich und warte darauf, dass sie mir meine Bibliothekskarte zurückgibt.
Sie nickt freundlich. »Das sind die meisten hier. Entweder arbeiten sie in der Eisbärensaison im Herbst oder in der Belugasaison im Sommer. Manche nehmen auch die Nordlichtertouren im Winter noch mit. Kaum einer will länger bleiben.«
Warum auch, denke ich, sage es aber nicht laut. »Und Sie? Sie sind nicht auf der Durchreise?«
»Eher nicht.« Sie lacht. »Ich bin jetzt schon seit zweiundzwanzig Jahren hier. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, woanders zu sein. Während der Bärensaison ist es ein bisschen überlaufen, aber ich habe ja meine Bibliothek, in der ich mich verstecken kann. Ich bin übrigens Lisa.« Sie schiebt mir meine Bücher zu und lächelt. »Interessante Auswahl. Sind die für die Schule?«, fragt sie.
»Homeschooling«, antworte ich, und dann höre ich mich sagen, dass ich meinen Lernplan beim Schulministerium einreichen muss, obwohl ich mir nicht so sicher bin, was ein Lernplan ist und wie ich das alles alleine hinkriegen soll. Aber zur öffentlichen Schule gehe ich auf gar keinen Fall, weil wir sowieso nicht lange bleiben. Ich beiß mir auf die Zunge. Wieso erzähle ich ihr das denn alles?
»Hast du die Formulare hier? Möchtest du, dass ich mir deinen Lernplan mal angucke?«
Ich ziehe die inzwischen eselsohrige Kopie hervor, die ich vom Homeschooling-Büro bekommen habe. Lisa liest sie aufmerksam durch.
»Du brauchst Lernziele für Englisch, Mathe, Natur- und Sozialwissenschaften. Wo liegen denn deine Interessen?«
»Meine Interessen? Was hat das denn damit zu tun, was ich lernen muss?«
»Vergiss einmal für einen Moment die ganzen Formulare, ja? Bist du zum ersten Mal in Churchill?«














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














