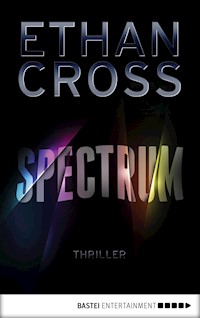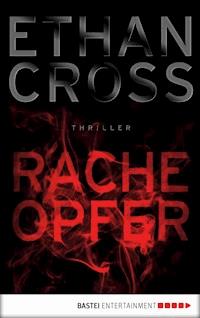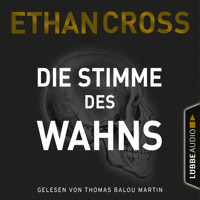9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Shepherd Thriller
- Sprache: Deutsch
In einer Strafanstalt in Arizona ereignet sich ein blutiger Amoklauf. Scheinbar wahllos erschießt ein Gefängniswärter mehrere Menschen. Zu seinem Motiv schweigt er.
Das ruft Bundesermittler Marcus Williams auf den Plan. Rasch findet er heraus, dass der Wärter von einem psychopathischen Killer erpresst wurde, der sich selbst Judas nennt. Um die Identität des Judaskillers aufzudecken, tut Marcus sich erneut mit seinem Bruder Francis Ackerman jr. zusammen, dem berüchtigtsten Serienkiller der Gegenwart: Marcus ermittelt außerhalb der Gefängnismauern, Ackerman jr. undercover unter den Häftlingen.
Was beide nicht ahnen: Der Judaskiller verfolgt weitaus größere Ziele als nur ein paar Morde...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zweiter Teil
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Dritter Teil
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Fallakte Francis Ackerman junior
Leseprobe
Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Thriller-Autors, der mit seiner Frau und zwei Töchtern in Illinois lebt. Nach einer Zeit als Musiker nahm Ethan Cross sich vor, die Welt fiktiver Serienkiller um ein besonderes Exemplar zu bereichern. Francis Ackerman junior bringt seitdem zahlreiche Leser um den Schlaf und geistert durch ihre Albträume. ICHBINDER ZORN ist der vierte Band um den gnadenlosen Serienkiller.
Ethan Cross
ICH BIN DERZORN
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonDietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Aaron BrownTitel der amerikanischen Originalausgabe: »The Judas Game«Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Wolfgang Neuhaus, OberhausenTitelillustration: © shutterstock/S. WacharaphongUmschlaggestaltung: Massimo Peter
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2988-9
Dieses eBook enthält eine Leseprobedes in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »ICH BIN DER HASS« von Ethan Cross.
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Wolfgang Neuhaus, OberhausenTitelillustration: © shutterstock/IgorskyUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Erster Teil
1.
Francis Ackerman junior bewunderte sein neues Gesicht auf der spiegelnden Seite des Fensters im Vernehmungsraum.
Die Ärzte hatten ausgezeichnete Arbeit geleistet und seine Erwartungen sogar übertroffen. Zu Anfang war er wenig aufgeschlossen für die Idee gewesen, ein neues Gesicht zu bekommen. Nicht dass er Bedenken gehabt oder sich Sorgen gemacht hätte, er könne dem Original nachtrauern. Seine Vorbehalte waren weder Eitelkeit noch Sentimentalität entsprungen. Nein, er hatte sich Gedanken um Brauchbarkeit und potenziellen Erfolg gemacht.
Sein vorheriges Gesicht war bei den allermeisten Frauen bestens angekommen. Sie hatten es als attraktiv betrachtet, als entwaffnend und verführerisch. Oh ja, sein Gesicht war stets ein verlässliches Werkzeug in seinem Arsenal gewesen, gewissermaßen ein Präzisionsinstrument, wenn es darum ging, Angehörigen des schwachen Geschlechts den Kopf zu verdrehen oder sie zu verführen. Würde er mit Gesicht Nummer zwei auch so durchschlagende Erfolge erzielen wie mit Gesicht Nummer eins?
Zu Ackermans Freude und Erleichterung waren diese Sorgen höchstwahrscheinlich unbegründet. Das neue Gesicht im Spiegel war mindestens so attraktiv wie das alte und hatte zusätzlich den Vorteil, dass es nicht im ganzen Land auf Steckbriefen zu sehen war.
Gesicht Nummer eins hatte die Wände jeder Polizeiwache in den USA geziert. Mittlerweile hingen die Fahndungsplakate nicht mehr aus, waren in Schubladen oder Papierkörben verschwunden. Dahin, wohin die Bürohengste Steckbriefe verschwinden ließen, die ihren Zweck erfüllt hatten, weil die Person, deren Gesicht den Steckbrief zierte, gefasst oder getötet worden war.
Francis Ackerman junior gehörte zu Letzteren.
Seine neuen Freunde im Justizministerium und beim Geheimdienst hatten alles Nötige getan, um es so aussehen zu lassen, als hätte Ackerman junior ins Gras gebissen. Nach offizieller Darstellung hatte er vor fast einem Jahr bei einer Schießerei mit der Polizei sein Leben verloren.
Die ganze Sache stimmte ihn ein wenig traurig. Nicht weil er nun offiziell als tot galt und in einem Geheimgefängnis der CIA saß – einem Knast von der Sorte, wie er normalerweise für Terroristen und andere Bedrohungen der nationalen Sicherheit reserviert war. Auch nicht, weil sein Beispiel zeigte, wie leicht ein Mensch ausgelöscht werden konnte und wie schnell er in Vergessenheit geriet. Schon gar nicht deshalb, weil man seine Steckbriefe abgehängt hatte.
Nein, Ackerman war enttäuscht, wie einfallslos, simpel, beinahe gleichgültig sie seinen Tod inszeniert hatten. Verdammt, diese Armleuchter hatten sein Vermächtnis ruiniert!
Ackerman verspürte das brennende Verlangen, dieses Unrecht ungeschehen zu machen. Er hätte einen stilvollen Abgang verdient gehabt, einen Abgang mit Größe. Sein Tod hätte die Menschen schockieren müssen. Er hatte sogar Vorschläge eingereicht, auf welche Weise er ins Jenseits zu befördern sei, aber sie hatten ja nicht auf ihn gehört, hatten ihre läppischen kleinen Pläne durchgezogen. Kleine Geister, kleine Gedanken.
Angeblich war er ums Leben gekommen, als zwei Cops einen als gestohlen gemeldeten Wagen gestoppt und keine Wahl gehabt hatten, als den steckbrieflich gesuchten Mörder, der hinter dem Lenkrad saß, über den Haufen zu schießen. Man stelle sich vor! Da war er einer der bekanntesten und gefürchtetsten Mörder in der Geschichte der modernen Welt, und denen fiel nichts Besseres ein, als ihn bei einer popeligen Routinekontrolle von zwei hergelaufenen Bullen abknallen zu lassen.
Das war eine Beleidigung. Eine Beschädigung seines Andenkens. Ein Rufmord. Und was hatte er alles auf sich genommen, um sich diesen Ruf zu erwerben!
Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Wichtig war nur, dass er eine gute Laborratte abgab und lange genug am Leben blieb, bis sein Bruder Marcus ihn hier rausholte, damit er weiterhin den Tätigkeiten nachgehen konnte, für die er geboren war: jagen und töten.
Der Raum war kalt, grau und ziemlich heruntergekommen. Das Neonlicht an der Decke summte wie eine elektrische Insektenfalle. Das ganze Geheimgefängnis stank nach altem Papier und Tinte, Staub und Druckerschwärze. Vielleicht waren hier früher Zeitungen, Prospekte oder was auch immer gedruckt worden.
Was seine Fesseln anging, hatte man diesmal jedes Risiko auszuschalten versucht. Ackerman trug eine Zwangsjacke, war von Kopf bis Fuß an einer Stehtrage fixiert und trug eine Maske, die verhindern sollte, dass er zubiss. Offenbar hatten die vorherigen Demonstrationen seiner Befreiungskünste und seiner Geschicklichkeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Summend öffnete sich die Tür, und ein CIA-Techniker in einem dunklen Polohemd kam in den Raum und setzte sich Ackerman gegenüber. Er war ein auffallend zierlicher Typ. Nicht dass er schmal oder zerbrechlich gewesen wäre, er schien körperlich überdurchschnittlich fit zu sein. Doch Ackerman kam der Mann irgendwie klein vor – auf eine Weise, die schwer zu beschreiben war. Es war, als ob Agent Poloshirt den Raum, den er einnahm, nicht ausfüllte, sondern ihn fast wie ein schwarzes Loch geradezu leersaugte.
Ackerman musterte den Mann mit mäßigem Interesse, als der nun auf ihn einredete. Offenbar versuchte er, eine Verbindung zwischen ihnen beiden herzustellen, vielleicht sogar, seine Überlegenheit zu etablieren; Ackerman konnte es nicht erkennen. Es war ihm auch herzlich egal.
Er fiel dem drauflosplappernden Poloshirt grob ins Wort: »Halt die Klappe.« Dann richtete er den Blick auf den Spionspiegel an der Wand, hinter dem, wie er genau wusste, Agent Green, Polos Vorgesetzter, das Geschehen verfolgte – in Gesellschaft von Ackermans alter Bekannter Dr. Emily Morgan, die ebenfalls in dem Raum hinter der halb durchlässigen Glasscheibe saß. Agent Roland Green leitete Ackermans »Laborrattenphase« während seiner Haftzeit.
»Ich werde dem Typen hier keine Fragen beantworten, Roland«, sagte Ackerman. »Schicken Sie mir einen anderen. Oder besser noch, schicken Sie mir Emily. Mit der mache ich den Test – versprochen. Der nachgemachte Dressman hier in seinem Poloshirt kann von mir aus die Geräte bedienen. Aber wenn ich diesem Typen Fragen beantworten soll, mache ich den Test nicht mit, ist das so weit angekommen?«
Der Techniker hatte unterdessen den medizinischen Gerätepark mit Ackerman verbunden und versuchte nun, mit dem Test weiterzumachen. Doch Ackerman hielt Wort und ignorierte den Mann völlig. Stattdessen ging er in sich, ließ die Gedanken schweifen.
Er stellte sich einen riesigen Staudamm vor und sah vor dem geistigen Auge, wie die Staumauer brach und ein gigantischer Tsunami über eine Kleinstadt hinwegraste. Die Einwohner wurden von den Wassermassen fortgerissen; Autos und Gebäudeteile wurden wie Kegel durch die Straßen und Gassen geschleudert, an Betonmauern zerschmettert oder von den Ästen der Bäume aufgespießt. Ackerman sah Menschen, die im Wasser verzweifelt um sich schlugen, ehe ein schwarzer Strudel sie verschluckte. Er beobachtete eine junge Mutter, die vergebens versuchte, ihre Kinder vor der heranrasenden Riesenwelle in Sicherheit zu bringen, die sie Augenblicke später packte und davontrug, inmitten von Trümmern und Leichen.
»Ackerman? Was ist los? Sind Sie eingeschlafen?«
Ackerman schlug die Augen auf. »Oh, hey, guten Morgen, Roland. Wie schön, Ihr Texas-Näseln zu hören. Im Unterschied zu Ihnen selbst weckt Ihre Stimme angenehme Gefühle in mir, wissen Sie das? Nun ja, an jedem Menschen ist irgendetwas Schönes. Bei Ihnen ist es weder das Gesicht noch die Persönlichkeit, sondern die Stimme. Sie erinnert mich an alte Western. Wenn ich Sie sprechen höre, Roland, habe ich nur noch einen Wunsch: Ich möchte Cowboy werden.«
Er versuchte absichtlich, den CIA-Mann so oft mit Vornamen anzusprechen wie möglich. Mit diesem kleinen Trick versuchte er, Green ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Agent Green hatte sich ihm nur mit dem Nachnamen vorgestellt, doch Ackerman hatte zufällig gehört, wie jemand auf dem Gang vor dem Verhörraum ihn mit »Roland« angeredet hatte. Dieser winzige Informationsschnipsel verschaffte Ackerman eine gewisse Macht über Agent Green. Er konnte förmlich sehen, wie sich in Greens Kopf jedes Mal die Rädchen drehten, wenn er ihn mit Vornamen ansprach. Green würde sich einzureden versuchen, dass Ackerman den Namen zufällig aufgeschnappt oder dass er sich verplappert hatte, aber sicher sein konnte er sich nie. Deshalb würden Green ständig Fragen durch den Kopf gehen, bewusst oder unbewusst, und ihm keine Ruhe lassen: Weiß Ackerman, wo ich wohne? Wo ich schlafe? Welche Schule meine Kinder besuchen?
Ackerman grinste. Es war köstlich.
Sekunden später erschien Green in der Tür des Verhörraums.
»Hallo, Roland«, sagte Ackerman. »Ich würde Ihnen ja gern die Hand schütteln, aber mein Anzug sitzt ein bisschen eng.«
Green schaute Ackerman kurz an und wies dann auf den Techniker. »Was stimmt nicht mit ihm?«
»Er deprimiert mich, Roland«, antwortete Ackerman. »Schauen Sie sich den Typen doch an. Seine Augen sind wie Blutegel. Wenn man zu lange hineinschaut, saugen sie einem die Seele aus.«
»Blutegel, die einem die Seele aussaugen.« Green seufzte. »An Ihnen ist ein Poet verlorengegangen.« Er wandte sich dem Techniker zu, musterte ihn und sagte schließlich: »Na schön.« Er richtete den Blick wieder auf Ackerman. »Ich wüsste nicht, was es schaden könnte, wenn Emily Ihnen die Fragen stellt, während Mister Blutegel sich um die Geräte kümmert. Aber wenn Sie mir Ärger machen oder irgendeine Dummheit versuchen, Ackerman, ist Ihre Vereinbarung mit der CIA hinfällig. Haben wir uns verstanden?«
»Gehe ich Ihnen auf die Nerven, Roland?«
»Aber nein! Sie sind mein Sonnenschein! Mein Tag wäre öde ohne Ihren Anblick, Mister Ackerman. Also, haben wir uns verstanden?«
»Carl Gustav Jung hat gesagt: ›Alles, was uns an anderen stört und aufregt, ist ein Hinweis auf unsere eigenen dunklen Seiten.‹«
Wieder seufzte Roland Green. »Ich werde einfach so tun, als hätten Sie Ja gesagt, und weitermachen. – Emily, kommen Sie bitte herein.«
Green zeigte mit dem Finger auf Ackerman, als er den Verhörraum verließ. »Vergessen Sie nicht, was ich gesagt habe.«
»Selbstverständlich nicht, Roland. Jedes Wort, das Sie sagen, sauge ich auf wie eine Wüstenblume den Regentropfen.«
Green hob die Augenbrauen und schüttelte den Kopf. »Was immer das heißen soll.« Die Tür öffnete sich, und Emily Morgan erschien. »Sie sind sicher, dass er nicht verrückt ist, Doc?«, fragte Green sie leise.
Emily neigte den Kopf auf die Seite und raunte ihm zu: »Verrückt ist ein viel benutzter und weitgefasster Begriff, keine Diagnose. Es ist eine Frage der Sichtweise und der Definition.«
Der grauhaarige Texaner nickte. »Schon klar, Doc. Okay, dann machen Sie mal. Viel Glück.« Er schlurfte davon.
Emily ging zu den beiden Stahlstühlen, die auf dem Boden verschraubt waren – auch was solche Dinge anging, hatte Ackerman ihnen bereits eine Lektion erteilt. Agent Poloshirt rutschte einen Platz zur Seite, während Emily sich auf den Stuhl direkt vor Ackerman sinken ließ. Ihre Bewegungen erregten seine Bewunderung; sie waren kraftvoll, anmutig und geschmeidig. Ihre Haut war makellos glatt, ihr Gesicht von vornehmer Blässe. Es zeigte eine merkwürdige Mischung aus asiatischen und irischen Wurzeln. Ackerman erinnerte sich, dass sie einen irischen Großvater und eine japanische Großmutter hatte; in einer der letzten Therapiesitzungen hatte sie es erwähnt.
Jedenfalls verband sie beide ein besonderes Verhältnis: Ackerman hatte Emilys Mann ermordet und sie selbst beinahe auch, und er hatte sie obendrein als menschlichen Köder benutzt. Dennoch hatte Emily ihn stets respektvoll behandelt, war ihm nie mit Verachtung oder gar Hass begegnet. Sie hatte sich sogar dem Kreuzzug seines Bruders Marcus angeschlossen, der das Ziel verfolgte, Francis Ackerman am Leben zu erhalten, um ihn bei der Jagd auf andere Mörder einzusetzen.
Wollte Emily dem Tod ihres Mannes irgendeinen Sinn verleihen, indem sie ihn, Ackerman, rehabilitierte? Oder wollte sie dafür sorgen, dass keiner anderen Familie Ähnliches widerfuhr wie der ihren? Hielt sie sich vielleicht nur an das Bibelwort vom Hinhalten der anderen Wange? Was immer der Grund war, Ackerman fand Emilys Verhalten bemerkenswert.
Und sie als Frau erst recht.
Emily Morgan war das genaue Gegenteil ihres Kollegen: Wo Poloshirt das Leben aus dem Raum saugte, hellte Emily ihn auf, erfüllte ihn mit Licht und Wärme.
»Gut sehen Sie aus«, begann sie.
Ackerman grinste hinter seiner Maske. »Ich finde mich auch todschick. Die Zwangsjacke ist das neueste Pariser Modell.«
Emily lächelte wider Willen. »Tja, wir scheuen hier keine Kosten und Mühen.«
Emily hatte bei ihrer letzten Begegnung mit Ackerman so viel Mut bewiesen, dass man ihr eine Therapeutenstelle in der Shepherd Organization angeboten hatte. Nach außen hin stellte sich diese Organisation als eine Art Denkfabrik dar, die im Auftrag des Justizministeriums arbeitete. In Wahrheit hatte sie die Aufgabe, Serienkiller zur Strecke zu bringen, wobei jedes Mittel recht war, selbst wenn dabei gegen das Gesetz verstoßen werden musste.
Die Shepherd Organization bestand fast ausschließlich aus Personen, die bei Begegnungen mit Serienmördern herausragende Eigenschaften an den Tag gelegt hatten. Emily hätte sich bestens in diese Gruppe eingefügt – als die psychologische Betreuerin, die man dringend brauchte. Aber dann hatte sie alle geschockt, besonders Ackerman, als sie stattdessen eine Tätigkeit als Agentin im Außeneinsatz anstrebte.
»Ich glaube, ich gehe dem armen Roland auf die Nerven«, nahm Ackerman nun das Gespräch wieder auf.
»Ich weiß, was Sie damit beabsichtigen«, erwiderte Emily.
»Womit?«
»Agent Green mit dem Vornamen anzusprechen.«
»Und was?«
»Sie versuchen ihm Macht zu stehlen, um ihn beherrschen zu können«, erklärte Emily. »Ihnen geht es immer nur um Macht, stimmt’s? Um Macht und Schmerz. Sie wollen Macht etablieren und in der einen oder anderen Form Schmerz erfahren.«
»Sie sagen das, als hätte ich selbst noch nie meine Empfindungen erforscht. Ich habe fast mein ganzes Leben in einem Käfig verbracht. Ich hatte mehr als genug Zeit, meine eigenen Tiefen auszuloten.«
»Ich habe nichts anderes behauptet. Ich habe nur eine Beobachtung gemacht.«
Ackerman hob die Augenbrauen. »Ach ja? Nur diese eine? Wie können Sie sicher sein, dass ich nicht mehr über diesen Knast weiß, als irgendjemand von Ihnen es sich auch nur vorstellen kann?«
»Wenn es so wäre, hätten Sie sich nicht beherrschen können und es uns längst unter die Nase gerieben.«
»Kluges Mädchen.« Ackerman lächelte. »Ich habe Sie vermisst, Emily.«
»Ich hatte andere Verpflichtungen.«
»Verpflichtungen in Bezug auf Ihre therapeutische Tätigkeit oder Ihre Ausbildung für den Außeneinsatz?«
»Verpflichtungen, die Sie nichts angehen.«
»Ging es um den Jungen? Dylan hat es auf seiner neuen Schule nicht leicht, habe ich gehört.«
»Ist das ein Wunder?«, entgegnete Emily. »Wo seine Mutter von seinem eigenen Großvater ermordet wurde? Von Ihrem Vater, Ackerman! Obendrein wurde Dylan einer Gehirnwäsche unterzogen, und auch er wäre beinahe ermordet worden. Glauben Sie vielleicht, dass es dem Jungen nach alldem leichtfällt, wieder in den Alltag zurückzufinden? Ich bin sicher, Sie können nachfühlen, wie es ihm geht.«
Das konnte Ackerman allerdings. Die Erfahrungen des Jungen spiegelten in vieler Hinsicht das wider, was er selbst durchgemacht hatte. Nur dass Dylan die Folter und die jahrelangen Manipulationen erspart geblieben waren, denen er selbst als Kind ausgesetzt gewesen war.
»Dylan muss aus seinen schrecklichen Erfahrungen lernen, Emily. Überlassen Sie ihn mir. Ich möchte ihn stärker machen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er ein Opfer der Umstände bleibt.«
Emily hob die Hand. »Tut mir leid, die Therapie ist meine Sache. In Ihren Gesprächen mit Dylan sollten Sie sich auf die Rolle des aufmerksamen und hilfsbereiten Zuhörers beschränken, nichts weiter. Ich überwache jedes Wort, das zwischen Ihnen fällt, jede Geste. Sobald ich auch nur den leisesten Verdacht habe, dass Sie Dylan zu manipulieren versuchen, wird Ihnen das Recht auf Kontakt zu dem Jungen entzogen, und zwar auf der Stelle.«
Ackerman knirschte mit den Zähnen. Er hasste es, dass die anderen etwas in der Hand hatten, mit dem sie ihm drohen konnten. »Aber ich …«, setzte er an.
Emily schüttelte den Kopf. »Keine Diskussionen.«
»Okay.« Ackerman gab sich geschlagen. Er wechselte das Thema. »Dann sagen Sie mir wenigstens, welche neue Technik die CIA heute an mir ausprobieren will.« Aus den Augenwinkeln blickte er auf das Gerät, das Agent Poloshirt inzwischen an ihm angeschlossen hatte. »Die Elektroden an dem Ding … wollt ihr mir damit Elektroschocks versetzen oder meine Gedanken lesen?«
»Weder noch«, sagte Emily. »Diese Messsonden verfeinern die neuen Lügendetektor-Algorithmen auf der Grundlage des letzten Tests, der mit Ihnen gemacht wurde.«
»Zu schade. Ich hatte mich so auf die Stromschläge gefreut.«
Agent Poloshirt meldete sich zu Wort. »Wir können anfangen, Doktor.«
»Okay.« Emily nickte und schaute auf ihr Klemmbrett. Offenbar enthielt es eine Liste vorformulierter Fragen, die sie Ackerman stellen wollte.
»Welcher Spezies gehören Sie an?«, lautete ihre erste Frage.
Ackerman räusperte sich. »Ich bin Gefrierfleisch vom Planeten Galaktron.«
Poloshirt fluchte leise und sagte: »Dem System zufolge sagt er die Wahrheit.«
»Nur damit es klar ist«, sagte Emily, »ich richte meine Fragen an Francis Ackerman junior und erwarte als Antwort auf meine Frage eine Tatsachenerklärung. Also, Mister Ackerman, begreifen Sie, was wir tun und was von Ihnen erwartet wird?«
Ackerman schmunzelte hinter seiner Maske. Offenbar hatte Emily zu beweisen versucht, dass er keinen Psychotrick brauchte, um das neue Hightech-Spielzeug der CIA durcheinanderzubringen. »Na klar begreife ich«, sagte er. »Und ich, Francis Ackerman junior, schwöre hiermit feierlich, Ihre Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, mit höchstem Respekt und unerschütterlicher Ehrlichkeit.«
»Er spricht die Wahrheit«, sagte Agent Poloshirt stirnrunzelnd.
Emily machte mit den Fragen weiter. »Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihren Beruf.« Sie verdrehte die Augen; die Frage war ja auch wirklich zu dämlich.
»Ich bin der sinnreiche Junker Don Quijote von La Mancha, Ritter ohne Furcht und Tadel.«
Poloshirt seufzte. »Er sagt schon wieder die Wahrheit.«
Ackerman bemerkte zufrieden, wie der Hauch eines Lächelns über Emily Morgans Porzellangesicht huschte, ehe sie zur nächsten Frage überging.
2.
Als Ray Navarro die Leiter von Turm 3 hinaufstieg, lauschte er dem Geräusch, das sein Ehering verursachte. Jedes Mal, wenn Ray die rechte Hand auf eine höhere Sprosse legte, klirrte der Ring gegen den Stahl, und der Klang von Metall auf Metall hallte die Betonmauern von Turm 3 hinunter.
Jeder Laut sandte neue Schockwellen von Bedauern und Zweifel durch Rays Inneres. Es kam ihm vor, als wäre die Welt auf den Kopf gestellt worden, sodass er in die Unterwelt hinabstieg, statt auf Turm 3 der Foxbury Correctional Treatment Facility, kurz FCTF, zu klettern.
Der Gefängniskomplex bestand aus einem alten Fabrikgelände und einem ehemaligen psychiatrischen Krankenhaus und war erst vor Kurzem in Betrieb genommen worden, als Teil eines Pilotprogramms für eine privat geführte »experimentelle Vollzugsanstalt«. Alle Wärter, Ray eingeschlossen, hatte man vor den ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen im FCTF gewarnt. Das Programm war allerdings freiwillig. Ray hatte die Risiken gekannt, aber die Bezahlung war zu verlockend, zumal zu Hause zu viele offene Rechnungen und offene Münder warteten.
Am Ziel angekommen, drückte Ray Navarro die Falltür im Boden des Krähennestes auf und zog sich in den drei mal drei Meter großen Raum an der Spitze des Turmes hoch. Zigarettengeruch stieg ihm in die Nase, obwohl in den Krähennestern das Rauchen verboten war. An einer Wand quietschte und rumpelte eine kleine, unter dem Fenster installierte Klimaanlage vor sich hin.
Ray zog seine Jacke aus und krempelte sich die Ärmel hoch. Der Waffenschrank stand an der Wand links von ihm. Er entriegelte ihn mit geübten, beinahe automatischen Bewegungen, nahm das .30-06-Gewehr heraus und lud es mit Patronen, die gerade die richtige Mischung aus Treibladung und Geschoss enthielten – Feuer und Stahl, die man brauchte, um jemandem ein zollgroßes Loch ins Fleisch zu stanzen. Mit Hochleistungswaffen für große Entfernungen hatte Ray sich immer schon hervorgetan.
Im Waffenschrank befanden sich außerdem eine Pistole und eine halbautomatische Flinte. Auch im Umgang mit diesen Waffen war Ray ein Könner, aber er brauchte sie jetzt nicht. Er brauchte die schwere .30-06; deshalb hatte er danach gegriffen wie ein sportverrückter Collegeboy nach einem gut eingefetteten Baseballhandschuh.
Ray klappte das Zweibein des Gewehrs aus, positionierte die Waffe und suchte auf dem Gefängnishof nach seinem ersten Opfer.
Das Fadenkreuz des Zielfernrohrs huschte über die Männergesichter hinweg. Roy bemerkte zwei der prominenten Gefängnisinsassen. Leonard Lash, den berüchtigten Bandenchef, sowie Oren Kimble, den Irren, der fünf Jahre zuvor in einem Einkaufszentrum ein Blutbad angerichtet hatte.
Navarros Blick bewegte sich weiter und blieb an den Gestalten zweier Wärter haften, die am Rand des Häftlingsbereichs patrouillierten wie Cowboys, die eine Herde bewachten. Die Männer schienen in ein Gespräch versunken – ein weiser grauhaariger Veteran, der einen jüngeren Schüler anleitete. Ray kannte den älteren Schwarzen gut. Wie Ray war auch Bill Singer ein Kriegsveteran und ehemaliger Scharfschütze. Als Ray ins Zivilleben zurückgekehrt war, hatte er sich in Selbstzweifeln verloren und war auf dem besten Weg gewesen, zum Trinker zu werden – bis er Bill Singer kennenlernte, der heute sein bester Freund war. Inzwischen war Ray seit fünf Jahren trocken und hatte sogar die damals bröckelnde Beziehung zu seiner Frau gekittet.
Ray runzelte die Stirn, denn Bill hätte bis Sonntag gar nicht im Dienst sein sollen. Offenbar war ihm etwas dazwischengekommen, denn da stand er und schien dem jüngeren Kollegen eine Gardinenpredigt zu halten.
Der jüngere Mann, Jerry Dunn, war gerade erst zu ihrer Truppe gestoßen. Jerrys hervorstechendstes Merkmal war sein trippelnder Gang; es sah aus, als machte er drei Schritte, wenn ein normaler Mann zwei machte. Diese Tippelschritte waren nicht das Einzige, was Jerry bei seinen Kollegen den Spitznamen »Gimp« – Krüppel – eingetragen hatte: Jerry blinzelte ständig und stotterte leicht.
Nicht dass Ray etwas gegen Jerry gehabt hätte, im Gegenteil. Es ging ihm sogar gegen den Strich, wie mies viele andere Wärter den Jungen behandelten. Ein leichtes Hinken, nervöse Augenlider und eine schleppende Sprechweise besagten ja nicht, dass Gimp seine Arbeit nicht machte oder machen konnte – und nach allem, was man so hörte, war der junge Wärter tüchtig und seinem Job mehr als gewachsen.
Ray hoffte, dass der Nächste, der die Leiter zur Turmspitze hinaufstieg, weder Bill Singer noch Jerry »Gimp« Dunn waren. Am liebsten wäre ihm, wenn überhaupt keiner zu ihm raufkäme. Es war eine Sache, auf feindliche Soldaten zu schießen – oder auf einen Häftling, wenn keine andere Wahl blieb –, aber das hier war etwas ganz anderes. Es war ungeschminkter Mord an Männern, die seine Kollegen waren, seine Freunde.
Kaltblütiger Mord.
Bei diesem Gedanken erbrach Ray sich würgend auf den Boden des Krähennests an der Spitze von Turm 3.
Als er wieder Luft bekam, fluchte er leise und keuchte: »Sie oder du. Sie oder du …«
Wieder suchte er sich sein Ziel, ließ das Fadenkreuz über das Herz des Mannes gleiten und langsam zu seinem Kopf hinaufwandern. Normalerweise zielte er auf die Brust, weil sie ein größeres Ziel bot und ein Treffer genauso vernichtend war wie ein Kopfschuss. Aber da es gut sein konnte, dass dies hier seine letzte Handlung auf Erden war, schadete es wohl nichts, ein bisschen anzugeben und auf das schwierigere Ziel zu feuern.
»Sie oder du.«
Ray wiederholte den Satz wie ein Mantra.
Sein Finger krümmte sich um den Abzug.
»Sie oder du!«
Ray feuerte.
*
Bill Singer beobachtete Jerry, der vor ihm her humpelte, wobei das Hinken ihn kaum zu behindern schien. Obwohl für Jerry jeder Schritt schmerzhaft sein musste und ihn mindestens doppelt so viel Anstrengung kostete wie andere, hatte er das Beste aus seinem Handicap gemacht. Bei dem Gedanken, welchen Schwierigkeiten Jerry sich in Anbetracht seiner angeborenen körperlichen Nachteile hatte stellen müssen, kam Bill nicht umhin, seinen jungen Kollegen zu bewundern, zumal er selbst in einem Alter war, in dem man erkannte, wie groß die Schulden waren, die für jede falsche Ernährungsentscheidung und für jedes Jahr ohne regelmäßigen Sport abgestottert werden mussten.
Bill hatte ein weiches Herz für den jungen Kerl; deshalb hatte er ihn unter seine Fittiche genommen. Bill und seine Frau waren kinderlos, aber er schätzte sich glücklich, schon mehrere junge Kollegen betreut zu haben, die ihm wie Söhne ans Herz gewachsen waren. Jerry war einer von ihnen; ein anderer war Ray Navarro, der, wie Bill wusste, gerade auf Turm 3 Wache hatte. Dazu kamen noch weitere, die Bill bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Klinik kennengelernt hatte. Seine Jungs, wie er sie gern nannte.
Doch Jerry Dunn war ein besonderer Fall. Er erinnerte Bill eher an einen Therapiepatienten als an einen Gefängniswärter wie etwa Ray Navarro. Jerry war ein verletztes Waisenkind, Ray ein verwundeter Krieger. Beide hatten auf ihre Weise Schwierigkeiten, die ihnen nicht anzulasten waren, aber die Unterschiede zeigten sich deutlich im unterschiedlichen Auftreten beider Männer.
Jerry hatte Bill seine Geschichte schon am ersten Abend erzählt, an dem sie sich zu scharf gewürzten Hähnchenflügeln und kaltem Bier getroffen hatten. Der Junge hatte Bill anvertraut, dass seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, als er erst acht Monate alt gewesen war.
Ein paar Kollegen hatten Jerry zwar ihr Mitgefühl bekundet, dann aber weiter hinter seinem Rücken über ihn gespottet. Und natürlich gab es in der Belegschaft auch Idioten, die Jerry sogar in seinem Beisein »Gimp« nannten, was sehr schmerzhaft für ihn sein musste, zumal er ohnehin schon viel Schmerz mit sich herumtrug, was immer der Grund dafür sein mochte. Das war Bill als Erstes aufgefallen, als er sich mit dem jungen Wärter angefreundet hatte.
Nun hielt Jerry in seinem Trippelschritt inne, machte auf dem Absatz kehrt und ließ den Blick über den Hof schweifen. Bill, der ihn weiterhin beobachtete, schüttelte den Kopf über das Aussehen des jungen Mannes. Jerrys glatte schwarze Haare hingen ihm bis über den Kragenrand und schienen seit Tagen nicht gewaschen und gekämmt worden zu sein. Jerrys Haut war so blass, wie Bills Haut dunkel war, und er verströmte einen wenig anziehenden Geruch, ein Gemisch aus Körperausdünstungen und dem Duft eines billigen Deos, mit dem er offenbar glaubte, sich vor dem Baden drücken zu können.
»Ich langweile mich zu Tode, Bill«, sagte Jerry. »Komm, lass uns wetten. Dahinten, die beiden Schlägertypen, siehst du sie? Der Dinosaurier und sein kleinerer Kumpel. Der Dino will auf der Bank gerade eine Million Tonnen stemmen. Ich wette zwei Dollar, dass der Typ es nicht schafft. Hältst du dagegen?«
Bill folgte Jerrys Blick und sah den hünenhaften weißen Schlägertypen, der sich im Bankdrücken an einem beeindruckenden Gewicht versuchte. Neben ihm stand ein kleinerer Mithäftling und achtete darauf, dass dem Riesen die Stange mit den Gewichten nicht auf die Brust krachte, sollten ihn die Kräfte verlassen.
Bill lächelte. Jerry schätzte die Situation völlig falsch ein. Der Riese würde niemals schlappmachen. »Ich nehme die Wette an, aber sagen wir … zwanzig Dollar.«
Jerry schien die Erhöhung des Einsatzes im ersten Moment zu beunruhigen, aber das hielt ihn nicht davon ab, die Wette einzugehen.
»Okay. Abgemacht.«
»Dein Pech.« Bill grinste und ließ den Blick auf den beiden Männern ruhen. Alles entwickelte sich genau so, wie er vermutet hatte. Der größere Mann stemmte das Gewicht so mühelos, dass sein Mithäftling, der die schwere Stange mit einem Flaschenzug sicherte, den Blick beinahe gelangweilt über den Gefängnishof schweifen ließ, ehe er die Stange mit dem Flaschenzug hochhievte, zur Seite schwenkte und ablegte. Dann tauschten beide Männer die Plätze. Der Hüne stand von der Bank auf und nahm den Platz seines kleineren Mithäftlings am Flaschenzug ein.
Bill lachte leise auf. »Das nennt man schnell verdientes Geld. Du kannst mir die Kohle nach Feierabend geben.«
»Okayokay …« Niedergeschlagen setzte Jerry seinen Weg am Zaun entlang fort. Bill ging neben ihm her. Beide Männer schwiegen eine Zeit lang.
»Unsere hundert Schützlinge«, sagte Bill schließlich und bezog sich auf die erste Welle von Häftlingen, die in das runderneuerte Gefängnis in Foxbury verlegt worden waren, »halten zusammen wie Pech und Schwefel. Ist dir das aufgefallen?«
Jerry nickte. »Na klar. Die sind eine verschworene Gemeinschaft.«
»Weißt du auch warum?«
»Nee.« Bill schüttelte den Kopf.
»Sie mussten rasch Bindungen herstellen, damit sie hier weiterhin das Sagen haben, sobald der nächste Schwung neuer Häftlinge kommt.«
»Verstehe.« Jerry nickte. »Aber weißt du, was mich noch mehr wundert?«
»Sag’s mir.«
»Wir sind zwar erst ein paar Monate hier, aber ich muss immer wieder staunen, dass noch niemand getötet worden ist. Ich finde, dieses sogenannte experimentelle Modell lässt den Häftlingen zu viel Freiheit. Die sind doch wie wilde Tiere.«
»Das liegt in ihrer Natur«, erklärte Bill. »Sie sind wie eine Meute hungriger Wölfe, die man in einen Zwinger gesteckt hat. Sie bilden Rudel und eine Rangordnung. Mir ist es egal, was unsere Chefs über diese Software und die Technik und die Kameras behaupten. Hier bei uns gilt das Gesetz der Natur. Das war immer so und wird immer so sein. Irgendjemand wird eine Lücke in den Sicherheitssystemen finden. Auf der ganzen Welt gibt es kein Sicherheitssystem, das nicht überlistet werden kann. Wenn einer schlau genug ist, um eine solche Sicherung zu konstruieren, gibt es irgendwo einen anderen, der versessen darauf ist, sie zu umgehen.«
»Bisher scheint es aber zu klappen. Ich glaube, das könnte wirklich ein Ausblick auf das Gefängnis der Zukunft sein.«
»Freu dich nicht zu früh. Es ist erst ein halbes Jahr um, mein Junge. Dein ›bisher‹ kann jeden Moment vorbei sein.«
Bill schaute wieder zu dem hünenhaften Schlägertypen hinüber, der am Flaschenzug stand und seinen kleineren Kumpan beim Stemmen der Gewichte beobachtete.
Im nächsten Moment geschah es.
Der Kopf des Hünen zerplatzte wie eine überreife Wassermelone. Bill sah das Blut einen Herzschlag lang, ehe er den Knall des Hochleistungsgewehrs hörte.
*
Auf den Tod des ersten Mannes folgte ein Augenblick schockierter Stille, die kaum mehr als einen Atemzug lang anhielt. In dieser winzigen Zeitspanne mussten die Häftlinge wählen: Flucht oder Kampf?
Die Zeit stand still.
Dann, mit einem Mal, schienen alle zu begreifen, was geschehen war. Die Häftlinge warfen sich zu Boden, wie man es ihnen beigebracht hatte, während die Wärter versuchten, aus dem plötzlichen Geschehen schlau zu werden.
Was war passiert, verdammt noch mal?
Der erfahrene Bill analysierte die Situation als Erster. Vermutlich hatte ein Häftling das Leben eines Wärters in Gefahr gebracht. Einen anderen Grund, aus dem ein Turmwärter das Feuer eröffnete, gab es nicht.
Bill hatte gerade genug Zeit, um den Blick über den Hof schweifen zu lassen und Ausschau zu halten nach dem, was er übersehen hatte, als der zweite Schuss fiel.
Diesmal erwischte es einen Häftling, der im Schatten einer Mauer vor sich hin döste. Der Mann zuckte wild, trommelte im Todeskampf mit den Füßen auf den Boden und lag dann still, während sein Blut über einen Mithäftling neben ihm sprühte.
Bill erstarrte, versuchte zu begreifen. Warum erschoss ein Turmwärter einen Häftling, der harmlos an einer Mauer saß? Das war Wahnsinn!
Es sei denn, es steckte irgendetwas dahinter.
Bills Erfahrungen aus seiner Zeit bei der Army meldeten sich. Sein geschulter Instinkt ließ ihn ahnen, was hier vor sich ging. Es konnte nicht anders sein. Scharfschützenbeschuss! Sie wurden angegriffen.
»Alles hoch!«, rief Bill über den Gefängnishof hinweg. »In die Gebäude! Alles in Deckung! Los, los!«
Die Häftlinge sprangen auf und rannten in den Schutz der Gebäude. Der Knall eines dritten Schusses trieb sie an, noch schneller zu laufen.
Den dritten Mann, der zu Boden ging, sah Bill nicht, aber er registrierte, von wo der Schuss kam, denn er hatte zu den Türmen und Mauern hochgeschaut und nach dem Schützen Ausschau gehalten. Und oben auf Turm 3 entdeckte er den Killer, der zu seinem Entsetzen wie Ray Navarro aussah – der Mann, der für Bill wie ein Sohn war. Ray spähte durch das Zielfernrohr seines Gewehrs und setzte zu einem weiteren Schuss an.
Was jetzt?
Bill wusste, letzten Endes ging es nur um die Frage, ob er die eigene Haut retten oder verhindern sollte, dass Ray getötet wurde.
Die Entscheidung fiel ihm leicht.
Er rannte zu Turm 3.
Zum äußeren Bereich des Hofes und den Wachtürmen gelangte man durch ein Gittertor in der alten Steinmauer. Das Problem bestand darin, dass das Tor viel moderner war als alles andere auf dem Hof. Es hatte kein Schloss, sondern wurde elektronisch verriegelt. Das Tor konnte nur von einem Überwacher geöffnet werden – so der Name, den die Wärter den Computertechnikern gegeben hatten, die ständig die Bilder der Tausende von Überwachungskameras im Gefängniskomplex mit Hilfe einer speziellen Software auswerteten. Bill musste dafür sorgen, dass ihn trotz des Durcheinanders auf dem Hof, dem Chaos von hundert Männern, die um ihr Leben rannten, einer der Überwacher bemerkte und das Tor öffnete.
Die Aussicht auf Erfolg war gering. Ganz zu schweigen davon, dass Bill sich direkt in Rays Fadenkreuz begeben musste – wenn es da oben wirklich Ray war –, um das Tor zu erreichen.
Der Ray, den er kannte, würde niemals auf ihn schießen. Aber dieser Ray hätte nie auf irgendjemanden geschossen. Wenn es also wirklich Ray war, dann war es nicht der Ray, den Bill kannte, sondern ein Killer. Und Bill hatte keine Möglichkeit vorherzusehen, was dieser Verrückte tun würde, der Rays Platz eingenommen hatte – dieser Dämon, der in Rays Haut geschlüpft zu sein schien.
Es wunderte Bill nicht allzu sehr, als er erkannte, dass zwei andere Gefängniswärter auf die gleiche Idee gekommen waren. Es waren zwei harte Jungs Mitte dreißig, Trent und Stuart. Sie hämmerten mit den Fäusten gegen das silbern glänzende Aluminiumtor und riefen zu einer der zahllosen Kameras hoch: »Macht auf, verdammt! Macht das dämliche Tor auf!«
Als Bill nur noch ein paar Schritte vom Tor entfernt war, hörte er zu seiner Überraschung das Summen und Klacken, mit dem die Verriegelung gelöst wurde. Augenblicklich schoben sich die beiden anderen Wärter durchs Tor, stürmten an Bill vorbei und verschwanden aus seinem Blickfeld. Bill wusste, wohin sie so eilig wollten.
Er warf einen raschen Blick auf Turm 3, während er zum geöffneten Tor rannte. Ray war vom Fenster des Turms verschwunden. Ob der Beschuss nun vorbei war oder Ray nur nachlud, konnte Bill nicht sagen. Aber er wusste, dass es für seinen jüngeren Freund besser war, wenn er, Bill, als Erster die Leiter hinaufstieg.
Er rief den anderen Wärtern zu, sie sollten warten und ihn zuerst zur Turmspitze hinauflassen, aber sein Sprint über den Hof hatte ihn außer Atem gebracht, sodass seine Stimme nicht die beabsichtigte Lautstärke erreichte. Die jüngeren Wärter reagierten nicht.
»Wartet!«, rief Bill. Der Gedanke, Ray könnte die Wärter angreifen, sodass die Situation weiter eskalierte, trieb ihn voran, jagte noch mehr Adrenalin in sein Blut.
Bill fing das Tor ab, ehe es zuschwingen und sich wieder verriegeln konnte, und sprintete um die Mauerecke.
Turm 3 ragte vor ihm auf.
In dem Moment, als Bill hinaufblickte, zerbarst das Krähennest an der Turmspitze in einem Glutball aus Glas und Feuer.
*
Die Druckwelle schleuderte Bill durch die Luft wie eine Stoffpuppe. Rings um ihn her schlugen geschwärzte Betonbrocken auf, einige davon zentnerschwer. Als das Bombardement nachließ, hob er den Kopf, starrte hinauf zu Turm 3 und lauschte. Zu seinem Entsetzen war er stocktaub. Was er sah, lief in gespenstischer Lautlosigkeit ab. Außerdem hatte er Mühe, scharf zu sehen, denn die Mittagssonne stand direkt hinter dem Wachturm am Himmel. Aus Bills Perspektive sah es aus, als hätte die Sonne die Brustwehr des Turmes verschlungen wie ein gigantischer Pac-Man aus Flammen. Bill blickte gerade lange genug in die Sonne, um zu erkennen, dass der obere Teil von Turm 3 verschwunden war, als wäre das Krähennest wie der Blütenstand einer Pusteblume weggeblasen worden – vor einer Sekunde noch da, dann spurlos verschwunden.
Desorientiert von der Druckwelle, dem Schock und dem grellen Licht, verschwamm Bills Sicht immer wieder. Dann entdeckte er durch Rauch, Dunst und Staub eine Gestalt, die durch die Öffnung in der Mauer stolperte und den Weg zum Hauptgebäude einschlug.
Es war Ray Navarro, da war Bill sicher.
War der Kerl übergeschnappt? War in seinem Leben irgendetwas vorgefallen, das ihn zu dieser Wahnsinnstat getrieben hatte? Falls ja, wusste Bill nicht einmal ansatzweise, was das gewesen sein könnte. Der Junge war nicht richtig im Kopf – das war die einzig schlüssige Erklärung.
Mit einem Mal kehrte Bills Gehör zurück. Eine Sekunde lang hörte er ein schrilles Klingeln, das im nächsten Moment mit den Geräuschen der realen Welt verschmolz: Schreie, Rufe, Stöhnen. Die Geräusche holten Bill in die Wirklichkeit zurück. Er kroch, dann taumelte er, schließlich rannte er in Richtung der Schreie.
Einer der Männer, die vor ihm den Turm erreicht hatten, war vom Feuer erfasst worden und wälzte sich verzweifelt am Boden, um die Flammen zu ersticken. Bill roch den Gestank versengten Fleisches, und Entsetzen kroch in ihm hoch. Trotz der Flammen stieß er nach dem Oberkörper des Mannes. Der kurze Kontakt mit der Gluthitze genügte, um ihm die Haare von den Armen zu sengen, aber der Stoß reichte aus, um den Wärter herumzuwälzen.
Bill half, die letzten Flammen zu ersticken, ehe er den schreienden jungen Mann wieder auf den Rücken drehte. Er hatte schreckliche Brandmale im Gesicht.
Bill stand ratlos da und überlegte fieberhaft.
Verdammt, was soll ich tun? Wie kann ich ihm helfen?
Das Knirschen von Sand und Kies unter harten Stiefelsohlen verriet ihm, dass andere Wärter herbeigerannt kamen. Einer von ihnen schob Bill zur Seite.
»O Gott«, rief der Mann, »er ist tot!« Der Wärter ließ sich auf die Knie fallen und begann mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Erst jetzt bemerkte Bill, dass der schwerverletzte junge Wärter nicht mehr atmete. Mit einem Mal fühlte er sich wie aus einem schlechten Traum erwacht. Wieder hörte er das schrille Klingeln in den Ohren, das an Lautstärke zunahm und einem Höhepunkt zuzustreben schien.
Bill beugte sich vor und erbrach sich.
Wieder dachte er an Ray.
Hatte er wirklich Ray auf dem Weg zum Hauptgebäude gesehen? Oder war es nur ein Trugbild gewesen? Hatte Ray dieses Blutbad angerichtet und versuchte nun, sich im Tumult davonzustehlen?
Bill rannte los. Der andere Wärter rief ihm zu, er solle ihm helfen, doch Bill beachtete ihn nicht.
Er kannte nur noch ein Ziel: das Tor.
Nur ein Gefühl trieb ihn an: Wut.
Der Verbrannte hätte ich sein können!
Und dann sah er Ray auf dem fast leeren Hof. Er näherte sich den Unterkünften im Norden.
Bill senkte den Kopf, mobilisierte alle Kräfte und rannte schneller, um den Abstand zwischen ihm und Ray zu verringern.
Ray blickte kein einziges Mal über die Schulter, als wollte er den Tod und die Zerstörung nicht sehen, die er angerichtet hatte, als wäre sie dadurch weniger echt, weniger schrecklich.
Bill holte auf.
Du Hurensohn!
Er hatte noch immer den Gestank des verbrannten Fleisches in der Nase, hörte noch immer die Schreie des jungen Wärters. Es stachelte ihn noch mehr an und weckte etwas in ihm, das er seit der Zeit bei der Army nicht mehr gespürt hatte und das er nicht benennen konnte.
Bill schloss den Abstand zu Ray, warf sich nach vorn und rammte ihm mit Wucht die Schulter in den Rücken. Beide Männer stürzten auf den Betonboden eines Basketballplatzes.
Ray war als Erster auf den Beinen und riss eine Pistole hervor, eine Glock, die er wahrscheinlich aus dem Waffenschrank von Turm 3 gestohlen hatte.
»Bleib, wo du bist!«, befahl er.
»Du Mistkerl …«
»Bleib stehen, habe ich gesagt!«
»Warum hast du das getan, Ray?«
Bills Stimme brach, während er einen Schritt auf den Mann zuging, den er so lange Zeit betreut hatte, der sein Schützling gewesen war.
»Bleib stehen!« Ray bewegte sich rückwärtsgehend in Richtung der Unterkünfte.
»Warum, Ray? Sag es mir!«
»Tut mir leid. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist, ehrlich.«
»Froh? Froh? Ich könnte tot sein! Und was ist mit den anderen, die du auf dem Gewissen hast?«
»Ich … ich kann nicht …« Ray schüttelte den Kopf, drehte sich um und rannte los.
Bill starrte ihm entgeistert hinterher.
Dieser Mann sah aus wie der Ray, den er kannte. Die Stimme war gleich. Der Ausdruck in den Augen. Aber der Ray, den Bill kannte, hätte so etwas nicht getan. Niemals.
Sicher, Ray war Exsoldat. Im Gefecht hatte er getötet. Aber das hier war etwas vollkommen anderes. Es war ein Gemetzel an Ahnungslosen, Unschuldigen. Was konnte Ray zu so etwas getrieben haben?
Ray hatte fünf oder sechs große Schritte in Richtung der Unterkünfte gemacht, als Bill zu der Entscheidung gelangte, dass Ray Navarro den Hof nicht verlassen dürfe.
Mit vier langen Sätzen überwand er den Abstand zwischen ihnen und warf sein ganzes Gewicht, seinen ganzen Schwung in einen einzigen Stoß. Wieder rammte er Ray und holte aus, um einen wuchtigen Schlag an dessen Hinterkopf zu landen. Mit einem einzigen Hieb würde er Ray ins Reich der Träume schicken. Der Kampf würde vorüber sein, ehe er begonnen hatte.
Doch es kam anders. Im letzten Sekundenbruchteil duckte sich Ray und fuhr herum, die Glock im Anschlag.
Bill erkannte augenblicklich seinen verhängnisvollen Fehler, aber es war zu spät.
Mündungsfeuer loderte aus dem Pistolenlauf.
Der Schmerz kam mit einer Millisekunde Verzögerung und riss Bill von den Beinen.
Er stieß ein dumpfes Stöhnen aus, blickte zum grauen Himmel, kippte zur Seite und schlug hart auf den Beton.
Er spürte, wie das warme Blut aus seiner Wunde strömte.
Wie durch Watte hörte er die Rufe anderer Wärter, die Ray befahlen, sich auf den Boden zu legen.
Bill Singer schloss die Augen. Wenigstens hatte er verhindert, dass Ray davonkam und noch jemanden tötete … oder sich selbst.
Wieder hörte Bill das Klingeln. Dann ohrenbetäubendes Gebrüll, das immer leiser wurde.
Dann nichts mehr.
3.
Marcus Williams sah, wie die Klinge in den Körper des Mannes drang. Ein Schwall Blut schoss aus der klaffenden Wunde und sprühte ihm ins Gesicht. Er hörte Maggie schreien, sah den Ausdruck auf ihrem Gesicht …
»Special Agent Williams?«
Marcus riss die Augen auf und sah die Vorzimmerdame, deren fragender Blick auf ihm ruhte. Ihr Tonfall ließ erkennen, dass sie ihn nicht zum ersten Mal ansprach. Offenbar war er eingedöst.
»Ja. Entschuldigen Sie«, sagte Marcus.
»Attorney General Fagan empfängt Sie jetzt«, sagte sie.
»Danke.« Marcus stand auf und ließ sich von der jungen Frau ins Büro von Trevor Fagan führen, seines Zeichens Assistent des Generalstaatsanwalts. Der Raum war kalt und nüchtern. Es roch nach einer seltsamen Mischung aus Pfefferminztee und Gurken. Das Büro war aufgeräumt und zeigte eine schier zwanghafte Aufmerksamkeit fürs Detail. Marcus nahm an, dass Dekor und Design den meisten Menschen elegant und ästhetisch ansprechend erschienen wären, aber auf ihn wirkte alles wie mit Gewalt ins Zimmer gequetscht. Das Büro schien nicht nach dem Geschmacksempfinden eines einzelnen Menschen eingerichtet zu sein, sondern nach den Vorgaben eines Ausschusses.
Fagan tippte weiter auf der Tastatur, als Marcus und die Vorzimmerdame eintraten. Er trug einen blauen Nadelstreifenanzug, und sein Haar war mit Gel nach hinten gekämmt. Es erinnerte Marcus an das glatte, glänzende Fell eines Flussotters, den er als Kind im Zoo in der Bronx gesehen hatte.
Die Vorzimmerdame schloss die Flügeltür hinter sich. Als sie fort war, warf Marcus die Aktenmappe, die er mitgebracht hatte, auf Fagans tadellos aufgeräumten Schreibtisch, wobei er darauf achtete, der Mappe gerade genug Schwung zu verleihen, dass die losen Blätter darin sich über Tischplatte und Fußboden verteilten.
Fagan fragte mit seinem Neuenglandakzent: »Wie kann ich Ihnen helfen, Special Agent Williams?« Er hatte immer noch nicht von der Tastatur aufgeblickt.
»Was zum Teufel soll das? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung.«
Fagan wandte sich ihm zu. »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihre Ansicht verstehe und dass wir sie überdenken werden. Das ist geschehen. Die Angelegenheit wurde besprochen. Wir haben entschieden, Ackerman am Leben zu lassen, weil er dann die beträchtlichen Kosten seiner Haft abarbeiten kann, indem er an bestimmten Forschungsvorhaben der CIA mitarbeitet.«
»Aber das Tageslicht wiedersehen wird er nicht?«
»Habe ich mich unklar ausgedrückt?« Fagan verzog das Gesicht. »Ihr Bruder hat Scharen von Menschen ermordet. Das wird ihm nicht allein deshalb verziehen, weil Sie nun eine glückliche Familie sind.«
»Mein Vater hat ihn gefoltert und an seinem Gehirn herumexperimentiert«, erwiderte Marcus. »Francis hat die Hölle auf Erden erlebt, und das ist kein leerer Spruch. Sie wissen doch, dass mein Vater Psychologe gewesen ist, dessen Traum es war, den Verstand von Serienkillern zu erforschen. Dieses Ziel wollte er erreichen, indem er Francis, seinen eigenen Sohn, zu einem dieser Ungeheuer machte. Mein Bruder wurde gezwungen, zu dem zu werden, was er ist. Unser Vater wollte sich einen Namen machen. Er wollte beweisen, dass er ein normales Kind in einen Psycho verwandeln kann – am Beispiel meines Bruders.«
»Das ändert aber nichts daran, dass Ihr Bruder ist, was er ist, und getan hat, was er getan hat.«
»Ich weiß. Es verlangt ja auch niemand, dass Francis vollen Straferlass bekommen und wieder auf die Welt losgelassen werden soll. Aber er ist in der einzigartigen Position, seine Taten wiedergutmachen zu können – oder es wenigstens zu versuchen. Wir jagen Serienmörder, und um dieses Ziel zu erreichen, brechen wir ohnehin schon eine Regel nach der anderen. Wenn wir Francis für uns einspannen, macht das auch nichts mehr aus.«
»Ihr Bruder ist ein gefährlicher Mann. Wie er dazu geworden ist, ist dabei unerheblich. Genauso wenig wie die Tatsache, dass er seit längerer Zeit dazu fähig ist, sich zurückzuhalten und nicht jeden zu ermorden, der ihm über den Weg läuft. Hätte ich Ihren Antrag genehmigt, wäre es vielleicht einen Tag gut gegangen, vielleicht sogar ein Jahr lang, aber am Ende hätte er Ihnen und Ihrem Team die Kehle durchgeschnitten und wäre spurlos verschwunden.«
Marcus setzte sich auf die Kante eines der weißen Ledersessel vor Fagans Schreibtisch, damit er dem Bürohengst in die Augen sehen konnte. »Wir haben noch immer den neuen NSA-Ortungschip mit der Tötungsfunktion, der in seiner Wirbelsäule implantiert ist. Wenn mein Bruder uns verrät, schalten wir ferngesteuert aus. Aber wir brauchen Francis. Seine Erfahrung und sein Wissen könnten unzähligen Menschen das Leben retten.«
Fagan lehnte sich zurück und faltete die Hände, dass die aneinandergelegten Finger ein spitzes Dach bildeten. »Ich glaube, dass die Polizei und das FBI uns ganz wunderbar beschützen. Bei extremen Fällen schaltet sich die Shepherd Organization ein. Aber Francis Ackerman junior?« Er schüttelte den Kopf. »Ich kann mir beim besten Willen keine Situation vorstellen, die so extrem wäre, dass ich ihn wieder auf die Straße lasse. Was sollte ich den Familien seiner Opfer sagen? Glauben Sie, die würden es billigen, wenn Ihr Bruder an eine Leine genommen und auf eine Spur angesetzt wird wie ein Jagdhund?«
»Denken Sie an Emily. Sie ist seine Therapeutin. Sie wäre dabei und könnte ihn überwachen. Sie gehört auch zu seinen Opfern und ist trotzdem mit meinem Vorschlag einverstanden.«
»Emilys Fall ist einzigartig, und das wissen Sie.«
»Ja, sicher. Aber Emily weiß, dass Francis das Richtige tun möchte. Ist das Andenken seiner Opfer nicht besser bewahrt, wenn er uns hilft, dafür zu sorgen, dass nicht noch andere Familien ähnlichen Schmerz und Verlust erdulden müssen?«
Fagan erhob sich und ging zur Bürotür. Marcus blieb sitzen.
»Die Entscheidung ist gefallen«, sagte Fagan. »Wenn Sie ihn bei einem Fall zurate ziehen wollen, gut. Aber Francis Ackerman junior bleibt im Käfig.«
Damit verließ Fagan ohne ein weiteres Wort, ohne eine Geste des Abschieds oder die Aufforderung, ihn zu begleiten, sein Büro.
Für einen Augenblick war Marcus verdutzt. »So kann man ein Gespräch auch beenden«, sagte er in das leere Büro, dann folgte er Fagan.
4.
Francis Ackerman junior blockte einen rechten Cross gegen seinen Kopf ab. Dann duckte er sich, um seinem imaginären Gegner einen Tiefschlag zu versetzen. Der unsichtbare Gegner krümmte sich zusammen. Blitzschnell zuckte Ackermans Faust hoch. Der Schlag trieb dem imaginären Widersacher das Nasenbein ins Gehirn und tötete ihn auf der Stelle.
Wie jedes Mal ließ Ackerman beim Training seiner Fantasie freien Lauf. Dadurch erhielt er Gelegenheit, manchen tödlichen Schlag und tödliche Kombinationen zu perfektionieren.
Seine Fingerknöchel schmerzten und bluteten von den Schlägen gegen die zehn Zentimeter dicke, durchsichtige Platte aus Polycarbonat. Bei jedem der immer schnelleren, immer wuchtigeren Hiebe jagten diese Wunden neue Wogen des Schmerzes durch Ackermans Körper, doch unbeirrt drosch er auf die Plastikwand ein, bis seine Muskeln dieser Folter nicht mehr standhielten – eine Folter, nach der sein Inneres sich sehnte. Als die Qualen ihren Höhepunkt erreichten, verringerte Ackerman allmählich das Tempo und die Wildheit seiner Schläge und ließ sich dann zu Boden sinken, erschöpft, verschwitzt und blutig.
Er hatte vorher schon bemerkt, dass zwei Männer ihn beim Training beobachteten, aber erst jetzt nahm er ihre Anwesenheit zur Kenntnis.
»Na, Bruderherz«, sagte er keuchend zu Marcus, dann schaute er auf Fagan. »Was für eine Ehre, Mister Fagan. Welchem Umstand verdanke ich dieses Vergnügen?«
Fagan ergriff das Wort. »Ihr Bruder hat mich überzeugt, dass ich herkommen und mir anhören sollte, was Sie zu sagen haben, ehe ich meine endgültige Entscheidung treffe.«
Ackerman leckte sich Blut von den Fingerknöcheln, wobei er sich aufrichtete. »Ich habe viel zu sagen. Grenzen Sie es bitte ein.«
»Wie wäre es mit einer Frage?«
»Nur zu, Trevor. Ich höre.«
»Wieso schlagen Sie mit solcher Wildheit auf die Plastikwand ein?«
»Zur geistigen und körperlichen Ertüchtigung.«
»Ziehen Sie in den Krieg? Sie scheinen zu trainieren, um jemanden zu töten.«
»Mit Kriegen und Kämpfen ist es so eine Sache, Trevor. Beides hat die unheimliche Eigenschaft, ganz von allein den Weg zu einem Krieger wie mir zu finden. Deshalb muss einer wie ich stets wachsam sein.«
»Sind Sie also ein Krieger?«
»Seit meiner Geburt. Mein Bruder und ich wurden geboren, um dem Pfad des Kriegers zu folgen. Nach der Geburt hatten wir die gleichen Voraussetzungen körperlicher und geistiger Art, aber wir wurden unterschiedlich geprägt. Bei mir war es mein wahnsinniger Vater, bei Marcus ein Pflegevater, ein New Yorker Polizist, wie Sie sicher wissen. Deshalb entwickelten wir uns auf verschiedene Weise. Aber wir jagen beide, und wir töten beide, denn wir haben dieselben Eltern, die gleichen Gene. Die Natur hat meinem Bruder und mir bei der Geburt eine Menge Scheiße eingebrockt – und als Bonus eine große Portion Wahnsinn.«
Fagan blickte auf die Uhr. »Sie meinen, wir sollen über Ihre Sünden hinwegsehen, weil Sie sie gewissermaßen geerbt haben?«
»Nein. Aber Sie sollten mir diese Sünden nicht vorhalten.«
»Wieso? Wollen Sie Buße zu tun? Für das, was Sie getan haben, gibt es keine Vergebung, Mister Ackerman.«
»Ich brauche keine Vergebung. Ich glaube, dass Gott mir bereits alle Vergebung erteilt hat, die ich benötige.«
»Weshalb ist es Ihnen dann so wichtig, Buße zu tun?«
»Wir sind alle zusammen auf dem gleichen Rettungsfloß und warten darauf, dass Gott uns in die nächste Existenzebene holt. Sie können diese Ebene Himmel nennen. Sie können sie nennen, wie Sie wollen. Sie können glauben, was Sie wollen. Tatsache bleibt, dass wir alle auf dem gleichen Rettungsfloß sitzen und die gleiche begrenzte Existenz erdulden, die wir mit Milliarden anderer teilen. Die Frage ist nur, was für ein Passagier Sie auf dem Rettungsfloß sein wollen.«
»Was für einer möchten Sie denn sein, Mister Ackerman?«
»Wir alle sind die Summe unserer Teile. Milliarden Gedanken und Gefühle, Erfahrungen und Lektionen, Fehler und Sünden aus unserem eigenen Leben und dem unserer Ahnen. Das sieht der göttliche Plan so vor. Ein Plan, der jeden von uns zu seiner ganz persönlichen Denkweise geführt hat – und zu dem Punkt in der Lebensreise, an dem wir alle uns genau jetzt befinden, in diesem Augenblick, auch Sie und ich.«
»Oh, ein Philosoph«, sagte Fagan. »Aber Sie weichen meiner Frage aus.«
»Welcher?«
»Was für ein Passagier Sie sein möchten. Auf diesem Rettungsfloß, das Sie beschrieben haben. Warum sollte ich ausgerechnet einen Irrsinnigen wie Sie, der jahrelang andere über Bord dieses Floßes gestoßen hat, einen Blick auf die Freiheit werfen lassen?«
»Ich bin überzeugt, dass mein Bruder und ich aus einem guten Grund zusammengeführt wurden, Trevor. Ich glaube, dass eine höhere Präsenz, nennen wir sie Gott, Güte, Licht, wie auch immer, meinen Bruder und mich hierher geführt hat, damit wir unsere Intelligenz, unser Wissen, unsere Erfahrungen und Gaben vereinen – auf eine Art und Weise, die den anderen Passagieren auf dem Rettungsfloß, das wir Erde nennen, hilft und sie vor Schaden bewahrt. Gott wünscht, dass ich meine Schuld sühne, indem ich helfe, andere vor Leuten wie mir selbst zu beschützen.«
»Und dieser Wunsch«, sagte Fagan, »hat nichts damit zu tun, dass einem Mann wie Ihnen die Jagd auf Killer und andere Bestien einen Heidenspaß machen würde? Dass es Sie mit Genugtuung erfüllen würde, diesen Mördern und Totschlägern zu zeigen, dass Sie besser, schneller und stärker sind als jeder von ihnen? Wollen Sie wirklich behaupten, dass es Ihnen nicht auch um dieses Vergnügen geht?«
Ackerman zuckte mit den Schultern. »Wer sagt denn, dass Buße keinen Spaß machen darf?«
5.
Judas hatte beschlossen, Peter Spinelli in sicherem Abstand zu folgen, denn der Mann kannte sein Gesicht. Zum Glück befanden sie sich an einem öffentlichen Ort, an dem es viele Möglichkeiten gab abzutauchen.
Peter Spinelli war das technische Genie, das die Software zur Gefahrenanalyse entwickelt hatte, die Scott Powells neues Gefängnis erst ermöglichte. Der junge Techniker war von seiner Freundin zu einer Reise überredet worden; Ziel war eine Touristenfalle namens Sedona in Arizona. Judas hatte von mehreren Seiten gehört, Sedona sei dank seiner roten Felsenwüstenlandschaft eines der schönsten Reiseziele der Welt.
Die Ortschaft war auch eine beliebte Anlaufstelle für Spiritisten und »Heiler«, da angeblich »Kraftströme« über die Gegend verteilt waren. Judas wusste bereits, dass Peters Freundin von diesen Kraftströmen regelrecht fasziniert war.
Na, die passt ja auch ins Muster dieser Freaks, überlegte Judas. Ihr Haar hatte blaue Strähnen, und sie trug Kampfstiefel zu ihrem Sommerkleid. Peter selbst war mit Tarnshorts und T-Shirt bekleidet.
Judas verabscheute diese dummen Amerikaner. Von dem Benzingeld, das sie für die stundenlange Fahrt nach Sedona verschleuderten, hätten sich in anderen Ländern ganze Familien satt essen können. Und das alles, um indianischen Schmuck zu kaufen und so zu tun, als würde man »Kraftströme« spüren.
Das Schlimmste war, dass sie ihm, Judas, die Fahrt hierher aufgezwungen hatten, um seine Mission zu vollenden.
Und heute war der einzige Tag, an dem diese Mission stattfinden konnte. Der Zeitplan musste eingehalten werden. Wenn auch nur einer der Dominosteine, die Judas aufgestellt hatte, verschoben wurde, geriet die gesamte Ereigniskette in Gefahr.
Natürlich würde er sich anpassen und improvisieren müssen, je weiter der Plan voranschritt, aber er mochte das Improvisieren nicht. Er mochte es, einen Plan zu haben. Ein Drehbuch zu schreiben und sich daran zu halten.
Dass er nun unvorbereitet handeln musste, konnte nur eins bedeuten: Man hatte während der Planungsphase irgendetwas übersehen. Wenn man eine Arbeit korrekt ausführte, fiel jeder Dominostein immer so, wie er fallen sollte. Den Plan abzuwandeln hieß Irrtümer einzugestehen, die eigene Fehlbarkeit.
Die besten Strategen hatten vor ihren Gegnern ein Dutzend gedankliche Schritte Vorsprung, und Judas wollte, dass eines Tages die zukünftigen Historiker seine Methoden untersuchten. Eine Abweichung vom Plan war nicht nur ein Angriff gegen ihn persönlich, sondern ein Angriff auf sein Vermächtnis.
Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Peter Spinelli. Die Freundin zog ihn an der Hand durch die Reihen der Kunden und Schaulustigen vor den Souvenirläden, an denen von Modeschmuck bis hin zu Kunstwerken und Kleidungsstücken alles Mögliche verkauft wurde. Der angenehm süße Duft von Zimtbrezeln hing in der Luft, wurde dann aber vertrieben vom beißend riechenden Qualm aus dem Auspuff eines vorüberfahrenden Straßenkreuzers. Vom Highway 89A drangen die Geräusche dröhnender Hupen und aufheulender Motoren heran. Dort herrschte dichter Verkehr, weil Leute hinter dem Lenkrad saßen, die nicht schnell genug zur nächsten Touristenfalle oder zur nächsten Yogastunde kommen konnten.
Judas schaute sich die Kauflustigen an, die nichts ahnten von der Gefahr, die sie umgab. Ihnen schien nicht bewusst zu sein, dass sich jedes menschliche Wesen stets am Abgrund des Todes bewegte. Judas grinste. Und es war so einfach, ihnen einen kleinen Stoß zu versetzen. Sie waren so leicht zu manipulieren. Ihre Ängste und Begierden ließen sich so einfach gegen sie wenden. Es war ein Klacks, die absolute Macht über sie zu erlangen, sie zu vernichten oder – wenn man ein wahrer Künstler war – sie zur eigenen Zerstörung zu ermutigen.
Während Judas diese Gedanken durch den Kopf gingen, schlug sein Herz schneller. Er merkte, wie er nach und nach die Kontrolle verlor, als die schwarzen Gewitterwolken der Wut heranzogen. Eine Wut, die sich nicht gegen die Kauflustigen und ihre Familien richtete, sondern gegen den, der verschuldet hatte, dass dies alles hier notwendig war.
Aber im Moment waren die ahnungslosen Passanten willkommene Ersatzopfer für Judas’ Zorn.
Pläne waren im Gang, und der arme, nichtsahnende Peter Spinelli war der Dominostein, der als Nächster umgestoßen werden musste. Judas hatte es kaum abwarten können, sich endlich mal wieder die Hände schmutzig zu machen.
Mit ein paar schnellen Schritten schloss er zu Peter und dessen Freundin auf, indem er sich durch die Menge schlängelte. Peter ging in südlicher Richtung über den Gehweg, der an den belebten Highway grenzte.
Als Judas dicht hinter seinem Opfer war, schob er ihm die Münze und die Nachricht in die Tasche. Dann tippte er ihm auf die Schulter.
Peter drehte sich um. Die Hand seiner Freundin entglitt seinen Fingern, aber die junge Frau wandte nicht einmal den Kopf, um festzustellen, weshalb Peter ihre Hand losgelassen hatte. Stattdessen galt ihr Interesse weiterhin irgendwelchen Kinkerlitzchen. Das Ziel war ihr wichtiger als die Reise.
Peter erkannte Judas anfangs nicht. Dann aber hob er die Brauen, als ihm etwas dämmerte.
Judas verübelte Spinelli sein schlechtes Personengedächtnis keineswegs. Schließlich trug er, Judas, Prothesen, damit niemand einem Phantombildzeichner seine Beschreibung liefern konnte.
»Hallo, Peter. Genießen Sie Ihren freien Tag?«, fragte Judas.
Und da kam es. Der Schimmer des Wiedererkennens.
Wie von ihm erhofft, erkannte Peter seine Stimme. Jetzt wusste er endgültig, wen er vor sich hatte. Die Augen des Softwaredesigners leuchteten auf, und er neigte den Kopf zur Seite. Vermutlich fragte er sich verwirrt, weshalb der Mann, den er von der Arbeit kannte, so anders aussah.
Für Judas war es wichtig, dass Peter wusste, wen er vor sich hatte. Dass er wusste, wer ihm antat, was in einer Sekunde geschehen sollte.
Judas genoss die Verwirrung in Peters Augen.
Im gleichen Augenblick stieß er ihm die schlanke schwarze Klinge in die Brust, durchbohrte Lunge und Herz.
Fasziniert beobachtete er, wie die Fragen auf dem Gesicht des Sterbenden einem Ausdruck von Schmerz und Fassungslosigkeit wichen, ehe sie verblassten. Peters Gesicht wurde tot und starr.
Judas hielt diesen wundervollen Augenblick fest, solange er konnte. Dann stieß er sein Opfer in den brodelnden Verkehr und verschwand wie ein Schatten in der Menschenmenge.
6.
Special Agent Maggie Carlisle bremste den Camaro langsam neben dem Baseballplatz. Der rechte Vorderreifen stieß gegen die Parktaschenbegrenzung aus Beton. Maggie hielt, stellte den schweren Motor ab.
Dann senkte sie den Kopf auf das Lenkrad und weinte.
Sie war stets eine unerschütterliche Optimistin gewesen, ein Fels in der Brandung. Nun aber glaubte sie, die Fassade nicht mehr aufrechterhalten zu können.
Nicht nach dieser Hiobsbotschaft.
Doch Maggie erlaubte sich nur ein paar Sekunden des Selbstmitleids, dann hob sie den Kopf und wischte sich die Tränen ab. Sie wollte nicht, dass Marcus sie so sah. So verletzlich, so schwach.
Ein Blick in den Innenspiegel. Na ja, geht so. Zum Glück trug sie nie viel Make-up, daher gab es keine Streifen auf ihren Wangen.