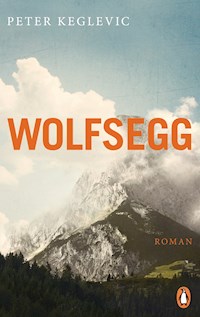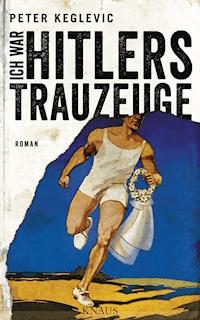
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fulminanter Roman über die Absurdität der letzten Kriegswochen
Anfang April 1945, die letzten Tage des »Dritten Reiches«. Bislang konnte der untergetauchte Jude Harry seinen Häschern entkommen, doch nun hat ihn das Glück verlassen. Wäre da nicht Leni Riefenstahl, die aus dem großen Lauf für den »Führer«, der in zwanzig Etappen von Berchtesgaden aus tausend Kilometer durch das »Tausendjährige Reich« führt, noch den großen Durchhaltefilm drehen soll. Doch es ist nicht mehr leicht, genügend Teilnehmer aufzubieten, und so gerät Harry dank Riefenstahls Hilfe in den Pulk der Läufer. Der irrwitzige Lauf führt ihn schließlich bis in den Berliner Führerbunker, wo er nicht nur als Trauzeuge von Adolf Hitler und Eva Braun Geschichte schreibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Ostersonntag 1945, ganz Berchtesgaden ist auf den Beinen. Zum 13. Mal wird der große Volkslauf »Wir laufen für den Führer« gestartet, eintausend Kilometer in zwanzig Etappen durch das Tausendjährige Reich. Der Sieger darf Adolf Hitler am 20. April persönlich zum Geburtstag gratulieren. Doch im Frühjahr 1945 ist es nicht leicht, eine stattliche Bewerberschar aufzubieten. Dank Leni Riefenstahl, die das Ereignis begleiten und den großen Durchhaltefilm drehen soll, gerät der untergetauchte Jude Harry Freudenthal in den Pulk der Läufer. Damit rettet die Regisseurin Harry vor dem Erschießen. Der irrwitzige Lauf nach Berlin wird für Harry, der sich Paul Renner nennt, zur Odyssee – durch Deutschland und durch sein erinnertes Leben. Bis er schließlich im Führerbunker Geschichte schreibt.
Mit großer Lust am historischen Detail und der Absurdität der Ereignisse in den letzten Wochen des Dritten Reichs erzählt Peter Keglevic die beispielshafte Lebensgeschichte eines Berliner Juden, der es bis in den Führerbunker schafft und dessen Schicksal aufs engste mit dem von Adolf Hitler verbunden ist.
Der Autor
Peter Keglevic, geboren 1950 und gelernter Buchhändler, ist ein erfolgreicher TV-Regisseur, ausgezeichnet u. a. mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis. Seit über 20 Jahren hat er für »Laufen für den Führer« und die Lebensgeschichte von Harry Freudenthal recherchiert. »Ich war Hitlers Trauzeuge« ist sein erster Roman.
Weitere Informationen zu unserem Programm unter www.knaus-verlag.de
PETER KEGLEVIC
ROMAN
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung für externe Links ist stets ausgeschlossen.
Copyright © 2017 beim Albrecht Knaus Verlagin der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Schutzumschlag: Sabine Kwauka
Schutzumschlagmotiv: © Interfoto/Bjarne Feiges; Shutterstock/Katrien 1
Der Verlag dankt Michael Ritz vom Landkartenarchiv.de, der für den Vorsatz die Panoramakarte »Deutschland, das schöne Reiseland« (© Landkartenarchiv.de) zur Verfügung gestellt hat. Die Karte ist 1935 erschienen und zeigt das Deutsche Reich vor der Expansion unter Hitler. Sabine Kwauka hat die Streckenverläufe von »Wir laufen für den Führer« eingezeichnet und für den Streckenverlauf 1945 das Städtchen Braunau ergänzt.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-18011-9V001
»Die Wahrheit kann warten, denn sie hatein langes Leben vor sich.«
Arthur Schopenhauer
NEW YORK, 19. OKTOBER 2015.
Alles ist schwarz. Ich habe die Augen geschlossen, und über mir wölbt sich das Dunkel. Es liegt etwas in der Luft. Alle meine Sinne sind angespannt. Ich höre, wie sich hinter mir die Ladentür öffnet und das Glöckchen über dem Rahmen bimmelt. Lauter, viel lauter schellt es heute als sonst. Bedeutet das etwas? Wie mein Erlebnis vorhin, auf dem Weg zu Joe?
Ich bin an einem Laden vorbeigekommen. Die Schaufensterscheibe war noch mit Packpapier zugeklebt, aber an einer Seite hing ein Streifen herunter. Ich lugte hinein und sah, dass es ein Tätowierstudio werden würde. Tafeln mit farbenprächtigen Mustern und Motiven hingen an der Wand. Ein Bild stach mir sofort in die Augen: Girlanden? Vielleicht Weinranken? Oder … Da schob sich hinter der Scheibe eine Gestalt ins Licht. »Wir eröffnen heute Abend!«, sagte sie durchs Fenster und klebte die gelöste Papierbahn wieder auf das Glas. »Dieses Motiv da, das mit den …«, ich erschrak, denn unwillkürlich kam das Wort »Gehenkten« über meine Lippen. »Woher kommt es?« »Keine Ahnung, Mexiko? Russland?«, sagte die Stimme. »Ich glaube, ich hab’s früher schon mal gesehen!«, rief ich und klopfte an die Scheibe, und die Stimme dahinter antwortete: »Dann wissen Sie ja alles!«
Ich klammere mich an die Stuhllehne. Jemand ist in den Laden getreten und hat für Augenblicke Geräusche von draußen mitgebracht. Jemand, der hinter mir her ist? Wegen meines Geheimnisses? Die Tür fällt mit einem Bimmeln wieder ins Schloss, und der Lärm reißt ab. Es ist Boris Makaver, ich erkenne ihn am Husten, mit dem er uns grüßt. Kein Grund, die Augen zu öffnen.
Ich beruhige mich allmählich. Happy Hour im Klassikkanal des Radios: »Und hier, direkt aus der Bar: Dean Martin!« Der Ventilator scheppert, Füße scharren leise. Und über allem das unermüdliche Schnappen einer Schere. Ja, mein Geheimnis, plötzlich bohrt es sich in die Wirklichkeit, wie der Krokus durch den letzten Schnee.
»Send me the pillow that you dream on – so darling I can dream on it, too …« Während ich mit geschlossenen Augen im grünen Lederstuhl sitze, den Kopf bequem auf der Nackenrolle, und Joe meine Haare schneidet, und wir das Für und Wider der Operation meiner Milz wegen Splenomegalie erörtern, trifft es mich unvermittelt: Mit 95 muss auch ich mit dem Ableben rechnen. War es dann nicht an der Zeit, mein Geheimnis zu lüften? Ich öffne vorsichtig die Augen, und wie zur Bestätigung starrt mich im Spiegel von Joe’s Barbershop, West 169/Fort Washington Ave., mein altersfleckiges, fleischgewordenes Krankenblatt an: vier Bypässe, launische Prostata, Keramik-Hüftgelenk links (seit 1999), querulanter Alterszucker …
Joe ist mit dem Haarschnitt fertig und seift nun mein Gesicht ein. Joe! Er ist afroamerikanischer Abstammung – wie ich gelernt habe, es korrekt zu sagen. Er sieht mich ungeduldig an und rüttelt mich. »Paul! Hörst du überhaupt zu? Wie ich dich dem großen Slick Whitey Ford vorgestellt habe? Weißt du noch? Das war ein Typ. Nicht so ein Würstchen, wie sie dir heute im Rudel begegnen und du sie am liebsten in ein Senfglas tunken wolltest!«
Ich brumme zur Bestätigung und lächle – Joe und seine Yankees!
»Wenn ich meinen Job so machen würde wie die meisten dieser Jungs – meine Herrschaften, wie würden dann meine Kunden aussehen! Wie mit ’ner Glasscherbe barbiert! Kassieren ’ne Kohle, wovon wir nur träumen können …«
Joe macht sich keine Gedanken über die Vergänglichkeit. Nicht, dass ich wüsste. Und ich kenne ihn nun schon seit 70 Jahren, und seit über einem halben Jahrhundert schneidet Joe mir die Haare und rasiert mich. Ich sehe im Spiegel, wie das Rasiermesser über meine linke eingeseifte Gesichtshälfte gleitet, so spielerisch, als verteilte ein jugendlicher Gangster die Karten für eine Runde Poker. Zärtlichkeit erfüllt mich für den alten Mann, der, während er vertanen Innings und vergeblichen Homeruns nachtrauert, meine Wangen rasiert, als streichle er einen Babypopo. Für alle Zeit bleibt Joe mit dem Anblick eines blühenden Apfelbaums verbunden. Da hing dieser schwarze Mann am Fallschirm im Apfelbaum, 15 Kilometer von Bayreuth entfernt, und die Blüten rieselten wie Schnee. Ein abgebrochener Zweig steckte in seinem wolligen Haar, und weil die Sonne hinter ihm stand, sah Joe im Gegenlicht aus wie ein kräftiges Zulu-Mädchen. Und da war dieser Geruch! Obwohl es erst Frühjahr war und der Baum nur Blüten trug, roch es nach Apfel. Und der Apfelduft stieg durch meine Nase mitten in das Zentrum der Sehnsucht. Sehnsucht nach einem Biss in einen Apfel. Ohne Flucht, Hetze, Angst. Einfach den Bissen kauen, bis Süße und Säure die Zunge und den Gaumen entlangfließen, über den Mundvorhof in die Schlundenge gleiten und schließlich in den Rachen rutschen. Alkmene aus Brandenburg! Eine Borgsdorfer Renette! Pfannkuchen mit Altländer-Apfelkompott!
Auch unser Wiedersehen 1959 war mit Apfelgeruch verbunden. Ich glaube, es war die Sorte Yellow Bellflower aus New Jersey. Oder Westfield Seek-no-Further. Damals wohnten wir noch unten in Brooklyn, wo auch unsere Töchter zur Welt gekommen sind. Sarah, Esther, Judith – alle im Flatbush General Hospital entbunden. Sooft es mir möglich war, lief ich damals am Strand von Coney Island. Links der Atlantik, rechts der hölzerne Boardwalk. Es war früher Morgen, und kaum einer war am Brighton Beach unterwegs. Nebel hing über der hölzernen Pier, und ich konnte den Rollercoaster hinten kaum erkennen.
Pach, pach, pach machten meine Füße auf dem feuchten Sand. Tak, tak, tak klang es oben auf den dicken Bohlen der Pier. Chh, chh, chhh macht es, wenn man durch kniehohes Gras läuft. Ja, ich kenne mich aus mit dem Laufen. Ich bin Spezialist, mein Lebensmotto: Ich laufe, also bin ich. Seitdem ich denken kann, laufe ich. Es geht gar nicht anders. Es ist wie ein Reflex, immer bin ich in Bewegung. Denn wenn man in Bewegung ist, kriegen sie einen nicht. So ist das nämlich.
Aber an dem Tag war etwas anders. Etwas irritierte mich. Ich sah zur Holzpier hoch. Dort fuhr ein Schwarzer auf dem Fahrrad parallel mit mir. Gemächlich fuhr er auf gleicher Höhe und studierte mich wie nebenbei. Dann offensichtlicher. Ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Jetzt taxierte er mich direkt. Was wollte der von mir? Wollte er mich überfallen? Ich überschlug, dass ich nur die Wohnungsschlüssel und einen Dollar dabeihatte. Aber, dachte ich, was ist, wenn er mich niederschlägt und die Wohnungsschlüssel raubt, und wenn er weiß, wo ich wohne, und wenn er …
Ich lief schneller. Auch der Schwarze zog das Tempo an. Ich kam ins Schwitzen und war mir sicher, er hatte es auf mich abgesehen. Schweiß wurde zu Angstschweiß. Ich kannte diesen Geruch nur zu gut, der jeden Hund und jeden SS-Mann anlockt. Weit und breit war kein Mensch, der mir hätte helfen können. Da brüllte der Schwarze von oben zu mir herunter:
»Was soll das sein? Ein Laufstil? Alles vergessen, HERR PAUL? In so kurzer Zeit!? Leg gefälligst die Ellenbogen enger an, und streck den Hintern nicht so weit raus, sonst gibt’s Ärger, und das nicht knapp!«
Langsam sickerten diese Sätze in mich hinein, ganz allmählich begriff ich das Unglaubliche.
»Lieutenant Joe Irving?«
»Wer sonst sieht das ganze Elend deiner Technik?«
Mir schossen die Tränen aus den Augen. Joe kam die Stufen herunter, eingehüllt in eine Wolke aus Apfelblütenduft. Wir liefen aufeinander zu, umarmten uns und tanzten und hopsten im Sand. Lieutenant Irving, war das denn möglich! Ein Wunder. Ich hätte nicht erwartet, ihn in diesem Leben wiederzusehen. 1st Lieutenant Joe Irving! Der »roi noir«, den wir »Roy Black« nannten. Lieutenant Irving, dem ich mein Leben verdankte. Der jetzt aber kein Lieutenant mehr war, weil sie ihn aus der Army entlassen hatten, nachdem er sich für die Freiheit der Welt in Korea die halbe Hüfte hatte wegsprengen lassen. Jetzt war er wieder nichts anderes als ein Niggerfriseur.
Und seitdem ist er auch mein Friseur.
Ja, das Leben, vielmehr das Überleben, ist ein Wunder. Wie zur Bestätigung, dass stetes Misstrauen angebracht ist, legt Joe unter dem Rasierschaum einen braunen Fleck frei. Genau über der Stelle taucht er auf, wo der Unterkieferknochen im Jochbein eingehängt ist. Ich beuge mich vor und schiele mit schiefem Kopf auf das Mal.
»Was ist das für ein Fleck? Joe, hast du den schon früher gesehen? Sieht aus wie ’ne neue Friedhofsblume.«
Joe dreht mich mit dem Stuhl vor sich und sieht mich genervt an. »Ja. Er war auch gestern schon da und auch vor zehn Jahren. Seit ich dich kenne, nervst du mit Krankheiten, die immer tödlich ausgehen könnten, mit Symptomen, die immer das Schlimmste bedeuten. Seit ich dich kenne, redest du vom Sterben wie andere von ihrem Auto, ihren Frauen oder Kindern. Dabei bist du einfach nur ein unbelehrbarer Hypochonder.«
Ich höre die Blätter des Ventilators durch die Luft schneiden, höre, wie der Rasierschaum in der Schale knisternd zusammenfällt, höre das Blubbern des Dampftopfes, in dem die Kompressen erhitzt werden, die es nach der Rasur auf das Gesicht gibt, das Husten des wartenden Makaver. Ich sehe unsere ganze Mischpoke, höre meinen Vater, der mich an meinem 13. Geburtstag zur Seite nimmt, mir die Arme auf die Schultern legt und mich aufmunternd anlächelt: »Es liegt in unserer Natur, dass wir immer mit dem Schlimmsten rechnen und dass der nächste Schritt tödlich sein kann.«
Ich nicke und lächle Joe an.
»Du hast ja Recht, Joe.«
Besänftigt rasiert er mich zu Ende.
»Natürlich hab ich Recht.«
Hat er natürlich nicht. Mein Vater hatte Recht. So habe ich es seit meinem 13. Geburtstag gehalten. Erst unfreiwillig, dann gezwungenermaßen und schließlich aus tiefster Überzeugung. Gibt es einen zwingenden Grund, nicht mit dem täglichen Ableben zu rechnen? Vor allem in meinem Alter. Da ist Weitsicht mehr als angebracht.
»So, jetzt ist Vorsicht geboten«, sagt Joe.
Das Rasiermesser schabt an meinem Kehlkopf, und ich halte mit geschlossenen Augen angespannt still. Es ist jedes Mal der Kitzel des Überlebens. Jedes Mal der Gedanke, wird ausgerechnet heute Joe verrückt und schneidet mir die Kehle durch? An dieser Stelle überkommt mich eine kleine Panik. Und da weiß ich es plötzlich: Es wird wirklich allerhöchste Zeit, mein Geheimnis zu lüften.
Ich reiße beide Augen auf, Joe hält irritiert inne, das Messer blitzt gefährlich nah vor meinen Augen.
»Ich war sein Trauzeuge.«
»Trauzeuge? Von wem?«
»Von ihm.«
»Von wem, ihm?«
Joe starrt mich an, und allmählich dämmert ihm ein fürchterlicher Verdacht. Er schüttelt beschwörend den Kopf.
»Nein … nein, das meinst du nicht im Ernst.«
Ich nicke mit der ganzen Würde und Bürde der Vergangenheit.
»Doch! Ich war Hitlers Trauzeuge, und ich habe …«
»Was hast du?«
»Wart’s ab.«
SAMSTAG, 31. MÄRZ 1945: 2039.
Es war später Nachmittag, unsere kleine Pilgergruppe lief weit auseinandergezogen. Ich bildete die Nachhut, weil ich zuverlässig und ausdauernd war. Würde einer meiner Kameraden schwächeln, sollte ich ihn auffangen und sicher weiterbringen. Vor mir hatte ich schon länger keinen mehr gesehen, und so musste ich die Abzweigung von der Saalach an die Stoißer Ache verpasst haben. Ich hatte vor mich hin geträumt und meine Freunde verloren. War es gerade eben geschehen oder schon eine Weile her? Nochmals zurückgehen und den Weg zur Ache suchen? Oder weitergehen und einen anderen Weg nach Südwesten finden? Letzteres schien mir vernünftiger zu sein. Es begann zu dämmern. Weit und breit kein Licht, nicht einmal das eines einzelnen Gehöfts. Ich wartete eine Weile, bis sich meine Augen an das Halblicht gewöhnt hatten, und ging weiter. Es war angenehm mild für Ende März. Kein Wind, kein Regen. Ausnahmsweise war das Glück mit mir.
Der Weg führte bergan. Bald war er steinig und glich einem ausgeschwemmten Bachbett. Offenkundig lief ich in die Berge. Ich blieb stehen. Es machte keinen Sinn, halbblind weiterzusteigen, ohne Orientierung, obwohl ich noch gut und gerne ein, zwei Stunden hätte weitergehen können. Ich aß eine gekochte, kalte Kartoffel samt Schale, kaute oft und langsam, denn so wird der Hunger am ehesten gestillt, und starrte in das nächtliche Grau vor mir.
Allmählich zeichneten sich Konturen ab, ich bekam Herzrasen. Ich kannte die Umrisse! Es war der Untersberg, seine Rückseite! Ich wusste, wo ich war, denn ich kannte diese Gegend seit Kindertagen.
*
Bis 1932 waren wir jedes Jahr im Platterhof zur Sommerfrische gewesen. Die ganze Familie. Die Eltern, Großmutter, meine zwei Brüder Herrmann und Helmut und Hilly, meine ältere Schwester. Wir hatten den ganzen ersten Stock für uns. Als ich zwei war, hatte mir dort einmal Sigmund Freud ein Stück Würfelzucker in den Mund gesteckt, das er vorher in Schnaps getunkt hatte. »Onkel Fredi«, wie ich ihn unerklärlicherweise nannte, verbrachte, wie wir, mit seiner großen Familie die Ferien in den Bergen. Aber er ist nur auf den flachen Wegen spazieren gegangen. Arthur Schnitzler hatte Freud wohl öfter besucht. Aber an ihn kann ich mich nicht erinnern, von ihm hat man mir später erzählt, als wir schon lange nicht mehr in die Sommerfrische fuhren.
Mein persönlicher Held aber war Bruno, der Besitzer des Hofes. Er war Radrennfahrer, Autorennfahrer, und er flog mit dem Pfalz-Doppeldecker für Lettow-Vorbeck Kampfeinsätze von Sansibar bis zum Kilimandscharo. Er baute mit mir meine erste, selbst geplante Seifenkiste Heia Safari, benannt nach meinem Lieblingsbuch. Dabei erzählte er, wie er den Doppeldecker in ein Wasserflugzeug umgebaut hatte und dann den Rufiji entlangpatrouilliert war, um die SMSKönigsberg zu beschützen. Seine Frau Sissi zeigte mir die Nilpferdpeitsche, die sie aus Deutsch-Ost mitgebracht hatte. Sie war aus vielen Schwanzhaaren zu einem Strang geflochten, und das schwarze Leder war mit Silberdraht umwickelt. Ich ließ sie durch die Luft sausen und malte mir aus, wie sie den Rücken eines schwarzen Sklaven aufplatzen ließ. Zisch! Platsch! Sissi nahm mir die Peitsche aus der Hand und lächelte.
»Wenn du einmal groß bist und es verdienst, bekommst du auch eine.«
Aber diese Peitsche, die sie zärtlich in braunes Seidenpapier einpackte, war für Herrn Wolf, der sich früher bei ihnen versteckt hatte. Egal. Dafür sauste ich mit der Heia Safari die Bergstraße hinunter, landete aber schon nach der zweiten Kurve in den Strohballen, die Bruno vorsorglich aufgestellt hatte. Die Seilklemme war nicht fest genug angezogen, und darum schoss das Bremsseil aus der Ösenschraube, anstatt das Bremsrohr nach unten zu drücken.
Als ich acht war, war ich einmal im Berghof, als er noch Haus Wachenfeld hieß. Frau Kommerzienratswitwe Winter-Wachenfeld aus Buxtehude hatte mich zu einer Limonade ins Wohnzimmer eingeladen. Ich hatte ihr geholfen, den Garten aufzuräumen, Erdbeeren und Johannisbeeren gepflückt, den Kompost umgeschichtet. Sie war ja uralt, bald achtzig, mit krummem Rücken, bei ihr konnte ich mir gut das Taschengeld aufbessern. Durch das geöffnete Fenster, das noch ein normales Fenster war und nicht die berühmte, versenkbare Panoramascheibe, schauten wir auf den Untersberg.
»Da drüben, Harry, wohnt mitten im Berg ein verzauberter alter Kaiser«, sagte Frau Winter-Wachenfeld, die wir Kinder »Trude aus Buxdehude« nannten. »Die einen sagen, es ist Karl der Große, andere sagen, dass es der Stauferkaiser Friedrich ist. Da sitzt er, welcher Kaiser auch immer, auf einem Bergkristallthron im Marmorpalast, inmitten seines Heldenheeres, und wartet auf jene Stunde, die ihm der Rabe ankündigen soll: Stehe auf und rette das deutsche Volk! Und das Volk leistet dann den Treueschwur: Zum Kaiser und zum deutschen Volk, will immer treu ich halten – Und jedem, der uns lästern sollt, kecklich den Schädel spalten! Dann zieht der Kaiser aus dem Berg, erkämpft den Sieg, und der Herold verkündet die Geburt Großdeutschlands!«
Genau in diesem Augenblick hielt unter dem Fenster ein Wagen, und Herr Hitler und Herr Speer stiegen aus. Sie nahmen einen tiefen Zug frische Bergluft und genossen das Panorama. Herr Hitler nahm Herrn Speer an der Schulter, zog ihn nah zu sich, Wange an Wange waren sie, und zeigte mit langgestrecktem Arm ins Salzburgische.
»Sehen Sie, mein lieber Speer, den Untersberg dort drüben. Es ist kein Zufall, dass ich ihm gegenüber meinen Sitz habe.«
Dabei klopfte sich Herr Hitler mit der Nilpferdpeitsche, die er in der anderen Hand hielt, gegen das Bein.
Da war ich acht. Als ich zehn war, hing schon an jedem Haus am Obersalzberg die rote Fahne mit den schwarzen Balken, und als ich mit dem Franzi, dem Sohn vom Türkenwirt, auf den Kehlstein hoch bin, fuchtelte der Franzi plötzlich in die Luft und schrie:
»Ein Zeichen, ein Zeichen! Das Kreuz!«
Und tatsächlich, mit ein wenig gutem Willen konnte man sehen, wie sich die Wolken zu einem Hakenkreuz zusammenschoben. Franzi war ganz aus dem Häuschen, und ich ließ mich zugegeben davon anstecken. Da standen wir und streckten den Arm grüßend gegen diese prophezeiende Wolkenformation, bis sie zerfloss und sich schließlich in nichts auflöste. Danach onanierten wir. Ich hatte die getragene Unterhose meiner Schwester Hilly mitgenommen, wir rochen am Schritt, wo eine kleine gelbe Spur lag, und legten los.
1932 war ich zwölf, und obwohl Vater, wie jedes Jahr, die Unterkunft telegraphisch bestellt und bestätigt hatte, teilte uns Bruno bei unserer Ankunft mit, dass wir nicht im Platterhof wohnen konnten. Ein sinnloser Dialog entspann sich. Vater bestand auf der rechtmäßigen Reservierung, Bruno beharrte darauf, dass mein Vater nicht im Voraus bezahlt habe, damit sei die Reservierung verfallen.
»Aber ich habe immer erst bei Ankunft bezahlt! In bar!«, brüllte mein Vater. »Seit 1919!«
»Das war immer schon unkorrekt! Ich hab’s bloß durchgehen lassen. Aus Gefälligkeit!«, brüllte Bruno zurück.
Ich bin nach draußen gegangen, weil mir die Brüllerei Angst machte und weil mir ein Gedanke durch den Kopf ging. »Seit 1919!«, hatte mein Vater gesagt. Also meinte er Sommer 1919, und ich wurde am 15. März 1920 geboren. Ich zählte an meinen Fingern nach. Neun! Das waren neun Monate! Also hatten sie mich während der Sommerfrische im Zimmer 7, das die Eltern immer hatten, gezeugt. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie sie das gemacht hatten. Als nacktes Vorbild kannte ich nur die Rubens- und Tizianfrauen, die Botticelli-Venus oder die Danaë von Rembrandt aus Vaters Geschichte der Malerei. Aber Mama konnte ich mir so nicht vorstellen. Einmal hatte ich Hilly nackt im Badezimmer überrascht, aber die sah so aus wie ich, bloß mit Schlitz. Ich malte mir weiter aus, wie mein Vater zu meiner Mutter sagt: »Du weißt schon, heute müssen wir unseren Sohn Harry machen!« Ich schloss die Augen und sah, wie sich die beiden küssten und Vater die Brüste meiner Mutter knetete. Ich spürte, wie ich eine sachte Erektion bekam, und hatte plötzlich den Geruch von Hillys Unterhose in der Nase.
»Wir sind hier nicht mehr erwünscht!«
Mein Vater stürmte aus dem Eingang. Das Taxi, das uns vom Bahnhof hochgefahren hatte, stand noch da, aber der Fahrer hatte keine Lust, schon wieder hinunterzufahren, er hatte sich ein Bier bestellt und wollte Hitler schauen. Wie Hunderte andere, die in einer endlosen Prozession hochgekommen waren und um Haus Wachenfeld lagerten. Die Leute hockten in der Wiese, tranken, picknickten, als warteten sie nur auf den Messias, der ihnen befahl, alles hinter sich zu lassen und ihm zu folgen. Da ging ein Aufschrei durch die Menge, eine Welle der Verzückung schwappte über die Jünger, Erregung ergriff sie. Herr Hitler war vor die Tür getreten und wandelte durch die Menschen. Ich sah von ihm nur Scheitel und Schnurrbart, und das sah aus wie die Finne eines Orkas, der durch einen Thunfischschwarm schneidet. Die Menge begann spontan zu singen. Hangseitig intonierten sie Heil Dir im Siegerkranz, und talwärts führte eine einsame Trompete zum Horst-Wessel-Lied. Am Platterhof, wo ich stand, kam dies als zäher Brei an: Hakenkreuz schon … Millionen … die hohe Wonne ganz … Liebling des Volkes … nur noch kurze Zeit.
Mein Vater zog mich am Kragen und schob mich und die Familie in den Postbus nach Berchtesgaden – einem Mercedes Lo 2000, 4 Zylinder, 45PS –, dessen Fahrer nur widerwillig den Fahrplan einhielt. Viel lieber hätte er noch weiter »Hitler g’schaut«. Der Lo 2000 war ein Aussichtswagen, und bei diesem prächtigen Wetter war das Faltdach nach hinten aufgerollt. Eine bessere Sicht als von hier oben gab es nicht. Wir rollten im Leerlauf durch die Menschenmenge, weil der Fahrer weder durch Motorlärm noch durch Gestank stören wollte. Diese jubelnden, singenden Menschen, diese Verzückung in ihren Augen, ihre roten Backen, die im Taumel vorgestreckten Arme und Hände. Es war ein derart feierlicher Augenblick, dass alle Geräusche um mich herum versiegten. Denn für wenige Momente sah ich Herrn Hitler in ganzer Gestalt. Die Menschen um ihn waren voll Ehrfurcht, einige knieten, andere sammelten die Kieselsteine auf, über die er geschritten war. Wir glitten lautlos an ihm vorbei, und genau in diesem Moment sah er zu mir hoch. Der Blick aus seinen blauen Augen folgte mir, und ich verrenkte mich, damit dieser Blick nicht abriss. Ich konnte nicht anders. Ich sprang auf, lief zur Rückbank des Busses und stellte mich darauf, den Arm weit in den strahlenden Sommerhimmel gestreckt – und noch immer verfolgte mich Herr Hitler mit seinem Blick. Ein unsichtbares Band. Etwas hielt uns zusammen. Etwas kettete uns aneinander.
Wir kamen im Alten Seewirtshaus unter. Es war wahrscheinlich das älteste Hotel der Gegend und lag direkt am Königssee, an der Schifflände, von wo aus die Boote zu den Rundfahrten ablegten. Die Besitzer, Herr Josef und Frau Walburga, störten sich nicht an unserer Krankheit, der Jüdischkeit, wie meine Mutter es ausdrückte, und im Herrgottswinkel der guten Stube hing auch noch das Kruzifix.
»Habt’s schon g’hört, was dem Schuster Karl vom Türken passiert ist?«
Der Türke, das Antenberg und der Platterhof waren die größten Lokalitäten auf dem Obersalzberg, und der Fischer, der diese Häuser mit frischem Fisch aus dem Königssee belieferte, konnte sich kaum beruhigen.
»Der hat die Stub’n voll mit SA und SS und RSD-lern. Die saufen und randalieren und nehmen überhaupt keine Rücksicht auf die anderen Hotelgäst’, die ihre Ruh haben woll’n. Da hilft kein Beschwichtigen und keine Vernunft mehr. Plötzlich steht ein SS-ler auf, zieht seine Pistole und schießt den Herrn Jesus im Herrgottswinkel mitten entzwei. Und in Zukunft hängt da ein Bild von unserem heiligen Führer!, brüllt der. Da packt ihn der Schuster Karl und schmeißt ihn aus der Stub’n.«
Eine lauernde Stille legte sich auf die Gäste des Seewirtshauses und auf die Einheimischen, die am Stammtisch Schafkopf spielten – eindeutig waren die Lager auch hier nicht verteilt. Aber bevor sich Braune, Schwarze oder Rote wichtigtun konnten, spendierte die Wirtin selbst gebrannten Enzian und für die Kinder ein Kracherl.
»Bei uns jedenfalls bleibt der Herr Jesus alleiniger Bewohner im Herrgottswinkel«, sagte sie.
Aus dem Raum nebenan erklang Klaviermusik. Walburga errötete vor Stolz und schob die Schiebetür zum Nebenraum ganz auf.
»Mozart. Allegro«, sagte sie.
Sie blickte ehrfürchtig auf ihren Sohn, den kleinen Josef, der voller Ernst und fast fehlerfrei das Stück spielte. Meine Mutter stieß mich in die Seite und deutete mit dem Kinn zum Wunderkind. »Nimm dir ein Beispiel, und dabei ist der Josef nur halb so alt wie du!«
Natürlich plusterte sich dann auch noch Hilly auf. »Was hältst du davon, Mama – Harry soll ab sofort jeden Tag Klavier üben!«
Ich trat ihr unterm Tisch gegen das Schienbein, dass sie aufheulte.
»Er hat mich getreten!«
»Stimmt gar nicht!«
»Doch!«
»Nein, bestimmt nicht, ich schwör’s!«
Schschsch!, zischte es von links und rechts, weil alle dem kleinen Mozart zuhören wollten. Als er fertig war, applaudierten die Leute wie verrückt, und Walburga drückte ihn an der Schulter, bis er sich verbeugte. Dabei trafen sich unsere Blicke, und ich grinste ihn so gehässig und voller Verachtung an, dass sich der kleine Josef die ganze Woche nicht mehr an mich herantraute.
Mit der Übersiedlung vom Berg zum See vermisste ich eigentlich nur Franzi, mit dem ich über alles reden und mit dem ich alles unternehmen konnte. Und Brunos Beratung und Sachverstand beim Seifenkistenbau.
Aber dann tauchte Nessi auf, und alles veränderte sich zum Guten. Sie hieß Agnes, aber alle riefen sie Nessi, und weil sie auch an einem unergründlichen See wohnte und genauso unvorhersehbar auftauchte wie das Ungeheuer in Loch Ness, passte Nessi bestens zu ihr. Sie war die Tochter vom Pächter in St. Bartholomä, und als wir uns das erste Mal begegneten, nahm sie mich, ohne Vorwarnung, in den Schwitzkasten und warf mich zu Boden. Ich war so überrascht, dass ich stillhielt wie ein auf den Rücken geworfenes Kälbchen.
»Gibst auf?«, zischte es an meinem Ohr.
Da strampelte ich mich hoch und musste schwer arbeiten, bis ich einen Arm freibekam und nun meinerseits Nessi in den Schwitzkasten drehte. Ich hatte meine Beine im Spreizschritt gegen den Kies gestemmt, und mein Körper lag so schwer auf ihr, dass ihr Widerstand erlahmte.
»Gibst auf?«, fragte ich.
Von Nessi kam keine Reaktion.
»Gibst auf?«, wiederholte ich.
Wieder kam keine Antwort. Langsam ließ ich locker und entspannte mein festgestemmtes Bein. Da entriss sich Nessi mit einem Ruck, umklammerte mich, und schon wälzten wir uns wieder auf dem Kies. Rotz und Spucke landeten im Haar und in der Halskuhle des anderen. Mit meiner Augenbraue radierte ich über ihren Mund und ihre Nase, ihr Kinn bohrte sich in meine Wange. Unsere Beine und Arme verhakten sich zu unlösbaren Knoten.
Ich war glücklich. So etwas Wunderbares hatte ich noch nie erlebt. In alle Ewigkeit hätte dieser Kampf weitergehen sollen.
Da entrissen uns die Erwachsenen der ewigen Umarmung. Sie schüttelten uns auseinander wie zwei ineinander verbissene Hunde. Fassungslos übergab mich mein Vater meiner Mutter. Seine Miene sagte, »das ist nicht das Kind, das ich großgezogen habe! Es muss dein Kind sein, kümmere dich darum!« Meine Mutter stammelte wie eine stecken gebliebene Schallplatte, »Harry, Harry! Was machst du bloß für Sachen, Harry!« Dabei schlug sie auf mich ein, mit Schlägen, denen jede Kraft fehlte – bis mir auffiel, dass sie mich gar nicht schlug, sondern den Staub von meinem Anzug klopfte.
Dann kam mein Vater mit diesem »Ich bin so erregt, aber ich beherrsche mich«–Gesicht wieder und entriss mich der mütterlichen Reinigung.
»Du entschuldigst dich. Sofort!«
Er drehte mich an der Schulter herum, und ich sah Nessi auf der anderen Seite des Gastgartens. Papa gab mir einen unmissverständlichen Stoß ins Kreuz. Ich schlich durch die Sommerfrischler, die unter den Kastanien tranken, aßen und lustige Lieder sangen. »Da drob’n auf’m Bergl, da steht a Gerüst, da werden die Weiber elektrisch geküsst!« Ich drehte mich nochmals um – vielleicht war ja mein Vater an der Erfüllung seines Auftrags nicht mehr interessiert –, aber da stand er und ließ mich nicht aus den Augen. Ich kam bei Nessi an, die Bierkrüge spülte. Noch immer war sie staubig, und beide Knie waren blutig. Sie nahm mich mit einem Seitenblick wahr und spülte und spülte, dass es bis zu mir spritzte.
»Ich soll mich entschuldigen«, sagte ich und deutete auf meinen Vater. Nessi platschte ungerührt weiter.
»Hast du gehört, ich …«
»Bin nicht taub!«, schnitt sie mir ins Wort und kam ungestüm auf mich zu, dass ich unwillkürlich einen Schritt nach hinten auswich. Ganz nah stand sie vor mir und machte die Augen schmal.
»Wir zwei sind noch nicht miteinander fertig. Noch lange nicht.«
Dann kam der 24. August, Namenstag des heiligen Bartholomäus, und wir nahmen mit anderen Sommerfrischlern an der alljährlichen Prozession teil. Die Wallfahrer kamen von Maria Alm, auf der anderen Seite des Berges, durch das Steinerne Meer zum Königssee, im Gedenken an die Pest, die vor ein paar Hundert Jahren in Salzburg gewütet hatte.
Mit allen Booten, die an der Schiffslände zur Verfügung standen, fuhren wir unter Gebeten, Gesang, Weihrauch und Baldachin über den See. Plötzlich hielten alle Boote mitten auf dem See an, nicht weit vom Steilufer. Stille breitete sich aus. In stummer Andacht neigten die Menschen ihre Köpfe zur Felswand, und der Priester segnete das schmiedeeiserne Kreuz, das am Fuß des Felsens festgeschraubt war, mit Weihrauch und Weihwasser.
»Wenn du lang genug ins Wasser schaust, kannst sie sehen.« Der kleine Josef stand plötzlich neben mir.
»Wen?«
»Die Toten.«
»Welche Toten?«
»Die toten Pilger, wegen denen wir die Wallfahrt machen.«
Er trat an den Bootsrand, beugte sich über die Reling und starrte ins Wasser. »Da ist einer«, sagte er ganz ruhig.
Verunsichert trat ich neben ihn und folgte seinem Finger.
»Dort! Siehst es, ’s ist ein junger Bursch. Und dort! A junge Frau, wahrscheinlich is’s dem sei’ Braut!«
Am 23. August 1688 waren 70 Wallfahrer bei einem schweren Gewitter während der Floßüberfahrt im See ertrunken. Das hatte mein Vater erzählt.
»Weil das Wasser so kalt ist, zerfallen die Leichen nicht«, erklärte Josef.
Ich wusste, dass das Unsinn war, aber je länger ich in das Wasser starrte, umso mehr Schatten sah ich, die sich in Körper verwandelten. Plötzlich krachte ein Böller. Mir blieb fast das Herz stehen. Und dann das Wunder: Sieben Mal trugen die Felswände das Echo des Schusses wieder zurück.
»’s ist ein Zeichen für die da unten, dass wieder ’n Jahr um ist. Normalerweise liegen’s aufm Grund, aber einmal im Jahr treibt sie der Böller hoch, und dann fischt keiner im See, weil keiner möcht a Wasserleich bei die Renken hab’n. Und um Mitternacht kommen’s in einer langen Prozession ausm Wasser und feiern in der Kapelle Bartholomä Gottesdienst und beten um ihre Erlösung.«
Der letzte Böller war abgefeuert und das letzte Echo verhallt, da drehte ich mich zu dem kleinen Josef. »Was bist denn du für ein Dampfplauderer!«, sagte ich, und im Wegdrehen verpasste ich ihm noch schnell eine Kopfnuss.
Ich freundete mich mit dem Königssee an. Fast jeden Tag fuhr ich mit dem Herrn Josef, unserem Wirt, auf der Gemse über den See. Das Elektroboot fuhr lautlos über das Wasser, und wenn nicht viele Touristen auf dem Schiff waren, konnte man sich gut vorstellen, wie sich in der Eiszeit der Gletscher durch die Felsen zwängte. Nur die Wallfahrerstelle ließ mich jedes Mal unruhig werden. Konzentriert blickte ich über den Bug nach vorne, in Richtung Watzmann oder links zum Anleger Kessel, ob ein Wanderer dort das Signal gesetzt hatte, dass er abgeholt werden wollte – es half alles nichts: Ich musste ins Wasser schauen, und immer meinte ich, eine Gestalt zu erkennen.
Meist stieg ich in St. Bartholomä aus, und am späten Nachmittag fuhr ich mit Herrn Josef wieder nach Hause. Den ganzen Tag war ich dort mit Nessi zusammen. Wir rangen miteinander, wir rollten, ineinander verschlungen, Hänge hinunter. Wir drehten dem anderen die Haut am Unterarm, dass es wie Brennnesseln brannte, und saugten und leckten uns gegenseitig die blutenden Wunden. Am liebsten aber war uns die Folterbank. Man lag auf dem anderen, hatte seine Handgelenke fest umfasst und die Füße in seine Fußrücken geklemmt, und streckte sich mit aller Kraft, dass auch der andere immer länger und länger wurde. Dabei keuchten wir Wange an Wange und pressten unsere Bäuche und Becken aneinander.
Beim ersten Mal, als Nessi mein steifes Glied spürte, wälzte sie sich von mir und packte mich da unten. Sie hielt mich so fest, dass ich nicht mehr zusammenfallen konnte.
»Na, so was«, sagte sie, »was haben wir denn da?«
Ich spürte, wie mein Herz in ihrer Hand schlug.
Nessi flüsterte: »Ich kannte eine Ratte, die hatte eine Latte. Die hobelte ihre Tante, die das von früher her kannte.«
Die nächsten Male, wenn sie mich spürte, hielt sie noch kurz inne, aber dann wurde es ganz normal. Ich glaube sogar, dass sie darauf wartete und dann besonders fest dagegendrückte.
Wenn wir dann erschöpft nebeneinanderlagen und stumm dem Lauf der Wolken folgten, war ich glücklich wie noch nie.
»Kommst nächstes Jahr wieder?«
»Sicher.«
»Weil …«
Zum ersten Mal erlebte ich, dass Nessi sprachlos war.
»Weil was?«
»Weil mein Vater g’sagt hat, dass das nicht sicher ist, dass ihr wiederkommts.«
Ich setzte mich auf und sah sie erschrocken an.
»Aber wieso denn?«
Nessi zuckte mit den Schultern. Dann sah sie mich eindringlich an, nahm meine rechte Hand hoch.
»Schwör’s!«
»Ich schwör’s!«
Sie atmete tief aus. Und ehe ich mich’s versah, packte sie meine gespreizten Finger und zog sie noch weiter auseinander. Ich brüllte und entriss ihr meine Hand. »Warte, das zahl ich dir heim!«
Herr Josef und ich fuhren am Abend alleine auf der Gemse zurück.
»Wie war’s?«
»Schön.«
Er sah in mein glühendes Gesicht und wuschelte durch mein Haar. Ich glaube, er wusste alles über Nessi und mich – er sagte aber nie etwas dazu. Lautlos glitten wir über den jetzt abendlich schwarzen See, die Toten waren auch schon zur Nachtruhe gegangen. Mir ging nicht aus dem Kopf, was Nessi gesagt hatte.
»Herr Josef, ich möchte dich was fragen.«
»Harry?«
»Der Vater von der Nessi hat gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob wir nächstes Jahr wiederkommen. Kannst du mir sagen, ob mein Vater reserviert hat oder nicht?«
Herr Josef blickte eine Weile Bug voraus, als hätte er meine Frage nicht gehört. Dann sah er mich an und lächelte.
»Ja. Hat er. Übernimmst?«
Er schob mich hinter das Steuerrad und legte meine Hände auf die Zapfen des Rades. Ich befürchtete, er wollte ablenken und mir die Wahrheit verschweigen. Ich sah ihn eindringlich an.
»Ganz ehrlich!?«
»Ganz ehrlich. Würd ich dich sonst fahren lassen – ich brauch nämlich nächstes Jahr einen Aushilfsschiffsführer.«
Beim Anlegen sahen wir schon von Weitem den Trubel vor dem Alten Seewirtshaus. Im Gastgarten standen die Leute, aufgeregt und aufgebracht, einige drängten auf die Veranda. Ich fürchtete schon, meinetwegen, weil ich meistens Grund einer Aufregung war, aber diesmal galt sie nicht mir. Meine Brüder Helmut und Herrmann waren die Ursache. Es überraschte mich, dass sie überhaupt da waren, so sehr waren wir uns die ganze Zeit aus dem Weg gegangen. Helmut war damals sechzehn, Herrmann fünfzehn, und sie interessierten sich nicht die Bohne für ihren kleinen Bruder.
Ich drängte mich durch die Zuschauer auf die Veranda und erschrak. Instinktiv wusste ich, dass das, was ich sah, keinem Unfall geschuldet war. Meine Brüder saßen blutüberströmt da, weinten und wimmerten vor Schmerzen. Herrmann mit gebrochenem Nasenbein und Jochbein, Helmut mit angeknacksten Rippen und ausgeschlagenen Zähnen, wie sich später herausstellte. Sie waren am Nachmittag mit den Fahrrädern nach Berchtesgaden gefahren, durch den Ort gebummelt, und in einem Jagd- und Angelgeschäft hatte sich Herrmann einen Hirschfänger gekauft und sich ihn, in der Lederscheide, an den Gürtel geschnallt. In der Maximilianstraße hatten sie sich zwei Virginia Krumme Hunde gekauft. Danach waren sie im Bräustüberl eingekehrt. Unglücklicherweise konferierte dort die NSDAP-Ortsgruppe Berchtesgaden. Es waren ein paar Hundert da, und sie nahmen ihr Thema sehr ernst. »Von heut an ist’s aus! Jetzt gibt’s nix mehr!«, echauffierte sich einer besonders und drohte mit dem Zeigefinger zur dunklen Holzdecke hoch. »Punkt eins: Verlust des Parteiabzeichens und des Mitgliedsbuches. Punkt zwei: Seine Gäste müssen sofort ausziehen! Punkt drei: Totalboykott!«
Es ging, wie meine Brüder schnell begriffen, um den Schuster Karl, den Wirt vom Türken. Sie lehnten am Ausschank, tranken jeder ein Helles, pafften die Virginia und verfolgten die Hetze. Da muss der Teufel meine Brüder geritten haben. Herrmann begann zu kichern und steckte Helmut damit an. Die ersten SA-ler drehten sich nach ihnen um. Doch die bösen Blicke fachten das Feuer nur noch mehr an. Beide bekamen einen Lachkrampf, je mehr sie versuchten, das Lachen zu unterdrücken. Und Helmut setzte dem Ganzen die Krone auf. Er legte zwei Finger unter die Nase und wiederholte mit gequetschter Stimme, was der Türken-Wirt gesagt hatte:
»Gibt’s denn hier gar nix mehr als Schwarze und Braune!«
Wie losgelassene Kettenhunde stürzten sie sich auf meine Brüder, die nicht einmal die Zeit hatten, ans Wegrennen zu denken. Sie prügelten mit Stuhlbeinen auf sie ein, traten ihnen mit Stiefeln ins Gesicht, und als einer entdeckte, dass Herrmann einen Hirschfänger am Gürtel trug, riss er ihn aus der Scheide und hätte meinen Brüdern wahrscheinlich die Kehle durchgeschnitten, wenn ihm nicht Bruno in den Arm gefallen wäre.
»Schluss. Das reicht. Das merken die sich bis in alle Ewigkeit!«
So zugerichtet und mit einem Vorgeschmack auf die Ewigkeit, hockten die beiden vor uns und berichteten.
»Bruno und der Schankbursche haben uns zum Hinterausgang geschleppt. Aber da war ich schon die meiste Zeit ohnmächtig. Ich weiß noch, ein Pferdefuhrwerk ist gekommen und hat uns heimgebracht.«
»Mir haben’s den Hirschfänger gestohlen!«, raunzte Herrmann, »zwölf Reichsmark hat er gekostet!«
Vorsichtig versuchten meine Mutter und Walburga, die Wunden mit lauwarmem Wasser zu säubern. Walburga legte Tücher in Lagen und goss aus einer bauchigen Glasflasche dunkelgelbe, ölige Flüssigkeit darauf, bis das Linnen triefte.
»Arnika mit Enzian!«
Begleitet von tiefem Stöhnen, hievten sie Herrmann auf einen Tisch, schnitten ihm das Hemd vom Körper, und Walburga legte ihm die Arnika-Enzian-Kompressen auf, was den Armen grässlich aufheulen ließ.
»Aber was habt ihr euch dabei gedacht!?«, schrie mein Vater dagegen an.
Es war die einzige Art, wie er Schmerz und Leid begegnen konnte: mit Ursachenforschung. Mit logischer Beweisführung.
»Ihr wisst doch, dass mit diesen Herrschaften nicht gut Kirschen essen ist!«
»Wir haben geglaubt, die kennen uns … Wir sind doch jedes Jahr hier … War doch nur ein Witz«, nuschelte Helmut, und schaumiges Blut quoll zwischen seinen Lippen hervor. Mein Vater beugte sich zu ihm hinunter und spreizte mit Daumen und Zeigefinger Helmuts Mund auf.
»Ei-ja-jeijeijei!«
Er rückte Helmuts Kopf zum Lampenlicht und tupfte mit dem Zipfel der Mullbinde den blutigen Oberkiefer frei, ganz so, als wäre er in seiner Praxis am Ku’damm 216, Ecke Fasanenstraße, U-Bahn Uhlandstraße, wie es im Inserat in der BZ hieß.
»Oben rechts – zwei. Drei, canini. Oben links – eins, incisivi«, diagnostizierte er. »Was da heißt – canini?«
»Eckzahn«, sabberte Helmut.
»Und incisivi, Harry?«
»Schneidezahn!«, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen.
Zum Glück prüfte er nicht auch die anderen Zähne, denn die Vormahlzähne und die Mahlzähne bekam ich immer durcheinander. Prämolaren-Molaren. Papa drehte Helmut zu sich.
»Junge, Junge. Das wird eine langwierige Angelegenheit – aber wir kriegen das hin!«
Dann kam der Doktor aus Schönau. »Guten Abend, die Herrschaften. Ich komme aus der Pfarrgemeinde Maria Sieben Schmerzen – wer hat mehr?« Er war der Einzige, der über seinen Witz lachte.
Schließlich traf der Kommandant des Polizeipostens Berchtesgaden ein, in seiner Begleitung war der Chef der NSDAP-Ortsgruppe. Sie schickten alle, bis auf meinen Vater und die Brüder, von der Veranda. Auch der Arzt musste draußen warten. Er klopfte meiner Mutter beruhigend auf den Arm. »Keine Bange, die besprechen sich jetzt, und dann ist alles in Ordnung.«
Spät in jener Nacht hatte ich in meiner Kammer, durch die angelehnte Tür, gehört, wie es meine Eltern hin und her erwogen. Unaufhörlich war mein Vater im Schlafzimmer auf und ab gegangen und hatte, minutiös wie ein Protokollant, jedes Wort, das auf der Veranda gefallen war, wiederholt.
»Mir sind die Hände gebunden! Wir mussten die Anzeige annehmen und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten!«, hatte der Polizeikommandant gesagt.
»Aufrührerische Hetze! Verunglimpfung einer politischen Partei! Herabsetzung einer demokratisch gewählten Amtsperson! Das sind keine Bagatellen!«, hatte sich der Ortsgruppenleiter eingemischt. »Gerade weil diese üble Schmähung von touristischen Halbwüchsigen aus Berlin kommt, muss man auf die Geisteshaltung der Erziehungsberechtigten schließen, und das macht den Vorfall erst richtig schlimm. Wes Geistes Kind sind Sie denn? Mit welchem Gedankengut vergiften Sie die eigenen Kinder?«
Er, der Polizeikommandant, könne jedenfalls nicht mehr für die Sicherheit garantieren. Auch nicht für die Sicherheit der anderen Hotelgäste, denn, wie das Beispiel des Türken-Wirtszeige, dem gesunden Volksempfinden und Volkszorn könne man sich nicht entgegenstellen. »Was, wenn sich dieser Zorn entzündet? Auch im Seewirtshaus hochlodert?«
Dann hatte der Ortsgruppenleiter dem Polizeikommandanten zugenickt, und der hatte kopfschüttelnd ein Päckchen aus der Aktentasche geholt. Er hatte es ausgepackt, vorsichtig. Herrmanns Hirschfänger. Auf der Klinge und in der Blutrinne klebte getrocknetes Blut. »Vielleicht hätte man den Vorfall vertuschen können. Aber das hier«, und der Polizist hatte auf den Hirschfänger gedeutet, »das war ein Mordversuch! Und da bleibt mir kein Ermessensspielraum.«
Da hatte sich der NSDAP-Ortsgruppenleiter wieder eingeschaltet. »Es sei denn …«
Zwei Tage später reisten wir ab. Diese Gnadenfrist hatten sie uns gegeben, damit Herrmann und Helmut nicht liegend transportiert werden mussten.
Am Tag vor der Abreise fuhr ich zum letzten Mal nach St. Bartholomä. Von Nessi keine Spur. Ich wartete bis zum letzten Boot, das zurückfuhr, aber sie tauchte nicht auf. Ich spürte, dass sie in der Nähe war. Ich war mir sicher, dass sie mich beobachtete, aber ich entdeckte sie nicht.
SONNTAG, 1. APRIL 1945: 2040.
Nessi hielt eine kleine Axt hoch. »Merk dir das, es kann dir das Leben retten!« Sie hackte drei Kreuze in die Rinde eines Baumstumpfs. »Jeder Stock, der so gezeichnet wird, und zwar im Augenblick, wenn sein Stamm fällt, macht einen gegen alles gefeit. Wenn nun das wilde Heer kommt, flüchten sich die Waldmännlein und Waldweiblein und auch die Seelen der erschlagenen und verunglückten Leute, die im Wald herumirren müssen, auf diese gezeichneten Plätze und sind so vor jeder Nachstellung der bösen Geister sicher …«
Kräftige Fußtritte beendeten meinen Traum, und ich schreckte hoch.
»Ja, was haben wir denn da! Eine Wildsau, die wir gleich erschießen sollten.«
Eine Drei-Mann-Patrouille hatte mich entdeckt und zerrte mich unter der gefällten Föhre hervor. Es war früh am Morgen, und meine Geistesgegenwart kehrte erst langsam zurück. Ich rappelte mich auf und brauchte ein paar Augenblicke, um mich zu erinnern: Ich hatte meine Kameraden verloren, war alleine weitergegangen und hatte dann festgestellt, dass ich schon einmal hier gewesen war. Ich hatte mich entschlossen, nicht mehr weiterzugehen, und war zum Schutz unter die breiten Zweige einer gefällten Föhre gekrochen. Jetzt sah ich, dass in den Baumstumpf drei Kreuze gehackt waren, aber bevor ich wieder in meine Erinnerungen abgleiten konnte, fällte mich ein Schlag in den Rücken.
»Hinknien! Hände hinter’n Kopf!«, brüllte mich der jüngste der Soldaten an, und dabei hielt er das K43 so nah vor mein Gesicht, dass ich den Schmauch aus dem Lauf riechen konnte.
»Ich habe mich verirrt!«, stammelte ich, »ich bin in der Nacht vom Weg abgekommen!«
In diesem Augenblick ging der Alarm los. Uns platzten fast die Trommelfelle, weil wir unmittelbar vor einem Sirenentrichter standen. Mit beiden Händen hielt ich mir die Ohren zu und flüchtete mit der Patrouille aus dem direkten Schallfeld. Dann sah ich nichts mehr. Von einem Moment auf den anderen stand ich in einem weißen Nichts. Es stank nach Chlor und Schwefel. Ich schnappte nach Luft, die Augen brannten und tränten, und kurz bevor ich bewusstlos zu werden drohte, packte mich eine Faust und riss mich mit sich.
Noch immer im undurchdringlichen Weiß, aber abseits seiner Quelle, kotzte und hustete ich mir die Lunge aus dem Leib. Schemenhaft sah ich Leute in Gummischürzen, Gummistiefeln und Gasmasken. Sie rollten große Fässer, tauchten auf und verschwanden wieder, und der Nebel schluckte jedes Geräusch. Ich hatte davon gehört, und jetzt war ich mitten drinnen: in der Nebelabteilung der Alpenfestung. Sie hatte die Aufgabe, bei Fliegeralarm das Berchtesgadener Tal bis Bad Reichenhall einzunebeln und unsichtbar werden zu lassen. Eine wolkige Tarnkappe. Alberichs Tarnkappe, denn er war hier der Hüter des Nibelungenhorts.
Meine Drei-Mann-Patrouille hatte ich verloren, aber die Faust, die mich vor dem Erstickungstod gerettet hatte, brachte mich in die Baracke der Wachmannschaft. Als mein Retter die Gasmaske abnahm, sah ich, dass es eine Retterin war. Eine Walküre? War es nicht Aufgabe der Walküren, die auf dem Schlachtfeld Gefallenen nach Walhall zu führen? War ich in Odins Festhalle gelandet? Meine Schildjungfer gehörte allerdings zu den SS-Maiden, die die Nebelbatterien bedienten.
»Spül dir die Augen aus.«
Sie reichte mir einen Kanister, auf dem »Sterilwasser« stand, und ich wusch mir die brennenden Augen aus. In der Zwischenzeit hatte sie den Wachhabenden über mich informiert.
»Was haben Sie hier zu suchen? Wie kommen Sie hierher? Papiere!«
Ich reichte sie ihm. Der Wachhabende blätterte darin und sah mich verständnislos an. »Was soll das sein?«
»Meine Papiere.«
»Was für Papiere soll’n das sein?!«
Er brachte mich zu seinem Vorgesetzten. Sein Vorgesetzter brachte mich zum Kommandanten der Wachmannschaft.
»Was soll das sein?!«
Er schlug mir mit meinen Papieren ins Gesicht.
»Meine Papiere!«, beharrte ich.
Man brachte mich hinunter zur SS-Kommandantur in Berchtesgaden. Auf der Fahrt durch die engen und spitzen Serpentinen gab es Entwarnung – Fehlalarm, keine feindlichen Flieger wurden erwartet. Wie denn auch! Im Bergreich der Kaiser und des Führers! Der lange, hohe Dauerton zog über die nebligen Hänge und begleitete uns durch jede Kurve. Nach einer Minute schwoll er ab, und wie auf ein verabredetes Zeichen riss der Nebel auf. Die Sonne tauchte hinter den Bergspitzen hoch und stach durch die zerfließenden Dunstwolken und Dampffetzen. Was für ein herrlicher Tag! Was für ein Ausblick tat sich mir auf! Ich genoss ihn, als wäre es ein letztes Mal. Erzählte man nicht, dass ein schöner Anblick ein letztes Geschenk Gottes sei, um einem die Reise in die Dunkelheit zu erleichtern. Obwohl ich hinten im Kübelwagen steckte und das Verdeck geschlossen war, sah ich durch die hintere Kunststoffscheibe die steilen Hänge mit taunassen Tannen und Lärchen, die im Gegenlicht glitzerten. Weiter oben krochen die Latschen und niedrigen Föhren durch felsige Türme und Scharten zu den Mannlköpfen hoch und schließlich zum Hohen Göll. Änderte sich nach einer Kehre meine Blickrichtung, sah ich in der Ferne das Sonntagshorn, weiter links dann den Hochkalter und schließlich den Watzmann mit einer blendend weißen Zuckerspitze. Kirchenglocken klangen zu uns hoch. Trotz Motorenlärms hörte ich sie. Es war ein volles Geläut, also war Sonntag – Ostersonntag!, fiel mir ein. Mit meinen verloren gegangenen Freunden hätte ich mir heute eine besinnliche Pause gegönnt. Wie weit sie es wohl geschafft hatten?
»Heute ist ja Ostersonntag«, sagte ich zu meinen zwei Begleitern. Zuerst wollte keiner antworten, aber dann drehte sich der Beifahrer zu mir zurück. »Genau. Darum nageln wir dich auch gleich ans Kreuz.«
Es war noch früh, als wir in Berchtesgaden ankamen, das voll war mit Menschen. Obwohl der Fahrer beharrlich hupte, konnten wir die Schießstättstraße nur hochschleichen. Ich reckte mich nach vorne, um besser sehen zu können.
»Was ist denn hier los?«
Der Beifahrer klatschte mir die Hand mit gespreizten Fingern ins Gesicht und schob mich nach hinten.
»Runter! Hände hinter’n Kopf! Kopf zwischen die Knie!«
Ich tat, wie mir befohlen. In dieser Haltung vermischte sich alles zu einem Brei: das Rumpeln und Kollern des VW-Motors unter mir, das unaufhörliche Hupen, das Rumoren der vielen Menschen auf der engen Straße, das Dröhnen der Kirchenglocken. Ich brummte mit und meinte, dass sie h-dis-fis-gis gestimmt waren. Wollen die alle zum Ostergottesdienst?, fragte ich mich.
»Achtung! Eins, zwei! Eins, zwei! Es ist mir eine große Freude …« Eine schrille Rückkoppelung beendete einen Lautsprechertest und schreckte mich auf. Wer hatte da »große Freude«? Wann hatte ich zum letzten Mal große Freude? Meine Gedanken glitten gleich wieder fort, und ich fragte mich plötzlich, warum der Zauber der drei in den Stamm gehackten Kreuze nicht funktioniert hatte? In dem Augenblick, wenn der Stamm fällt, so war die Formel, muss der Stock gezeichnet werden. War da ein Fehler passiert? Wer hatte überhaupt die Föhre gefällt? Ich biss mich an Details fest, denn das war immer die beste Methode, mich aus der Wirklichkeit zu entfernen. Aber auf einmal stand die Frage doch vor mir: War der Zauber, der mich bisher glücklich begleitet hatte, aufgebraucht? Stand ich unmittelbar vor dem Ende? Hatte ich den ersten Schritt in die Dunkelheit getan?
Wir hielten vor den Arkaden des Schlossplatzes. Ich hatte kaum die steifen Beine durchgestreckt und die Arme gelockert, da sah ich, dass es auf dem Platz vor dem Schloss nur so wuselte, als mich ein weiterer Stoß in den Rücken vorwärtsstolpern ließ.
Ich landete schließlich vor dem Schreibtisch eines SS-Hauptsturmführers. »Wes Geistes Kind bist du denn!«, brüllte er mich an. »Was ist denn das für eine Maskerade!«
Er wedelte wild mit meinem Ausweis. Ich erkannte ihn sofort wieder: Wolfgang Ehrlinger! Er war damals als NSDAP-Ortsgruppenleiter mit dem Polizeikommandanten im Alten Seewirtshaus erschienen.
»Was glotzt du mich so an!«, brüllte er.
Bevor ich antworten konnte, stürmte der Adjutant herein und beugte sich ans linke Ohr des Hauptsturmführers. Ich schnappte verstümmelte Wortfetzen auf: … auleiter … iesler … Völkischobachter … Star … erschoben …
Da sprang der Hauptsturmführer plötzlich erfreut auf: »Tatsächlich? Sie kommt?«
Der Adjutant nickte, offensichtlich froh, dass er seinem Chef wenigstens eine gute Nachricht hatte bringen können.
»Antwort!«, brüllte der mich wieder an und warf meine Papiere vor mich auf den Tisch. »Was ist das für eine Schweinerei?«
»Das ist mein Pilgerpass. Credencial del Peregrino. Für den Jakobsweg.«
Er sah mich ungläubig an, und ich fuhr im breiten Wiener Dialekt fort. »Ich pilgere von Wien nach Santiago de Compostela, und wenn ich dort ankomme, erhalte ich die compostela, das ist die Urkunde, dass ich diese Pilgerreise gemacht habe, allerdings muss ich jeden Tag nachweisen und hier im Pass einstempeln lassen, wo ich war.«
Ich beugte mich vor – froh, ein Alibi vorweisen zu können – und tippte auf einen Stempel im Pass.
»Hier, das ist der Stempel von Stift Melk … Stift Ardagger und hier, der Stempel von gestern, Maria Plain.«
Da mich Wolfgang Ehrlinger, der Ex-NSDAP-Ortsgruppenleiter und jetzige SS-Hauptsturmführer, noch immer ungläubig anstarrte, redete ich weiter, als gebe es die Regel: Solange du sprichst, bleibst du am Leben.
»Der heilige Jakobus der Ältere ist unser Schutzpatron. Er ist auch der Patron der Arbeiter und Lastenträger, aber hauptsächlich ist er für uns da – die Apotheker und Drogisten. Und Hutmacher. Ich bin allerdings Drogist. Drogerie Zum Weißen Engel, Sechhauser Straße … also, unsere Innung hat beschlossen, dem heiligen Jakobus zu Ehren eine Pilgerfahrt zu machen, die Kollegen fragten mich, ob ich mitkomme – und: Hier bin ich.« Ich versuchte, charmant und glaubwürdig zu lächeln. »Zu zwölft sind wir aufgebrochen, drei Apotheker, acht Drogisten, ein Hutmacher. Leider habe ich sie gestern verloren. Wahrscheinlich am Abzweig von der Saalach zur Stoißer Ache …«
Hauptsturmführer Ehrlinger sprang auf und zog mich mit sich. Er zerrte mich in den Hof und dort in einen Schuppen. Da lagen meine Wallfahrerbrüder. Mausetot. Erschossen. Ich spürte keine Regung. Keinen Schmerz, keine Trauer. Ich war leer. Mein Unterbewusstsein nahm wahr, wie Ehrlinger feixte und sich diebisch freute, dass ihm eine derartige Überraschung gelungen war. Er schlug mir auf den Rücken.
»Als Schutzpatron taugt der Herr Jakobus nicht viel, was?«
Ich spürte, wie er an seiner Pistolentasche fingerte. Aus dem Nichts heraus erinnerte ich mich an meine Glückshaube. Mit dieser Fruchtblase überm Kopf war ich geboren worden, und bevor die Hebamme sie von meinem Kopf gezogen hatte, hatte meine Großmutter, die bei allen Geburten meiner Mutter dabei war, gerufen: »Masel tov! Eine Geistesgröße wird er werden, ein Advokat, und voller Großmut wird er sein! Unser Neschomele. Sie beschütze ihn sein Leben lang.«
Die Hebamme hatte das Häutchen auf ein Stück Mull gelegt, dann damit mein Gesicht abgerieben und so das Häutchen in den Mull gedrückt. Diese Geschichte bekam ich zu jedem Geburtstag erzählt. In diesem Talisman wohnte, der Überzeugung meiner Großmutter nach, ein Schutzgeist, und immer wieder hatte sie dieses Stück Mull in meine Kleidung genäht. War ich aus einer Hose herausgewachsen, hatte sie es herausgetrennt und in die neue Hose im Bund eingesetzt.
Von fern drang ein Geräusch zu mir: Der Schlitten der Pistole wurde zurückgezogen und schnappte mit einem Klacken zurück. Seltsam, dachte ich, so endet nun dein Leben auf der elften Etappe einer Pilgerreise. Es war ein ganz sachlicher Gedanke, ohne Bedauern. Ich spürte zwischen den Fingern eine Verdickung in meinem Hosenbund. Meine Glückshaube! Sie fühlte sich an wie ein Knorpel. Der Knorpel meines Schicksals. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass meine Großmutter den Talisman da eingenäht hatte, wie sollte sie auch, aber es musste …
»Herr Hauptsturmführer!«, brüllte es über den Hof. »Die Reichsfilmregisseurin!«
Ich drückte den Knorpel – plötzlich hatte ich irrsinnigerweise den Geschmack von gefüllter Kalbsbrust auf der Zunge – und dachte, ich sei schon auf der anderen Seite, dachte, siehst du, so schmerzlos ist der Tod, und seine Empfangsdame ist die Reichsfilmregisseurin und kein Zerberus. Da schob mich der Hauptsturmführer in den Hof zurück, schlug die Tür zum Schuppen zu, und seine Pistole steckte, schwuppdiwupp, wieder im Holster. Er knallte die Hacken zusammen und riss den Arm hoch. »Große Freude, Frau Reichsfilmregisseurin begrüßen zu dürfen!«
Bei ihrem Anblick verstärkte sich der Geschmack der gefüllten Kalbsbrust. Die Erinnerung kaute das resch angebratene Fleisch, das nach Pfeffernelke duftete, und ich pickte die Rosinen aus der Füllung.
Leni Riefenstahl! Meine Heldin so vieler Filme! Die Maria in Weiße Hölle von Piz Palü, die Hella Armstrong in Stürme über dem Mont Blanc. Der Weiße Rausch. Und wieder die Hella, diesmal Hella Lorenz, in S.O.S Eisberg, wo auch Dr. Johannes Krafft auftaucht und mit Hella zusammen ihren verschollenen Ehemann, Professor Lorenz, im ewigen Eis sucht. Was mich lange irritierte, und niemand konnte es mir zufriedenstellend beantworten: Dieser Dr. Johannes Krafft, mit Doppel f, tauchte ja schon in Piz Palü auf. Er verunglückte aber dort an der Nordwand und erfror schließlich am Ende des Films. Wieso konnte er dann wieder in Grönland auftauchen? Oder war das sein Sohn?Meine Lieblingsfigur aber war das Bergmädchen Junta, das das blaue Licht des Monte Christallo hütete. So wild und so scheu. Sie erinnerte mich an Nessi. Ich weiß nicht, wie oft ich mir den Film angesehen hatte, bestimmt zehn Mal. So verliebt war ich in Junta, und so stellte ich mir Nessi vor, wenn sie groß war.
»Nehmen Sie doch endlich den Arm runter!«, sagte Leni Riefenstahl genervt. Da erst merkte ich, dass auch ich meinen rechten Arm ausgestreckt hatte und dass sie mich meinte. Schnell legte ich die Arme an und stand steif und ehrfurchtsvoll. Sie trat unter meinen Geradeaus-Blick, und ich sah, sie trug einen offenen Pelzmantel und darunter einen weißen Kittel, so wie ihn Ärzte tragen. Sie musterte mich von oben bis unten, was den Reiz ihres Silberblicks nur noch vergrößerte. »Reichsgletscherspalte« fiel mir ein – ihr Spitzname, weil sie in ihren Filmen in so viele Eis-, Schnee- und Gletscherspalten gefallen war. Später hatte mich ausgerechnet meine Schwester Hilly aufgeklärt, dass mit »Spalte« ganz was anderes gemeint war. Ich hatte sie dumm angeguckt.
»Muschi. Möse. Spalte. Die Riefenstahl fickt mit allen, die ihr einen Vorteil bringen. Eine berechnende Fotze ist die!«
Ich war fassungslos gewesen.
Leni kniff die Augen zusammen, als könnte sie meine Gedanken lesen, und legte den Kopf schief.
»Sie kenne ich. Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen …«
Wie Recht sie hatte. Ich war auf ihrem Olympiafilm. Marathonlauf. Ich stand genau hinter dem Streckenreporter. »Hier ist der Sprecher am Kaiser Wilhelm Turm«, hatte er in der Direktübertragung kommentiert. »Die Läufer haben schon 35 Kilometer hinter sich. Zabala, der Sieger von Los Angeles, ist zusammengebrochen. Das schnelle Anfangstempo hat ihn zermürbt. Son. Japan. Führt.« Dabei hatte ich mich hinter seiner Schulter bewegt und war kurz zu sehen. Alle meine Freunde haben mich später im Kino bewundert, für eine kurze Zeit war ich ein richtiger Star. »Harry schon im Kino gesehen?«, hieß es. »Nee, als was? Kartenabreißer?« »Idiot. Marathon, Kilometer 35!«
Ich überlegte noch, wie ich das kurz zusammenfassen konnte, aber Leni Riefenstahl hatte andere Sorgen.
»Das ist armselig. Aber so was von armselig! Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Was soll ich hier? Wie soll ich diesen elenden, erbärmlichen Haufen fotografieren? Das Objektiv, das aus Scheiße Gold macht – das ist leider noch nicht erfunden.«
Ihr Blick fiel wieder auf mich. »Solche wie ihn brauche ich. Nicht so ein Schladderzeug!« Sie hielt inne, sah mich an, sah den Hauptsturmführer an. »Warum steht der noch hier herum? Warum ist der noch nicht umgezogen? Oder sind das schon seine Klamotten?« Dabei tippte sie mir dauernd auf die Brust, mit einem Gesichtsausdruck: Gleich hab ich’s, gleich hab ich’s! Und tatsächlich: »Olympia, Marathonlauf. Kilometer 35! Ich vergesse keinen und nichts! Oben auf dem Karlsberg.«
So ergab das eine das andere. Hauptsturmführer Ehrlinger, der mich vor einer Minute noch hatte erschießen wollen, hielt mich jetzt für einen berühmten Marathonläufer, der mit Leni auf Du und Du war. Er brüllte seinen Adjutanten herbei, brüllte Anordnungen und Befehle.
Leni Riefenstahl wiederholte immer wieder »bitte, bitte nicht brüllen, ich hab eine solch grauenhafte Migräne!«, bis mich schließlich der Adjutant am Arm packte und mit sich riss.
Der Einzige, der nicht wusste, um was es ging, war ich.
»Hopp, hopp, hopp, Laufschritt!«, brüllte nun auch der Adjutant, »aber dalli.« Hin, zurück, im Laufschritt los! Hollari, Hollaro! Laufschritt, nichts anderes war mir seit Jahren vertraut. Laufen, davonlaufen, das war mein Leben. Also auch hier. Wir rannten über den überfüllten Schlossplatz, liefen am Eingang der Stiftskirche vorbei, durch deren offen stehendes Portal die Orgel klang und der inbrünstige Gesang der Gläubigen. »Christ ist erstanden.« Sie waren bei der zweiten Strophe. »Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis.«
Stimmte das? Gab es noch irgendeinen, der sich freute? War die Welt nicht schon längst vergangen? Das Halleluja riss ab, und hinter uns krachte das Tor in die Verriegelung. Wir waren im Wittelsbacher Schloss.
Hier war der Teufel los. Im Kreuzgang liefen Uniformierte, BDM-Mädels, hemdsärmelige Zivile, Abordnungen des Trachten- und des Schützenvereins herum wie Ameisen vor einem drohenden Unwetter. Eine Mädelringführerin hielt einen Fahnenjunkerleutnant an und wollte wissen, ob denn endlich der Kurier aus Berlin eingetroffen sei.
»Entzieht sich meiner Kenntnis!«, meldete der korrekt und eilte weiter.
Bevor sie uns ansprechen konnte, brüllte schon der Adjutant: »Tut mir leid, Eilauftrag!«
Im Garten des Kreuzganges hockten und standen Männer in Gruppen und Grüppchen. Vierzig. Fünfzig. Wie unterschiedlich große Maulwurfshügel hatten sie sich verteilt. »Konkurrenten«, sagte der Adjutant, der mich jetzt wie ein Kind an der Hand führte. Die Männer trugen kurze Hosen oder Turnhosen, manche Trainingshosen; Laufschuhe oder feste Halbschuhe; Unterhemden, Turnleibchen oder Hemden mit kurzen, abgeschnittenen oder aufgekrempelten Armen.
»Sind das Läufer?«, fragte ich meinen Begleiter.
»Angeblich. Mieser Jahrgang!«
Am meisten irritierte mich das Alter der Männer. Die schienen von sechzehn bis weiß Gott wie alt zu sein, sechzig, siebzig?
Ich kannte das Wittelsbacher Schloss von unseren Aufenthalten während der Sommerfrische. Da gab es bei uns das Zeremoniell: bei Regen – Schlossbesichtigung. Mein Vater hatte dem Kronprinzen Rupprecht einmal bei einem Weisheitszahn geholfen, und als Dank durften wir ins Schloss. Ich mochte die Waffenkammer mit den Schwertern und Bihändern. Am liebsten hatte ich aber die Büchse mit der Elfenbeinverzierung. Da war eine nackte Dame drauf, und wenn man auf ihre rechte Brust drückte, öffnete sich der Deckel des Kolbenfaches. Ihr Nippel war schon ganz blank vom vielen Drücken.