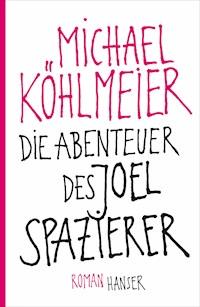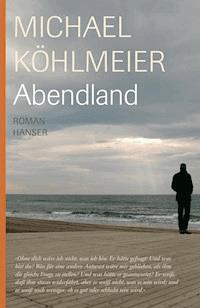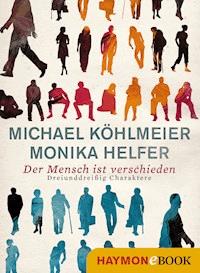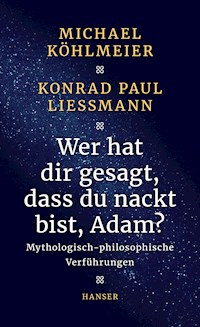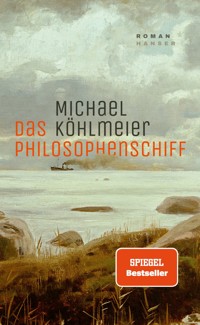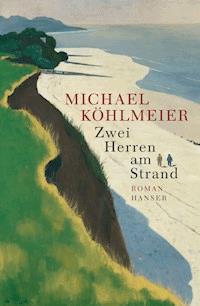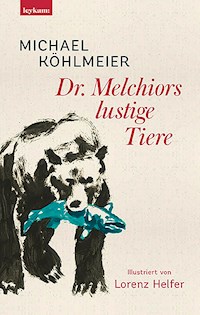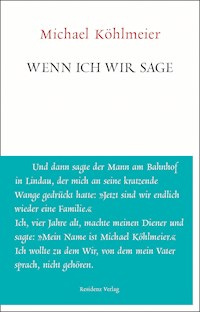Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alter Rhein. Zwei Männer spazieren am Ufer entlang, ins Gespräch vertieft. Es ist tiefer Winter, die Seitenarme des Flusses sind zugefroren, doch der Föhn spielt Frühling, es taut. Von weitem sehen die beiden einen großen schwarzen Hund über das Eis auf sie zulaufen. Plötzlich bricht er ins Eis ein. Der Hund kämpft um sein Leben. Einer der Männer holt Hilfe. Der andere, er ist Schriftsteller, bleibt alleine mit dem Hund. Er bricht einen großen Ast von einer Weide und kriecht auf diesem zu dem Hund. Er fasst ihn an den Vorderläufen. Der Hund verbeißt sich in seinem Ärmel. Er wird den Hund nicht retten können. Doch der Tod hat vor einigen Jahren eine so tiefe Wunde in sein Herz geschlagen, dass er ihm unter keinen Umständen dieses Leben überlassen will. Er hält den Hund verzweifelt fest, auch als der sich schon längst nicht mehr rührt. Michael Köhlmeier kann, was nicht viele können: in einer ganz kleinen Geschichte eine ganz große erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Köhlmeier
Idylle mit
ertrinkendem Hund
Deuticke
eBook ISBN 978-3-552-06104-0
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2008Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.deuticke.at
für Monika
für Oliver
für Undine
für Lorenz
für unsere liebe Paula
Der eine und der andere sitzen am Alten Rhein und warten auf den Engel. Damit er vielleicht die Nacht mit ihnen verbringe. Es ist kalt, aber sie trauen sich nicht, im Auto zu schlafen, weil sie Angst haben, den Engel zu verpassen. Sie denken sich: Der Engel wird bestimmt nicht auf uns warten. Wenn wir schlafen, wird der Engel uns nicht wecken.
Paula Köhlmeier,
Der eine und der andere
1
Nur drei meiner Bücher hat Dr. Beer lektoriert. Die Arbeit am vierten brach er ab – wie er mir in einem handgeschriebenen Brief mitteilte, »nach gesundheitlichen Erwägungen«. Ich weiß es besser. Er schämte sich vor mir – wegen der Ereignisse, die während unserer letzten gemeinsamen Arbeit vorgefallen waren: die Geschichte mit dem Hund. Kann sein, dass es ihm nicht recht ist, wenn ich diese Geschichte hier erzähle. Aber: Er war nicht nur mein Lektor, sondern auch mein Lehrer, und er hatte stets betont, Literatur, die auf irgendetwas oder irgendjemanden Rücksicht nehme, sei nichts wert.
Erst wenige Tage vor jenen Geschehnissen hatte er mir das Du-Wort angeboten. Niemals hätte ich damit gerechnet! Ich hätte mir nicht einmal vorstellen können, dass er seine eigene Frau duzte (von deren Existenz – und, bitte, wir kannten uns immerhin seit acht Jahren! – ich damals nichts wusste). Mit Begriffen wie Frau, Freundin, Geliebte oder gar Familie brachte ich diesen Mann nicht in Verbindung; nicht einmal Eltern stellte ich ihm in meiner Einbildung beiseite; ebenso sträubten sich lebensgeschichtliche Kategorien wie Kindheit und Jugend dagegen, sein Leben als ein zum Beispiel mit dem meinen vergleichbares zu beschreiben. Dass ich ihn in Zukunft Johannes nennen sollte, versprach ein Krampf zu werden, ein immer neuer, sich nie entspannender Krampf. Natürlich vermied ich es. Er konnte sich ebenfalls nicht an meinen Vornamen gewöhnen; das war offensichtlich, beinahe beleidigend offensichtlich.
Nur ein einziges Mal habe ich seinen Vornamen ausgesprochen. Als ich ihn meiner Frau vorstellte. »Das ist der Johannes«, hatte ich gesagt. In unserer alemannischen Umgangssprache setzt man einen Artikel vor den Namen, was in seinen Ohren sicher plump klang. Mir war’s recht; der Artikel vergrößerte den Abstand von Haut zu Haut deutlich – stellte die Ordnung wieder her, mit der ich zufrieden gewesen war, weil sie verlässlich war wie die Temperatur auf dem Meeresboden.
Ich gebe zu, dennoch hätte ich gern meinen Vornamen aus seinem Mund gehört, wenigstens einmal – als einen Akt des Ausgleichs, als ein Ist-Gleich-Zeichen zwischen unseren Gewichten. Ich hatte das Gefühl nie loswerden können, er halte kleine, versteckte Prüfungen mit mir ab; nicht unbedingt, um mich eines Fehlers zu überführen, sondern eher um mich in einer Art von väterlichem Einverständnis zu überwachen, also durchaus wohlwollend (was ja noch beschissener wäre). Kaum hatte ich seinen Namen ausgesprochen, schämte ich mich auch schon dafür. Er merkte es. Als wäre ich ihm zuvorgekommen und hätte seinen schwachen Punkt getroffen, bevor meiner in sein Visier geraten war. Er wandte sich Monika zu und nannte sie – demonstrativ? – bei unserem Familiennamen.
Sein erstes Du war am Telefon gefallen, und zwar – daran zweifelte ich bald nicht mehr – aus Versehen. Vielleicht war, als ich anrief, jemand in seinem Zimmer gewesen, den er duzte, und ich war mitten in ihr Gespräch geplatzt – was ich mir aber auch nicht vorstellen konnte, einfach deshalb nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er Freunde hatte, und mit Sicherheit hätte er nur einem solchen das Du erlaubt.Am wahrscheinlichsten schien mir, dass er gerade in einem Buch oder in einem Manuskript gelesen hatte, eine besonders gelungene Szene, in der sich – wer weiß – zwei Freunde unterhielten, und er so tief in diese erfundene Welt versunken war, dass er für einen Augenblick über das Klingeln des Telefons hinaus den Sound dieser fiktiven Welt nicht loswerden konnte und ihn in Gedanken mitnahm, in den Hörer hinein und hinein in mein Ohr.
Plausibel schien mir auch diese Erklärung nicht: Dr. Beer war mein Lektor, er war nun sechzig, und überall, wo Einblick ins deutsche Verlagswesen bestand, wurde er als einer der kompetentesten geschätzt, über etwas anderes als über Literatur hatten wir beide uns bis dahin nicht unterhalten, abgesehen vom Wetter und vom Frankfurter Stadtverkehr, und ich kenne niemanden, der je auf ein anderes Thema gestoßen wäre, das sich für ein Gespräch mit ihm als tragfähig erwiesen hätte. Dennoch hatte ich ihn immer in Verdacht gehabt, er interessiere sich in Wahrheit gar nicht für Romane und Erzählungen, Novellen oder Essays, Plots, Charaktere, Dialoge; er interessiere sich nämlich schlicht nicht für Literatur, sondern nur für die Virtuosität im Umgang mit ihr; am Herzen liege ihm aber etwas ganz anderes. Allerdings hatte ich nicht die geringste Ahnung, was das sein könnte. Ein Mann mit einem Doppelleben? Er hätte das Wort im Manuskript mit Wellenlinie markiert, und wenn wir während der Arbeit bei dieser Stelle angelangt wären, gesagt: »Ich persönlich mag solche Wörter ja und wünschte mir deshalb, Sie hätten es in einen passenden Zusammenhang gesetzt, so aber muss ich Sie bitten, es gegen ein anderes auszutauschen.«
Er selbst sagte einmal über sich: »Ich bin Lears Narr.« Wobei die Frage offen blieb: Wer war sein Lear? Wer würde sich denn schon mit diesem Schmerzensmann vergleichen wollen?
Niemand wusste, was er tat, nachdem er seinen Mantel angezogen, den Kragen hochgestellt, den Regenschirm aufgespannt, sich von der Frau beim Eingang verabschiedet hatte und aus dem Verlagsgebäude verschwunden war. Nicht einmal, ob er mit dem Taxi oder dem Bus, der U-Bahn oder dem eigenen Wagen oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Hause wollte. Nach Hause? Wie sah sein Zuhause aus? An den Wänden in seinem Büro standen Regale bis zur Decke, und im Gegensatz zu seiner Kollegin von der Sachbuchabteilung, deren Bücher, von einem Bord mit Nachschlagewerken abgesehen, aus der hauseigenen Produktion stammten, vermittelten seine den Eindruck einer Privatbibliothek. Da parkten deutsche Klassiker und russische Dichter und Amerikaner, die gesammelten Werke von D. H. Lawrence, Joseph Conrad (sein – und mein – Lieblingsautor) und Luigi Pirandello, Lyriker aus Frankreich und Irland, hauptsächlich aber philosophische Werke. Er habe, hatte er mir einmal erzählt – knapp und unwirsch und erst, nachdem ich ihn zweimal danach gefragt hatte –, Philosophie studiert und über ein Thema der Husserlschen Phänomenologie dissertiert. Literatur von und über Husserl machte ein sattes Viertel seiner Bibliothek aus. Ob also hier, nur hier in seinem Büro, sein Schreib- und Leseleben – sein intellektuelles Leben – stattfand? Warum nicht? Und privat ging er mit Steuerberatern und Rechtsanwälten kegeln oder gehörte einem Biker-Club an oder trieb sich mit Spezis in Bars herum? Warum nicht? Ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass dieser Mann Spezis hatte; eben weil ich mir nicht vorstellen wollte, dass er überhaupt ein Privatleben hatte.
Über das Privatleben von Lears Narr weiß auch niemand Bescheid. Und niemand weiß, ob er an das glaubt, was er sagt. Die Worte sind das Werkzeug des Narren, anderes Werkzeug kennt er nicht.
Und dann am Telefon – nach einem, in einem unbedachten Augenblick entschlüpften Du: »Ich schlage vor, wir sollten in Hinkunft auf diese Weise miteinander sprechen.«
Ohne Kränkung konnte das Wort nicht mehr zurückgenommen werden. Weder von ihm noch von mir. Und doch hatte er in seinem Angebot so peinlich darauf Bedacht genommen, es nicht noch einmal auszusprechen ...
Obendrein schlug er vor, dass diesmal nicht ich nach Frankfurt, sondern er zu mir nach Hohenems kommen würde, um an dem Manuskript zu arbeiten – und erschrak prompt über sich selbst, das entging mir keineswegs, aber da war auch das bereits draußen. Ich schätzte, er hatte die Folgen der neuen Situation zu wenig berechnet, nämlich dass dem Du ein wenig Praxis nachzuschieben sei, damit es nicht als bare Option wie ein drohender Stalaktit über jedem künftigen Wort hänge, und nun fand er sich in einer noch unangenehmeren Lage.
Während ich den Hörer in der Hand hielt, schaute ich zum Fenster hinaus, als könnte ich auf diese Weise dem Aufprall an Intimität ausweichen. Ein Schweigen hatte zwischen uns begonnen, und es war wie ein Wettrennen. Ich hörte, er hörte, wie er, wie ich, an einem Satz bastelte, in dem sich das Wörtlein bei ihm zum zweiten, bei mir zum ersten Mal, auf jeden Fall aber unbefangen unterbringen ließe. Ich sah ihn vor mir (diesen nicht großen, zarten Mann, dessen Bewegungen schnell, zielsicher und sehr eigen waren); er würde seinen Satz mit einem leichten Kopfschütteln beginnen und mit einem leichten Kopfschütteln beenden.
Es schneite so dicht, dass ich unser Nachbarhaus nur schemenhaft wahrnahm. Seit Wochen schneite es. Es war Jänner, der schneereiche Winter 2006. Mir fiel ein, dass Dr. Beer mir einmal erzählt hatte, er gehe jeden Tag spazieren, mindestens eine Stunde, so halte er es seit seinem dreißigsten Lebensjahr.
Ich sagte: »Wenn du kommst ...« – es gelang mir nicht, das Wort nicht zu betonen – »... bring gutes Schuhwerk mit für unsere Spaziergänge und einen dicken Mantel und eine Mütze dazu.«
»Das werde ich«, sagte er. »Magst du diesen Winter?«
»Magst du ihn?«, fragte ich zurück.
»Ja, sehr«, sagte er. »Und du?«
»Ich glaube eigentlich nicht.«
Nach dem Tod meines Vaters Anfang der achtziger Jahre waren Monika und ich mit den Kindern nach Hohenems in mein Elternhaus gezogen. In unserer Straße hat sich seit meiner Kindheit so gut wie nichts verändert. Unser Nachbarhaus ist irgendwann verputzt worden, das war alles. Aus seinem Dach ragt noch immer ein kleiner Kamin aus Blech, ich weiß nicht, wozu er dient, wusste es nie, er war für meine Schwester und mich der Maßstab für Schnee gewesen. An ein einziges Mal kann ich mich erinnern, das muss in den frühen Sechzigern gewesen sein, da war nichts mehr von ihm zu sehen gewesen, nichts außer einer sanften Erhebung. Nun war nicht einmal mehr eine Erhebung zu sehen, der Kamin war zur Gänze in den Schneemassen auf dem Dach versunken. Während der vorangegangenen Wochen war ich jeden Morgen um sieben aufgestanden und hatte in der Dunkelheit den Weg zu unserer Haustür freigeschaufelt. Der Briefträger hatte mir zu verstehen gegeben, dass er andernfalls keine Post mehr bringen würde. Rechts und links des schmalen Pfades, auf den ich mich beschränkte (gerade so breit wie ein Schlitten), wuchsen übermannshohe Schneehaufen empor. Ärgerlich war, dass der Schneepflug erst nach dem Briefträger kam und unseren Eingang wieder zuschüttete, manchmal fuhr er am Nachmittag noch ein zweites Mal durch unsere Straße, und nicht selten am Abend noch ein drittes Mal.
Monika und ich verließen kaum noch das Haus. Mit dem Schlitten gingen wir einkaufen, alle drei Tage höchstens. Über den Schlossberg zu wandern, wie es Monika sonst bei jedem Wetter sechsmal in der Woche tut, war gar nicht möglich. Sie hatte es probiert und aufgegeben, als sie bereits hinter der ersten Kehre bis zur Brust im Schnee versank. Von unserem Küchenfenster aus konnten wir durch einen Feldstecher den Wald über der Felswand sehen. Die Tannen waren strukturlose weiße Kegel, die mehr an Kunstobjekte von Christo und Jeanne-Claude denken ließen als an Werke der Natur.
Ich fragte, ob ich ein Zimmer für ihn besorgen solle.
Ohne zu zögern und ohne weiteren Kommentar sagte er: »Nein.«
»Ganz einfach«, interpretierte Monika, nachdem ich aufgelegt und vor ihr das Telefongespräch bis in seine Einzelheiten nachgespielt hatte, »er will bei uns übernachten. Es ist doch ganz einfach. Er ist jetzt dein Freund, und ein Freund bringt seinen Freund nicht in einem Hotel unter.«
»Mein Freund?«
»Was denn sonst! Es ist längst überfällig. Gibt es jemanden, dem du dich in den letzten Jahren mehr preisgegeben hast?«
»Was heißt ›preisgeben‹?«
»Ich brauche dir doch das Wort nicht zu erklären.« (Er würde das Wort einer eingehenden Prüfung unterziehen.)
»Dir habe ich mich zum Beispiel mehr preisgegeben.«
»Ja. Und sonst?«