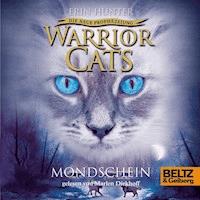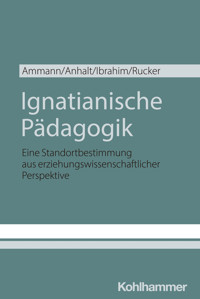
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ignatianische Pädagogik gilt als eine der wirkmächtigsten Strömungen katholischer Pädagogik weltweit. Im Kontext der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft fristet sie jedoch bislang ein Schattendasein und bringt es in Darstellungen zur Geschichte pädagogischen Denkens und Handelns bestenfalls zu einer Randnotiz. Mit vorliegendem Band ist das Anliegen verbunden, erstmals eine Standortbestimmung der ignatianischen Pädagogik aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive zu entwickeln und diese Position damit für die Theoriebildung und Forschung im Fach zu erschließen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kira Ammann/Elmar Anhalt/Omar Ibrahim/Thomas Rucker
Ignatianische Pädagogik
Eine Standortbestimmung aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Forschungsprojekt ›Ignatianische Pädagogik – Eine Standortbestimmung‹ wurde gefördert durch das Zentrum für Ignatianische Pädagogik.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045772-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-045773-7
epub: ISBN 978-3-17-045774-4
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Ignatianische Pädagogik gilt als eine der wirkmächtigsten Strömungen katholischer Pädagogik weltweit. Im Kontext der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft fristet sie jedoch bislang ein Schattendasein und bringt es in Darstellungen zur Geschichte pädagogischen Denkens und Handelns bestenfalls zu einer Randnotiz. Mit vorliegendem Band ist das Anliegen verbunden, erstmals eine Standortbestimmung der ignatianischen Pädagogik aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive zu entwickeln und diese Position damit für die Theoriebildung und Forschung im Fach zu erschließen.
Dr. Kira Ammann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung für Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaft, Universität Bern.
Prof. Dr. Elmar Anhalt, Ordinarius für Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaft, Universität Bern.
Dr. Omar Ibrahim, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Erziehungs- und Bildungstheorie, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau.
Prof. Dr. Thomas Rucker, Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Erziehungs- und Bildungstheorie, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau.
Inhalt
Einleitung
1. Vergewisserungen: Ideengeschichtliche Hintergründe ignatianischer Pädagogik
Omar Ibrahim
1.1 Die Frage nach der Frage
1.2 Traditionszusammenhänge
1.2.1 Griechisch-römische Philosophie
1.2.2 Christliche Spiritualität
1.2.3 Neuzeitliche Renaissance
1.3 Bezugspunkte
1.3.1 Person und Persönlichkeit
1.3.2 Tugend und Tugendhaftigkeit
1.3.3 Lebensform und Leben formen
2. Klärungen: Die Idee einer ignatianischen Pädagogik
Kira Ammann & Thomas Rucker
2.1 Personalität als Maßgabe
2.2 Pädagogik der Person
2.2.1 Person
2.2.2 Bildung als ›Aktuierung‹ der Person
2.2.3 Erziehung als Unterstützung einer ›Aktuierung‹ der Person
2.3 Ignatianische Pädagogik als Pädagogik der Person
2.3.1 Gott in allen Dingen
2.3.2 Indifferenz
2.3.3 Menschen für andere
2.3.4 Reflexion
Regierung
Unterricht
Beratung
Erziehender Unterricht
Erfahrung, Reflexion und Handeln
2.3.5 Die Frage nach Gott
3. Kontextualisierungen: Ignatianische Pädagogik und ihre Pädagogizität
Thomas Rucker
3.1 Ignatianische Pädagogik – Variante 1
3.1.1 Bestimmtsein zu einem gottgefälligen Leben
3.1.2 »Vereinigung von Wissen und Frömmigkeit«
3.1.3 Disziplinierung, Einübung und Unterweisung
3.2 Die Eigenlogik moderner Erziehung
3.3 Ignatianische Pädagogik – Variante 2
3.3.1 Personsein als Selbstgestaltungsaufgabe
3.3.2 Verantworteter Umgang mit Freiheit
3.3.3 Regierung, Unterricht und Beratung
3.4 Pädagogik vs. Ignatianische ?
3.4.1 Bekenntnis vs. Bildung
3.4.2 Das Problem der Indoktrination
3.4.3 Pädagogisierung und Reaktualisierung
4. Spezifizierungen: Erziehung des Charakters
Thomas Rucker
4.1 Tugenderziehung als Vorgabe der Tradition
4.2 (Neo-)aristotelische Tugenderziehung
4.2.1 Tugend und Tugenden
4.2.2 Eudaimonia und Selbstverwirklichung
4.2.3 Gewöhnung und Unterweisung
4.3 Herausforderungen
4.3.1 Moral im weiten, Moral im engen Sinne
4.3.2 ›Interne‹ Probleme
4.3.3 Komplexität
4.3.4 Personalität
4.3.5 Nachfolge revisited
4.4 Alternativen denken
4.4.1 Moral der universellen Achtung
4.4.2 Tugend als Einheit von Einsicht und Wille
4.4.3 Charaktererziehung als Erziehung zur Moralität
4.4.4 Erziehung als Wagnis
5. Problematisierungen: Ignatianische Pädagogik und Gesellschaft
Elmar Anhalt
5.1 Allgemeines | Besonderes: Das Problem der Universalien
5.1.1 Die Schwierigkeit der Standortbestimmung
5.1.2 Asymmetrie und Symmetrie
5.1.3 Die Notwendigkeit einer Entscheidung
5.1.4 Zu einem Urteil kommen
Das Urteil von Richter:innen
Das Urteil von Expert:innen
5.1.5 Gegebenes
5.1.6 Relevanz der Problemstellung für das Thema
Suche nach Orientierung
Einseitigkeit der Faktenorientierung
Urteilsaufschub
5.2 Gesellschaft | in Gesellschaft sein: Das Problem der Ordnung
5.2.1 Der Begriff der Gesellschaft
5.2.2 Die Gesellschaft der Pädagogik
5.2.3 Strategie der kreativen Traditionssicherung
5.3 Erziehung als Verhältnis von Selbstverhältnissen: Das Problem der Sozialität
5.3.1 Bewahrung und Entgrenzung
5.3.2 Das Proprium der ignatianischen Pädagogik
5.3.3 Der Mensch als mehrdimensionales Lebewesen
5.3.4 Pädagogik als Angelegenheit der Menschen
5.3.5 »Kompetenz im Umgang mit komplexen pädagogischen Aufgaben«
5.3.6 Pädagogik als praxeologische Theorie
5.3.7 Erziehung als Form des Miteinanderumgehens
Schluss
Literatur
Einleitung
Am Beginn des 3. Jahrtausends ist deutlich zu erkennen, dass die als Säkularisierung bezeichnete Entwicklung hin zu spätmodernen Gesellschaftsformationen zahlreiche Probleme mit sich führt und vor der Erschöpfung steht. Die Probleme sind allenthalben greifbar, weil die Welt nicht dem technologisch-ökonomisch-politischen Verwertungsparadigma einverleibt werden kann. Die Kulturen fügen sich nicht vorbehaltlos diesem Paradigma und die Umwelten stellen nicht endlos Ressourcen bereit. In dieser Situation wird von verschiedenen Seiten ein Umdenken angemahnt, das sich wieder einer Kultur der Sorge füreinander zuwendet.
In den Diskussionen wird vermehrt den tief in die Kulturen eingewebten religiösen Formen der Sinnorientierung Beachtung geschenkt (vgl. Habermas 2001, 2005; Joas 2004, 2011, 2012, 2017; Taylor 2007/2009). Dies hat nicht nur dazu beigetragen, dass Wert- und Normfragen wieder vermehrt in ihrer gesellschaftsstabilisierenden Funktion thematisiert werden (vgl. Anhalt 2012b; Rucker 2021a), sondern auch dazu geführt, dass die Wissenschaft herausgefordert wird, ihren wertneutralen Standpunkt zu überdenken. Vor allem geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Fächer sehen sich aufgerufen, ihr Verhältnis zu den sinnstiftenden Angeboten einer Gesellschaft zu klären (vgl. Anhalt & Binder 2020).
Religion und Erziehung spielen in diesen Überlegungen eine zentrale Rolle. Für Religion wie Erziehung ist es ausgemacht, dass der Mensch als ein Gemeinschaftswesen in den Blick genommen werden muss und dass alles, was im Umgang mit ihm veranstaltet wird, von der Tatsache auszugehen hat, dass Menschen imperfekte Lebewesen sind (vgl. Rahner 1964; Müllner 2007; Sünkel 2013; Benner 2015). Als solche stehen sie vor der Aufgabe, in Gemeinschaft mit ihresgleichen zu versuchen, sich sowohl die Welt als auch das einzelne Leben und das Zusammenleben in ihr verständlich zu machen und gemeinwohlverträglich zu gestalten (vgl. Butzer 2008; Rappel 1996). Vor diesem Hintergrund sollte die Erziehungswissenschaft ein Interesse daran haben, noch besser als bislang zu verstehen, welches Angebot durch religiöse Sichtweisen, die ein »Ergriffensein von einem letzten, unbedingten Anliegen« (Tillich 1962, S. 9) zum Ausdruck bringen, bereitgestellt wird und wie das Verhältnis von Religion und Erziehung in seinen differenzierten Verzweigungen konkret beschaffen ist und in der täglichen Praxis gestaltet werden kann.
Problemstellung
Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht das Angebot, das von einer ignatianischen Pädagogik bereitgestellt wird, in der Erziehung im Lichte der Tradition des Jesuitenordens, wie sie mit dem Werk von Ignatius von Loyola (1491–1556) ihren Ausgang nimmt, bestimmt wird (zur Geschichte des Jesuitenordens vgl. Friedrich 2020, 2021). Ignatius war mit einer Gruppe von Mitstudenten der Gründer der ›Gesellschaft Jesu‹ und ist – auch innerhalb der Pädagogik und Erziehungswissenschaft – vor allem als Autor der Geistlichen Übungen, der Exerzitien, bekannt (vgl. u. a. Knauer 2006). Bei diesem Werk handelt es sich um eine Anleitung, um Übungen zu begleiten, die darauf gerichtet sind, dass eine Person ihren Glauben vertieft und darüber hinaus lernt, dem eigenen Glauben entsprechende Entscheidungen in der Nachfolge Jesu Christi zu treffen. In diesem Sinne fasst Ignatius unter dem Begriff der geistlichen Übungen »jede Weise, die Seele darauf vorzubereiten und einzustellen, um alle ungeordneten Anhänglichkeiten von sich zu entfernen und nach ihrer Entfernung den göttlichen Willen in der Einstellung des eigenen Lebens zum Heil der Seele zu suchen und zu finden« (von Loyola 1544/2008, S. 27). Die Exerzitien fungieren bis heute als ein maßgeblicher Bezugspunkt von Bestrebungen, Erziehung im Lichte der Tradition ignatianischer Spiritualität zu bestimmen.
Mit unserem Fokus auf die ignatianische Pädagogik wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Jesuitenordnen bereits zu einem frühen Zeitpunkt seiner Geschichte dem Umgang mit der nachwachsenden Generation Aufmerksamkeit geschenkt und diesen Umgang zum Gegenstand der Reflexion gemacht hat. Mehr noch: Das »Bildungswesen« avancierte zum »charakteristischen Bereich jesuitischen Engagements« – eines Engagements, das bis heute anhält. »Auch wenn Ignatius und seine ersten Gefährten ihre ›Sendung‹ in einem allgemeineren Sinn verstanden hatten, wurden die (religiöse) Unterweisung, Unterricht und Erziehung in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen schon sehr bald, verstärkt dann im Kontext der konfessionellen Auseinandersetzungen, zum wichtigsten Betätigungsfeld der Jesuiten« (Conrad 2000, S. 205). Aus Sicht der Erziehungswissenschaft wäre es vor diesem Hintergrund wichtig zu wissen, worin das spezifische Angebot einer ignatianischen Pädagogik besteht.
Eine Standortbestimmung ignatianischer Pädagogik aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, auf die man sich an dieser Stelle berufen könnte, liegt bislang nicht vor. Neben den Geistlichen Übungen von Ignatius werden in der Rede über ignatianische Pädagogik heute vor allem zwei Referenztexte bemüht, nämlich zum einen das Dokument The Characteristics of Jesuit Education aus dem Jahre 1986 und zum anderen das Dokument Ignatian Pedagogy: A Practical Approach von 1993 (jeweils abgedruckt in Neulinger 1998, S. 11 ff. und S. 97 ff.). Auf dieser Grundlage sind bis heute eine Reihe von Beiträgen verfasst worden, in denen die ignatianische Pädagogik zum Thema gemacht wird (für den deutschsprachigen Raum vgl. u. a. Funiok & Schöndorf 2000; Mertes 2004, 2009; Zimmermann 2009; Mertes & Siebner 2010; Spermann, Gentner & Zimmermann 2015; Gentner, Spermann & Zimmermann 2019).
Zwar wird Ignatius teilweise sogar als ein Klassiker der Pädagogik angeführt (vgl. Erlinghagen 1979/2000; März 2000; Prange 2007), doch bleibt festzuhalten, dass die ignatianische Pädagogik bis heute kaum zum Gegenstand der Erziehungswissenschaft avanciert ist – schon gar nicht unter systematischen Gesichtspunkten (vgl. Lundberg 1966; zur Geschichte jesuitischer Schulen und Hochschulen vgl. die Beiträge in Funiok & Schöndorf 2000 und Pavur 2017). Doch auch der Klassikerstatus ist umstritten, der Ignatius bisweilen zugesprochen wird. So glaubt z. B. Fritz März, die »Geschichte der Pädagogik« könne Ignatius »allenfalls eine Fußnote zum – zugegebenermaßen gewichtigen – Kapitel über die Pädagogik der Jesuiten« zugestehen (März 2000, S. 266). Im Unterschied hierzu argumentiert Karl Erlinghagen, dass die »Pädagogik des Jesuitenordens« ihren Ausgang von der »Spiritualität« des Ordensgründers nehme und ohne diese nicht hätte entwickelt werden können. Ignatius habe zwar selbst keine Beschreibung von Erziehung angefertigt, doch wäre der Erfolg des vom Jesuitenorden getragenen Schul- und Hochschulsystems nicht möglich gewesen ohne »die Person, das Werk und das Fortwirken des Ignatius«, weshalb dieser durchaus als Klassiker der Pädagogik gelten könne (Erlinghagen 1979/2000, S. 90). Darüber hinaus, so könnte man hinzufügen, gibt es durchaus gute Gründe, die Exerzitien selbst als eine Beschreibung von Erziehung zu interpretieren – dies jedenfalls dann, wenn Erziehung nicht von vorneherein an einen schulischen Kontext geknüpft wird. So spricht Klaus Prange Ignatius ausdrücklich das Verdienst zu, in den Exerzitien »ein allgemeines Schema des Erziehens« und – damit verbunden – »die rechte Ordnung eines existenziell bedeutsamen Lernens« entwickelt zu haben (vgl. Prange 2007, S. 97 f.).
Avanciert eine ignatianische Pädagogik in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft zum Gegenstand, so werden in der Regel spezifische Problemstellungen verfolgt (z. B. Brinkmann 2008), allerdings wird dem allgemeinen Problem einer ›Ortsbestimmung‹ ignatianischer Pädagogik nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. In neueren Geschichten zur Pädagogik avanciert die ignatianische Pädagogik lediglich zu einer ›Randnotiz‹ (vgl. Böhm 2007, S. 52; Koerrenz et al. 2017, S. 107 ff.). Aktuellere Entwürfe einer ignatianischen Pädagogik sind in der Erziehungswissenschaft bislang nicht berücksichtigt worden – von einigen sporadischen Hinweisen einmal abgesehen (vgl. Tenorth 2017, S. 17 f.). Schon gar nicht liegt bis dato eine historisch-systematische Zusammenschau der verschiedenen nationalen und internationalen Beiträge zur ignatianischen Pädagogik vor. Entsprechend ist unklar, ob es überhaupt sinnvoll ist, von ›der‹ ignatianischen Pädagogik zu sprechen, oder ob es sich nicht vielmehr bei dem, was heute mit diesem Namen bezeichnet wird, um einen mehr oder minder kohärenten Zusammenhang verschiedener Beschreibungen von Erziehung handelt, die im Laufe der Geschichte zusammengetragen worden sind.
Unsere Untersuchung verfolgt das Ziel, Grundzüge einer Standortbestimmung der ignatianischen Pädagogik aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive zu entwickeln, indem Ansätze zu einer entsprechenden Pädagogik historisch-systematisch rekonstruiert sowie in die Problemgeschichte pädagogischen Denkens und Handelns eingeordnet werden. Eine solche Standortbestimmung erweist sich als notwendig, wenn heute eine erziehungswissenschaftlich reflektierte Antwort auf die Frage gegeben werden soll, welche Bedeutung einer ignatianischen Pädagogik unter den gegenwärtigen und voraussichtlich zukünftigen gesellschaftlichen Bedingungen zukommt, zukommen könnte und vielleicht auch zukommen sollte (klassisch: vgl. Schwickerath 1903). In diesem Sinne ist mit unserer Untersuchung nicht nur das Anliegen verbunden, ein Desiderat in der erziehungswissenschaftlichen Forschung zu bearbeiten. Der Anspruch lautet ferner, über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen sowie über Entwicklungspotentiale ignatianischer Pädagogik unter den Bedingungen einer spätmodernen Gesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen aufzuklären. Für die Arbeit an ignatianischen Schulen, wie sie heute weltweit betrieben wird, könnte eine solche Standortbestimmung einen wichtigen Beitrag zur Selbstreflexion darstellen.
Blinde Flecke
Die Arbeitshypothese, von der wir ausgehen, lautet, dass eine ignatianische Pädagogik eine Alternative zu dem offeriert, wie (schulische) Erziehung in der Gegenwart üblicherweise verstanden wird, nämlich als die möglichst effizient gestaltete Ausstattung von Heranwachsenden mit ökonomisch verwertbaren Qualifikationen und Kompetenzen. Von einer solchen Annahme auszugehen, erscheint durchaus als sinnvoll, wenn man berücksichtigt, dass in neueren Schriften zur ignatianischen Pädagogik eine gegenwärtig dominante Rede von Bildung problematisiert wird. Damit reiht sich eine ignatianische Pädagogik in die Stimmen derer ein, die an einem instrumentellen Bildungsverständnis Kritik üben, in dem Heranwachsende als ›Humankapital‹ erscheinen, statt als Personen, die nicht auf einen vorgegebenen Lebensentwurf festgelegt werden sollten (vgl. Mertes 2004, S. 44). Zugleich wird von Seiten einer ignatianischen Pädagogik für ein Bildungsverständnis votiert, wie es in der Moderne entwickelt worden ist, und in dem die pädagogische Sorge um Kinder und Jugendliche unter den Anspruch gestellt wird, diesen dabei zu helfen, sich zu den Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, in ein Verhältnis zu setzen sowie zu lernen, dass und wie man die Abhängigkeiten, in denen man sein Leben führen will, selbst wählen kann (vgl. Mertes & Siebner 2010, S. 139; Gentner, Spermann & Zimmermann 2019, S. 6).
Sowohl die Kritik an einem instrumentellen Bildungsverständnis als auch das Votum für die Wiederaneignung eines ›christlichen Humanismus‹ werden relational zur ignatianischen Tradition begründet (vgl. Funiok & Schöndorf 2000, S. 13). Hierbei ist auffällig, dass gleichsam wie selbstverständlich von einer prinzipiellen Kompatibilität zwischen einem modernen Begriff von Bildung und einer Beschreibung von Erziehung, die in einem religiösen Selbst- und Weltverständnis gründet, ausgegangen wird. Überraschend ist dies allein schon dann, wenn man berücksichtigt, dass eine Ausrichtung an Bildung Erziehung unter den Anspruch stellt, Heranwachsende nicht auf vorgegebene Orientierungsmuster festzulegen, sondern diesen zu einer Lebensführung aus gedanklicher Selbständigkeit zu verhelfen (vgl. Rucker 2014). In diesem Sinn konfligiert eine Erziehung als Ermöglichung von Bildung in der Tat damit, Bildung auf die Aneignung gesellschaftlich erwarteter Qualifikationen und Kompetenzen zu reduzieren und (schulische) Erziehung an den Anspruch zu knüpfen, Heranwachsende für den internationalen Wettbewerb der Staaten auszurüsten. Jedoch sollte hierbei nicht übersehen werden, dass eine Erziehung als Ermöglichung von Bildung auch mit dem Anspruch konfligiert, Heranwachsende auf vorgegebene religiöse Orientierungsmuster zu verpflichten, was in Beiträgen zur ignatianischen Pädagogik durchaus eingeräumt wird (vgl. Mertes 2009, S. 283 f.; Zimmermann 2009, S. 65 f.). Dieser Umstand schließt zwar nicht aus, die ›Frage nach Gott‹ als eine unverzichtbare Komponente von Bildung zu bestimmen und zu begründen. Kinder und Jugendliche in die ›Frage nach Gott‹ zu verstricken und ihnen dabei zu helfen, in der selbsttätigen Auseinandersetzung mit tradierten Antworten auf diese Frage ihren eigenen Standpunkt in Sachen Religion zu suchen und zu finden, bedeutet aber doch eine andere Ausrichtung von Erziehung, als sie in der Tradition ignatianischer Pädagogik ursprünglich bestimmt und realisiert worden ist, nämlich Heranwachsende in eine christliche Lebensführung einzuweisen und sie damit ihrer Bestimmung als Geschöpfe Gottes zuzuführen (vgl. Lundberg 1966).
Schon allein die These von der Kompatibilität einer in ignatianischer Tradition situierten und in diesem Sinne religiös fundierten Pädagogik mit einem modernen Begriff von Bildung sollte auf der Seite der Erziehungswissenschaft ein Interesse dafür erzeugen, die Beschreibung von Erziehung genauer in Augenschein zu nehmen, die von Seiten einer ignatianischen Pädagogik offeriert wird. Darüber hinaus wäre im Fach zur Kenntnis zu nehmen, dass der Jesuitenordnen »weltweit das größte zusammenhängende internationale Schul- und Ausbildungssystem« unterhält, »das von einer nichtstaatlichen Institution getragen wird« (Mertes 2004, S. 8). Nach Angaben der Internationalen Kommission für das Apostolat Jesuitischer Erziehung (ICAJE 2024) besuchen aktuell rund 1.700.000 Schüler:innen Jesuitenschulen. Ferner sind in diesem Jahr etwa 1800 Jesuiten und 100.000 Laien an rund 3450 Schulen in der Trägerschaft des Ordens tätig. Diese Schulen sind auf 79 Länder verteilt. Vor diesem Hintergrund mag es dann doch überraschen, dass die ignatianische Pädagogik für die (deutschsprachige) Erziehungswissenschaft scheinbar allenfalls von historischem Interesse ist, und bisher entsprechend keine ernsthafte Thematisierung, Prüfung und Problematisierung aktueller Entwürfe einer ignatianischen Pädagogik sowie der darin offerierten Thesen und Argumenten erfolgt ist.
Umgekehrt kann festgestellt werden, dass in Beiträgen zur ignatianischen Pädagogik kaum eine diskursive Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung und Forschung stattfindet. Überblickt man die Literatur, so dominiert klar die Binnenperspektive, worauf Autor:innen ausdrücklich aufmerksam machen, ohne diesen Umstand jedoch weiter zu problematisieren (vgl. Funiok & Schöndorf 2000, S. 16). Hinzu kommt, dass Beiträge zur ignatianischen Pädagogik selbst relativ unverbunden nebeneinanderstehen und sich bei näherer Betrachtung keinesfalls als deckungsgleich erweisen. Wie wir zu zeigen versuchen, lassen sich auch heute Beiträge zur ignatianischen Pädagogik ausfindig machen, in denen Erziehung daraufhin ausgerichtet wird, Heranwachsende dazu zu bewegen, sich als Christen zu verstehen und aus einem entsprechenden Selbstverständnis heraus das eigene Leben zu führen. All dies bleibt nicht ohne Konsequenzen. So ist bis heute unklar, was unter ignatianischer Pädagogik zu verstehen ist, wie ihr Verhältnis zu alternativen pädagogischen Entwürfen bestimmt werden kann, aber auch welche Bedeutung einer ignatianischen Pädagogik unter den Bedingungen einer spätmodernen Gesellschaft zukommen könnte, sollte oder gar müsste.
Kategoriale Differenzen
Diese Untersuchung ist mit dem Anspruch verbunden, erste Antworten auf diese Fragen zu geben. Hierzu bedarf es zunächst der Einführung bestimmter kategorialer Differenzen, die für die vorliegende Arbeit grundlegend sind. Die Klärung dieser Differenzen bedeutet nicht nur eine Konturierung der für uns maßgeblichen Perspektive, sondern eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, dass die Forschung sowohl an der erziehungswissenschaftlichen Außen- als auch an der jesuitischen Binnenperspektive anschließen und diese methodisch kontrolliert untersuchen kann.
Die Untersuchung beruht auf einer Unterscheidung dreier Kategorien, nämlich der Kategorie des Sachverhalts, der Kategorie der Beschreibung eines Sachverhalts und der Kategorie der Reflexion auf die Beschreibung eines Sachverhalts. Diese Unterscheidungen können fachspezifisch konkretisiert werden. In diesem Fall gilt es, zwischen der Erziehung, Beschreibungen dieses Sachverhalts sowie der Reflexion auf Beschreibungen von Erziehung zu unterscheiden.
Ignatianische Pädagogik wird von uns als ein spezifischer Sachverhalt aufgefasst, nämlich als ein Vorschlag, wie man Erziehung bestimmen kann. Daneben gibt es andere pädagogische Entwürfe, in denen Erziehung anders beschrieben wird. Der Vorschlag gibt an, wie es sich mit der Sache ›Erziehung‹ verhält. Eine Erziehung, wie sie aus der Perspektive ignatianischer Pädagogik bestimmt wird, bezeichnen wir als ignatianische Erziehung. Die von uns eingenommene erziehungswissenschaftlichePerspektive kommt darin zum Ausdruck, dass auf Beschreibungen von Erziehung reflektiert wird. Aus dieser Perspektive haben wir es mit zwei Sachverhalten zu tun: einmal mit der Frage, wie es sich mit der Sache ›Ignatianische Pädagogik‹ verhält, und einmal mit der Frage, wie es sich mit der Sache ›Erziehung‹ aus Sicht der ignatianischen Pädagogik verhält. Aus diesem Grund können wir nicht aus einer Binnenperspektive heraus argumentieren, d. h. aus der Warte von Vertreter:innen einer ignatianischen Pädagogik, sondern müssen stattdessen die Position einer externen Beobachterin einnehmen. Es macht für uns folglich einen Unterschied, ob an einer Schule z. B. Sozialpraktika vorbereitet, durchgeführt und reflektiert werden, oder ob Beschreibungen ignatianischer Erziehung angefertigt werden, in denen argumentiert wird, es sei die Aufgabe von Erziehung, ›Männer und Frauen für Andere‹ hervorzubringen. Und hiervon wiederum sind Versuche zu unterscheiden, in denen ein solcher Anspruch z. B. historisch kontextualisiert (›Dieser Anspruch steht in der Tradition von …‹), zu alternativen pädagogischen Entwürfen in Beziehung gesetzt (›Dieser Anspruch verhält sich zu …‹) oder unter den Bedingungen einer modernen Gesellschaft auf seine Überzeugungskraft hin beurteilt wird (›In der Moderne erweist sich dieser Anspruch als …‹). Die für uns maßgebliche Perspektive auf einen Sachverhalt, der Aussagen über einen Sachverhalt macht, ist die einer Beobachtung zweiter Ordnung – und damit eine Perspektive, in der die ignatianische Pädagogik selbst zum Gegenstand der Betrachtung avanciert (vgl. Rucker 2014, S. 54 ff.).
Von dieser Warte aus können verschiedene Pädagogiken als Standpunkte in den Diskussionen über adäquate Beschreibungen von Erziehung verstanden und als Optionen behandelt werden, zwischen denen man wählen kann. Um dies tun zu können, müssen sie unter eine Alternative gestellt, d. h. in ein Verhältnis gesetzt werden. Als wählbare Option ist ein Standpunkt ein Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung wie jeder andere Gegenstand, dem sich die Aufmerksamkeit zuwendet. In dieser Hinsicht genießt die ignatianische Pädagogik keinen Vorzug gegenüber anderen Gegenständen. Als Gegenstand der wissenschaftlichen Betrachtung wird sie genauso behandelt wie jeder andere vergleichbare Gegenstand. Man bemüht sich, in möglichst neutraler, objektiver und um Sachlichkeit bemühter Haltung Erkenntnisse über diesen Gegenstand zu erlangen, die der Prüfung in einer wissenschaftlichen Kommunikationsgemeinschaft standhalten können.
Von daher kann in einer wissenschaftlichen Einstellung zwar für die Notwendigkeit der Einnahme eines Standpunktes argumentiert werden. Dies würde aber bedeuten, dass ein Sollen als verbindlich erklärt wird, das in der Gesellschaft durch den Austausch zwischen den Positionen ermittelt werden muss – wenn man sich von der Idee eines demokratischen Austausches leiten lässt. In diesem Austausch fungiert auch die wissenschaftliche Perspektive selbst nur als eine wählbare Perspektive.
Wissenschaftliche Urteile
Wer sich wissenschaftlich betätigt, hält für eine gewisse Zeit an Regeln fest, damit eine Methode vorliegt, mit der gearbeitet werden kann. Eine Methode ist ein Weg, auf dem die Schritte, die gegangen werden, unter Kontrolle stehen. Man schreitet in einem Verfahren voran. Es gibt keine Regel, die alle Regeln und deren Befolgung regelt, weshalb der Anwendung einer Methode eine Wahl vorausgeht. Methoden sind folglich optional und damit von Voraussetzungen abhängig, die nicht durch sie selbst unter Kontrolle gebracht werden können. Zugespitzt formuliert: Die Wahl einer Methode ist selbst nicht vollständig als Verfahren durchführbar. Man muss sich in Freiheit entscheiden für eine Methode und sollte auf Anfrage in der Lage sein, diese Entscheidung zu begründen. Für die erforderliche Begründung gilt ebenso, dass es keine Begründung für die Begründung gibt, von der alles abhängt. In diesem Sinne setzt das wissenschaftliche Denken und Arbeiten aus methodischen Motiven ›Haltepunkte‹. Diese werden (oft unbemerkt) gesetzt, in theoretischer Reflexion meist nur unvollständig durchschaut und entweder anerkannt oder der Kritik ausgesetzt. Dies führt dazu, dass sich das Problembewusstsein ausdifferenziert. Es entfaltet sich in einem ›Zirkel der Problemgenerierung‹ (vgl. Anhalt 2007, 2010, 2012; Rucker 2014, 2017; Rucker & Anhalt 2017; Anhalt & Welti 2018; Ammann 2020).
Wer in einer wissenschaftlichen Einstellung seine ›Haltepunkte‹ in Gebrauch hat, tut dies in der Erwartung, sein Vorgehen in geordneter Form zu vollziehen. Mit einem ›Haltepunkt‹ wird ein Startpunkt gesetzt, hinter den zurück nicht weiter gefragt werden soll, damit an einer Stelle begonnen werden kann. Mit einem ›Haltepunkt‹ wird gleichzeitig ein Rahmen gesetzt, innerhalb dessen Problemstellungen und Lösungsvorschläge formuliert und bearbeitet werden können, weil das Fragen und die Suche nach Antworten sich in diesem Rahmen als sinnvoll erweisen. In Orientierung an einem ›Haltepunkt‹ wirkt es wenig überzeugend und oft sinnlos, Probleme jenseits des gesteckten Rahmens zu vermuten.
Im Unterschied zu ›Haltepunkten‹, die außerhalb der wissenschaftlichen Einstellung Orientierung bieten, weiß die Wissenschaft um die Funktion von ›Haltepunkten‹, weil sie diese zum Gegenstand von Reflexionen macht. Im Zirkel der Problemgenerierung machen sich die wissenschaftlichen Positionen gegenseitig aufmerksam auf die Begrenzungen, die gewählte ›Haltepunkte‹ mit sich bringen, und die Möglichkeiten, die sie eröffnen. Es werden die Abhängigkeiten diskutiert, in die man sich begibt, wenn man einen ›Haltepunkt‹ setzt. Auf diese Weise relativieren sich die wissenschaftlichen Positionen wechselseitig in ihren spezifischen Geltungsansprüchen. Die Form, auf die man sich im Zirkel der Problemgenerierung einigen kann, ist die Perspektivität, in der die Fachwissenschaften sich wechselseitig als je spezifische Perspektiven auf eine Welt platzieren, die sie in einer spezifischen Kultur der Problemorientierung zum Gegenstand machen.
In ihrer Gegenstandsorientierung und Methodenwahl kultiviert eine Fachwissenschaft ihre besondere Problemorientierung. Ihr ist im Prinzip der akademischen Freiheit das Recht gegeben, ›Haltepunkte‹ zu setzen, wie es aus fachwissenschaftlichen Gründen als sinnvoll ausgewiesen wird. Dieser Ausweis kann nur als eine methodische Absicherung in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass die Wissenschaft bemüht ist, sich allein von methodischen ›Haltepunkten‹ abhängig zu machen. Diese sind prinzipiell austauschbar und daher von befristeter Gültigkeit. Sie können im Zirkel der Problemgenerierung zum Thema gemacht und unter Umständen als problematisch diskutiert werden. In diesem Sinne korrespondiert der wissenschaftlichen Problemorientierung die Setzung von methodischen ›Haltepunkten‹.
Da zahlreiche Fachwissenschaften ihre eigenen Perspektiven entfaltet haben, weist die Perspektivität der wissenschaftlichen Problemorientierung, in der heute Aufklärung über die Welt angestrebt wird, einen hohen Grad der Ausdifferenzierung auf. Es gibt in dieser Perspektivität keine wissenschaftlich durchführbare Begründung dafür, eine Perspektive gegen die anderen auszuzeichnen, um auf diesem Wege die Perspektive ausfindig zu machen, aus der alle anderen Perspektiven abgeleitet werden können oder die alle anderen ersetzen kann. In diesem Sinne vertreten wir in dieser Untersuchung nicht die Auffassung, eine erziehungswissenschaftliche Perspektive sei den Perspektiven anderer Fachwissenschaften übergeordnet. Wir gehen stattdessen von der Annahme aus, dass die von uns eingenommene Perspektive einen Blick auf die ignatianische Pädagogik eröffnet, wie er aus der Warte alternativer Fachwissenschaften nicht möglich ist. Der Titel unserer Studie bringt diese Annahme zum Ausdruck: Es geht uns um eine Standortbestimmung der ignatianischen Pädagogik aus erziehungswissenschaftlicherPerspektive. Wie die ignatianische Pädagogik aus anderen Perspektiven zum Gegenstand der Betrachtung gemacht wird, ist kein Gegenstand unserer Studie.
Limitationen
Die Perspektivenwahl kommt u. a. in bestimmten inhaltlichen Schwerpunktsetzungen zum Ausdruck, die für unsere Untersuchung maßgeblich sind und auf die wir noch zu sprechen kommen werden. In dem von uns gezogenen Rahmen erfolgt beispielsweise eine Fokussierung auf den deutschsprachigen Raum, wobei deutschsprachige Publikationen zur ignatianischen Pädagogik durch englischsprachige Publikationen ergänzt werden.
Ein solcher Zuschnitt ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass es im Kontext der Erziehungswissenschaft kaum Vorarbeiten zu einer Standortbestimmung ignatianischer Pädagogik gibt, auf die man zurückgreifen könnte. Zwar wird in Werken zur Geschichte der Pädagogik immer wieder auf Ignatius Bezug genommen. Wie bereits erläutert, steht hierbei zumeist die Ausdifferenzierung des vom Jesuitenorden getragenen Schul- und Hochschulsystems im Mittelpunkt, weniger jedoch die Frage, ob es eine im Kontext ignatianischer Spiritualität begründete Idee von Pädagogik gibt und, falls ja, wie diese in Alternative zu anderen Pädagogiken bestimmt werden könnte. Stattdessen wird die ignatianische Pädagogik auf eine Spielart katholischer Pädagogik reduziert, die v. a. im 16. und 17. Jahrhundert auch über den europäischen Kontext hinaus eine gewisse Dominanz entfaltete.1 Aus dem Blick geraten dabei Neuentwürfe einer ignatianischen Pädagogik, die insbesondere seit den 1980er Jahren international, vor allem aber auch im deutschsprachigen Raum entwickelt werden. Die vorliegende Untersuchung verfolgt vor diesem Hintergrund den Anspruch, die ignatianische Pädagogik nicht nur unter historischen, sondern auch und vor allem unter systematischen Gesichtspunkten als einen Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung und Forschung zu erschließen.
Wenn hier von einer Standortbestimmung die Rede ist, so sind zunächst bestimmte Unterscheidungen vorzunehmen, die zugleich auf Limitationen unserer Untersuchung verweisen. Diese zielt nicht auf ein Gutachten ab, in dem eingeschätzt wird, ob eine ignatianische Pädagogik den Ansprüchen gerecht wird, denen Beschreibungen von Erziehung heute Rechnung tragen müssen, um nicht Kritik auf sich zu ziehen. Wir fassen die ignatianische Pädagogik vielmehr, wie bereits erwähnt, als einen spezifischen Vorschlag auf, Erziehung zu denken und zu gestalten, und möchten den Versuch unternehmen, dieses Angebot in seinen Möglichkeiten, Grenzen, Herausforderungen und Entwicklungspotentialen besser zu verstehen.
Wir erforschen hierzu nicht die Praxis an jesuitischen Schulen und auch nicht das Selbstverständnis der verschiedenen Akteur:innen vor Ort. Unser Interesse gilt vielmehr der spezifischen Beschreibung von Erziehung, die sich auf der Grundlage von Texten zur ignatianischen Pädagogik rekonstruieren lässt. Solch eine Rekonstruktion erweist sich in mehrfacher Hinsicht als bedeutsam. So erlaubt es erst eine Klärung dessen, was ignatianische Erziehung ›ist‹ bzw. was unter ignatianischer Erziehung in diesen Texten verstanden wird, bestimmte Formen des Miteinanderumgehens als ignatianische Erziehung zu erkennen. Dieser Hinweis ist nicht trivial, will man nicht von der fragwürdigen Voraussetzung ausgehen, dass jegliches Miteinanderumgehen an Schulen, die sich in der Trägerschaft des Jesuitenordens befinden, als ignatianische Erziehung bezeichnet werden kann. In diesem Sinne leistet unsere Untersuchung nicht zuletzt einen Beitrag dazu, ignatianische Erziehung zukünftig auch zum Gegenstand gehaltvoller empirischer Forschung zu machen.
Ignatianische Pädagogik wird von uns als ein spezifischer Antwortversuch auf eine Frage rekonstruiert, die Friedrich Schleiermacher wie folgt formuliert hat: »Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?« (Schleiermacher 1826/2000, S. 9) Diese Frage bringt ein Grundproblem einer jeden Pädagogik zum Ausdruck. Das Erziehungsverständnis, das in der Tradition ignatianischer Pädagogik als eine Antwort auf diese Frage offeriert wird, muss sich nicht mit dem Selbstverständnis z. B. einzelner Lehrer:innen an jesuitischen Schulen decken. Umgekehrt gilt ebenso: Was ignatianische Pädagogik ›ist‹, ist nicht einfach davon abhängig, was einzelne Personen, die an jesuitischen Schulen tätig sind, für ignatianische Pädagogik halten. Darüber, was ignatianische Pädagogik ›ist‹, geben zunächst einmal die einschlägigen Schriften Auskunft, in denen eine Beschreibung von ignatianischer Erziehung angefertigt und begründet wird, und die einen spezifischen Traditionszusammenhang stiften sollen.
Es ist bekannt, dass Selbstbeschreibungen sich nach Gewohnheiten richten, die sich aus der Perspektive einer Fremdbeschreibung als widersprüchlich und wenig überzeugend darstellen können. Auf die von Immanuel Kant aufgeworfene Frage, mit der jeder ernsthafte Versuch, eine Theorie der Erziehung unter demokratischen Bedingungen zu entwickeln, rechnen muss, können die Beschreibungen widersprüchliche Auffassungen zum Ausdruck bringen. Kant hatte gefragt: »Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? (Kant 1803/1982, S. 711). Es ist zu erwarten, dass die ignatianische Pädagogik eine andere Antwort auf diese Frage anbietet als eine Pädagogik, bei der sich die Generationen nicht auf einem religiösen Boden begegnen. Was die ältere Generation mit der jüngeren will und was die jüngere Generation mit sich machen lässt, wenn sie dem Zwange der älteren Generation ausgesetzt ist, dürfte von den Grundüberzeugungen abhängen, die in den Beschreibungen zum Ausdruck kommen.
Die von uns verfolgte Problemstellung hat u. a. zur Folge, dass bestimmte Debatten, die um den Jesuitenorden und das von ihm getragene Schul- und Hochschulsystem geführt werden, im Folgenden ausgeklammert bleiben. Hierzu zählt zum einen die Debatte um sexuellen Missbrauch an Schulen in der Trägerschaft des Ordens (vgl. Mertes 2021; Hilpert et al. 2020). Hierzu zählen zum anderen die kolonialen Verstrickungen des Ordens, die mit zur Entstehung und Aufrechterhaltung globaler Ungerechtigkeitsverhältnisse beigetragen haben, wie sie heute insbesondere von Seiten der post- und dekolonialen Theorie problematisiert werden (vgl. Blackburn 2000; Molina 2015; zur postkolonialen Theorie vgl. Castro Varela & Dhawan 2015; Kerner 2021). Die damit aufgeworfenen Fragen werden von uns nicht deshalb ausgeklammert, weil wir diese für unwichtig erachten. Das Gegenteil ist der Fall: Sie sind aus unserer Sicht zu wichtig, um sie ›nebenbei‹ abzuhandeln.
Überblick
Für unsere Untersuchung sind mehrere inhaltliche Schwerpunktsetzungen kennzeichnend, die jeweils spezifische Aspekte einer historisch-systematischen Verortung ignatianischer Pädagogik betreffen:
Im ersten Kapitel werden ideengeschichtliche Hintergründe ignatianischer Pädagogik thematisiert. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass die Exerzitien des Ignatius bis heute als der maßgebliche Referenztext sowohl einer ignatianischen Spiritualität als auch einer ignatianischen Pädagogik fungieren. Zur Kontextualisierung der ignatianischen Pädagogik werden in den Exerzitien ›Spuren‹ griechisch-römischer Philosophie, christlicher Spiritualität sowie einer neuzeitlichen Selbstbeschreibung des Menschen nachgewiesen. Darüber hinaus werden Facetten eines ignatianischen Selbst-, Welt- und Gottesverständnisses herausgearbeitet, die als Bezugspunkte einer ignatianischen Spiritualität und Pädagogik fungieren, sowie entlang der Dimensionen des Glaubens, der Praxis und der Gemeinschaft systematisiert. Die Rekonstruktion ist von der Annahme geleitet, dass eine ignatianische Pädagogik nicht angemessen verstanden und beurteilt werden kann, ohne die umfassenderen ideengeschichtlichen Zusammenhänge zu berücksichtigen, in denen diese Pädagogik situiert ist.
Das zweite Kapitel ist darauf gerichtet, aktuelle Selbstbeschreibungen ignatianischer Pädagogik zu rekonstruieren und – damit verbunden – die Frage zu klären, ob es eine Idee von ignatianischer Pädagogik gibt, die ausfindig gemacht werden kann. Was sind die Aufgaben, Inhalte, Methoden und Mittel, die mit ignatianischer Erziehung verbunden werden? Und was sind die anthropologischen, gesellschaftstheoretischen, moralisch-ethischen sowie theologischen Voraussetzungen, die in Beschreibungen ignatianischer Erziehung in Anspruch genommen werden? Mit Blick auf neuere Arbeiten zur ignatianischen Pädagogik im deutschsprachigen Raum wird der Vorschlag entwickelt, ignatianische Pädagogik als eine besondere Spielart einer Pädagogik der Person aufzufassen.
Im dritten Kapitel wird untersucht, wie sich aktuelle Selbstbeschreibungen zu traditionellen Entwürfen einer ignatianischen Pädagogik verhalten, um so mögliche Kontinuitäten und Brüche in den Blick zu rücken. Die Frage lautet, ob gewisse Muster ausgemacht werden können, wenn man auf die Selbstbeschreibungen schaut, die in den Jahrhunderten angefertigt worden sind. An solchen Mustern wäre zu erkennen, wie die ignatianische Pädagogik als Angebot in der Geschichte in Erscheinung tritt und was sie durch die Veränderungen im Wandel der Zeit hindurch aufbewahren möchte. Dabei wird in diesem Kapitel insbesondere der Frage nachgegangen, wie eine ignatianische Pädagogik im Verhältnis zur Eigenstruktur moderner Erziehung bestimmt werden kann, wie sie in pädagogischen Entwürfen zwischen 1700 und 1850 beschrieben worden ist und in der Erziehungswissenschaft bis heute eine zentrale Rolle spielt. Auf diese Weise soll eine Verortung ignatianischer Pädagogik im Kontext der pädagogischen Problemgeschichte vorgenommen werden.
Im Rahmen des vierten Kapitels rückt ein spezifisches Moment, das in traditionellen und aktuellen Entwürfen einer ignatianischen Pädagogik von großer Bedeutung ist, in den Mittelpunkt der Betrachtung – das Problem der Charaktererziehung. Dabei wird für die These argumentiert, dass ignatianische Pädagogik in ihrer Orientierung an der Idee einer Erziehung des Charakters nicht nur eine Alternative zu aktuell dominant gewordenen Auffassungen von Erziehung offeriert, sondern sich damit auch in eine Tradition moderner Pädagogik einreiht – einer Tradition, in der Erziehung an die Aufgabe geknüpft wird, Heranwachsenden dabei zu helfen, die Fähigkeit und Bereitschaft zu entwickeln, zur Entwicklung einer Gesellschaft beizutragen, in der der Mensch im Mittelpunkt der Verantwortung steht.
Schließlich wird im fünften Kapitel das Verhältnis von ignatianischer Pädagogik und Gesellschaft in den Blick genommen. Eine Klärung dieses Verhältnisses erweist sich als eine anspruchsvolle Problemstellung. Hierbei muss nicht nur in Rechnung gestellt werden, dass es sich bei Erziehung selbst um eine spezifische Form des ›In-Gesellschaft-Seins‹ handelt. Darüber hinaus muss der Umstand berücksichtigt werden, dass eine Bestimmung des Verhältnisses von ignatianischer Pädagogik und Gesellschaft unter den Bedingungen einer modernen und in diesem Sinne funktional differenzierten Gesellschaft erfolgt, nämlich aus der Warte des Wissenschaftssystems, das einer eigenen Logik folgt und spezifische Anforderungen an Beschreibungen von Sachverhalten richtet. Umgekehrt offeriert eine Bearbeitung der Problemstellung aus unserer Sicht wichtige Erkenntnismöglichkeiten. Dabei arbeiten wir insbesondere heraus, dass Erziehung im Kontext ignatianischer Pädagogik als eine spezifische Form von Kommunikation zwischen Selbstverhältnissen (Personen) konzipiert wird, und stellen wir die These zur Diskussion, dass eine solche Gegenstandsorientierung gute Gründe dafür offeriert, in der Erziehungswissenschaft praxeologischen Theorieofferten wieder verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken.
Jedes Kapitel ist für sich lesbar. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die einzelnen Kapitel Aspekte eines Zusammenhangs thematisieren, der erst dann in den Blick kommt, wenn die Kapitel auch im Zusammenhang studiert werden. Jedes Kapitel wurde unter Federführung eines Autors bzw. einer Autorin verfasst. Wenn wir dennoch durchgehend von ›wir‹ und ›uns‹ sprechen, so soll damit nicht nur zum Ausdruck gebracht werden, dass in die einzelnen Kapitel immer auch Hinweise der weiteren Koautor:innen eingeflossen sind. Darüber hinaus zeigt das ›wir‹ auch an, dass in dieser Arbeit ein Zusammenhang von Aspekten thematisiert wird, der die einzelnen Kapitel verbindet und der von uns hier gemeinsam zur Diskussion gestellt wird.
Die vorliegende Arbeit geht auf ein Forschungsprojekt zurück, das unter dem Titel ›Ignatianische Pädagogik – Eine Standortbestimmung‹ vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2023 an der Universität Bern durchgeführt worden ist. Dem Projektteam gehörten in dieser Zeit Kira Ammann (Mitarbeiterin), Elmar Anhalt (Leitung), Jana Bratschi (Hilfsassistentin), Fion Emmenegger (Mitarbeiter), Omar Ibrahim (Mitarbeiter), Deborah Kölliker (Hilfsassistentin) und Thomas Rucker (Leitung) an. Das Projekt wurde von Seiten des Zentrums für Ignatianische Pädagogik (Ludwigshafen, Deutschland) gefördert. Wir danken der Leitung des ZIP, namentlich Tobias Zimmermann SJ und Ulrike Gentner, für die reibungslose Zusammenarbeit und insbesondere für die Bereitschaft, den ›externen‹ Blick auf die ignatianische Pädagogik zu unterstützen, ja geradezu einzufordern. Wichtige Ideen sind im Austausch mit Kolleg:innen entstanden. Dabei sind wir insbesondere Michael N. Ebertz, Mathias Molzberger, Barbara Schellhammer, Jörg Schulte-Altedorneburg und Jochen Sautermeister zu Dank verpflichtet.
Bern und Landau, im Sommer 2024
Kira Ammann, Elmar Anhalt, Omar Ibrahim und Thomas Rucker
1. Vergewisserungen: Ideengeschichtliche Hintergründe ignatianischer Pädagogik
Omar Ibrahim
Die Geistlichen Übungen (1544/2008) von Ignatius gelten bis heute als der maßgebliche Referenztext sowohl einer ignatianischen Spiritualität als auch einer ignatianischen Pädagogik. Zwar gibt es weitere Texte, auf die bis heute immer wieder Bezug genommen wird, um das Selbstverständnis ignatianischer Pädagogik zu artikulieren, doch wird in diesen Texten selbst wiederum auf die Exerzitien rekurriert (vgl. Mertes 2004, S. 9 f.), wodurch ein Traditionszusammenhang gestiftet wird, der berücksichtigt werden will, insofern eine Standortbestimmung ignatianischer Pädagogik entwickelt werden soll. Diese hat den Geistlichen Übungen besondere Beachtung zu schenken, und zwar auch dann, wenn man in der darin beschriebenen Form des Miteinanderumgehens zwischen einem Exerzitienbegleiter (Person, die die Übungen gibt) und einem Exerzitanten (Person, die die Übungen durchläuft) gar keine Erziehung erkennt – was selbst wiederum eine umstrittene Deutung der Exerzitien bedeuten würde (vgl. Merz 2000, S. 266; Funiok & Schöndorf 2000, S. 10).
Die Geistlichen Übungen sind in ideengeschichtlichen Zusammenhängen situiert, die vor allem in ihrer Bedeutung für eine ignatianische Pädagogik in ihren verschiedenen Spielarten kaum aufgearbeitet sind (vgl. jedoch Lundberg 1966). Eine Vergewisserung der entsprechenden Zusammenhänge erlaubt es nicht nur, die ideengeschichtlichen Hintergründe ignatianischer Pädagogik ›sichtbar‹ zu machen, sondern eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, Kontinuitäten, Brüche, partielle Verschiebungen sowie grundlegende Neuorientierungen in den offerierten Beschreibungen von Erziehung in den Blick zu rücken. Allerdings sollte man sich hierbei vor einem ›naiven‹ Herangehen hüten, denn es ist keineswegs selbstverständlich, wie eine entsprechende Vergewisserung erfolgen sollte.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der erste Teil unserer Untersuchung mit der Frage, wie die ignatianische Pädagogik vergewissert werden kann und auf welche ideengeschichtlichen Zusammenhänge man stößt, wenn man eine entsprechende Vergewisserung unternimmt. Wenn Hans Urs von Balthasar fragt, was das »Christliche am Christentum« (von Balthasar 2019, S. 5) sei, so ist diese Frage nicht rhetorisch zu verstehen, sondern drängt diese in theologischer Hinsicht auf eine Antwort. Entsprechend kann auch die Frage, was das Ignatianische an der ignatianischen Pädagogik sei, gestellt werden. Im Folgenden werden unterschiedliche Aspekte dieser Problemstellung bearbeitet und damit Zusammenhänge in den Blick gerückt, an die in den weiteren Teilen der Arbeit angeschlossen wird.
1.1 Die Frage nach der Frage
Sich im Kontext einer Vergewisserung der Tradition ignatianischer Pädagogik vor einer ›naiven‹ Herangehensweise zu hüten, bedeutet insbesondere, dass man sich im Hinblick auf eine entsprechende Vergewisserung zuerst vergewissern muss, wie überhaupt vergewissert werden kann. Die folgenden Überlegungen kombinieren drei Formen der Vergewisserung, die hier als analytische, genealogische und allegorische Vergewisserung bezeichnet werden.
In der analytischen Vergewisserung wird eine transzendentalkritische Analyse eines Phänomens oder eines Begriffes angestrebt. Es werden in diesem Sinne unterschiedliche Möglichkeitsbedingungen aufgedeckt, welche eine Reidentifikation des besagten Phänomens möglich machen (vgl. Niquet 1991, S. 26 ff.). Die Möglichkeitsbedingungen bilden also die notwendigen – und gemeinsam eventuell hinreichenden – Bedingungen dafür, dass ein Phänomen als genau jenes Phänomen bestimmt und unter anderen Umständen reidentifiziert werden kann. Dies soll sowohl in synchroner als auch diachroner Weise möglich sein. Das Ergebnis einer analytischen Vergewisserung bildet damit eine Begriffs- oder Phänomenbestimmung. Ein entsprechender Zugriff kann zur Folge haben, dass bisherige oder spätere Entwicklungen eines Phänomens sowie leichte Abweichungen nicht mehr zu diesem Phänomen gerechnet werden können.
In der genealogischen Vergewisserung werden diskursive Formationen und deren Entwicklung in der Geistes- und Ideengeschichte nachgezeichnet sowie latente Strukturen und Prozesse aufgedeckt. Es wird versucht aufzuzeigen, woher Gedanken und Ideen kommen, woher sie ihre Überzeugungskraft erhalten und wie sie sich im Verständnis von Gesellschaften und Gruppierungen über die Zeit hinweg verändert haben. Dazu gehört es auch, über Machtmechanismen nachzudenken, die dazu beitragen, dass eine Diskursordnung oder ein Paradigma über gesellschaftlichen Einfluss verfügt und damit alternative Positionen verdrängt.
Die letzte Form der Vergewisserung die hier zum Einsatz kommen soll, kann als allegorische Vergewisserung bezeichnet werden. In ihr wird ein Phänomen oder ein Begriff anhand eines Vergleichs verstanden. Es wird hier also nicht erklärt oder bestimmt, sondern man versucht, etwas als etwas zu verstehen, indem man es durch etwas anderes beleuchtet. Das Andere muss nicht völlig anders sein, sondern kann lediglich zu einem typologischen Vergleich dienen. Dabei sind für die Art und Auswahl der Vergleichskandidaten stets Gründe vorzubringen. So kann das Verstehen in einen Kontext eingebettet werden, der zur Ergründung des Phänomens beiträgt, ohne die eigene Perspektivität aus den Augen zu verlieren.
Die folgenden Überlegungen sind Ausdruck des Einsatzes aller drei Formen der Vergewisserung. Der Mehrperspektivität der Untersuchung wird folglich ein Primat gegenüber der Spezialisierung zugesprochen. Dies geschieht vor allem aus Gründen der Anschlussfähigkeit für weitere Überlegungen. Ohnehin schließen sich die verschiedenen Formen der Vergewisserung nicht aus, sondern stehen in einem Ergänzungsverhältnis zueinander.
Es dürfte sinnvoll sein, am Ursprung der ersten Werke zu beginnen, um sich darüber zu vergewissern, was ignatianische Pädagogik ist, zumindest aber sein könnte. Die ignatianische Pädagogik beginnt nicht erst mit den Ordenskonstitutionen der Gesellschaft Jesu und auch nicht mit der später erschienenen Studienordnung. Vielmehr können schon die GeistlichenÜbungen des Ordensgründers als pädagogisches Werk betrachtet werden. Der Titel der Übungen, auch Exerzitien genannt, weist bereits auf den pädagogischen Charakter dieses Werkes hin. »Übung«, so Malte Brinkmann, »erscheint bei Ignatius als primäre Lernform. Auf der Grundlage einer leiblich-situativen Anthropologie der Sinne werden in Wiederholungen existenzielle Haltungen und Einstellungen ein- und umgeübt« (Brinkmann 2012, S. 344). Dieser Prozess wird zwar von einer Person durchlaufen, doch ist stets eine zweite Person präsent, die diesen Prozess initiiert und unterstützt. Insofern kann hier durchaus von einer erzieherischen Situation gesprochen werden, die damit auch die erziehungswissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. Die Annahme, dass das Üben ein zentrales Moment im pädagogischen Prozess bildet, die dahinterliegende christliche Anthropologie, Welt- und Gottesvorstellung sowie die damit verbundene Zielsetzung der zu erlernenden Haltungen und Einstellungen bilden Problemkomplexe, die im Hinblick auf eine ignatianische Pädagogik vergewissert werden können.
Im Folgenden werden zunächst Traditionszusammenhänge vergewissert, in denen die Exerzitien entstanden sind. Da die Exerzitien des Ignatius für die ignatianische Pädagogik sowohl als Inspirations- als auch als Legitimationsquelle durchgehend Bedeutung hatten, wird der Fokus auf dieses Werk gelegt – wohlwissend, dass auch anderen von Jesuiten verfassten Schriften Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung und Weiterentwicklung einer ignatianischen Pädagogik zukommt.
1.2 Traditionszusammenhänge
Blickt man auf ein beinahe halbes Jahrtausend Geschichte des Jesuitenordens zurück, scheint es sinnvoll zu sein, von einem Traditionszusammenhang – als narrative Zeitgestalt einer gemeinsamen Wahrnehmung und Erfahrung – zu sprechen (vgl. Assmann 2022). Darüber hinaus gilt es aber auch zu konstatieren, dass die Geistlichen Übungen nicht ex nihilo entstanden sind, sondern sich selbst – wenngleich zumeist implizit – auf tradierte Vorstellungen, Praktiken etc. beziehen. Auch wenn Ignatius und seine Ordensbrüder mit der jesuitischen Lebensform einige wesentliche Neuerungen in die Geistesgeschichte eingebracht haben, waren sie selbst schon in spezifische Traditionen verstrickt. Entsprechend situiert auch Malte Brinkmann die Exerzitien, wenn er diese als ein »paradigmatisches Modell der Übungen« kennzeichnet, das »im Übergang von Mittelalter und Neuzeit« entstanden ist und »in seinen Tiefenstrukturen antike, christliche und neuzeitliche Elemente vereint« (Brinkmann 2012, S. 323). Die Geistlichen Übungen stellen somit eine Kombination unterschiedlicher Elemente dar, die zusammen die theologisch-philosophischen Voraussetzungen einer ignatianischen Pädagogik bilden. Diese Elemente lassen sich im Anschluss an Brinkmann in antike, christlich-katholische und neuzeitliche Aspekte unterscheiden.
Bevor auf die damit angesprochenen Traditionszusammenhänge eingegangen wird, soll zunächst geklärt werden, was überhaupt unter den Geistlichen Übungen zu verstehen ist. Ignatius gibt in seinem Werk schon zu Beginn eine Antwort auf diese Frage: »Unter diesem Namen ›geistliche Übungen‹ ist jede Weise, das Gewissen zu erforschen, sich zu besinnen, zu betrachten, mündlich und geistig zu beten, und anderer geistlicher Betätigungen zu verstehen« (von Loyola 1544/2008, S. 27). Diese Antwort weist zwei miteinander verbundene Aspekte auf, denen auch im Kontext ignatianischer Pädagogik bis heute eine zentrale Stellung zukommt. Zum einen geht es um die Entwicklung des eignen Selbst, zum anderen wird eine Hinwendung zu Gott angestrebt. Die Entwicklung des Selbst und – damit verbunden – die Hinwendung zu Gott wird als prozessoffen bestimmt, da die Gnade und Zuwendung Gottes nicht vom Menschen hergestellt werden kann. Hinzu kommt, dass dem Exerzitienbegleiter und dem Exerzitanten ein mehr oder minder großer Spielraum von Freiheit zugestanden wird, den diese wiederum Gott gegenüber verantworten müssen. Entsprechend werden auch die Wirkmöglichkeiten der Exerzitien bestimmt: »Sie wollen Hilfestellung geben, aber nicht den Anschein erwecken, Gott könne durch bestimmte Techniken herbeigezwungen werden« (Leppin 2007, S. 84). Die einzige Möglichkeit für den Menschen besteht darin, sich für die Gnade Gottes vorzubereiten. Und genau hierfür wird die Selbstentwicklung im Sinne einer purgatorischen Askese notwendig. Purgatorisch sind die Exerzitien in dem Sinne, dass der Exerzitant sich von seinem Fehlverhalten abwendet und sich einer tugendhafteren, frommeren Lebensführung zuwendet. Die Askese kann als Form der Übung verstanden werden und bezieht sich nicht auf die umgangssprachlichen Verzichtsleistungen. Volker Leppin erläutert diese Form der Übung treffend, wenn er »Askese« als fortwährenden »Kampf gegen die Dämonie der Versuchungen« deutet, »der sich vor allem als Kampf gegen die eigenen Leidenschaften äußerte« (ebd., S. 41).
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Geistlichen Übungen nicht allein durchgeführt werden, sondern stets in Begleitung eines erfahreneren Jesuiten oder geistlichen Führers (teils auch Führerin). Die Exerzitien sind sowohl für die Übenden als auch für die Begleitpersonen verfasst (vgl. Friedrich 2021, S. 15). Das Miteinanderumgehen zwischen demjenigen, der die Übungen gibt, und demjenigen, der die Übungen vollzieht, findet sich in einem biblisch begründeten und theologisch reflektierten Rahmen sowie im Kontext einer spezifischen Anthropologie situiert (vgl. Winkler 2000, S. 12). Diesen Rahmungen gilt es im Folgenden nachzugehen, um die Traditionszusammenhänge der Exerzitien herauszuarbeiten und diese entsprechend zu verorten.
1.2.1 Griechisch-römische Philosophie
Das frühe, sich zunehmend verbreitende Christentum, sowohl in West- als auch in Osteuropa, ist stark von der griechischen und römischen Philosophie geprägt. Dies liegt daran, dass viele Kirchenväter – man denke hier bspw. an Augustinus – sich ausgiebig mit beiden Kulturgebieten auseinandergesetzt haben. Entsprechend hält Volker Leppin fest: »Die christliche Theologie nahm die sie umgebende Philosophie auf und hätte ohne dies schwerlich überleben können, denn nur so konnte die Wahrheit der Bibel vor den denkenden Menschen der Zeit erwiesen werden« (Leppin 2007, S. 27).1
Während in der griechisch-römischen Philosophie beinahe zahllose Strömungen existierten, erwiesen sich zwei Strömungen als besonders bedeutsam für die christliche Theologie: Der späte Neuplatonismus und die Stoa. Pseudo-Dionisios von Areopagita hebt diese Verbindung von neuplatonischer Philosophie und Christentum explizit hervor. Er unterstreicht in seinem Werk, dass das Christentum in seiner Praxisform von seinen Anfängen an auch eine Anwendungsform neuplatonischer Philosophie gewesen sei (vgl. ebd., S. 26). Hierbei wird nicht (nur) die ethische, sokratische Lebensführung heraufbeschworen, sondern im Zentrum steht insbesondere die platonische Metaphysik und Epistemologie. Claus Priesner weist auf dieselbe Verbindung hin, wenn er darauf aufmerksam macht, dass zu dieser Zeit das christliche Gottesbild tiefgreifend der neuplatonischen Philosophie angepasst wurde. »Die neoplatonische Suche nach Erkenntnis – Gnosis – ist nicht mehr gottesfern, indem sich [nämlich] Gott auch in der Natur ausdrückt« (Priesner 2011, S. 46). Griechisch-römische Metaphysik und Epistemologie verschmelzen hier mit christlicher Gotteslehre. Zu erkennen, was wahr, gut und schön ist, kann dem Menschen, so die Gnosis, bis zu einem gewissen Grad zugänglich sein. Neben der Offenbarung, bspw. in Form der zehn Gebote, der Apostelbriefe etc. verfügt der Mensch u. a. über die Fähigkeit zu erkennen, was moralisch-ethisch richtig ist und was nicht. Diese Ansicht findet sich nicht nur im neuplatonischen Denken, sondern ganz besonders auch in der Stoa. So weist etwa Seneca darauf hin, dass der Mensch danach streben sollte, zu erkennen, was das Gute ist: »Durch eine einzige Sache wird die Seele vervollkommnet, durch das unwandelbare Wissen von Gütern und Übeln« (Seneca 2022, S. 389).
Beide Dimensionen, Ethik und Metaphysik/Epistemologie, sind bei Ignatius und dem christlich-katholischen Denken seiner Zeit stark vom Neuplatonismus und der Stoa geprägt, was sich an ausgewählten Beispielen veranschaulichen lässt. Bezeichnend für die platonische Philosophie ist die metaphysische Unterteilung des Menschen in Leib und Seele sowie der Welt in Materie und Geist. Wenige Konzepte haben die Ideengeschichte Europas so stark geprägt wie diese. So schreibt auch noch im 20. Jahrhundert Pierre Teilhard de Chardin, wie schwer es fällt, sich hiervon zu lösen: »Nirgends empfinden wir stärker, in welche Schwierigkeiten wir noch immer geraten, wenn wir Geist und Materie mit einem einheitlichen verstandesmäßigen Blick zusammenfassen wollen« (Teilhard de Chardin 2022, S. 51). Eine solche Auffassung kommt auch bei Ignatius zum Ausdruck. Wichtig ist es dabei hervorzuheben, dass schon bei Platon und später auch im Christentum die Stellung des Geistigen/Seelischen dem Materiellen/Leiblichen vorgezogen wurde. Der Körper bildet nur ein irdisches Gefäß für die unsterbliche Seele. Entsprechend formuliert auch Ignatius seine christlich platonische Anthropologie, wenn er dazu auffordert, »mit der Sicht der Vorstellungskraft zu sehen und zu erwägen, daß meine Seele in diesem verderblichen Leib eingekerkert ist« (von Loyola 1544/2008, S. 48). Dass der Leib sterblich und somit vergänglich ist, bildet jedoch keine arbiträre Akzidenz, sondern hebt den Wert der eigenen Seele nochmals hervor. Indem die Seele unsterblich ist, ist der Mensch dazu veranlasst, sich um diese Seele bestmöglich zu kümmern, auch wenn dabei der Körper und dessen Pflege zu kurz kommen können. Und ganz besonders im Hinblick auf das irdische Ableben des Körpers bis zum Tag des Gerichts wird die Sorge um das Seelenheil nach christlicher Auffassung nochmals bedeutungsvoll. Pointiert formuliert: »Angesichts des [leiblichen] Todes verstehen wir unser Leben verändert« (Winkler 2000, S. 247). Weil der Mensch im irdischen Reich sterblich ist und die Seele das irdische Leben überdauert, ist der Mensch dazu angehalten, sich um das eigene Seelenheil zu kümmern. Dieser Gedanke spielt im Kontext einer ignatianischen Pädagogik bis heute eine wichtige Rolle.
Dabei lässt sich zeigen, dass die Bestimmung der irdischen Lebensführung und der damit verbundenen Kultivierung des Seelenheils unterschiedliche Elemente aus der sokratischen Philosophie und der Stoa aufgenommen hat. Auch Ignatius bezieht sich auf die griechisch-römische Philosophie, worauf Brinkmann hinweist, der nachweist, dass »Aus-, Selbst- und Fremdführung in den Geistlichen Übungen mittels rhetorischer und sokratischer Technologien vermittelt werden« (Brinkmann 2021, S. 324). In der sokratischen und späten platonischen Philosophie findet man erste methodisierte Ansätze, wie man sich um das eigene Seelenheil kümmern kann, indem man die richtige Lebensführung anstrebt. Hierfür ist eine philosophische Praxis, die dialektische Form, durchgehend prägend. Die philosophische Ethik der Antike war daher eine praktische Einübung in das gute und gelungene Leben (vgl. Leeten 2019). Sokrates bspw. »ist überzeugt, dass nur die eigenen, mühsam herausgearbeiteten Überzeugungen und Erkenntnisse dazu beitragen, sie anschließend auch zu leben« (Stavemann 2015, S. 29; Hv. i. O.). Der Mensch kann also durch Einsicht sein Leben verändern und sich dem Guten zuwenden. Dies ist jedoch kein einfaches Unterfangen, sondern bedarf der Übung und in diesem Zusammenhang zumindest auch des Beistands durch andere Menschen. Harlich Stavemann hält zur sokratischen Praxis entsprechend fest, dass es »etlicher Anstrengungen« bedürfe, »um die unangemessenen Vorurteile, Annahmen und Schemata, die das Weltbild eines Menschen bestimmen, dauerhaft zu verändern« (ebd., S. 47). Eine entsprechende Transformation im Selbst- und Weltbezug zu initiieren und zu unterstützen, ist heute auch Anspruch einer ignatianischen Pädagogik, die Heranwachsenden die Entwicklung von sachlichen Einsichten und eigenen Werturteilen zu ermöglichen sucht.
Es ist dennoch Vorsicht geboten, die Aspekte griechisch-römischer Philosophie unmittelbar auf das christliche Denken zu übertragen. Wie bei Sokrates und Platon das Gute noch nicht zwangsläufig mit dem Göttlichen gleichgesetzt wird, so wäre auch mit Blick auf die Stoa quasi von einer säkularen philosophischen Praxis zu sprechen. In dieser Selbstkultivierung ist der Mensch noch derjenige, an dem die Übung gemessen wird. Der Mensch tut dies um seinetwillen. Praktische Ethik wird in diesem Sinne als humanistisch aufgefasst. »Befreie Dich für Dich selbst« (Seneca 2022, S. 5) findet sich als Maßgabe in den stoischen Schriften. Ein solcher Humanismus war für das (frühe) Christentum nicht akzeptabel, da der Heilsweg Gottes nicht mit säkular orientierten Lebensführungen konkurrieren sollte. Entsprechend wurde bei der Integration des römisch-griechischen Denkens das platonisch Gute mit dem christlich Göttlichen gleichgesetzt. Dasselbe gilt für die Zwecksetzung der Selbstkultivierung. Die Annahme, dass eine gelungene Lebensführung durch Einsicht und Einübung methodisch angestrebt werden kann, wurde hingegen aufrechterhalten.
Entsprechend diesem Traditionszusammenhang finden sich sowohl die Idee der stoischen Ataraxie als auch die Idee der aristotelischen Phronesis in jesuitischen Schriften wieder.2 Ein wesentlicher Unterschied zwischen den philosophischen Positionen und einem ignatianischen Selbst- und Weltverständnis liegt darin, dass das Erstreben des menschlichen Glücks nicht den höchsten Zweck darstellt. »Dieses Glück ist weder das zentrale Motiv, das die Menschen bewegt – noch der Segen des Himmels, der dem Menschen dies Glück als Prämie für gutes Verhalten verleiht. Das Glück ist höchstens eine ganz angenehme Zugabe« (Marcuse 1972, S. 93). Stattdessen wird die Gnade Gottes angestrebt, und diese wiederum setzt eine im christlichen Sinne tugendhafte Lebensführung voraus.
1.2.2 Christliche Spiritualität
Der Spiritualitätsbegriff ist ein moderner Begriff mit einer spezifischen Geschichte und kann daher nicht ohne weiteres auf die Vergangenheit appliziert werden. Wenn hier von christlicher Spiritualität gesprochen wird, so ist damit kein individuelles Verständnis von Sinn und Transzendenz im Kontext eines postsäkularen Zeitalters gemeint (vgl. Peng-Keller 2021). Stattdessen wird der Begriff in seiner ursprünglichen Bedeutung aufgefasst – und zwar in einem pneumatologischen und teilweise auch in einem parakletischen Sinne.3 Es geht also um den Geist, um denjenigen des Menschen und denjenigen Gottes.
Eine christliche Lebensführung ist nicht als ein Zusammenhang von Aktivitäten zu verstehen, die neben anderen Formen der Lebensführung existieren, geschweige denn simuliert werden können. Sie betrifft, so ihr zentrales Merkmal, den Menschen in seiner Ganzheit. Daher bedarf es auch der aufrichtigen Entscheidung, sich der christlichen Lebensführung und der damit einhergehenden Einübung zuzuwenden. Entsprechend hält Michel de Certeau fest: »Es ist ein Wollen, das ein Wissen einführt. Erkenntnis wird nur möglich durch eine vorgängige Entscheidung: volo« (De Certeau 2010, S. 274). Vor diesem Hintergrund wird nun gefragt, was genau unter christlicher Spiritualität zu verstehen ist, die in einer entsprechenden Lebensführung praktiziert wird. Selbstverständlich lässt sich hierzu eine allgemeingültige, überzeitliche Definition nur schwer finden. Die folgenden Überlegungen schließen sich dem Vorschlag von Leppin an: »Der gemeinsame Grundzug ist eine religiöse Haltung, die eine Transzendenz Gottes gegenüber dem glaubenden Menschen als gemeinsame Erfahrungstatsache voraussetzt und diese Transzendenz schon im Diesseits punktuell zu überwinden trachtet: Das Transzendente wird wenigstens momenthaft immanent – und hebt dabei die Begrenzungen des innerweltlichen Gläubigen auf« (Leppin 2007, S. 9). Das bedeutet, dass der Art und Weise, wie die Geister miteinander in Kontakt treten, eine existenziale und zugleich transformative Bedeutung zukommt. Für das jesuitische Denken ist diese Überzeugung besonders zentral, weshalb Thomas Philipp ausdrücklich festhält: »In den Exerzitien begegnet der Einzelne Gottes Willen unmittelbar. Ohne dass ein Priester ihn vermitteln müsste« (Philipp 2013, S. 74).
Der Mensch ist also dazu angehalten, mit seinem Geist auf Gott hinzustreben. Dies betont auch Malte Brinkmann, wenn er von der christlichen Spiritualität der Geistlichen Übungen schreibt: »Die Dynamik der Exerzitienerfahrung speist sich aus dem Ziel des Über-sich-hinaus-Strebens, das einem antik-christlichen Dreierschema entspringt: Reinigung, Durcharbeitung, Vereinigung« (Brinkmann 2012, S. 339). Dieses Dreierschema zur Kultivierung und Verbindung des Geistes entspricht grob den Wochenabschnitten der Exerzitien. In der ersten Woche werden die eigenen Sünden betrachtet und bereut. Die darauf anschließenden Wochen helfen, sich dem neuen Leben zuzuwenden sowie mögliche Lebensentwürfe durchzuarbeiten. Das Ziel der gesamten Exerzitien ist letztlich die Nachfolge Jesu und in diesem Sinne die mit Gott und dem Sohn vollzogene geistige Vereinigung.
Das von Brinkmann erwähnte antike Dreierschema ist im Ursprung nicht unbedingt christlich motiviert, sondern speist sich aus der alchemistischen Tradition, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Christentums und schon deutlich früher praktiziert wurde. Der Prozess von Reinigung (katharsis), Durcharbeitung (photismos) und Vereinigung (henosis) wurde sowohl bei der Verarbeitung von Metallen als auch bei der Kultivierung des Menschen angestrebt (vgl. Coreth 2001, S. 63; Priesner 2011, S. 22 ff.). Menschen und Metalle, so die damalige Vorstellung, funktionieren auf eine ähnliche Weise. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass zur damaligen Zeit gewisse ontologische Kategorien noch nicht trennscharf voneinander geschieden wurden. Zwar sind einige Kategorien zur Lebzeit von Ignatius schon deutlicher gefasst, es finden sich dennoch Gegenstimmen, die jene Kategorien wieder zu vermengen suchen, darunter auch Pico della Mirandola, Marsilio Ficino oder Agrippa von Nettesheim. Bei ihnen wird die alchemistische Kunst sowohl auf die Metallverarbeitung als auch auf die Kultivierung des Menschen bezogen und dabei mit einem Gottesbezug versehen, der den »Weg der Selbstreinigung, wenn nicht gar Selbsterlösung« (Priesner 2011, S. 47) in spezifischer Hinsicht justiert. Um ein Meister der Alchemie zu werden, bedarf es eines gottesfürchtigen Lebens, und dieses muss ebenfalls entsprechend kultiviert werden: »Um zum Adepten, also zum Meister der Kunst Alchemia zu werden, muss sich der Alchemist nicht nur dem Studium der Schriften und der Natur widmen und von geeigneten Lehrern unterwiesen werden, er muss auch charakterlich geeignet, ja göttlich begnadet sein« (ebd., S. 27).
Das antike Dreierschema, das sich in den Geistlichen Übungen wiederfinden lässt, soll hier nochmals eingehender betrachtet werden, um die christliche Spiritualität, wie sie bei Ignatius und seinen Zeitgenossen verstanden worden ist, klarer zu fassen. Die Exerzitien beginnen mit der Läuterung des Menschen. Eine solche Läuterung kann durch die Einsicht und Explikation sowie die damit einhergehende Reue der eigenen Sünden durchgeführt werden. Hierfür gibt Ignatius an, dass man sich anhand von Biografie- und Erinnerungsarbeit darin übt, die eigenen begangenen Fehler zu vergegenwärtigen: »Alle Sünden des Lebens ins Gedächtnis bringen, indem ich Jahr für Jahr oder Zeit für Zeit schaue« (von Loyola 1544/2008, S. 51). Die Vergegenwärtigung bedarf im zweiten Schritt zusätzlich der Explikation. Sünden müssen (mehr oder minder) öffentlich zugegeben werden, damit der Mensch diese tatsächlich einsieht und Verantwortung für seine Fehltaten übernimmt. Dies wurde und wird in der katholischen Kirche durch die Beichte zeremoniell strukturiert. Die regelmäßige Beichte in der Kirche ermöglicht es den Gläubigen, sich der sündhaften Seite des eigenen Lebens sowie der Erfahrung des Bösen immer wieder bewusst zu werden. Die Beichte bietet daher die unmittelbare Gelegenheit, das auszusprechen, was den eigenen Geist und die Seele belastet, und so neue Freiheit zum Handeln und letztlich zum tieferen Glauben zu erlangen (vgl. Ziemer 2015, S. 64). Nach der Beichte wird Buße getan, um zu zeigen, dass die Reue tatsächlich vorhanden ist und der Mensch sich um eine Umwendung im Leben bemüht. Entsprechend heißt es in den Exerzitien: »Erbitten, was ich will. Hier wird dies sein: um gesteigerten und intensiven Schmerz und Tränen über meine Sünden bitten« (von Loyola 1544/2008, S. 51). In vergleichbarer Weise schreibt Agrippa von Nettesheim, ein Zeitgenosse von Ignatius, über die Buße: »Die Buße ist das vorzüglichste Mittel zur Sühnung unserer Sünden, indem sie dem Vergnügen das Leid entgegenstellt, die törichte Fröhlichkeit aus der Seele austreibt und ihr eine besondere Kraft, die zum Himmlischen zurückführt, verleiht« (von Nettesheim 2021, S. 460).
Es ist das Gewissen, in dem sich jener Prozess abspielt, der überhaupt erst zur Läuterung und zur Reue führen kann. Im ignatianischen Kontext wird das Gewissen auch als eine Kammer im Seeleninnenraum des Menschen verstanden, die über mehrere Eingänge verfügt. Durch die eine Tür tritt der menschliche, durch einen weiteren Eingang der böse und durch die dritte Pforte der göttliche Geist (vgl. Poltrum 2016, S. 12 f.). Das Gewissen wird daher verbaliter zum Kampfplatz unterschiedlicher Geister, auf dem sich entscheidet, wie sich der Mensch (weiter)entwickeln kann. Ein Mensch, der Gott und dessen Einwirkungen auf den eigenen Geist anhängt, wird schließlich ein













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)