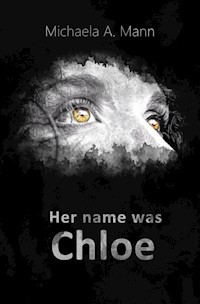Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Welten. Zwei Frauen. Ein Jäger. Er hat sie gefangen, sie gebrochen. Immer und immer wieder. Für ihn war sie nur ein Spielzeug. Ein Zeitvertreib. Ein Experiment. Für sie jedoch war er alles. Ihr Leben und vor allem ihr Tod. Er war ihre Welt. Er war das Böse, das sie verfolgte, das sie gefangen hielt und brach. Chloe war mehr tot als lebendig, als sie ihm entkommt. Doch ist sie ihm wirklich entkommen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
If you remember me, than I don´t care if everyone else forgets.
Haruki Murakami
Inhaltsverzeichnis
Chloe
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Clare
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Epilog
Chloe
-1-
Ich rannte. Meine Beine schmerzten bei jedem Schritt. Meter für Meter kämpfte ich mich vorwärts. Ich atmete hektisch und doch hatte ich das Gefühl, keine Luft zu bekommen.
Die Gasse, in der ich mich befand, lag fast völlig im Dunkeln. Die Laterne, die sie eigentlich beleuchten sollte, flimmerte nur alle paar Sekunden hell auf, bevor sie wieder erlosch.
Die Luft war kühl, doch sie war alles andere als angenehm. Der Geruch von Urin stieg mir in die Nase. Mir wurde übel, doch ich lief eisern weiter. Mir war es egal, wohin mich meine Beine trugen, solange sie mich nur schnell genug an einen anderen Ort brachten.
Einen Ort, den ER nicht erreichen konnte.
Einen Ort, an dem ich sicher vor IHM war.
Je dunkler und schattiger die Gassen wurden, desto sicherer fühlte ich mich. Ich hatte schon längst jede Orientierung verloren. Straße für Straße, Gasse für Gasse, Hinterhof für Hinterhof. Noch immer rannte ich so schnell ich konnte durch diese fremde Stadt. Mein Puls rauschte mir in den Ohren und ich musste mich zusammenreißen, damit mein lauter, keuchender Atem nicht sofort meine Position verriet. Ich war es nicht gewohnt, mich zu bewegen. Zu lange war ich eingesperrt gewesen. Meine Muskeln waren verkümmert. Mein Körper schwach.
Eilig sah ich mir über die Schulter, aus Angst, dass ER mich verfolgte. Aus Angst, dass ER mich finden würde.
Nichts.
Niemand schien mich zu verfolgen, dennoch lief ich weiter.
Ich durfte mir keine Pause genehmigen.
Hoffnung machte schwach.
Hoffnung war etwas, das ich mir nicht erlauben konnte. Nicht erlauben durfte.
Ich musste weg, denn früher oder später würde ER mich finden.
Es war nur eine Frage der Zeit.
Es war unausweichlich.
ER war unausweichlich.
Wieder erreichte ich das Ende einer Gasse und sah mich hektisch um. Obwohl es mitten in der Nacht sein musste, waren noch dutzende Menschen unterwegs. Motorenlärm drang aus allen Richtungen zu mir. Betrunkene, die durch die Straßen wanderten. Hunde, die laut bellend ausgeführt wurden.
Die Straßen waren belebt, egal wie weit ich mich vom Stadtzentrum entfernte, daher mied ich sie. Ich beschränkte mich auf die schmalen, dunklen Gassen, die von den meisten Menschen übersehen wurden. Gassen, die selbst bei Tageslicht unheimlich wirkten und um die man besser einen weiten Bogen machte.
Gassen, die wie für mich gemacht waren. Ich fand sie weder unheimlich, noch gefährlich und der Gestank ließ sich ignorieren.
Für mich waren es einfache Verstecke.
Verstecke, die es IHM schwer machen würden, mich zu finden.
Nur wenige Schritte und schon verschluckte mich völlige Dunkelheit. Ich hieß sie willkommen, denn sie war meine einzige Deckung. Mein einziger Schutz.
ER war in der Nähe.
Ich konnte es spüren.
Mein Atem klang in dieser schmalen Gasse unsagbar laut. Ich rannte weiter, denn ich wusste, dass er mich jeden Moment finden konnte.
Langsam erkannte ich das Ende der Gasse. Die Straße dahinter war matt beleuchtet. Auf der rechten Seite, einige Meter entfernt, stand eine Laterne mit orangefarbenem Licht. Schnell eilte ich in die entgegengesetzte Richtung. Hinein in die Schatten. Weg vom Licht.
Plötzlich fühlte es sich an, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Die Luft wurde mir aus der Lunge gepresst und ich gab einen erstickten Laut von mir. Ein Arm legte sich grob um meine Taille. Einen Augenblick später wurden mir die Arme auf den Rücken gedreht, bis es anatomisch kaum noch möglich war, ohne mir einen Knochen zu brechen.
Binnen einer Sekunde war ich gefangen.
Es ging so schnell, dass ich kaum reagieren konnte und selbst wenn, … ich hatte es schon längst aufgegeben, um Hilfe zu schreien. Mir würde niemand helfen, das wusste ich. Egal, wie lange – egal, wie laut ich schrie.
Der Mann hielt mich fest. Seine Haut war dunkel wie die Nacht. Seine Augen schwarz und in der Dunkelheit kaum zu erkennen.
Kein Grund, sich vor ihm zu fürchten.
Er war nicht ER.
Erleichterung durchflutete mich, jedoch nur für einen kurzen Augenblick. Ich war auf der Flucht. Ich durfte nicht stehen bleiben, sonst würde ER mich finden.
Hilflos sah ich den Mann an und wagte es nicht, auch nur einen Ton von mir zu geben. Zu groß war die Angst vor IHM und davor, dass ER mich hören würde.
Der Fremde musterte mich seinerseits. Er stellte keine Frage, als würde er spüren, dass etwas nicht stimmte. Sein Griff, der mir beinahe den Arm brach, wurde etwas sanfter. Er war etwa einen Kopf größer als ich und hielt mich problemlos fest. Seine Schultern waren breit und die Arme muskulös. Ich machte keinerlei Versuche, mich zu befreien, denn es wäre ohnehin zwecklos gewesen. Ich brauchte meine Kräfte noch.
Schluckend machte ich mich bereit. Die Zeit drängte. »Bitte«, murmelte ich so leise ich konnte. Es war kaum mehr als das bloße Bewegen meiner Lippen. »Lass mich gehen«, forderte ich kraftlos und war über den Klang meiner Stimme selbst erstaunt. Schwach und dünn. Wie lange war es her, dass ich sie zuletzt gehört hatte? Wann hatte ich es aufgegeben zu sprechen?
»Was willst du in meinem Viertel?«, entgegnete der Mann, ebenso leise.
Ich war dankbar dafür, dass er flüsterte und keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zog und doch … war ich enttäuscht. Sah er mich nicht? Sah er nicht, dass ich Hilfe brauchte? Dass ich auf der Flucht war?
Wir standen am Eingang einer schmalen Gasse. Hinter ihm konnte ich weitere Männer erkennen. Sie waren dunkel gekleidet, manche größer, manche kleiner. Es schien so, als ob sie vor einer Tür herumlungerten. Einem Eingang. Einem Versteck. Zwei von ihnen sahen schweigend zu uns hinüber.
Das Echo von Schritten, nur wenige Meter entfernt, ließ mich zusammenzucken. Ich erkannte es. Kannte die Schritte.
Es waren SEINE Schritte.
ER war ganz in der Nähe.
Ich hatte es gewusst und doch jagte mir ein kalter Schauer über den Rücken.
Es gab kein Entkommen.
Hoffnung machte schwach.
»Lass mich los«, forderte ich erneut, doch ich rechnete nicht damit, dass der fremde Mann auf mich hörte und meiner Aufforderung nachkam. Auch ER hatte mich nie losgelassen. Ich wappnete mich für das, was kommen würde.
Dass ER kommen würde.
SEINE Schritte kamen immer näher, als wüsste ER genau, wo ich mich befand.
ER kannte mich und ER würde mich finden, daran bestand kein Zweifel.
Ich wand mich, doch mein verdrehter Arm ließ kaum eine Bewegung zu. Der Mann hielt mich noch immer an der Taille fest. Nicht so stark, um mir die Luft zum Atmen zu nehmen, doch ich konnte mich nicht befreien. Es war eine nutzlose Zeitverschwendung, also machte ich mich schwer, ließ mich voll und ganz von diesem Fremden halten und hob die Füße vom Boden.
Der Mann hielt mich ohne Probleme, als wäre ich nichts weiter als ein lästiges Blatt, doch er schien zu verstehen, was ich wollte und ließ mich auf den Boden sinken. Sofort schob ich mich hinter die Füße des Mannes und flehte ihn stumm an, leise zu sein. Noch immer hielt er mich am Handgelenk fest.
Er musste IHN bereits sehen.
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, so laut, dass ich befürchtete, ER würde es hören.
Plötzlich schob mich der Mann enger an die Hauswand, in den Schutz der Schatten, den die Nacht über diese Stadt gelegt hatte. Er sagte kein Wort, als würde er verstehen, dass ich mich versteckte. Vor diesen Schritten. Vor IHM.
Endlose Sekunden kauerte ich mich auf den Boden. Der Gestank von Urin und Verwesung brannte mir in der Kehle, doch ich hatte schon Schlimmeres erlebt.
Weitaus Schlimmeres.
Ich konnte IHN nicht sehen, doch ich hörte SEINE Schritte, die ohne jegliches Zögern an uns vorbeiführten.
Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Wagte es nicht, zu atmen.
Erst lange, nachdem jegliche Geräusche verhallt waren, rührte sich der Mann. Er wich zurück und zog mich kraftvoll auf die Beine.
Meine Muskeln schmerzten.
Lange sah er mich an und ich blickte meinerseits in seine dunklen, geheimnisvollen Augen.
Dieser Mann hatte mich beschützt.
Warum?
Was hatte er davon?
Hatte er Mitleid mit mir?
»Verschwinde«, raunte er mir schließlich zu, wobei er endlich mein Handgelenk frei gab. Seine tiefe Stimme vibrierte in der Luft.
Ich wollte nicht gehen.
Dieser Mann hatte mich beschützt, obwohl ich ihn nicht darum gebeten hatte.
Er hatte mir geholfen.
Noch immer starrte ich ihn an. Sah ihm in die Augen. Hoffte, dass er mich sah. Hoffte, dass er seine Meinung änderte und ich bei ihm bleiben konnte.
Hoffte.
Und zwang mich zu gehen.
Ich drehte mich um und schob mich zurück in die Dunkelheit der Gasse. Meine Beine trugen mich, auch wenn jeder Schritt schmerzte. Sowohl seelisch, als auch körperlich.
Hoffnung machte schwach.
So unfassbar schwach.
Ich war wütend auf mich selbst, darauf dass ich hoffte. Dass ich die Hoffnung zugelassen hatte. Ich dachte, dass ich meine Gefühle unter Kontrolle hatte, doch dieser Fremde … Dieser Mann brachte alles durcheinander.
Mir war nach Weinen zumute, doch für Tränen fehlte mir die Kraft und zum Schreien war meine Stimme viel zu schwach.
Ich sehnte mich nach einer Pause, doch die konnte ich mir nicht leisten. Ich wusste nicht, wie viel Zeit mir noch blieb. Wie lange meine Freiheit währte. Wie lange ich mich noch vor IHM verstecken konnte.
ER war der Jäger und ich seine Beute.
ER würde mich finden.
Ich hätte nicht fliehen sollen …
Nein!
Ich würde es immer wieder tun!
Ich würde nicht aufgeben!
Niemals!
Kaum war ich um die nächste Ecke gebogen, sah ich blinkende Lichter in Blau und Rot. Sie färbten ganze Straßen und Wände ein und ließen die Nacht erstrahlen. Ich brauchte einen Moment, um den dunklen Fleck am unteren Ende der Fassade als Graffiti wahrzunehmen. Es war kaum zu entziffern und erinnerte mich an eine riesige Spinne, die an der Wand hing. Immer auf der Lauer. Immer auf der Jagd.
Langsam näherte ich mich den Lichtern und entdeckte kurz darauf einen Wagen.
Die Polizei.
Hilfe.
Vielleicht war dies meine Chance.
Vielleicht konnte ich so entkommen.
Die uniformierten Gestalten entdeckten mich sofort. »Ist sie das?«, fragte einer von ihnen.
Sie suchten nach mir?
Warum? Warum suchten sie nach mir?
Zögernd blieb ich stehen.
Noch vor einem Moment hatte ich mich gefreut, diese blinkenden Lichter zu sehen, auf Hilfe gehofft, doch ein ungutes Gefühl machte sich in mir breit.
Hoffnung machte schwach.
Wie hatte ich nur glauben können, IHM zu entkommen? Wie hatte ich nur so dumm sein können?
Es war eine Falle.
Es war SEINE Falle.
Und ich war geradewegs hineingelaufen.
-2-
»Vielen Dank, dass Sie meine Nichte gefunden haben«, sagte ER. Der geheuchelte Ton in seiner Stimme war kaum zu überhören, doch dem Polizisten, der auf der anderen Seite des Tresens stand, war das egal.
Gefangen.
Ich wurde nicht gefunden.
Ich wurde gefangen.
Der Polizist nickte nur, als hätte er diese Leier schon dutzende Male gehört. Er war alt, kurz vor dem Ruhestand. Sein Bart war grau. Seine Haut fettig. Er wollte seine Schicht beenden, mehr schien ihn nicht zu interessieren.
»Ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wie froh ich bin, dass sie wieder in Sicherheit ist. Wenn ihr etwas passiert wäre … «
»Chicago ist ein gefährliches Pflaster«, kommentierte der Polizist gelangweilt und legte ein Blatt zur Seite.
»Es wird nicht wieder vorkommen.«
»Gut«, sagte der Polizist nur. »Der Papierkram ist soweit erledigt. Ihr dürft gehen.«
»Vielen Dank. Auf Wiedersehen.« Dann drehte ER sich um und sah mich an.
Sah mich direkt an.
Und mir gefror das Blut in den Adern.
ER sah unscheinbar aus. Für andere. Wenn ER sich bemühte, den Wahnsinn hinter einer netten Fassade zu verstecken. Hinter seinen einfarbigen Hemden, seinen gepflegten Haaren und dem durchschnittlichen Erscheinen. Nicht zu perfekt, auch wenn ER genau das bezweckte.
ER sah aus wie jeder andere.
Doch SEIN Blick …
SEIN Blick schien mich töten zu wollen.
Ich empfand nichts, durfte es nicht. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ER mich bestrafen würde und diesmal würde ER mich nicht so leicht davonkommen lassen.
Wortlos stand ich auf und lief mit IHM durch die Tür nach draußen, als wäre alles völlig normal. Doch das war es nicht.
Nicht im Ansatz.
Es war nicht gerecht.
ER wollte mich nicht in Sicherheit wissen.
ER wollte nur seine Beute.
Mich, die psychisch gestörte Nichte.
Ich musste beinahe lachen, wenn ich es nicht schon vor Jahren verlernt hätte.
Warum wollte mir niemand glauben?
Warum wollte mir niemand helfen?
Warum sah niemand, wer ER wirklich war?
Noch immer war es dunkel, doch ich wusste nicht, wie lange ich den Himmel über mir noch sehen durfte.
»Du kannst mir nicht entkommen«, flüsterte ER siegessicher, während ER den Wagen aufsperrte und mir die Tür öffnete.
Eine junge Polizistin mit einem Kaffeebecher in der Hand sah uns nach, wandte sich dann ab und ging in das Gebäude. SEIN Wagen parkte nur wenige Meter entfernt vom Eingang.
Niemand glaubte mir.
Niemand würde mir je glauben.
Der kalte Ausdruck in SEINEM Gesicht machte mich krank. ER würde mich töten – früher oder später – und ER würde es genießen.
Sobald ich in diesem Wagen saß, würde ich sterben. Es gab kein Zurück mehr. Ich hatte keine Zweifel daran.
Mein Fluchtversuch war gescheitert und ich würde bitter dafür bezahlen müssen.
Ich griff nach der Tür, doch ich zögerte.
ER würde mich ohnehin töten.
Ich konnte nur den Zeitpunkt bestimmen und dafür sorgen, dass es vielleicht – vielleicht – nicht ganz so qualvoll ausfallen würde.
ER hatte seine Hand oben auf den Rahmen der Tür gelegt. Schnell riss ich sie zurück, drückte sie zu, sodass SEINE Finger eingeklemmt wurden.
Kurz schrie ER auf, doch ich achtete nicht darauf, sondern rannte los.
Weg.
Ein letzter, verzweifelter Versuch, zu überleben. Oder zu sterben.
ER folgte mir in die Gasse, weg von der Polizei, die mir kein Wort glaubte.
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis mich eine Kugel traf. Direkt in meinen linken Oberarm. Schmerz breitete sich in mir aus, doch ich blieb nicht stehen. Wenn es der einzige Preis für meine Freiheit war, würde ich ihn gerne bezahlen. Ich würde nahezu jeden Preis bezahlen, um am Leben zu bleiben, wobei ich nicht einmal wusste, was mich an diesem Leben überhaupt hielt.
Ich konnte mich kaum daran erinnern, was es bedeutete, am Leben zu sein.
Leben bedeutete Schmerz.
Ich presste meine Hand auf meine Schulter und rannte weiter.
Schmerz bedeutete, dass ich noch am Leben war. Ich hieß ihn Willkommen.
Eine weitere Kugel surrte an meinem Kopf vorbei und schlug in der Wand neben mir ein. ER benutzte ganz offensichtlich einen Schalldämpfer, denn der Schuss war kaum zu hören.
Ein Jäger war ein Jäger.
Die Jagd begann erneut.
Keuchend schleppte ich mich weiter, immer tiefer in dieses Labyrinth aus Gassen und Straßen, Hinterhöfen und Parkplätzen hinein.
An Bettlern vorbei, die mich ignorierten.
An Prostituierten, die die Augen verschlossen und mich meinem Schicksal überließen.
An dunklen Gestalten, die nur in ihrer eigenen morbiden Welt lebten.
An Menschen, denen mein Leben egal war.
Sie wussten es.
Sie sahen, dass ich verletzt war.
Warum?
Warum halfen sie mir nicht?
Sahen sie mich nicht? Sahen sie das Blut nicht? Sahen sie nicht, dass ich Hilfe brauchte?
Mein Arm war eine einzige schmerzende Masse. Warmes Blut lief mir im Ärmel meines schwarzen Pullovers entlang und tropfte von meinen Fingerspitzen hinab auf den Boden. Es waren Brotkrumen, die ER finden würde.
Erschöpft lehnte ich mich an die Mauer neben mir. Jede Gasse sah wie die nächste aus. Jede Straße glich der vorigen. Jedes Graffiti war gleich.
Der Morgen dämmerte bereits, doch wohin sollte ich mich wenden?
Meine Zeit lief ab. Ich konnte es spüren.
Ein Motor heulte ganz in der Nähe auf und ließ mich zusammenzucken.
Nein.
NEIN!
Ich biss die Zähne zusammen, stieß mich von der Wand ab und rannte weiter.
Es war SEIN Motor.
ER verfolgte mich.
ER war noch immer auf der Jagd.
Ich trat an das Ende der Gasse und sah mich um. Eine einsame Laterne auf der rechten Seite erhellte einen Teil der Straße vor mir. Etwas daran kam mir seltsam bekannt vor. Mein Instinkt trieb mich vorwärts und als ich die Gasse vor mir erkannte, rannte ich geradewegs hinein. Es war die Gasse, in der ich abgefangen wurde, doch diesmal war niemand zu sehen. Niemand war im Begriff, mich abzufangen oder festzuhalten.
Niemand würde mir helfen.
Enttäuschung machte sich in mir breit und nahm mir beinahe die Luft zum Atmen.
Hoffnung machte schwach.
Immer und immer wieder sagte ich es mir wie ein Mantra, dennoch konnte ich nicht verhindern, dass ich hoffte. Ich konnte nicht verhindern, dass ich leben wollte.
Die nächste Laterne, meterweit entfernt, warf nur noch einen langen Schatten auf den Hauseingang. Die Tür wirkte wie ein schwarzes, offen klaffendes Loch.
Etwas zaghaft klopfte ich gegen das kalte Metall der Tür, denn eine Klingel gab es nicht. Es war kein richtiger Eingang, eher eine Hintertür.
Das Motorengeräusch wurde währenddessen immer lauter. Ich wusste, dass ER mich finden würde. Es war nur noch eine Frage der Zeit.
Ich musste in Bewegung bleiben. Ich durfte nicht stehenbleiben und auf Hilfe warten.
Oder hoffen.
Wieder klopfte ich an der Tür, diesmal etwas drängender. Hoffnung war eines der schlimmsten Gefühle, doch einmal entfacht, war es nur schwer zu unterdrücken.
»Bitte!«, rief ich – schwach wie ich war – und klopfte erneut.
Helft mir!
Mein Herz pochte wie wild, während die Geräusche immer lauter wurden. Nicht, dass diese Stadt jemals wirklich still geworden wäre, doch SEINEN Wagen erkannte ich überall.
Helft mir, bitte!, flehte ich stumm.
Ich wartete.
Verzweifelte.
Und dann – wie durch ein Wunder – wurde mein Flehen erhört. Die Tür öffnete sich, wenn auch nur für ein kleines Stück.
Es genügte mir völlig.
Schnell drängte ich mich hinein, verschwand in der dort herrschenden Dunkelheit.
Im nächsten Moment packten mich Hände. Grobe Hände. Ein Mann presste mich gegen die nächstbeste Wand.
»Bitte«, flehte ich über den Schmerz hinweg, der augenblicklich durch meinen Körper fuhr.
Mein Gegenüber sah mich forschend an. Auch er – wie die Männer zuvor – war dunkelhäutig. Im trüben Licht war nur das Weiß seiner Augen zu erkennen. Zögerlich nickte er, dann schloss er die Tür. Keine Sekunde später rollte SEIN Wagen vorbei.
ER fuhr langsam.
ER war auf der Suche, doch er stoppte nicht.
Erleichtert rutschte ich an der Wand entlang und sackte an Ort und Stelle zusammen.
ER hatte mich nicht gefunden.
Noch nicht.
»Was willst du?«
Diese Stimme … Es war der Mann, der mich festgehalten hatte. Ich sah auf, doch mir blickten dutzende dunkelhäutige Gesichter entgegen, sodass ich ihn nicht ausmachen konnte.
»Ayden«, sagte jemand etwas überrascht. »Du kennst sie? Dachte nicht, dass du auf kleine, bleiche Püppchen stehst.«
Einige Männer begannen zu lachen, andere grinsten nur stumm vor sich hin. Unter den Anwesenden war auch eine Frau mit langen geflochtenen Haaren. Sie verdrehte genervt die Augen.
»Darf ich, wenn du mit ihr fertig bist?«, fragte jemand, wobei er den Mann neben sich mit dem Ellenbogen anstieß.
Da entdeckte ich ihn. Ayden. Sein Blick war kalt und so unberechenbar wie bei unserer letzten Begegnung.
»Wer bist du?«, fragte er emotionslos. Die anderen Männer wurden still. Die Atmosphäre spannte sich an.
»Bitte«, murmelte ich nur. Es waren so viele Worte in meinem Kopf, doch nur dieses eine schaffte es über meine Lippen. Ich klang so erbärmlich, wie ich mich fühlte.
Wieder fuhr SEIN Wagen vorbei, diesmal rückwärts und noch langsamer als zuvor. ER ließ den Motor laut aufheulen. ER wusste genau, dass ich noch in der Nähe war.
Mein Blick huschte zurück zur Tür.
ER hatte meine Spur verloren. ER wusste, dass ich mich hier irgendwo versteckte und ER würde mich finden.
So, wie ER es immer tat.
»Wer ist das?«, fragte Ayden gelassen. Langsam kam er näher. Der andere Mann, der mir die Tür geöffnet hatte, machte ihm Platz.
Plötzlich verkrampfte sich alles in mir. Ich hoffte auf Hilfe und Schutz, doch von Ayden ging eine gefährliche, unfreundliche Aura aus. Was, wenn ich mich getäuscht hatte? Was, wenn er mich IHM ausliefern würde?
Ich hätte nicht anhalten dürfen. Es war ein dummer Fehler gewesen. Niemand würde mir helfen. Niemand hatte mir je geholfen.
»Wer«, wiederholte Ayden, während er vor mir in die Hocke ging, »ist das?«
Ich öffnete meinen Mund, doch kein einziger Ton kam heraus. Sollte ich es ihm sagen? Würde er mir glauben oder hielt er mich auch für eine Lügnerin, wie die Polizisten es getan hatten?
»Chloe, ich weiß, dass du hier bist«, rief ER über den Lärm seines Wagens hinweg. Es klang nicht bösartig, sondern eher so, als würde ER nach einem vermissten Haustier suchen.
Und ich war SEIN vermisstes Haustier.
Ein Haustier, das IHM weggelaufen war.
Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Mein Blick wanderte erneut zur Tür. In meinem Kopf spielten sich dutzende Szenarien ab, doch keines davon beendete ich lebend.
ER würde sich nicht die Mühe machen, mich an einen anderen Ort zu bringen. ER würde mich in dem Moment töten, in dem ER mich fand. Und ER würde mich finden.
»Bist du Chloe?«, wollte Ayden wissen und ich zwang mich, ihn erneut anzusehen.
Langsam, ganz langsam, nickte ich. Der Schmerz in meiner Schulter brachte mich um den Verstand. Ich biss mir auf die Lippen und versuchte, ihn zu ignorieren. Inzwischen drückte ich schon so stark auf meine Schulter, dass mir auch mein anderer Arm schmerzte.
»Was hast du da?« Ayden fragte im selben Moment, in dem er nach meinem Arm griff und ihn beiseite zog. Als er das Blut an meiner Hand bemerkte, brummte er abfällig.
Es war schlimm, doch ich hatte schon Schlimmeres erlebt. Es ärgerte mich, dass mein Körper so schwach war. So erbärmlich. Meine letzte Mahlzeit war Tage her.
ER wusste, wie ER mich kontrollieren konnte.
»Was will er von dir?«, fragte Ayden.
Ich zögerte. Die Polizei hatte mir nicht geglaubt, warum sollte er es tun? Doch ich zwang mich zu einer Antwort. »Er will mich töten.« Ich hörte selbst, wie neutral meine Stimme klang. Genau genommen hatte ich keine Angst vor dem Tod, sondern nur davor, wie qualvoll ER es mir machen würde. »Wenn er mich findet«, brachte ich kaum hörbar hervor, »wird er mich töten.«
»Er wird dich nicht finden.« Selbstsicherheit sprach aus seinen Worten.
Glaubte er mir?
Wollte er mir wirklich helfen?
»Kümmert euch um ihn«, befahl Ayden, während er mich nicht aus den Augen ließ. Einige Männer verließen kommentarlos den Raum. Offenbar nahmen sie einen anderen Ausgang. Die Tür, die ich versperrte, führte direkt in einen großen, offenen Bereich. Alte Sofas und Kisten standen darin. Noch immer saßen darauf mehrere Männer, die mich aufmerksam musterten. Es waren überwiegend junge Männer. Auch Ayden war noch jung, fiel mir auf, doch seine Aura ließ ihn viel älter erscheinen.
Wie alt war ich inzwischen? Was sahen diese Männer, wenn sie mich musterten?
»Terence, kümmere dich um ihren Arm. Sie verliert viel Blut.« Ein weiterer Befehl, doch noch immer lag sein Blick auf mir.
Ein rundlicher Mann erhob sich vom Sofa. Im schummrigen Licht wirkte er wie ein massiver Fleischberg, auch wenn er ein recht freundliches Gesicht hatte. Er war ebenfalls dunkelhäutig, so wie alle anderen hier.
Wortlos kam er zu mir, packte meinen rechten Arm und zog mich auf die Füße.
Ich konnte kaum stehen und wehrte mich nicht. Wozu auch? Ich hatte keine Wahl. Mein Körper war schwach.
Ayden sah mir nach, als Terence mich etwas weiter in den Wohnraum führte. Ich war froh, dass meine Füße mich trugen. Wir näherten uns einer Pritsche und einem abgenutzten Hocker, der direkt daneben stand.
Terence schob mich auf die Pritsche zu. »Dann werden wir uns das mal genauer ansehen«, sagte er, bevor er mich bäuchlings auf die dünne, fleckige Matte drückte. Ein helles Licht ging an und blendete meine Augen, dann war plötzlich ein Taschenmesser in seiner Hand. Kommentarlos schnitt er meinen Pullover vom Kragen her auf. Vorsichtig, um mich nicht zu verletzen. Ich hielt still, so gut ich konnte, während jede noch so kleine Bewegung schmerzte.
Dann, als er zufrieden mit seiner Arbeit war, begutachtete Terence den Schaden. Er war sehr behutsam, beinahe schon zärtlich.
Ich ließ ihn gewähren, denn es musste sein.
»Die Kugel steckt noch«, murmelte er nach einer Weile. »Das wird jetzt … unangenehm.«
Etwas raschelte, dann erkannte ich eine kleine Pinzette und etwas, das wie ein Skalpell aussah. Terence legte beides fein säuberlich neben sich, dann öffnete er eine kleine Flasche. Augenblicklich stieg mir der strenge Geruch von Desinfektionsmitteln in die Nase.
Ich wehrte mich nicht. Ich zuckte noch nicht einmal, als er nach dem Projektil in meinem Arm stocherte. Es musste getan werden. Ich hatte inzwischen schon so viel Blut verloren, das ich mich kaum noch wachhalten konnte.
»Gleich hast du es geschafft«, murmelte er beruhigend. »Da haben wir den Übeltäter.« Er hielt das kleine, blutige Projektil hoch und legte es dann beiseite.
»Wird eine Narbe geben«, sagte er missmutig, als würde er sich bei mir entschuldigen.
Eine weitere Narbe machte mir nichts aus. Terence würde mich nicht sterben lassen, mehr interessierte mich nicht.
Langsam entspannte ich mich.
Ich war frei, ich war am Leben und ich würde diese Nacht überleben.
Innerlich jubelte ich vor Freude, doch ich war so unglaublich müde, dass ich kaum noch die Augen offenhalten konnte.
ER hatte mich bestraft, wenn ich in Ohnmacht gefallen war, doch ER war nicht hier.
ER war nicht hier.
Ich entspannte mich und schloss die Augen.
-3-
Blinzelnd wurde ich wach. Mein Kopf fühlte sich merkwürdig an, dick und gleichzeitig federleicht. Ich lag auf dem Rücken, blickte zur Decke und wusste, dass etwas anders war. Mehrere Sekunden lang starrte ich hinauf, bis es mir einfiel.
Es war nicht dieselbe Decke, die ich all die Jahre angestarrt hatte.
Ich war nicht mehr dort.
Ich war frei.
Ich lebte.
Mein Arm war bandagiert worden, doch ich konnte ihn bewegen. Dumpf pochte es durch meinen Körper, doch den Schmerz spürte ich kaum. Ich fühlte mich leicht und unbeschwert. Ich genoss das Gefühl, denn ich wusste, dass es nicht ewig anhalten würde.
»Wie geht es dir? «
Schweigend drehte ich meinen Kopf und sah mich um. Terence hatte gefragt. Er kam langsam zu mir. Ich lag auf dem Sofa, noch immer befand ich mich in diesem Wohnbereich. Ein schummriges Licht brannte an der Decke. Tageslicht gab es nicht.
Terence setzte sich in den Sessel neben meinem Kopf und sah mich fragend an. Er wirkte nett, doch davon ließ ich mich nicht täuschen. Auch hinter einem netten Gesicht konnte ein Monster stecken.
»Du kannst mich hören, oder?« Er machte eine Pause, doch ich wollte ihm nicht antworten.
Ich war müde, mein Kopf leer. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Sofort verschwanden meine Gedanken, flüchtig, wie sie waren.
»Willst du nicht mit mir sprechen?« Wieder eine Pause. »Nein?« Ein Seufzen.
Erneut sah ich ihn an, musterte ihn, so wie er mich musterte. Er erwiderte meinen Blick und in seinen Augen … war nichts.
Kein Hass.
Kein bodenloser Abgrund.
Kein Wahnsinn.
Terence war besorgt. Nichts an ihm wirkte gefährlich, bedrohlich oder verärgert. Er würde warten, bis ich bereit war, ihm zu antworten.
Mehr nicht.
Langsam setzte ich mich auf, wobei ich erst jetzt die schwere Decke bemerkte, die mir bis zur Brust reichte. Sie roch angenehm. Blumig. Nach einer Blume mit kleinen, lila Blüten, doch mir wollte der Name nicht einfallen.
»Chloe, richtig?«
Ich hob meinen Blick von der Decke und sah Terence erneut an. In meinem Kopf drehte sich alles. Mein Magen rebellierte.
»Willst du noch ein Schmerzmittel?«
Ich schüttelte den Kopf, einmal, ganz langsam. Mein Magen beruhigte sich wieder und auch das Karussell wurde langsamer.
»Du solltest deinen Arm in nächster Zeit nicht belasten, dann wird alles gut verheilen.«
Ich nickte langsam.
»Wie fühlst du dich?«, fragte er.
»Watte«, murmelte ich. Das Wort rollte nur schwer von meiner Zunge. »Wie … in Watte gepackt.«
»Keine Schmerzen?«, fragte Terence, wobei sich ein erleichtertes Lächeln auf sein Gesicht stahl. »Das ist gut.«
Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen und stellte fest, dass nur Terence und ich anwesend waren.
»Ayden ist nicht hier.«
Ich nickte. Langsam wurde mein Kopf klarer. Ayden war nicht hier. Die anderen Männer waren ebenfalls verschwunden. Was, wenn ER mich hier fand? Würde Terence ihn aufhalten?
Oder hatten Aydens Männer ihn bereits gefunden? Gefangen? Getötet?
»Wo ist er?«, fragte ich langsam.
»Das kann ich dir leider nicht sagen. Er kommt bald wieder.«
Ich schüttelte den Kopf. »Er.«
»Oh«, machte Terence. Er wich meinem Blick aus. »Es tut mir leid. Er ist uns entwischt.«
Mein Magen verkrampfte sich, doch ich war nicht überrascht.
ER ließ sich nicht so leicht fangen.
ER war ein Jäger.
Erschöpft ließ ich mich zurück auf das Sofa sinken. »Er wird kommen«, murmelte ich kaum hörbar. »Ich sollte nicht hier sein.«
»Er wird dir nichts tun. Das werde ich nicht zulassen.«
Ich schwieg. Wie sollte Terence auch wissen, dass er gegen IHN nichts ausrichten konnte? Er war zu weich und gutherzig. Er hatte keine Chance gegen ein Monster.
»Chloe«, begann Terence kurz angebunden. Seine Stimme war dabei unglaublich sanft. »Kannst du mir erzählen, was passiert ist?«
Konnte ich das? Wie sollte ich es in Worte fassen? Worte reichten nicht aus, um zu beschreiben, was ER mir angetan hatte.
»Wie alt bist du?«, änderte Terence seine Frage, als ich ihm nicht antwortete.
»Ich wurde 2001 geboren.«
»21?«, fragte Terence nach einem Moment. »Wann hast du Geburtstag?«
Ich konnte mich an kein Datum erinnern. Es lag schon zu weit zurück. Was hatte mich mein Alter interessiert, solang ich dort gefangen war?
»Wie alt warst du?«, fragte er noch eine Spur sanfter. Mitgefühl lag in seinen Worten. Etwas, an das ich mich kaum erinnern konnte.
»Sechs.« Ich war länger eine Gefangene, als dass ich ein freier Mensch gewesen war. Was sagte das über mein Leben? Was sagte das über mich? Gab es mich überhaupt?
»Es ist vorbei, Chloe.« Terence griff nach meiner Hand und drückte sie leicht. »Ruh dich aus. Es wird alles gut.«
Leider glaubte ich ihm kein Wort.
ER war dort draußen.
Und ER machte Jagd auf mich.
Es musste der nächste Morgen sein, denn Tageslicht erhellte dieses merkwürdige, karge Wohnzimmer. Niemand schien sich um mich zu scheren, daher setzte ich mich auf und sah mich langsam um.
Niemand war bei mir.
Ich lauschte in die leere Wohnung hinein, doch alles um mich herum war still. Von draußen drangen Stadtgeräusche zu mir. Hupen, das Dröhnen einer Alarmanlage. Autos, die im Verkehr steckten. Menschen, die lachten oder in ihr Telefon brüllten.
Normal.
Es fühlte sich so seltsam normal an.
Der Raum, in dem ich mich befand, sah auch bei Tag nicht besser aus. Die Garnitur aus Sofa und Sessel war wild durcheinander gewürfelt und wirkte abgenutzt. Ein paar Kisten dienten als zusätzliche Hocker. Ein großer Schrank nahm die Hälfte der Wand ein, daneben führte ein Flur in den hinteren Teil des Gebäudes.
Die Tür, durch die ich gekommen war, diente offensichtlich als Hintertür. Sie sah von innen wie eine gewöhnliche Zimmertür aus.
Es gab keine persönlichen Gegenstände. Nichts, das den Raum in irgendeiner Hinsicht wohnlicher oder wärmer machte.
Dieser Raum war Mittel zum Zweck. Welchem Zweck, das wusste ich nicht und es kümmerte mich auch nicht. Diese Menschen hatten mir geholfen und nun musste ich verschwinden, bevor …
Ich wusste es nicht.
Ich wollte einfach nur weg.
Die Tür war nur wenige Schritte entfernt. Der Drang, aufzustehen und durch diese Tür in die Freiheit zu gehen …
Es war eine unglaubliche Gelegenheit.
Ich konnte die Freiheit förmlich riechen, konnte sie auf meiner Zunge schmecken.
Schnell streifte ich die Decke ab, die über mir ausgebreitet worden war, und setzte meine Füße auf den Boden. Meine Turnschuhe standen keine zehn Zentimeter daneben. Schnell schlüpfte ich hinein und huschte zur Tür hinüber. Ich trug einen viel zu großen, abgetragenen Pullover, doch es kümmerte mich nicht. Auch wie ich mit meiner blutbefleckten Jogginghose, dem Verband und meinem verwahrlosten Äußeren aussah, kümmerte mich nicht im Geringsten.
Vor mir lag die Freiheit.
Endlich.
Ich sah kurz zurück, doch dann öffnete ich die Tür und trat vorsichtig nach draußen.
Nichts konnte mich jetzt noch aufhalten.
Ich war frei.
Die Luft war kalt, doch sie roch bereits jetzt unangenehm und verbraucht.
Ich war draußen.
Das Sonnenlicht blendete mich so stark, dass ich meine Augen dagegen abschirmen musste.
War ich wirklich frei?
Nun, da mich niemand verfolgte und mich durch die Stadt jagte, spürte ich die Kälte, die augenblicklich durch meine Kleidung drang. Weder der Pullover, noch die blutbeflecke Hose, konnten mich davor schützen.
Ich war frei.
Ich war draußen!
Tief atmete ich ein, doch eine Stimme in mir wusste, dass ich niemals frei sein würde.
ER wusste, wo ich war.
ER wusste es immer.
Ich merkte erst, dass ich rannte, als ich bereits einige Meter zurückgelegt hatte. Die Gasse führte zu einer breiten Straße. Ich zwang mich zu einem normalen Tempo und folgte ihr. Ich wusste nicht, wo ich war oder wohin mich meine Beine trugen, doch je weiter weg, desto besser.
ER wusste, dass ich hier war und allein dieser Gedanke versetzte mich in Alarmbereitschaft.
Alles in mir drängte zur Flucht.
Plötzlich riss mich ein unförmiger Berg aus Kleidungsstücken aus meinen Gedanken. »Hey«, sprach er mich an. Erst im nächsten Moment erkannte ich den Bettler darin. »Ich soll dir das geben«, sagte er mit rauer, abgenutzter Stimme und streckte mir einen kleinen Zettel entgegen. Zögernd nahm ich ihn entgegen und erstarrte.
Es war kein Zettel, sondern ein Bild.
Ein Bild von mir.
ER hatte es gemacht.
Mein Gehirn begann wieder zu arbeiten. Schnell sah ich auf und drehte mich um meine eigene Achse. Auf der Straße, die neben dem Bettler entlang führte, waren mehrere Menschen unterwegs.
Ein Stadtmitarbeiter leerte Mülleimer.
Eine Frau eilte mit ihrem Kind an uns vorbei.
Jemand telefonierte.
Und dann sah ich IHN.
Mir wurde kalt. Mein ganzer Körper begann zu zittern.
Nein.
ER stand auf der anderen Straßenseite, ein paar Meter versetzt von mir.
Lächelnd.
In meinen Ohren rauschte es so laut, dass ich kein anderes Geräusch mehr wahrnahm.
»Gefunden«, formten SEINE Lippen.
NEIN!
Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte zurück. Ich war ein Tier bei der Treibjagd und ich wusste, dass ER es genoss.
Ich schob mich an Menschen vorbei, rempelte jemanden an, der seinen Kaffee verschüttete, und rannte eilig weiter.
Weg.
Ich musste weg!
Doch ich wusste weder wo ich war, noch, wohin ich gehen sollte.
»HEY!«, rief mir jemand entgegen. Es war eine genervte, schrille Frauenstimme. »Pass besser auf, du kleine Schlampe!«
Ein kleiner, weißer Hund bellte, während er an seiner Leine zerrte und mir in den Weg sprang, doch auch an ihm rannte ich mich ohne zu zögern vorbei.
Plötzlich zerrte etwas an mir, zog mich zur Seite und hielt mir den Mund zu. Ich spürte seinen Körper an meinem Rücken. Seinen festen Griff um meine Arme. Den Druck auf meiner Wunde.
Ich zappelte und trat nach ihm.
NEIN!
»Still«, wies er mich an und das wurde ich auch, denn es war nicht ER, der mich festhielt, sondern Ayden.
»Du bist hier nicht sicher«, murmelte er. »Komm mit.« Er ließ mich los, nahm mich an der Hand wie ein Kleinkind und zog mich schlichtweg mit sich. Wie paralysiert folgte ich ihm. Ich stellte keine Fragen oder versuchte, mich von ihm zu lösen.
Es war zwecklos.
Ich konnte nicht entkommen.
ER wusste genau, wo ich war.
Erst als Ayden mich auf das Sofa drückte und ich mich in die Polster sinken ließ, wurde mir bewusst, dass er mich zurück in dieses merkwürdige Wohnzimmer gebracht hatte.
Ohne zu fragen nahm er mir das Bild ab, das ich nach wie vor in meiner Hand hielt. Es war völlig zerknittert.
Ich wollte nicht, dass Ayden mich sah – mich so sah, erbärmlich und erniedrigt – doch ich wagte es nicht, zu protestieren.
ER hatte gerne Bilder gemacht. Auf diesem hatte er mich an einem gedeckten Teetisch drapiert. Ich hatte ein weißes Kleid getragen und einen Knebel in meinem Mund, damit ich schwieg, keine Grimassen schnitt oder nach ihm biss wie ein tollwütiger Hund.
Es war eines der ersten Bilder. Ich war noch jung und unerfahren. Leicht zu zerbrechen.
»Du kannst hier bleiben«, sagte Ayden ungerührt. »Ich wollte schon lange ein Haustier. Bleib drinnen. Wir kümmern uns um ihn. Solange er in meinem Viertel ist, hat er hier nichts verloren.« Mit diesen Worten stand er auf und verschwand über die Treppe, etwas weiter hinten im Flur, nach oben.
Seine Worte waren so nett und positiv, doch ich wusste – ich WUSSTE – dass Ayden machtlos war. ER war ein Monster. ER würde sich nicht so einfach schnappen lassen.
»Hast du Hunger?«, fragte mich Terence, der sich plötzlich in mein Sichtfeld schob und mir einen Teller voll Pommes vor die Nase stellte.
Augenblicklich grummelte mein Magen.
»Greif zu«, sagte Terence noch.
Ohne zu zögern griff ich nach dem Teller und aß schweigend die vor Fett triefenden Pommes.
Ich hatte gelernt, keine Fragen zu stellen.
»Ich war etwas in Sorge, als du nicht geschrien hast. Dachte schon, dass die Nerven beschädigt wurden.« Terence deutete auf meinen Arm. »Es freut mich, dass du dich damit schon so gut bewegen kannst.«
Mein Körper war es gewohnt, sich zu heilen. Schmerzen waren keine Ausrede. »Er wollte meine Stimme hören«, sagte ich leise. Ich wusste nicht viel über diese Welt, doch bei einer Sache war ich mir sicher: Terence gab mir zu essen. Ich durfte ihn nicht gegen mich aufbringen. Ich musste mich gut mit ihm stellen. »Es war das Einzige, wozu er mich nicht zwingen konnte«, erklärte ich weiter, denn Terence sah mich noch immer fragend an.
Er stockte kurz, bis er begriff, was ich meinte. »Zu schreien?« Sein Gesicht spiegelte Mitgefühl und Schmerz wieder.
Ich nickte nur.
»Sie ist ein kleiner, weißer Wurm«, mischte sich jemand ein. »Hör auf sie zu bemuttern. Das ist widerlich.«
»Ayden mag sie«, rechtfertigte sich Terence.
Der andere schnaubte abfällig. Er murmelte etwas von »Haustier« und kam näher. »Wenn sie nicht so miserabel aussehen würde, hätte er sie schon längst im Bett.«