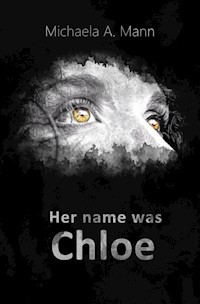Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den endlosen Weiten Islands sucht Ann nicht nach Liebe, sondern nach Frieden. Eine niederschmetternde Diagnose hat ihr das Ende angekündigt, doch das Schicksal führt sie zu Jón, einem Fremden mit einer dunklen Vergangenheit. Zwischen Sturm und Stille, Feuer und Eis, entsteht eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Doch genau das, was sie verbindet, droht sie zu zerstören. Manche Versprechen hallen weiter - selbst über das Leben hinaus. "Polarlichtflüstern" ist ein Roman über die Kraft der Liebe, das Loslassen und die stille Magie, die selbst in den dunkelsten Nächten aufleuchtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für all die verlorenen Seelen, die sich zwischen bedruckten Seiten aus Papier wiederfinden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
-1-
"The rain may fall, the wind may blow, My journey starts, where shadows grow. No looking back, no time to weep, The promises, I have to keep."
Mitten in diesem Nirgendwo, das wie das Ende der Welt wirkte, durchbrach das mechanische Surren eines Motors den monotonen, strömenden Regen. Ein gedämpftes Summen, fast unmerklich im steten Trommeln der Tropfen auf dem harten Boden, doch es war da. Ein Hoffnungsschimmer in der völligen, alles verschlingenden Dunkelheit, die mich seit Stunden umgab und zu erdrücken drohte.
Endlich.
Erleichterung durchflutete mich und belebte meine müden Glieder für einen kurzen Moment.
Ich blieb mitten in der schwarzen Schotterstraße stehen und lauschte angestrengt, um das herannahende Fahrzeug auszumachen. Meine Ohren versuchten jeden noch so kleinen Hinweis auf seine Position zu filtern.
Vergeblich.
Ein leiser Fluch entwich meinen Lippen.
Das Meer aus dunklen Schatten verschluckte alles. Es umhüllte mich wie ein riesiges, alles verzehrendes Wesen, dessen kalte Tentakel nach mir griffen. Jede Richtung war gleich – undurchdringlich und bedrohlich.
Facetten aus Grau und Schwarz bestimmten mein Sichtfeld. Regentropfen und Gestein verschmolzen zu einem einzigen, tristen Bild. Der Himmel war eine dichte, undurchdringliche Wolkendecke. Kein Mond, keine Sterne – nichts, was die Dunkelheit hätte erleuchten können. Zu dicht waren die Wolken, zu hoch die schweigenden, massiven Berge, die mich umgaben und die Welt von mir abschotteten.
Regen prasselte unaufhörlich auf mich nieder, durchnässte meine leuchtend gelbe Regenjacke, die mir inzwischen wie ein dünner, nutzloser Schutz vorkam, und jagte mir kalte Schauer über den Rücken.
Ein tückischer Windstoß peitschte mir eisige Tropfen ins Gesicht, fand einen Weg unter meine Jacke und ließ mich erneut schaudern.
Meine braunen Haarsträhnen, die sich von meinem notdürftig gebundenen Pferdeschwanz gelöst hatten, wehten wild umher, verdeckten meine Sicht und klebten unangenehm an meiner nassen Haut.
Der Motor dröhnte lauter. Ein kehliges Knurren, das durch die trostlose Landschaft hallte und die Stille zerriss. In diesem Nirgendwo gab es nur eine einzige Straße aus losem, schwarzem Schotter und unzähligen Schlaglöchern – und diese würde zwangsläufig zu mir führen. Die Gewissheit, dass gleich jemand hier sein würde, ein Mensch, ließ mich erleichtert aufatmen.
In der freudigen Erwartung, den feindlichen Elementen bald zu entkommen, rieb ich meine Hände aneinander und versuchte, die eisige Kälte zu vertreiben, die bis in meine Knochen gekrochen war und meine Glieder steif werden ließ. Die Reibung erzeugte keine Wärme, aber die Geste löste immerhin meine innere Anspannung.
Glücklicherweise musste ich nicht lange warten, bis ein greller Lichtstrahl durch den dichten Regen schnitt und die karge Gesteinslandschaft vor mir gespenstisch erhellte. Dann schossen die Scheinwerfer eines Fahrzeugs über die Kuppe eines Hügels. Zwei gleißend helle, warmweiße Lichter, die stur auf mich gerichtet waren und mich durch den Regen hindurch blendeten.
Mit zusammengekniffenen Augen sah ich dem Fahrzeug entgegen. Es war groß, vermutlich ein SUV oder ein Geländefahrzeug, jedenfalls schien es robust und offensichtlich für diese unwirtliche Gegend gemacht. Doch an den Scheinwerfern allein konnte ich weder Modell noch Marke ausmachen. Die Umrisse des Fahrzeugs ließen sich durch das blendende Licht kaum erkennen und auch die Entfernung war nur schwer einzuschätzen.
Immer wieder schaukelten die Lichter gefährlich, als das Fahrzeug in eines der unzähligen Schlaglöcher fuhr. Die Lichtkegel schienen mir dabei geradewegs zuzunicken.
Das Knirschen der Reifen auf dem losen Schotter wurde lauter und verwandelte sich in ein nahezu bedrohliches Geräusch. Langsam trat ich zur Seite, um nicht direkt vor der Motorhaube zu stehen. Gerade, als ich den Straßenrand erreicht hatte, rutschten die losen Steine unter meinen Schuhen weg. Augenblicklich spürte ich eiskaltes Wasser ins Innere fluten. Kälte durchfuhr mich und jagte mir eine Gänsehaut über den ganzen Körper.
Doch was waren schon nasse Füße? Die Aussicht auf Wärme und Sicherheit überwog alles.
Während ich dort stand und wartete, durchnässt bis auf die Knochen und zitternd vor Kälte, kam das Fahrzeug stetig näher. Immer wieder spritzte Regenwasser aus den tiefen Pfützen nach oben, wie kleine Fontänen in der Dunkelheit. In meiner Nähe wurde der Wagen langsamer und rollte aus, bis er schließlich mit der Beifahrertür direkt neben mir zum Stehen kam. Das lautstarke Knirschen der Reifen verstummte, abgelöst vom gleichmäßigen Brummen des laufenden Motors, dem steten Tackten des Scheibenwischers und den dicken Regentropfen, die unaufhörlich auf das Autodach prasselten.
Das Fenster der Beifahrerseite senkte sich langsam und gab den Blick ins Innere frei.
Ein Jeep, wie ich jetzt feststellte. Wahrscheinlich war er dunkelgrün, doch in der Dunkelheit, die mich umgab, war es nahezu unmöglich, die genaue Farbe zu erkennen.
Hinter dem Lenkrad saß ein Mann, dessen Gesicht von dem schwachen, rötlichen Schein des Armaturenbretts nur schemenhaft beleuchtet wurde. Er sah fragend in meine Richtung, seine Silhouette war ruhig und abwartend. Selbst aus dieser Entfernung, trotz des Regens und der Kälte, konnte ich die wohlige Wärme spüren, die vom Fahrzeuginneren ausging – eine unwiderstehliche Verlockung.
»Góða kvöldið, get ég aðstoðað þig? [GO-tha KVÖL-dith, get JEK ATH-sto-thath thick]«, drang seine Stimme zu mir. Tief, angenehm und sonor. Sie vibrierte förmlich in der Luft, doch ich konnte kein Wort verstehen. Isländisch, das war mir klar. Eine Sprache, die so fremd war wie die Landschaft um mich herum. In seinem Tonfall lag allerdings nicht die geringste Spur von Argwohn oder Misstrauen, eher eine ruhige Freundlichkeit. Daher ging ich instinktiv davon aus, dass er mir helfen wollte. Mein Herz pochte schneller vor Hoffnung.
Das Gesicht des Mannes war in der matten Dunkelheit schwer zu erkennen, doch was ich schemenhaft ausmachen konnte, war ein gepflegter Drei-Tage-Bart und dunkle Haare, die zu einem Knoten an seinem Hinterkopf zusammengebunden waren. Vermutlich war er Mitte dreißig oder älter.
»Tut mir leid«, begann ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern gegen den Lärm. Der Regen prasselte so laut auf das Dach des Jeeps, dass meine Worte fast darin untergingen. »Aber ich spreche kein Isländisch.«
Der Mann sah mich weiter an, eine unleserliche Miene auf seinem Gesicht. »Willst du mitfahren?«, fragte er dann, seine Stimme mit einem leichten, aber erkennbaren Akzent gefärbt. Mein Magen zog sich zusammen, dann breitete sich eine Welle der Erleichterung aus.
Ich war überrascht, dass er mich verstand und darüber hinaus noch meine Sprache sprach. Ich hatte schon fast erwartet, mich mit Händen und Füßen verständigen zu müssen. Die isländische Sprache bestand aus Lauten, die ich nicht von mir geben konnte. Zumindest nicht in der richtigen Reihenfolge.
Der Motor brummte unaufhörlich, ein konstantes, tiefes Grollen, und ich wusste, dass ich antworten musste. Plötzlich stieg Panik in mir hoch, eine Welle der Unsicherheit ließ mich zweifeln. Doch ich war bereits zu weit gekommen, hatte zu viel riskiert, um jetzt einen Rückzieher zu machen. Ich riss mich aus meiner Erstarrung, atmete tief ein, und zwang mich zu einer Antwort. Mein Entschluss stand fest.
»Ja, bitte.« Die Worte leise, aber bestimmt.
»Steig ein.« Weder Befehl noch nett gemeinter Ratschlag. Der Ton war hart, direkt, aber nicht unfreundlich. Er ließ keinen Raum für Diskussionen oder weitere Fragen.
Die Fensterscheibe fuhr wieder hoch, ein leises Surren, das die Wärme nahm und mich zurück in die Trostlosigkeit schickte.
Mit kalten, zittrigen Fingern suchte ich nach dem Türgriff. Das Metall war sogar noch kälter als meine Haut. Vorsichtig öffnete ich die Tür und hielt sie fest, damit der Wind sie mir nicht aus der Hand riss. So schnell es mir meine steifgefrorenen Glieder erlaubten, schwang ich mich auf den Beifahrersitz, wobei ich meinen kleinen Rucksack von den Schultern gleiten ließ und auf den Schoß nahm. Die Tür fiel mit einem dumpfen, endgültigen Geräusch zu.
Dann saß ich dort. Durchnässt bis auf die Knochen und dreckig wie ich war. Aber sicher.
Eine unbeschreibliche Erleichterung breitete sich in mir aus. Im Inneren des Fahrzeugs war es so angenehm warm, dass ich am liebsten lautstark geseufzt hätte.
Warm, windgeschützt und trocken.
Ein kleiner Sieg in einer langen Nacht und kein schlechter Anfang für mein neues Leben. Der Gedanke ließ ein leichtes Lächeln auf meinen Lippen erscheinen.
Etwas holprig rollte der Jeep an. Die Räder knirschten leise auf dem Schotter. Der Regen prasselte auch weiterhin lautstark auf die Windschutzscheibe, doch im Inneren des Jeeps war es so gemütlich und trocken, dass die Elemente, die draußen tobten, nur halb so schlimm wirkten. Ein Hintergrundgeräusch, nichts weiter.
Ich ließ den Rucksack in den Fußraum gleiten und hielt ihn zwischen meinen Füßen fest. Selbst die schwarze, wetterfeste Hose, die ich über einer Leggings trug, war inzwischen vollkommen durchnässt und unsagbar schwer, als hätte sie sich mit Blei vollgesogen.
Erst jetzt, da die unmittelbare Anspannung nachließ und die Wärme meine Glieder durchdrang, spürte ich, wie das Gewicht meiner Kleidung und meiner Knochen mich gleichermaßen tiefer in die weichen Polster drückten. Mit einem Schlag war ich unfassbar erschöpft, meine Muskeln schmerzten und jede Faser meines Körpers schrie nach Ruhe. Ich spürte das stete, nadelartige Stechen in meiner Brust umso deutlicher. Eine ständige Erinnerung, ein ständiger Begleiter.
Meine Gedanken schweiften ab, bis mir eine wohlige Wärme den Rücken hinaufkroch. Der gesamte Sitz, samt Rückenlehne, war angenehm warm und als ich meinen Blick über das Armaturenbrett schweifen ließ, bemerkte ich auch den Grund dafür. Der Schalter für die Sitzheizung, der sich in der Mittelkonsole des Jeeps befand, leuchtete in der höchsten Stufe. Augenblicklich überkam mich eine Welle der Dankbarkeit.
Vorsichtig spähte ich zu dem Fremden hinüber, der ohne ein Wort und ohne jegliche Fragen oder Höflichkeitsfloskeln weiterfuhr. Er schien sich meiner Anwesenheit kaum bewusst zu sein, oder ignorierte sie gekonnt.
Er war nicht ansatzweise so alt, wie der Bart und seine tiefe Stimme hätten vermuten lassen. Im rötlichen Schein des Armaturenbretts sah er nahezu makellos perfekt aus, als wäre er direkt auf eine Leinwand gemalt worden und nicht einfach nur hübsch oder attraktiv. Als läge mit diesem rötlichen Schimmer sein ganz persönlicher Filter über ihm.
Verstohlen musterte ich ihn weiter, meine Blicke glitten über seine markanten Gesichtszüge und den gepflegten Bart, der sein Kinn umrahmte. Seine sinnlichen, vollen Lippen, seine gerade Nase und die dunklen Augen, umringt von langen Wimpern und dichten Brauen. Ich nahm sein Bild voll und ganz in mich auf, versuchte jedes Detail zu speichern, ließ meinen Blick zur gemütlichen, dunklen Jacke schweifen und hinab bis zu seinen Händen, die fest auf dem Lenkrad ruhten. Ruhig und sicher.
Als er sich kurz von der Straße abwandte und mich ansah, nur für einen flüchtigen Moment, fühlte ich mich regelrecht ertappt. Mein Herz machte einen Satz, und ich wandte den Blick hastig von ihm ab, starrte stattdessen aus dem Beifahrerfenster. Meine Wangen glühten.
»Wohin fahren Sie?«, fragte ich schnell, um das unangenehme Schweigen zu brechen und die Stille zu füllen, die sich zwischen uns ausgebreitet hatte.
»Nach Hause.« Erneut war seine Antwort knapp und deutlich härter als notwendig, sodass der Klang seiner Worte in der Luft stehen blieb und wie ein Echo in meinen Ohren nachhallte. Eine kalte Feststellung, kein Angebot.
»Okay«, antwortete ich nur, und das war es auch. Ich hatte kein Ziel, zumindest keines, das ich örtlich benennen konnte. Mein Ziel war ein Gefühl, ein Zustand, kein Ort.
Er schien dem nichts hinzufügen zu wollen und seltsamerweise war mir seine Art nicht unangenehm. Ich war dankbar für die Wärme und zog sein Schweigen den unausgesprochenen Fragen vor, die in der Luft hingen.
Die Scheibenwischer bewegten sich rhythmisch von einer Seite zur anderen und wieder zurück, ein hypnotisierendes Geräusch, während wir schweigend weiterfuhren. Das Radio war so leise gedreht, dass ich nun, da der Regen nachließ, Bruchstücke der Musik und vereinzelte, gedämpfte Wortfetzen hören konnte.
Ich entspannte mich allmählich, wobei die beheizten Polster ihren Anteil dazu beitrugen, und atmete erleichtert durch. Im Wagen herrschte eine Mischung aus warmer, stickiger Luft, vermischt mit dem Geruch von Regen und frischer Erde – ein Geruch, der seltsam tröstlich und beruhigend wirkte.
»Ich habe hier draußen noch nie jemanden trampen sehen«, sagte der Fahrer schließlich und brach damit die Stille, die sich zwischen uns eingerichtet hatte. Seine Stimme war tief und beruhigend, wie warmer Honig, der sich langsam in meinen Ohren ausbreitete. »Es ist gefährlich.«
»Ich weiß«, antwortete ich mit leiser Stimme, meine Augen auf die vorbeiziehende Dunkelheit gerichtet. »Aber ich musste gehen.«
»Mitten in der Nacht?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Spielt die Uhrzeit eine Rolle?«, fragte ich mit gespielter Gleichgültigkeit zurück. Ich wollte nicht darüber sprechen. Wollte ihn nicht wissen lassen, dass ich alles bis ins kleinste Detail geplant hatte. Abgesehen vom isländischen Wetter, das sich nun wirklich nicht planen ließ und mich überrascht hatte. Das war die einzige Variable, die ich nicht kontrollieren konnte.
Der Mann schnaubte leise. Ich war mir nicht sicher, ob er mir meine Gleichgültigkeit abnahm oder mich für unsagbar naiv hielt. Oder beides. Ich konnte es ihm nicht verübeln, aber ich war nicht naiv. Nur verzweifelt und entschlossen.
»Weißt du, wo du heute Nacht schlafen kannst?«, fragte er, wobei sein Tonfall nun etwas mitfühlender war, eine Spur von Sorge schimmerte durch.
Ich schwieg und wusste nicht, was ich antworten sollte. Was sollte ich schon sagen? Nein? Selbst in meinen Ohren klang es naiv und dumm, kindisch und unvorbereitet. Das Letzte, was ich sein wollte.
Ich hatte meine eigenen Pläne, auch wenn sie noch nicht ausgereift waren, und ich war mir durchaus bewusst, dass der Anfang schwer werden würde. Das Wetter hatte ich unterschätzt, doch das änderte nichts an meinem Vorhaben. An meinem Wunsch nach einem Neuanfang. An meiner Entscheidung.
Ehrlich gesagt hatte ich es jetzt schon besser erwischt, als ich je erwartet hatte. Trocken und warm. Zur Not würde ich bestimmt im Jeep schlafen können.
»Ich würde nicht fragen, wenn es in dieser Gegend irgendwelche Unterkünfte gäbe«, setzte der Fremde hinzu, als sich das Schweigen zwischen uns ausdehnte.
Vor uns tauchten mehrere Schafe auf, die sich am Straßenrand dicht zusammendrängten. Wir wurden etwas langsamer und rollten vorsichtig an ihnen vorbei, bis sie erneut von der nächtlichen Schwärze verschluckt wurden, dann beschleunigte der Jeep wieder. Ein tiefes Schlagloch katapultierte mich fast aus meinem Sitz und ließ etwas im Kofferraum klappern.
»Ich nehme das als ein Nein«, sagte der Mann unbeeindruckt, als offensichtlich war, dass er von mir keine Antwort bekommen würde. Er klang dabei nicht verärgert, eher neugierig oder interessiert, fast schon amüsiert. Eine seltsame Mischung in seiner Stimme. »Warum sitzt du in meinem Jeep?«, fragte er dann.
Er schwieg geduldig, ohne mich dabei anzusehen oder mich unter Druck zu setzen, und ich nahm mir die Zeit, die ich brauchte, um auszusprechen, was ich nicht aussprechen wollte.
Diesmal waren es keine bloßen Gedanken, die in meinem Kopf herumschwirrten.
Diesmal war es real.
Diesmal tat ich es wirklich.
Endgültig.
»Ich laufe weg.« Die Worte kamen mir nur zögerlich über die Lippen, ein Geständnis, dem ich viel zu lange ausgewichen war.
Für einen kurzen Moment wurde es still, eine absolute Stille, als hätte selbst der strömende Regen auf meine Worte gewartet, nur, um Augenblicke später ebenso heftig zurückzukehren, ein dumpfes Prasseln, das die plötzliche Leere füllte.
»Wovor?«, fragte der Mann nur. Gleichgültig und knapp. Er wich meinem Blick aus und fast schien es, als ob seine volle Aufmerksamkeit der schwarzen Schotterstraße vor uns galt, doch ich spürte, dass er mich insgeheim beobachtete.
Meine Haut kribbelte.
Mir war, als würde die ganze Welt den Atem anhalten, nur, um meinen Worten zu lauschen.
»Ist das wichtig?«, murmelte ich nur, um nicht weiter darüber sprechen zu müssen. Es änderte schließlich nichts an dieser Situation. Die Vergangenheit war vergangen.
»Ein Mann?«, vermutete er, eine leise Frage.
»Nein«, antwortete ich lediglich und atmete tief durch, um meine Fassung zu bewahren. »Es ist … kompliziert.« Doch war es wirklich so kompliziert? Es gab einen anderen Mann, ja, aber er war nicht der Grund für meine Flucht. Es war komplexer, tiefer. »Ich will ein neues Leben. Ein Leben, das mir gehört«, murmelte ich vor mich hin und hoffte, dass er es dabei belassen würde.
Der Regen hatte etwas nachgelassen, sodass der Rhythmus des Scheibenwischers langsamer wurde. Nun konnte ich sogar das Radio hören, das leise ein liebliches Stück vor sich hin spielte, eine zarte Melodie, die mir den Mut gab, weiterzusprechen.
»Sobald die Sonne aufgeht«, begann ich nach einer Weile, »werde ich nach einer Arbeit suchen.« Mein Vorhaben in Worte zu fassen und laut auszusprechen, machte es irgendwie noch realer, noch greifbarer. »Ich kann arbeiten. Alles. Solange ich dafür einen Platz zum Schlafen und eine warme Mahlzeit bekomme. Mehr verlange ich nicht.«
»Alles?«, fragte er nach und warf mir einen musternden Blick zu, seine dunklen Augen huschten über mich. Als hätte er bereits eine Idee, eine mögliche Arbeit, die ihm vorschwebte. Seine Miene war undurchdringlich.
Konnte es wirklich so leicht sein? Hatte ich wirklich bei meinem erstbesten Versuch gleich eine Arbeit gefunden? Einfach so? Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ein kribbelndes Gefühl der Hoffnung durchfuhr mich. Doch ich versuchte, mir meine Freude nicht anmerken zu lassen, solange er keine konkrete Aussage machte. Ich wollte mich nicht zu früh freuen.
»Alles«, bestätigte ich nur, die Stimme fest, um ihn zu überzeugen. Noch wusste ich nicht, was er für mich vorgesehen hatte, doch ich meinte es ernst. Ich wollte diesen Neuanfang und ich war bereit, wirklich alles dafür zu tun, was nötig war.
»Dann habe ich etwas für dich«, sagte er leise. Der dunkle Klang seiner Stimme war dabei verlockend und sinnlich, schon fast verführerisch. Ein Versprechen, das förmlich in der Luft lag.
»Für Miete und Verpflegung?« Meine Stimme zitterte leicht vor Nervosität.
»Miete und Verpflegung«, war seine knappe Antwort. Eine Bestätigung, die wie Musik in meinen Ohren klang. »Ich habe ein Sofa, das du benutzen kannst. Lass uns später darüber reden.«
»Danke«, entgegnete ich und meinte es auch so. Trotz meiner Zweifel und Unsicherheiten, der Ungewissheit, die noch vor mir lag, freute ich mich auf das, was vor mir lag.
Irgendwie.
Auf eine seltsame Art und Weise.
»Ich mag dein Gesicht.«
Erst im nächsten Augenblick wurde mir bewusst, dass ich meine Gedanken – wenn auch nur leise – tatsächlich ausgesprochen hatte. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Schnell wandte ich meinen Blick ab und sah aus dem Beifahrerfenster, in der albernen Hoffnung, dass er mich nicht gehört hatte.
»Nur mein Gesicht?«, fragte er jedoch, wobei sein Blick kurz zu mir flackerte, ein amüsierter Ausdruck in seinen Augen.
Als mir klar wurde, dass er mich tatsächlich gehört hatte, wollte ich am liebsten im Boden versinken. Meine Wangen mussten inzwischen eine tiefrote Farbe angenommen haben. Ich war mir nicht sicher, ob er amüsiert war oder die Frage vollkommen ernst meinte, doch ich wagte es nicht, seinen Blick zu erwidern und starrte stattdessen weiter schweigend aus dem Fenster.
Der Regen war inzwischen in ein sanftes Nieseln übergegangen und der Himmel hellte sich allmählich auf. Zartes Mondlicht erleuchtete kleine Teile der Landschaft, malte Silhouetten auf die Berge und die steinige Erde.
»Ich deins auch«, murmelte er kaum hörbar. So leise, dass ich mich fragte, ob ich mir die Worte vielleicht nur eingebildet hatte, ein Wunschtraum in der nächtlichen Dunkelheit.
Kurz huschte mein Blick zu ihm, doch er sah auf die Straße vor sich und fuhr unbeirrt weiter. Nichts deutete auf die leisen Worte hin, die ich eben gehört hatte, kein Lächeln, keine Geste.
Wunschdenken, nichts weiter.
Ein kleiner Stich der Enttäuschung durchfuhr mich. Warum sollte er mich auch hübsch finden? Ich war keine Schönheit, ich war erschöpft und durchnässt, er hingegen das Inbild eines Mannes.
Eines unfassbar schönen Mannes.
Ich schluckte schwer und versuchte, auf andere Gedanken zu kommen, meine Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu lenken. Überlegte, welche Arbeit er wohl für mich hatte und wie mein Leben ab Morgen aussehen würde.
»Also, bleibst du bei mir?«, fragte er plötzlich in den Sturm meiner Gedanken hinein.
Ich sah der aufklarenden Wolkendecke entgegen, den sanften Regentropfen, die im fahlen Mondlicht glitzerten und noch immer auf das schwarze Gestein um uns herum fielen. Den kleinen Moospflänzchen, die sich in Farbtönen von Dunkelgrün bis zartem Hellgrau davon abhoben.
Obwohl in meinem Kopf ein einziges Chaos herrschte und ich mich innerlich schon längst entschieden hatte, konnte ich meinen Worten selbst kaum glauben. Es war ein Sprung ins Ungewisse, aber es fühlte sich richtig an.
»Ja, ich bleibe bei dir.«
-2-
"He vanished through the open door,
My body soaked right to the core.
The past was shut, and firmly sealed,
A path unknown, now lay revealed."
Wir fuhren noch eine ganze Weile auf der holprigen Straße, immer weiter hinaus in die Fjorde. Ich kämpfte gegen die bleierne Müdigkeit, die mich trotz des endlosen Rüttelns und Schüttelns nicht losließ.
Es war erstaunlich, wie dunkel die Nächte in diesem Niemandsland waren. Eine Schwärze, die das Licht regelrecht verschluckte. Selbst das spärliche Mondlicht, das nun zaghaft durch die Wolken brach, konnte nichts daran ändern. Es war nur ein matter Schimmer, der die Konturen der Berge unwesentlich erhellte.
Wir bogen mehrmals ab und überquerten schließlich eine schmale Brücke, gerade breit genug für den Jeep. Danach kämpfte er sich durch den matschigen Untergrund, und ich spürte, wie sich die Räder immer tiefer in den zähen Schlamm gruben. Der Mann hinter dem Steuer ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und fuhr unbeirrt weiter, seine Hände fest am Lenkrad. Seine Gelassenheit war beeindruckend und zugleich beängstigend.
Als wir schließlich auf einen Weg abbogen, der nur noch wenig mit einer Straße gemein hatte – eher einem ausgewaschenen Pfad aus losem Geröll und tiefen Furchen –, verkrampfte sich mein Magen zu einem schmerzhaften Knoten. Ein kalter Klumpen der Angst bildete sich in meiner Brust. Was, wenn dieser Mann mich in die Irre führte? Was, wenn ich ihm blind vertraute und einen Fehler machte?
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo wir uns befanden, geschweige denn in welche Richtung wir uns bewegten. Ich war seinem Willen vollständig ausgeliefert.
Erst im Licht der Scheinwerfer, das sich wie ein gleißender Fächer vor uns ausbreitete, ließ sich die kleine Hütte ausmachen, die einsam und verlassen am Fuß eines Fjords lag. Ein Anblick, der mir einen Schauer über den Rücken jagte, der nichts mit der Kälte zu tun hatte.
Der Mann, dessen Namen ich noch immer nicht kannte, parkte den Jeep direkt vor der Hütte, die Motorhaube in Richtung Eingangstür. Mittlerweile nieselte es nur noch leicht. Die kleinen Tropfen tanzten in den Scheinwerfern.
Wir hatten unser Ziel erreicht. Viel zu früh, wie mir schien, und doch war ich froh, endlich angekommen zu sein. Die Anspannung ließ langsam von mir ab.
Im Gegensatz zu mir zögerte der fremde Mann keine Sekunde. Kaum war das Fahrzeug geparkt, öffnete er die Fahrertür mit einer leisen Bewegung und stieg aus. Ein Schwall kalter, feuchter Luft ließ mich erneut frösteln, sodass ich meine durchnässte Jacke noch enger um mich zog. Die wohlige Wärme des Jeeps schwand augenblicklich. Der Kofferraum wurde mit einem dumpfen Geräusch geöffnet und dann mit einem trockenen Klack zugeschlagen, noch bevor ich mich nach dem Türöffner umsehen konnte. In der Stille, die daraufhin entstand, hörte ich meinen eigenen, hastigen Herzschlag – gefolgt von knirschenden Schritten auf losem Schotter, die sich vom Jeep entfernten.
Der Mann ging zur Haustür hinüber, ein kleines Bündel über der Schulter. Nur schemenhaft ließ er sich in dieser Dunkelheit ausmachen. Ein dunkler Umriss vor der noch dunkleren Kulisse.
Ich biss mir auf die Unterlippe und spürte den leichten Schmerz, während ich versuchte, meine angespannten Nerven zu beruhigen.
Und scheiterte maßlos.
Doch ich wollte es.
Ich hatte mich für diesen Schritt entschieden.
Ich wollte einen Neuanfang. Ein neues Leben. Ein Leben, das mir gehörte.
Jetzt war es zu spät für Gewissensbisse, zu spät für einen Rückzieher. Das wusste ich. Und doch nagten die Zweifel an mir.
Als ich schließlich aus dem Jeep stieg, fühlten sich meine Glieder schwer wie Blei an. Jeder Muskel protestierte. Ich war bis auf die Knochen durchnässt, und nach der langen Autofahrt und der Wärme, traf mich die eisige Kälte so unvorbereitet, dass ich kaum einen Schritt gehen konnte. Meine Beine zitterten unter mir, doch ich zwang mich weiter, jeder Atemzug ein kleiner, schmerzhafter Stich in meiner Brust.
Nur Augenblicke, nachdem ich die Tür zugeschlagen hatte, verriegelte der Jeep mit einem leisen Klick und blinkenden, orangefarbenen Lichtern. Ich zuckte erschrocken zusammen und sah auf, konnte aber nur erkennen, wie der Mann die Haustür aufschloss. Er sah nicht einmal in meine Richtung, während der Schlüssel leise in seiner Hand klimperte.
Eilig lief ich zu ihm hinüber, meine Füße stolperten fast über das lose Geröll. Bei jedem Schritt knirschte der Schotter unter meinen Sohlen. Der feine Nieselregen bohrte sich wie eisige Nadeln in meine Haut. Tief holte ich Luft, doch ich konnte kaum atmen.
Der Mann verschwand im Inneren der Hütte. Ein leises Klicken ertönte, das Geräusch eines Lichtschalters. Im nächsten Moment leuchtete mir das warmweiße Licht mehrerer Glühbirnen entgegen, das sich wie ein rettender Schein in die Dunkelheit ergoss.
Am Eingang angekommen spähte ich vorsichtig hinein. Ein schmaler Flur empfing mich, dahinter öffnete sich ein Raum mit einem kleinen Tisch und einer schmalen Küchenzeile. Auf dem Herd stand ein zugedeckter Topf, dessen Inhalt ich nicht erkennen konnte. Ein schwacher, holziger Duft wehte zu mir.
Wenige Augenblicke genügten, und ich fühlte mich bereits wohl. Eine tiefe Erleichterung durchzog mich. Sauber und gemütlich. Ein Ort der Ruhe. Und geradezu einladend warm.
»Komm rein. Es ist kalt«, sagte der Mann, seine Stimme nun etwas näher, fordernder. Wartend stand er an der offenen Tür, bereit, sie hinter mir zu schließen und die draußen liegende Welt auszusperren.
Die Aussicht auf endgültige Wärme und Trockenheit trieb mich tatsächlich schneller ins Innere der kleinen Hütte. Ich schob mich an ihm vorbei und trat ein.
Der Flur führte mich in ein Esszimmer mit schmaler Küchenzeile und angrenzendem Wohnbereich. Alles war klein und zweckmäßig eingerichtet, ohne überflüssigen Schnickschnack, doch gleichzeitig auch behaglich und warm. Dekorationen oder Bilder gab es kaum, dafür jedoch eine Wolldecke, die über dem Sofa lag und eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlte.
Nachdem der Mann die Tür hinter mir geschlossen hatte, zog er seine Jacke aus und warf sie achtlos über die erstbeste Stuhllehne am Esstisch. Seine Schuhe streifte er am Flur ab und ließ sie dort auf einer Matte stehen.
Ich folgte seinem Beispiel, zog meine Schuhe aus und stellte sie neben seine. Dann stellte ich meinen Rucksack ab, schälte ich mich aus meiner tropfnassen Jacke und legte sie über den nächsten freien Stuhl. Zwei weitere blieben leer und waren bis zum Anschlag unter den Tisch geschoben, als warteten sie auf weitere Gäste.
Meine Socken hinterließen nasse Abdrücke auf dem Dielenboden. Alles, vom Pullover bis hin zu meiner Unterwäsche, war durchnässt und klebte unangenehm an meiner Haut.
Ich schlang meine Arme um mich und ignorierte die Kälte, die noch immer tief in meinen Knochen steckte. Trotz der langen Fahrt und der wohligen Wärme der Hütte.
Doch es hatte sich gelohnt. Ich war frei. Der Gedanke hallte in meinem Kopf wider, wie ein Mantra, das ich zu glauben versuchte und doch nicht völlig verstand.
Frei.
Ich ließ meinen Blick durch die Hütte schweifen und realisierte langsam, dass ich es tatsächlich war.
Frei.
Befreit von der Last auf meinen Schultern.
Befreit von mir selbst.
Doch wie ein übergroßes, hilfloses Baby wusste ich nichts mit mir anzufangen. Schließlich konnte ich die Vergangenheit nicht ungeschehen machen oder gar vergessen. Sie war ein Teil von mir. Ich konnte lediglich versuchen, nicht daran zu denken. Sie in eine Schublade sperren und den Schlüssel wegwerfen. Doch selbst das löste nicht alle Probleme.
»Das Sofa gehört dir«, sagte der Mann hinter mir. Ich fühlte seinen musternden, eindringlichen Blick auf mir und fragte mich, was er wohl sah. Mich, eine Frau, die vor ihrem Leben floh, mit eingefallen Wangen und Kleidung, die ihr zu groß war, oder eine, die dumm und naiv genug war, mitten in der Nacht vor sein Auto zu stolpern? Oder eine, die dringend Hilfe brauchte.
Er ließ sich jedenfalls nicht anmerken, ob er mit dem, was er sah, zufrieden war. Seine Miene blieb fest und undurchdringlich, doch für einen Wimpernschlag glaubte ich, etwas in seinen Augen zu sehen – einen flüchtigen Ausdruck von Besorgnis. Unausgesprochenen Fragen. Oder die Spiegelung meiner eigenen Angst.
Ich für meinen Teil wandte mich ab und betrachtete das Sofa genauer. Es war ein gemütlich aussehender, hellbrauner Zweisitzer mit dicken, gepolsterten Lehnen, die zum Verweilen einluden. Die Wolldecke lag noch unordentlich über einer Seite, als hätte jemand gerade erst darauf gesessen. Die Liegefläche war groß genug, dass ich darauf schlafen konnte und machte zudem einen behaglichen Eindruck. Ich hätte es durchaus schlechter treffen können. Viel schlechter. Und am liebsten hätte ich mich sofort in die dicken Kissen fallen lassen, doch so nass, wie ich war, hielt ich mich zurück.
»Das Badezimmer«, kommentierte der Mann mit Blick auf die geschlossene Tür im Rücken des Sofas. »Der Rest ist privat.« Er deutete grob in den Flur, der seitlich vom Sofa abging und in zwei angrenzenden Zimmern endete. Die Türen waren geschlossen. Vermutlich lag sein Schlafzimmer in einem von beidem.
Ich nickte.
Diese Hütte war etwas klein, aber besser, als ich erhofft hatte. Viel besser, wenn ich ehrlich war. Ein echter Glücksfall.
»Ich bin Jón«, sagte der Mann. Eine einfache Feststellung, keine Frage, kein Zwang, doch ich vermutete, dass es seine Art war, mich nach meinem Namen zu fragen – reichlich spät für meinen Geschmack, doch besser spät als nie. Ich konnte ihm keinen Vorwurf machen, denn ich hatte ihn auch nicht nach seinem gefragt.
»Ann«, antwortete ich nur.
Wie gerne wünschte ich mir einen längeren, kraftvolleren Namen, etwas mit mehr Gewicht, das zu meinem neuen Leben passen würde, doch es war einfach nur Ann. Kurz und unscheinbar.
Jón nickte, als Zeichen, dass er mich verstanden hatte. Und auch mir war nicht nach Sprechen zumute, die Worte steckten mir in der Kehle fest.
»Hast du andere Kleidung?«, fragte er in die entstandene Stille hinein, seine Stimme nun etwas sanfter, besorgter.
»Ja.« Ich deutete auf den kleinen Rucksack, den ich neben meiner Jacke abgestellt hatte und um den sich bereits eine beachtliche Wasserpfütze gebildet hatte. »Aber ich glaube nicht, dass etwas davon trocken geblieben ist. Es hat eine Weile gedauert.«
»Davon zu laufen?« Seine Frage war direkt.
»Mich finden zu lassen«, korrigierte ich ihn schlicht, meine Stimme fest. Die Wahrheit, auch wenn sie nur ein Teil davon war.
Wieder sah er mich mit diesem Ausdruck in den Augen an, den ich nicht benennen konnte. Nicht wirklich neugierig oder drängend, aber auch nicht teilnahmslos. Eine Mischung aus Verständnis und Beobachtung.
»Geh duschen. Ich suche dir etwas zum Anziehen und werfe deine Sachen in den Trockner.« Seine Anweisung war klar, keine Frage, kein Angebot und doch nicht unfreundlich.
»Danke«, sagte ich noch, während er mich mehr oder weniger stehen ließ und sich am Sofa vorbei in den hinteren Teil der Hütte begab.
Ich war froh über seine Hilfsbereitschaft, auch wenn er etwas grob und wortkarg wirkte.
Meinen durchnässten Rucksack ließ ich am Tisch zurück. Eine kleine Geste des Vertrauens. Ich hatte nichts zu verbergen und meinetwegen konnte er den kompletten Rucksack – so, wie er war – in den Trockner werfen. Es waren nur ein paar Pullover, eine weitere Jeans, Socken und Unterwäsche darin. Nichts von Wert. Kein Bargeld und erst recht kein Smartphone oder ähnlich Wertvolles.
Das Badezimmer war klein und schlicht, wie auch alles andere in dieser Hütte. Der Boden und ein großer Teil der Wände waren mit grauen Fliesen in Steinoptik bedeckt, nur über dem Waschbecken waren cremefarbene Kacheln angebracht worden, die einen kleinen Kontrast bildeten. Es gab ein kleines, beinahe quadratisches Fenster zum Lüften neben einer zweckmäßigen Toilette. Keine Badewanne, dafür jedoch besagte Dusche. Graue Handtücher stapelten sich ordentlich gefaltet in einem schmalen Regal zwischen Waschbecken und Duschwand.
Ich pellte mich mühsam aus meinen Klamotten und ignorierte dabei meine eiskalten Finger, die sich kaum noch bewegen ließen. Eilig schob ich die einzelnen Teile mit den Füßen zusammen und bildete einen unordentlichen Haufen auf dem Boden. Ich ging nicht davon aus, dass es Jón stören würde. Meinen Slip schob ich dennoch mit dem Fuß unter die Jeans, ein letzter Hauch von Privatsphäre, die in diesem Moment fast lächerlich wirkte.
Noch nie zuvor hatte ein fremder Mann meine Wäsche gewaschen. Ich wusste nicht, ob ich mich schämte. Unangenehm war es auf jeden Fall, doch ich konnte es nicht ändern.
Ich schob den Gedanken beiseite, beugte mich in die Dusche hinein, drehte das Wasser auf und wartete darauf, dass es warm wurde. Schon nach wenigen Augenblicken prasselten lauwarme Tropfen aus dem Duschkopf. Eilig stieg ich in die Duschwanne und stellte mich unter das laufende Wasser, blieb einfach nur dort stehen und ließ das warme, angenehme Nass an meinem Körper hinablaufen. Erleichtert atmete ich auf, als die Kälte, die mir inzwischen durch Mark und Bein gegangen war, durch ein wohlig warmes Gefühl abgelöst wurde. Jeder Muskel entspannte sich, die Anspannung der letzten Tage fiel von mir ab, und ich spürte, wie sich ein tiefer, längst vergessener Frieden in mir ausbreitete.
Doch sobald ich mich entspannte, spürte ich das altbekannte Stechen in meiner Brust. Ein vertrauter, scharfer Schmerz, der sich wie eine eisige Nadel, tiefer und tiefer in meine Lunge bohrte.
Ich wusste, dass ich es nicht ewig würde verstecken können, nicht vor Jón, nicht vor der Welt, nicht einmal vor mir selbst. Doch für den Moment wollte ich nicht weiter darüber nachdenken müssen. Wollte es ausblenden und die Wärme genießen, die mich umgab.
Als hätte ich es damit heraufbeschworen, verkrampfte sich meine Lunge schlagartig. Für einen quälenden Augenblick war alles blockiert. Dann zog sich alles in mir zusammen und ein erstickendes Würgen riss mir die Luft aus der Kehle. Zitternd hustete ich in meine Hände, wobei ich versuchte, das Geräusch so gut wie möglich zu dämpfen.
Der scharfe, metallische Geschmack von Blut erfüllte meinen Mund, bevor es, verdünnt mit dem warmen Wasser, meinen Arm herunterlief und von meinem Ellbogen tropfte.
Ich erstarrte.
Schluckte.
Atmete vorsichtig ein und aus.
Mein Herz raste, mein Verstand schrie nach Flucht, doch ich zwang mich zur Ruhe.
Dann riss ich mich zusammen und spülte das Blut in den Abfluss. Mechanisch und akribisch, um jeglichen Beweis für meine Krankheit verschwinden zu lassen.
Wenn sich doch nur alles so leicht fortspülen ließe. Nicht nur das Blut, sondern auch die Gewissheit, dass jeder Atemzug mich näher an das Ende brachte, das ich so verzweifelt zu kontrollieren versuchte.
-3-
"New life begun, old fears remain, A kiss, a choice, a whispered name. In shadows deep, doubts take their flight, A fragile hope in darkest night. "
Meine Hände zitterten noch immer, diesmal jedoch nicht vor Kälte, sondern vom Nachbeben meines Anfalls. Nur langsam beruhigte sich mein Körper und der vertraute, stechende Schmerz in meiner Brust, bis ich schließlich völlig erschöpft aus der immer kälter werdenden Dusche stieg.
Der Spiegel über dem Waschbecken war angelaufen, daher wischte ich mit der Hand darüber. Mein erschöpftes, nasses Ich blickte mir entgegen. Dunkle Haare, die in einem viel zu blassen Gesicht klebten. Müde, leere Augen. Es dauerte nur einen Moment, bis mein Spiegelbild erneut im dunstigen Nebel verschwand.
Ich sah mich nach einem Handtuch um, zog es vom Stapel und wickelte mich darin ein. Der Stoff war weich und angenehm. Einen Fön konnte ich nicht finden, daher nahm ich mir ein weiteres, etwas kleineres Handtuch vom Stapel und begann, meine Haare zu trocknen, ehe ich sie zu einem Turban drehte.
Eingewickelt in die beiden flauschig-weichen Handtücher trat ich vorsichtig aus dem Badezimmer und spähte in den Wohnbereich. Ich kam mir unerwartet nackt und entblößt vor, obwohl ich kaum Haut zeigte, nur die Umrisse meines Körpers waren zu erkennen.
Jón saß auf dem Sofa, die Fernbedienung in der Hand, seine Aufmerksamkeit dem flackernden Fernseher zugewandt.
»Fertig?«, fragte er, ohne mich länger als nötig anzusehen, seine Stimme ruhig und gefasst.
»Ja«, antwortete ich knapp.
»Hier, das sollte dir passen.« Er deutete auf einen Schlafanzug, den er ordentlich über die Lehne des Sofas geworfen hatte. Er gehörte definitiv ihm, daran hatte ich keine Zweifel, doch damit ließ sich arbeiten. Es war besser als nichts.
»Danke.«