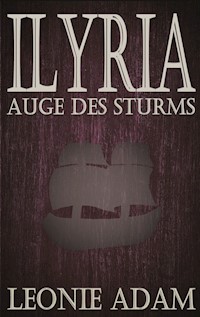
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ILYRIA
- Sprache: Deutsch
Freya Tolsson liebt das Abenteuer. In ein fremdes Königreich aufzubrechen, um ihren lange verschollenen Onkel zu suchen, scheint eine ganz wunderbare Idee zu sein. Doch sie ahnt nicht, dass dort dunklere Gefahren lauern, als sie sich ausmalen kann. Gefahren, die ganz Ilyria zerstören könnten... Band 2 der ILYRIA - Trilogie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bisher erschienen:
ILYRIA Schatten der Rache (ISBN: 9783740768669)
Foto: Kristin Adam
Über Leonie Adam:
Die junge Autorin veröffentlichte 2020 mit »ILYRIA Schatten der Rache« ihr erstes Buch als Auftakt einer Trilogie. Schon als Kind träumte sie von einer Zukunft als Schriftstellerin und plant, sich in verschiedenen Genres auszuprobieren. Derzeit arbeitet sie am großen Finale der Ilyria-Reihe und bereitet weitere Romanprojekte vor.
Für Mama
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1: Die Suche
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil 2: Der Schatten
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Teil 3: Der Feind
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
PROLOG
Der Vollmond war durch die dichte Wolkendecke kaum auszumachen. Die tiefschwarze Dunkelheit der Nacht lag wie ein Schatten über Ilyria und schien jeden Lichtschein zu verschlingen. Der vereinzelte Schrei eines Nachtvogels – dann war wieder alles still. Es war eine dieser Nächte, in denen man besser im Bett blieb und auf keinen Fall einen Fuß vor die Tür setzte. Und doch schlief der Magier nicht, sondern kauerte hinter einem dichten Gebüsch, gehüllt in einen schwarzen Umhang, um in der Dunkelheit möglichst unsichtbar zu bleiben. Seine Gelenke schmerzten. Sein Rücken forderte Bewegung. Entlastung. Aber er würde sein Versteck um keinen Preis aufgeben. Noch nie war er so nah dran gewesen. So nah dran! Es musste jeden Augenblick soweit sein.
So lange hatte er sich darauf vorbereitet. Er hatte alles, was er brauchte. Vor allem den Glauben daran, dass es funktionierte. Es blieb ein gewagtes Unterfangen. Das konnte er nicht leugnen. Es würde gefährlich werden. Oh ja. Es war möglich, dass er diese Nacht nicht überlebte, aber wer wollte denn den Teufel gleich an die Wand malen? Es bestand immerhin die Chance, dass sein Vorhaben von Erfolg gekrönt war. Das war Grund genug, es zu versuchen. Zudem war es seine Pflicht.
Er horchte auf. Er hörte die Brandung an der nahen Küste. Ein paar Grillen zirpten leise. Aber da war noch etwas. Schritte.
Vorsichtig griff er in die Tasche seines Umhangs und zog den Stein heraus. In der Dunkelheit sah er wie ein Kohleklumpen aus, dabei war er so viel mehr. Es war schwer gewesen, ihn zu beschaffen. Mondkristalle waren so selten. Aber sie bündelten Magie auf einzigartige Weise. Vor allem bei Vollmond. Er spürte den kalten Kristall in seiner Handfläche. Spürte die scharfen Kanten. Spürte die Kraft, die von ihm auszugehen schien. Es war beinahe, als würde der Stein atmen.
Die Schritte kamen näher. Eine Silhouette wurde sichtbar. Das musste der flammende Schatten sein. Es war Zeit, zu handeln.
Der Magier hielt den Kristall mit beiden Händen fest und schloss die Augen. Er spürte die Magie ganz deutlich. Es war leicht, sie in den Kristall zu leiten. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand zeichnete er die Runen auf den Stein, an denen er so lange gearbeitet hatte. Und es funktionierte. Er spürte, wie die Magie sich neu formte. Wie sie an Kraft gewann und sich auf die Reise begab. Wie sie sich einen Weg durch das Gebüsch bahnte und die Gestalt erreichte. Doch dann – nichts.
Irgendetwas stimmte nicht. Der Kristall hörte auf zu atmen, die kraftvolle Magie verlor sich in der kalten Nachtluft. Als wäre sie nie da gewesen.
Nein! Das war unmöglich! Er durfte nicht scheitern. Konnte nicht scheitern. Nicht schon wieder! Er hatte an alles gedacht. Hatte die Kräuter dabei, die seine Magie verschleierten. Hatte den Kristall, der seine Kraft bündelte. Hatte die Runen wieder und wieder geübt, bis er sie auswendig konnte.
Er versuchte es erneut, spürte aber bloß ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen. Als würde die Magie sich ermattet zu erheben versuchen, dann aber doch der Schwäche erliegen.
»Willst du dich weiter verstecken wie ein feiger Hund?«, erklang eine kalte Stimme. Bei allen vier Göttern. Ich habe versagt. Er atmete tief durch. Er war gescheitert. Die Magie war gescheitert. Bloß, wie? Weshalb?
»Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich!«, rief die Stimme weiter.
Er überlegte einen Augenblick lang. In einer direkten Konfrontation hätte er keine Chance. Es blieb nur die Flucht. Hier gab er ein zu leichtes Ziel ab. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der flammende Schatten ihn aufspüren würde. Doch noch konnte er entkommen.
Er griff nach einem Kräuterbündel aus einer Innentasche seines Umhangs und zerrieb die trockenen Zweige zwischen seinen Fingern. Dann blies er die Krümel in die Nachtluft und spürte zufrieden, wie sie weit von ihm forttrieben. Es würde genügen, um seinen Gegner einen Moment lang – vielleicht sogar eine kleine Weile – zu täuschen. Er erhob sich lautlos aus seiner lauernden Haltung, verkniff sich ein Stöhnen ob der schmerzenden Gelenke und lief, so schnell seine Beine ihn trugen, hinunter zum Strand. Der Sand schluckte den Klang seiner Schritte, doch er erschwerte das Rennen ebenso wirkungsvoll.
»Du kannst nicht vor mir davonrennen!«, hörte er die kalte Stimme hinter sich. Allerdings weit hinter sich.
Er wurde nicht langsamer. Vor ihm zeichneten sich die hohen Masten zahlreicher Schiffe gegen den Nachthimmel ab: Der Hafen. Hoffentlich waren dort keine unschuldigen Menschen mehr unterwegs. Seine Beine schmerzten vom Laufen, seine Lunge brannte von der kalten Luft. Aber er durfte nicht anhalten. Er spürte die ersten Holzplanken des langen Stegs unter seinen Füßen. Viele Möglichkeiten blieben ihm nicht. Eigentlich nur eine.
Der Hafen lag so spät in der Nacht wie verlassen da und wurde bloß vom Schein des Mondes beleuchtet, der es noch immer kaum durch die Wolken schaffte. So konnte er nur hoffen, dass das Schiff, das nun vor ihm in der Dunkelheit aufragte, seinen Wünschen entsprach. Mit einem einzigen, großen Satz sprang er an Bord. Keuchend vor Anstrengung stand er einen Augenblick da, dann schloss er die Augen und nahm all seine Kraft zusammen. Er spürte die wogende Energie des Meeres unter sich und streckte eine Hand aus, um der Magie den Weg zu weisen. Die Vertäuung des Schiffes löste sich mit einem Knarzen wie von selbst, die Meeresoberfläche wurde rauer und begann bereits, das Schiff vom Steg fortzutreiben. Schweißperlen liefen seine Schläfen hinunter. Doch das Meer gab ihm Kraft, stärkte seine Magie und trieb das Schiff immer weiter in die Dunkelheit hinaus.
»Lauf nur davon!«, schallte es vom Land zu ihm herüber. »Eines Tages finde ich dich! Ich weiß, wer du bist!«
Der Magier atmete tief durch. Der flammende Schatten würde ihm nicht folgen. Nicht heute Nacht.
»Das Vergnügen habe ich nicht«, sagte jemand.
Erschrocken fuhr der Magier herum und verlor die Kontrolle über seine Magie, die sich sofort in der salzigen Luft verflüchtigte.
Ein Mann stand vor ihm. Offenbar der Kapitän des Schiffes. Bei den Göttern! Hätte ich nicht ein verlassenes Schiff finden können? Der Kapitän trug eine Kerze in der einen Hand, deren Schein sein Gesicht nicht erreichte. In der anderen hielt er ein Schwert – die Klinge auf den nächtlichen Eindringling gerichtet.
»Ich bitte um Verzeihung«, sagte der Magier und hob beschwichtigend die Hände. »Ich wähnte das Schiff verlassen. Ich floh vor einem Feind. Es ging um mein Leben. Ich hatte nicht die Absicht…«
»Ihr habt mein Schiff gestohlen. Ohne einen einzigen Finger zu rühren.«
»Ich bin kein gewöhnlicher Mann«, erklärte der in der Tat nicht gewöhnliche Mann.
»Ihr seid Magier«, knurrte der Kapitän. Seine Stimme hatte etwas seltsam Vertrautes. Kenne ich ihn? Unwahrscheinlich. Ein fremder Mann in einer fremden Gegend.
»In der Tat. Das bin ich. Ich…«
Der Magier stockte mitten im Satz. Der Kapitän hatte die Kerze ein Stück angehoben und ihr Schein beleuchtete nun sein Gesicht. Sein ganz und gar nicht fremdes Gesicht.
Das kann nicht sein. Unmöglich! Aber er ist es. Der Bart ist länger, aber es ist derselbe Mann.
Offenbar deutete der Kapitän den erschrockenen Ausdruck auf dem Gesicht seines Gegenübers richtig, denn er sagte misstrauisch: »Ihr seht mich an, als wäre ich ein Geist. Sind wir einander schon einmal begegnet?« Er kam mit der Kerze ein Stück näher, ohne das Schwert zu senken. »Auch Euer Gesicht erscheint mir vertraut. Sagt: Wie heißt Ihr?«
Der Magier hustete, um seine Stimme nach dem Schreck wiederzuerlangen, und sagte dann langsam: »Coly Jones.«
Der Kapitän riss die Augen auf, ließ das Schwert sinken und stolperte zurück. In seinem Blick lag das blanke Entsetzen.
TEIL 1DIE SUCHE
Auf Zehenspitzen schlich sie die große Treppe hinunter. Es war vollkommen still im Haus. Ihre Eltern schliefen und selbst das Dienstmädchen war noch nicht auf den Beinen. Es war der perfekte Moment.
Die unteren Dielen knarzten, das wusste sie. Leichtfüßig und beinahe geräuschlos sprang Freya Tolsson die letzten drei Stufen hinunter. Sie lief hinüber in die Eingangshalle und streifte ihre Lederstiefel über. Dann öffnete sie so leise wie möglich die Tür und trat ins Freie. Dort atmete sie tief durch. Die Morgenluft war kühl, aber der Tag würde warm werden. Die Vögel in den Bäumen rund um das Herrenhaus der Tolssons waren schon seit einiger Zeit wach und zwitscherten fröhlich um die Wette, als wollten sie den neuen Tag gebührend begrüßen. Die morgendlichen Sonnenstrahlen wärmten Freyas Gesicht. Aber sie war nicht hier, um den Morgen zu genießen. Und wenn sie zurück sein wollte, bevor zum Frühstück gerufen wurde, durfte sie keine Zeit vergeuden.
Sie umrundete das Herrenhaus, bis sie einen kleinen, hölzernen Verschlag hinter den Stallungen erreichte. Mit den Fingern fuhr sie die Bretter der Rückwand entlang. Das sechste von links war lose. Sie zog es heraus und begutachtete nachdenklich, was dahinter zum Vorschein kam.
Was würde sie heute brauchen?
Sie entschied sich für ein kleines hölzernes Messer, das sie sich in den Schaft ihres Stiefels steckte und zog außerdem ein armlanges Holzschwert aus dem Versteck. Sie atmete tief durch. Ja. Dies war eindeutig ein Tag für das Schwert. Sie positionierte das lose Brett wieder an Ort und Stelle und machte sich mit einer pulsierenden Vorfreude auf den Weg.
Es war nicht weit bis zum kleinen Wäldchen. Bloß ein kurzer Fußmarsch den Hügel hinunter, der sie wach machte und ihre Sinne schärfte. Die frische Luft duftete nach Blumen und Bäumen, nach wilden Sträuchern und saftiger Erde. Freya liebte den Sommer mehr als jede andere Jahreszeit. Sie liebte die langen Tage, die wärmende Sonne, die Energie, die jeder spüren und niemand erklären konnte.
Sie trat in die ersten Schatten der mächtigen Bäume und hielt inne. Zu hören war nichts außer dem Zwitschern der Vögel und dem Rauschen der Blätter in der kühlen Brise. Sie schlich ein paar Schritte näher und drückte sich mit dem Rücken an einen der Stämme.
Sie sind schon hier.
Sie spürte es. Wusste es. Sie hatte mit ihrer Ankunft keinerlei Getier aufgeschreckt. Keine Kaninchen, keine Mäuse. Nicht einmal ein Eichhörnchen. Es befand sich bereits jemand im Wald, der dort nicht hingehörte. Freya grinste und hob ihr Schwert vor den Körper. Vorsichtig drückte sie sich um den Stamm herum und sondierte ihre Umgebung. Nichts zu sehen. Sie wartete noch einen Herzschlag lang, dann drückte sie sich ab und rannte hinüber zu einer großen Eiche. Noch immer regte sich nichts. Sie wiederholte das Spiel. Wieder und wieder. Arbeitete sich vorsichtig tiefer in das Wäldchen hinein. Sie konnte bereits den schmalen Bachlauf sehen, der sich zwischen den Bäumen hindurchschlängelte. Wieder drückte sie sich von einem Baumstamm ab. Sie war auf halbem Weg zum nächsten Baum, als sie hinter sich ein Rascheln hörte. Blitzschnell drehte sie sich um und riss ihr Schwert in die Höhe.
Gerade rechtzeitig.
Die Wucht, mit der die beiden Holzklingen aufeinandertrafen, erschütterte Freyas ganzen Körper, aber sie erholte sich schnell. Sie wich einem zweiten Hieb aus und traf die feindliche Klinge von links. Ihr Gegner taumelte ein paar Schritte zur Seite und Freya hatte einen Augenblick Zeit, um ihren Stand zu festigen und ihre Schwerthaltung zu korrigieren.
»Du hast dich also auch für ein Schwert entschieden?«, rief sie grinsend. »Blöd nur, dass du beide Hände dafür brauchst!« Mit diesen Worten machte sie einen Schritt nach vorn, traf die Klinge des Zweihandschwerts von rechts und tänzelte geschickt um ihren Gegner herum, der mit der großen Waffe tatsächlich etwas überfordert zu sein schien.
»Fühl dich nicht zu sicher«, knurrte Krys Bartley und holte weit aus. Freya sprang im letzten Moment rückwärts, verlor aber bei der Landung das Gleichgewicht und strauchelte. Krys nutzte die Gelegenheit und traf Freyas Schwert so, dass es ihr aus der Hand rutschte und zu Boden fiel. Triumphierend blickte er auf sie hinunter, wobei ihm einige Strähnen seines dunklen Haars in die Stirn fielen.
Freya überlegte nicht lange. Als Krys mit dem Schwert zum vernichtenden Schlag ausholte, rollte sie sich blitzschnell zur Seite, sprang auf, trat ihm seine Waffe aus der Hand und warf sich mit aller Kraft gegen ihn. Gemeinsam stürzten sie zu Boden. Freya zog grinsend das kleine hölzerne Messer aus ihrem Stiefel und stieß es direkt neben Krys‘Hals in den Waldboden.
»Du bist tot«, flüsterte sie.
»Zwei Waffen?«, stöhnte Krys geschlagen.
»Darauf sollte man stets vorbereitet sein.«
Bevor Freya ihren Sieg jedoch weiter auskosten konnte, spürte sie einen dumpfen Schmerz an ihrem rechten Oberschenkel und seufzte.
Natürlich.
Sie sprang auf und rannte zu ihrem Schwert. Dann blickte sie sich zu allen Seiten um. Es war noch nicht vorbei. Ein Blick auf ihr rechtes Hosenbein bestätigte ihre Vermutung. Ein kleiner weißer Fleck war dort zu sehen. Neben Krys auf dem Boden lagen der präparierte Pfeil und das Mehlsäckchen. Pfeil und Bogen waren Ollys Lieblingswaffe. Und er war verdammt gut darin, sie zu benutzen. Den zweiten Pfeil sah sie gerade noch rechtzeitig und duckte sich zur Seite. In einiger Entfernung erkannte sie eine Gestalt, die sich hinter einen Baumstamm flüchtete. Sie grinste. Jetzt wusste sie wenigstens, wo er war.
»Vergiss nicht, dass dein Bein verletzt ist!«, rief Krys ihr vom Waldboden aus zu, als sie erneut begann, von Baum zu Baum zu rennen, um ihrem zweiten Angreifer näher zu kommen. Freya seufzte, zog aber artig das rechte Bein etwas nach.
Vorsichtig arbeitete sie sich durch den Wald. Sie kam Olly näher, das spürte sie. Doch er hatte schon länger keinen Pfeil mehr auf sie abgeschossen. Warum zögerte er? Freya duckte sich hinter ein Gebüsch und kroch näher zu der Stelle, an der sie Olly vermutete.
»Keinen Schritt weiter!«, hörte sie plötzlich eine Stimme hinter sich. Sie seufzte resigniert und drehte sich um.
Da stand er. Olyver Bartley. Mit gespanntem Bogen und einem Mehlsäckchen-Pfeil auf sie gerichtet.
»Waffe fallen lassen«, forderte er gelassen.
Freya legte den Kopf schief. »Kann ich auf Gnade hoffen?«
»Nachdem du meinen Bruder ermordet hast?« Olly lächelte und schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall.«
Geschlagen ließ Freya ihre Waffe fallen und hob die Hände. Sie öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen, als Olly auch schon den Pfeil fliegen ließ und das Mehlsäckchen sie hart gegen die Rippen traf.
»Verdammt!«, rief sie und rieb sich die Stelle. »Das gibt einen saftigen Bluterguss. Wie soll ich den meiner Mutter erklären?«
»Du bist tot«, stellte Olly gelassen fest. Es raschelte hinter ihm und Krys trat hinzu. Jeder konnte erkennen, dass die beiden Brüder waren. Zwillingsbrüder sogar. Sie sahen einander ungemein ähnlich. Sie waren beide hochgewachsen, stattlich, hatten das gleiche dunkle Haar und die gleichen dunklen Augen. Nur wer genau hinsah, konnte die feinen Unterschiede erkennen.
»Vielen Dank, Brüderchen«, sagte Krys und klopfte Olly auf die Schulter. »Aber im Ernstfall wäre es hilfreich, wenn du den Gegner tötest, bevor ich draufgehe.«
Freya lachte, hob ihre Waffe auf und trat auf ihre beiden Freunde zu. »Du warst so schnell erledigt, da konnte er nicht mal einen Pfeil anlegen!« Sie flüchtete zur Seite, als Krys ihr einen Hieb in die Rippen versetzen wollte, und lachte nur noch mehr.
Gemeinsam machten sie sich auf den Rückweg zum Waldrand. Wäre es nach Freya gegangen, hätte sie noch den ganzen Tag mit den Bartley-Zwillingen im Wald verbringen können. Aber sie wurden alle drei zum Frühstück erwartet und Freyas Mutter konnte recht ungehalten werden, wenn sie sich verspätete. Ohnehin war es besser, wenn Myra Tolsson gar nicht erfuhr, dass ihre Tochter sich im Wald herumgetrieben hatte. Schon wieder.
Als Freya, Krys und Olly noch Kinder gewesen waren, hatten sie oft von früh bis spät im Wald gespielt, sich Stockschlachten geliefert und waren auf die höchsten Bäume geklettert. Aber sie waren kaum mehr Kinder. Während John Bartley seinen Zwillingssöhnen nun beibrachte, wie man sich rasierte und mit dem Schwert umging, wurden von Freya immer mehr weibliche Pflichten erwartet. Sie sollte lernen, wie man einen Haushalt führte, wie man Festessen ausrichtete, wie man sich gegenüber Höhergestellten oder Untergebenen verhielt und wie man sich korrekt ausdrückte. Die Götter wussten, dass Freyas Mutter Myra nicht unbedingt die beste Lehrerin in solchen Dingen war. Umso mehr störte es Freya, dass sie nicht mehr tun und lassen konnte, was sie wollte. Erwachsenwerden stellte sich zunehmend als nicht besonders spannend heraus. Als sie einmal nachgefragt hatte, ob sie denn auch lernen dürfte, mit dem Schwert zu kämpfen, hatte Myra ganz fürchterlich zu fluchen begonnen und erklärt, dass sich das für eine junge Lady so gar nicht ziemte. Seitdem trainierte Freya heimlich mit Krys und Olly und allmählich schlug sie wenigstens Krys fast jedes Mal.
Die drei erreichten lachend und plaudernd den Waldrand, verabschiedeten sich und schlugen den jeweiligen Heimweg ein. Die Bartley-Brüder liefen weiter den Hügel hinunter, wo die kleine Stadt Saorlyn lag, mit ihrer zierlichen Stadtmauer und den hübschen, mit Efeu bewachsenen Gebäuden. Freya wandte sich stattdessen nach links zum Herrenhaus ihrer Eltern, von wo aus die Lordschaft Tolsson verwaltet wurde. Der Abschied fiel nicht schwer, denn er würde nicht für lang sein. Am Nachmittag waren die Bartleys zum Essen eingeladen.
Gut gelaunt schlenderte Freya nach Hause, versteckte ihre Waffen im Verschlag und schlich dann zur Eingangstür. Das Herrenhaus der Tolssons war im Vergleich zu den Wohnsitzen der anderen Lords des Königreichs eher klein. Es war stattlich, keine Frage: Helle Steinmauern zwischen dunklem Fachwerk, zwei kleine Erker in der oberen Etage und ansehnliche Stallungen hinter dem Haus. Die Lordschaft selbst umfasste mit Saorlyn nur eine richtige Stadt und die umliegenden Dorfschaften. Viel war es nicht. Doch Freya liebte alles daran. Vor allem die Wälder, die zu den Ländereien gehörten.
Freya schlüpfte durch die Eingangstür in Innere und horchte einen Augenblick lang. In der Küche war bereits irgendjemand beschäftigt. Vielleicht eines der Mädchen aus dem Dorf, die Lydia hin und wieder im Haushalt halfen. Doch sonst schien noch alles still zu sein. Leise streifte Freya ihre Stiefel ab und wollte gerade die Treppe hinaufgehen, als ein tadelndes Räuspern sie innehalten ließ. Ertappt drehte Freya sich um. »Mutter! Ich dachte nicht, dass du…«
»Dass ich dich dabei erwischen würde, wie du dich schon wieder weiß-der-Teufel-wo herumgetrieben hast?« Myra Tolsson hatte die Hände vorwurfsvoll in die Hüften gestemmt.
»Ich war bloß spazieren«, log Freya und legte ein möglichst unschuldiges Lächeln auf, das Myra sofort durchschaute.
»Spazieren, ja? Hölle und Teufelsbrut! Na, wer sollte dir das denn glauben? Du siehst aus, als hättest du dich mit den Waldtrollen im Matsch gewälzt und eine verdammte Hose trägst du auch noch!«
»Wäre es dir lieber, wenn ich mich künftig mit Röcken im Matsch wälze?«
»Verflucht noch eins, Freya! Wie oft haben wir darüber gesprochen?«
Freya seufzte. »Oft genug, dass ich auf dieses Mal verzichten kann. Ich würde mich jetzt gerne umziehen. Du willst doch sicher nicht, dass ich in einer Hose beim Frühstück sitze.«
Myra schnaubte wütend. »Wenn ich es nicht besser wüsste – und bei den Göttern: ich weiß es besser – würde ich behaupten, Satan höchstselbst sei dein Vater!« Mit einer zornigen Handbewegung schickte sie Freya nach oben.
Ebenso zornig stapfte Freya die Treppenstufen nach oben in ihr Schlafzimmer. Sie ließ sich auf einen Sessel am Fenster sinken und schnaubte frustriert. So etwas passierte in letzter Zeit immer häufiger. Es war aber auch furchtbar ungerecht! Krys und Olly durften tun und lassen, was sie wollten. Und sie? Da hatte Myra ganz klare Vorstellungen. Sie musste Kleider tragen, höflich sein und am besten den ganzen Tag brav zuhause sitzen. Dabei war eine ganze Welt da draußen, die entdeckt werden wollte. Das Fernweh hatte sich schon seit einiger Zeit in Freyas Herz eingenistet und wollte einfach nicht verschwinden. Doch ihre Mutter konnte das weder verstehen noch akzeptieren. Es war zum Verzweifeln!
Freya drehte den Kopf und horchte. Sie hörte das dumpfe Klopfen, das das hölzerne Bein ihres Vaters bei jedem Schritt verursachte. Es kam näher. Freya rollte genervt mit den Augen. Jetzt würde sie die gleichen Vorwürfe noch einmal hören.
Finley Tolsson trat durch die Tür und sah seine Tochter mit einer Mischung aus Ärger und Belustigung an.
»Du warst wieder kämpfen?«, fragte er sie rundheraus.
Freya schüttelte den Kopf. Woher konnte er das wissen? »Ich war spazieren und bin ausgerutscht. Ich war einfach ungeschickt«, sagte sie mit einem möglichst geknickten Gesichtsausdruck.
Fin zog zweifelnd eine Augenbraue in die Höhe. »Du vergisst, wer hier vor dir steht, Freya. Du bist vieles, aber sicher nicht ungeschickt. Ich weiß schon lange, was du hinter den Ställen versteckst.«
Freyas Überraschung verwandelte sich blitzschnell in Panik. »Bitte!«, flehte sie. »Du darfst Mutter nichts davon sagen! Sie wird sie mir wegnehmen! Sie wird vollkommen durchdrehen, sie…«
Fin unterbrach sie mit einer Handbewegung und sagte: »Das weiß ich doch. Deshalb habe ich es ihr ja auch bisher nicht gesagt.«
»Bisher?«
Fin lächelte. »Natürlich erwarte ich ein gewisses Entgegenkommen für mein Schweigen.«
»Natürlich«, seufzte Freya. »Was verlangst du?«
Fin durchquerte den Raum und setzte sich auf Freyas Bettkante. Dann seufzte er ebenfalls und sah seine Tochter ernst an.
»Sei nachsichtig mit ihr«, sagte er schließlich. Das war wahrlich nicht, was Freya erwartet hatte. Sie sah Fin überrascht an und wartete auf weitere Erklärungen.
»Du weißt, es geht ihr nicht gut«, sagte er und schloss bekümmert die Augen. Freya senkte ebenfalls den Blick und schluckte. Es stimmte. Beinahe jede Nacht erwachte Freya zurzeit von dem leisen Schluchzen ihrer Mutter, die im Nebenraum von einem ihrer Alpträume gequält worden war. Es ging in jedem davon um ihre Brüder. Freyas Onkel.
Einer von ihnen – Petter Jones – war in der legendären Schlacht um die Erdburg einige Jahre vor Freyas Geburt gefallen. Freya hatte Geschichten von ihm gehört. Von seinen großen Ohren und seinem überdurchschnittlichen Hörvermögen. Von seiner Ehrlichkeit und seiner Loyalität. Freya wünschte sich oft, sie hätte ihn einmal kennen gelernt. Myra sprach viel von Petter. Manches Mal voller Freude, weil sie sich an wundervolle Erlebnisse erinnerte, manches Mal voller Trauer, wenn sein Verlust ihr wieder und wieder das Herz brach. Aber Petter war nun schon viele Jahre tot. Meistens war nicht er es, der Freyas Mutter den Schlaf raubte.
Es war der andere Bruder.
Coly Jones.
Freya wusste kaum etwas über ihn. Sie war ihm auch noch nie begegnet, obwohl er – soweit sie annahm – quicklebendig war. Er war ein Magier, so viel hatte sie aufgeschnappt. Er war einige Jahre jünger als Myra und hatte wohl viel Zeit mit zwei alten Frauen verbracht, die ihn die Magie gelehrt hatten. Was Freya niemand so recht erklären konnte – oder wollte – war, warum Coly sich so von seiner großen Schwester entfernt hatte. Freya hatte gehört, dass er im Königreich des Wassers lebte. Am anderen Ende Ilyrias. Als könnte er kaum genug Distanz zwischen sich und seine Schwester bringen.
Freya hatte selbst keine Geschwister. Aber Krys und Olly kamen dem schon sehr nahe. Sie konnte sich nicht vorstellen, einen von ihnen niemals wieder zu sehen.
Aber es war ja nicht so, als würde Coly nichts von sich hören lassen. Immer wieder brachten Boten oder fahrende Händler Briefe von weit her. Briefe an Myra Tolsson. In diesen Zeiten ging es Freyas Mutter besonders schlecht.
»Hat sie wieder einen Brief bekommen?«, fragte Freya vorsichtig.
»Er kam gestern«, sagte ihr Vater nickend.
»Verstehe«, murmelte Freya, obwohl sie es nicht wirklich verstand. »Was hat sie damit gemacht?«
Fin schüttelte den Kopf. »Erst gelesen, dann ins Feuer geworfen.« Bevor Freya weiter nachfragen konnte, ertönte mit einem Mal ein schrilles Klingeln von unten. Fin erhob sich. »Lydia läutet zum Frühstück. Wir sollten sie nicht warten lassen.«
Freya rührte sich nicht. »Warte! Wirst du es für dich behalten? Ich meine… du weißt schon…«
»Vorerst«, sagte Fin lächelnd. »Zieh dir dem Frieden zuliebe einen Rock an und dann komm.«
Die Stimmung beim Frühstück war gedrückt. Myra vermied es zwar, Freyas morgendlichen Ausflug zu erwähnen, doch man sah ihr an, dass das Verhalten ihrer Tochter sie ärgerte. Freya stocherte etwas lustlos in ihrem gebratenen Ei herum und Fin erzählte von finanziellen Engpässen benachbarter Lordschaften durch Streitereien über Landgrenzen. Freya hatte Mühe, die Augen offen zu halten.
Als das Dienstmädchen Lydia schließlich die Teller vom Tisch räumte, erhob sich Freya und flüchtete nach oben in ihr Schlafzimmer. Die Freude über den halben Sieg am Morgen war wie weggeblasen. Stattdessen ärgerte sie sich über sich selbst. Sie hätte neben den hölzernen Waffen wohl besser auch einen Rock hinter dem Verschlag versteckt. Dann hätte sie sich umziehen können, bevor Myra sie entdeckte. Aber es war nun einmal so, dass Freya Röcke und Kleider nicht besonders gut leiden konnte. Sie schlackerten umher, ständig stolperte man über den Saum und sie waren ganz einfach fürchterlich unpraktisch beim Kämpfen. Für dieses Argument war Freyas Mutter mit Sicherheit nicht allzu empfänglich.
Freya stellte sich seufzend vor den großen Spiegel neben ihrem Bett und betrachtete das junge Mädchen, das ihr von dort entgegenblickte. Ein flüchtiges Grinsen huschte über ihr Gesicht. Kein Wunder, dass Myra ihre Lüge bezüglich des Spaziergangs sofort durchschaut hatte: Als kleines Kind hatte sie die gleichen wilden Locken gehabt wie ihre Mutter. Doch je älter sie wurde, desto glatter fielen ihr die Haare über den Rücken – obgleich man von diesem Umstand im Moment kaum etwas erkennen konnte. Ihr rotes Haar, in einen langen Zopf geflochten, war zerzaust und schmutzig. Und ihre Kleidung konnte ebenfalls kaum darüber hinwegtäuschen. Sie hatte sich zum Frühstück zwar tatsächlich einen Rock angezogen, aber ihre Bluse war ebenso schmutzig wie ihr Haar. Freya schlug sich die Hand vor den Mund, um nicht laut zu lachen. Sie sah wirklich ganz und gar nicht wie eine junge Lady aus. Eher wie ein Bauernbalg.
Als es an der Tür klopfte, wandte Freya sich von ihrem Spiegelbild ab. »Ja?«, rief sie und beobachtete, wie Lydia den Raum betrat.
»Eure Mutter schickt mich, Mylady. Ich soll Euch zurechtmachen und zur Leseübung hinunterbringen.«
Freya schüttelte seufzend den Kopf. »Wenn ich doch nur eine Wahl hätte. Nun gut, Lydia. Macht Euch ans Werk.«
Und genau das tat Lydia. Die junge Frau mit den breiten Hüften und den kräftigen Armen führte Freya mehr fordernd als unterwürfig zu einem Stuhl und begann, den langen Zopf zu entwirren. Dabei grummelte sie mitunter leise vor sich hin, als wäre es für sie vollkommen undenkbar, schmutziges Haar zu haben. Freya ignorierte das und säuberte unauffällig ihre Fingernägel.
Warum sie sich zur Leseübung so herausputzen musste, war ihr ein Rätsel. Ebenso der Umstand, dass sie überhaupt an der daran teilnehmen musste. Freya las und schrieb seit vielen Jahren flüssig und fehlerfrei. Eines der vielen Privilegien, wenn man als Tochter eines Lords aufwuchs. Myra Tolsson hingegen war als Tochter eines Holzfällers großgeworden. Eines Trunkenbolds. Sie hatte erst gemeinsam mit ihrer Tochter Lesen und Schreiben gelernt, tat sich damit aber noch immer schwer. Freya wurde den Verdacht nicht los, dass es Myra mit der Übung viel eher um die eigenen Fähigkeiten ging als um die ihrer Tochter.
Nun – im Grunde war es egal, denn Freya musste so oder so erscheinen. Und offenbar war ihr Äußeres dafür enorm wichtig. Lydia war inzwischen geübt darin, Freyas Haar zu bändigen, und so steckte es nur wenig später in einem ordentlichen Knoten. Sie bemerkte beiläufig, aber mit Nachdruck, dass eine frische Bluse wohl kaum schaden könne, und so kam Freya bald sauber und adrett – mit einer blütenweißen Bluse – ins Kaminzimmer und ließ sich in einem der gewaltigen Sessel nieder. Myra saß bereits dort und blätterte mit gerunzelter Stirn in einem Buch über die Schlacht um die Erdburg.
»Warum liest du darin, Mutter?«, fragte Freya belustigt. »Du weißt doch, was geschehen ist. Du warst dabei!«
Es stimmte. Freyas Eltern waren beide maßgeblich an der legendären Schlacht beteiligt gewesen. Fin hatte sein Bein und beinahe auch sein Leben dabei verloren. Myra hatte die Königin der Erdburg begleitet und beschützt.
Myra lächelte. »Ich weiß verdammt genau, was damals geschehen ist.« Sie schlug das Buch zu und schüttelte den Kopf. »Und in diesem Buch steht ein verfluchter Haufen Blödsinn. Sie stellen alles vollkommen verkehrt dar. Teufel aber auch.«
Freya lächelte und stellte erleichtert fest, dass ihre Mutter wohl nicht mehr wütend war. Myra erhob sich und trat an den gewaltigen Bücherschrank, der im Kaminzimmer stand. Sie wählte ein Buch aus und reichte es Freya. »Lies mir daraus vor.«
Es war ein Friedensangebot, das war Freya klar. Sie nahm das Buch entgegen und schlug den ledernen Einband auf. Es war eine Sammlung von fantastischen Geschichten über eine junge Heldin, die verschiedenste Monster und Zauberwesen bekämpfte. Fin hatte Freya diese Geschichten immer vorgelesen, als sie klein gewesen war, und sie hatte nicht genug davon bekommen können. Freya räusperte sich und begann zu lesen.
Der weitere Vormittag verstrich weitestgehend ereignislos. Freya verschwand irgendwann in die Ställe und half dem alten Stallburschen Harris dabei, die Pferde zu versorgen. Sie mochte Harris. Er war ein zäher, alter Bursche, der mit Pferden besser auskam als mit Menschen. Einzig Freya empfing er gern in seinen Ställen, wie er zu sagen pflegte. Meist kümmerte Freya sich um ihr eigenes Pferd Lord, während Harris die benachbarten Boxen ausmistete und ihr Geschichten von Abenteuern erzählte, die alle ausgedacht waren, obwohl Harris fest darauf bestand, sie tatsächlich erlebt zu haben. An diesem Vormittag berichtete er ihr von einem gewaltigen Bären, den er im unendlichen Wald besiegt haben wollte. Freya grinste in sich hinein, wusste sie doch, dass Harris viel zu viel Angst vor dem unendlichen Wald hatte, um auch nur einen einzigen Fuß hineinzusetzen. Sie lauschte trotzdem gespannt und horchte erst auf, als sie vom Haus her laute Stimmen hörte.
Harris wandte den Kopf zum Stalleingang und seufzte. »Die Bartleys sind wohl da. Ich werde mich um die Pferde kümmern müssen und du, kleine Lady, wirst sicher von deinen Freunden erwartet.«
Freya klopfte sich verirrte Strohhalme vom Körper und nickte. »Kommst du auch sicher allein zurecht?«, fragte sie. Harris schnaufte belustigt und machte eine ungenaue Handbewegung.
»Nun verschwinde schon. Deine Eltern werden dich sicher nicht gern im Stall auffinden.«
Das ließ Freya sich nicht zweimal sagen. Sie schlüpfte durch die große Stalltür, zupfte sich im Gehen letzte Strohhalme vom Rock und erreichte kurz darauf die Vorderseite des Herrenhauses, wo tatsächlich die Bartleys angekommen waren. Elys und John wurden bereits stürmisch von Myra begrüßt, während Krys und Olly gerade erst aus ihren Sätteln stiegen. Freya beschleunigte ihre Schritte und blieb neben den Gästen stehen.
»Freya!«, rief Elys fröhlich. »Wie schön dich zu sehen. Du wirst wirklich jeden Tag hübscher!« Freya grinste etwas verlegen und umarmte Elys. Sie nickte John Bartley zu, der ironisch salutierte und begrüßte dann die Zwillinge.
»Na? Habt ihr euch gut erholt?«
»Wovon denn erholt?«, fragte Elys mit einem Stirnrunzeln.
Freya tauschte einen vielsagenden Blick mit Krys und sagte dann ganz unschuldig: »Von dem Ritt hierher natürlich. Für zwei so stinkfaule Kerle muss es doch verdammt großartig sein, sich von einem Pferd tragen zu lassen.«
»Ey!« Krys boxte ihr freundschaftlich gegen die Rippen. Sehr zielsicher. Er erwischte genau den Punkt, an dem Ollys Pfeil Freya am Morgen getroffen hatte, was sie vor Schmerz nach Luft schnappen ließ.
»Krys!«, sagte sein Vater grimmig. »So behandelt man doch keine junge Lady.«
»Wenn ich mal einer begegne, werde ich dran denken«, sagte Krys schulterzuckend und fing sich sofort den verdienten Faustschlag von Freya ein. Myra und John Bartley lachten.
»Da siehst du es, Freya«, sagte Myra zufrieden. »Das kommt davon, wenn man unbedingt ein verfluchter Wildfang sein will.«
Freya legte den Kopf schief. »Du dagegen sprichst stets wie eine echte Lady, Mutter.« Dieses Mal lachten alle.
Es versprach ein fröhliches Mittagessen zu werden. Es gab Wildbraten mit Gemüse und einer herrlichen Soße. Alle unterhielten sich gut und amüsierten sich prächtig über den Umstand, dass Olly Freya mitten im Gespräch irritiert einen Strohhalm aus den Haaren entfernte. Myra bedachte das mit einem missbilligenden Zucken ihrer Augenbrauen, sagte aber nichts.
Niemand erwartete, dass die Stimmung dramatisch kippen würde. Natürlich nicht. Nicht einmal Freyas Mutter, die sich mit dem Besuch ihrer Freunde ganz wunderbar von den Sorgen um ihren verlorenen Bruder abzulenken schien. Es begann auch ganz harmlos.
»Weißt du, Fin«, sagte Bartley mit grimmiger Miene, was allerdings nichts zu bedeuten hatte, weil er eigentlich immer so aussah. »Wir sollten zum Ratstreffen bereits im Morgengrauen losreiten. Die Mittagssonne wird immer kräftiger und ich schätze es nicht, wenn sie mir den Nacken versengt.«
Fin nickte zustimmend. »Eine gute Idee. Wir haben Glück, dass der Rat sich dieses Mal auf der Erdseite trifft. So sind wir schnell dort und noch schneller wieder zurück.« Er griff nach Myras Hand und zwinkerte ihr liebevoll zu.
»Schon wieder ein Ratstreffen?«, fragte Elys verwundert. »Ihr seid erst vor kurzem bei einem gewesen. Ist etwas passiert?«
Bartley zuckte mit den Schultern. »Offenbar gibt es ein dringendes Anliegen. Mehr wissen wir auch nicht.« Er schob sich eine Gabel voll Gemüse in den Mund, kaute genüsslich und fuhr dann fort. »Ich habe mir im Übrigen überlegt, dass es an der Zeit ist, meine Söhne einmal mitzunehmen.«
Überrascht sahen die Zwillinge von ihrem Essen auf. »Wir sollen zu einem Ratstreffen mitkommen?«, fragte Olly ungläubig.
Bartley nickte. »Es ist an der Zeit. Eines Tages könntet ihr selbst einen Sitz im Ilyrischen Rat besetzen und es kann nicht schaden, schon einmal einflussreiche Bekanntschaften zu schließen.«
Freya warf einen Blick zu ihrem Vater. »Darf ich auch mitkommen?«, fragte sie begierig. Fin öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Myra war schneller.
»Auf gar keinen Fall!« Die Heftigkeit ihrer Worte ließ alle erstarren. Fin legte ihr behutsam eine Hand auf die Schulter, aber sie schob sie weg. »Das kommt nicht infrage. Du begleitest mich stattdessen zu einem Besuch auf der Erdburg.«
Freya ließ erschüttert ihre Gabel sinken. Kurz hatte sie Hoffnung gehabt, endlich einmal etwas wirklich Spannendes zu erleben. Kurz hatte sie sich einen wundervollen Tag mit Krys und Olly ausgemalt. Ganz kurz. »Ist das dein Ernst, Mutter?«, fragte Freya bemüht ruhig. »Was soll ich denn dort?«
»Was sollst du denn bei einem Ratstreffen?«, konterte Myra mit schief gelegtem Kopf.
»Vielleicht besetze ich ja auch eines Tages einen Sitz im Ilyrischen Rat. Wer weiß? Lass mich bitte mitreiten!«
Elys räusperte sich vorsichtig. »Es wäre für Freya sicher spannend zu sehen, was ihr Vater im Ilyrischen Rat…«
»Beim Teufel und seiner alten Mutter!«, fiel Myra ihr ins Wort. »Ich werde darüber nicht diskutieren. Die Königin rechnet fest mit deiner Anwesenheit, Freya. Du wirst sie nicht enttäuschen. Pettra freut sich schon auf deinen Besuch.«
Freya schnaubte. Pettra Victoria Lengston war die perfekte, wunderschöne und wohl erzogene Thronfolgerin der Erdburg. Ihre Mutter, Königin Alissa, war mit Myra befreundet und irgendwie waren die beiden Frauen dem Irrtum erlegen, aus ihren Töchtern ebenso gute Freundinnen machen zu können. Doch Pettra und Freya hatten nicht besonders viel füreinander übrig. So war sich Freya sicher, dass die Königstochter sehr wohl auf ihren Besuch verzichten konnte.
Doch sie sagte nichts. Blickte in stummer Wut ihren halbleeren Teller an. Konnte ihre Gedanken nicht im Zaum halten. Warum tat Myra alles – aber auch wirklich alles –, um ihrer Tochter jeglichen Spaß zu versagen? Jedes Abenteuer, jede spannende Erfahrung wurde im Keim erstickt. Als würde Freya von unsichtbaren Fesseln davon abgehalten, etwas zu erleben.
Am Tisch war eine unangenehme Stille eingekehrt. Freya wagte nicht, irgendjemanden anzusehen. Sie würde Mitleid in ihren Blicken finden und das konnte sie in diesem Augenblick nicht ertragen. Sie wusste, dass sie sich wie ein bockiges Kind verhielt, aber sie fühlte sich so gedemütigt. Herabgewürdigt. Und das machte sie wütend. Zu wütend, um noch einen weiteren Bissen zu sich zu nehmen. Stattdessen schob sie langsam ihren Stuhl zurück, erhob sich und machte Anstalten, den Raum zu verlassen.
»Wo willst du hin, Freya? Setz dich wieder«, forderte Myra mit bebender Stimme.
»Fahr zur Hölle«, zischte Freya leise und beschleunigte ihre Schritte, bis sie die Treppe erreicht hatte. Sie hastete hinauf und blieb erst stehen, als sie eine Tür fand, die sie hinter sich zuschlagen konnte. Dann blieb sie stehen und schloss die Augen. Ihre Reaktion war ihr jetzt schon peinlich. Ihre Wut hatte wieder einmal gewonnen. Das war in letzter Zeit recht häufig der Fall. Aber jetzt war es nun einmal passiert. Sie konnte schlecht einfach wieder hinuntergehen und die Blicke ertragen, die man ihr zuwerfen würde. Freya stampfte fest mit dem Fuß auf den Boden auf und trat dabei auf den Saum ihres Rockes. Das machte die Sache nun wahrlich nicht besser. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und atmete tief durch.
Erst als sie sich allmählich beruhigte, fiel ihr auf, wo sie sich befand. Statt in ihr eigenes Schlafzimmer war sie in das Arbeitszimmer ihres Vaters geflüchtet. Sie kam nicht oft hier hinein. Aber jetzt erschien der Raum ihr genau richtig. Sie trat auf eines der großen, geöffneten Fenster zu, deren Vorhänge in der leichten Brise flatterten. Sie hatte eigentlich nur etwas frische Luft schnappen und ihr Gemüt beruhigen wollen, aber sie blieb auf halbem Weg vor dem gewaltigen Schreibtisch ihres Vaters stehen. Etwas darauf hatte ihren Blick auf sich gezogen.
Etwas halb Verkohltes.
Etwas aus gelblichem Papier.
Etwas, auf dem in einer sauberen Handschrift der Name Myra Tolsson geschrieben stand.
Das musste der Brief sein, von dem ihr Fin erzählt hatte! Fin hatte ihn aus irgendeinem Grund aus dem Flammen gerettet und hierhergebracht. Ob er alle Briefe von Coly aufbewahrte? Oder nur diesen einen? Er schien nach Freya zu rufen. Sie zu sich zu locken. Ein Brief von Coly Jones an seine Schwester. Ein Brief, der dafür sorgte, dass Freyas Mutter in der heutigen Nacht wieder einmal aus grausamen Alpträumen aufschrecken würde.
Freya trat näher und strich vorsichtig über das raue Papier. Fuhr mit den Fingern den Namen ihrer Mutter nach. Als hätte der Wind ihn durch das offene Fenster hineingetragen, flog ihr mit einem Mal ein Gedanke durch den Kopf. Aus dem Gedanken wurde sogleich eine aberwitzige Idee und schon einen Wimpernschlag später hatte Freya Tolsson einen waghalsigen Entschluss gefasst.
Es war ein Tag wie jeder andere. Jeder Tag war ein Tag wie jeder andere. Das steckte ja genau genommen schon in der Formulierung. Die Sonne ging auf, Menschen besprachen unwichtige Dinge und am Abend ging die Sonne wieder unter. Immer wieder. Auf, unter. Liam Ferrick Lengston konnte daran rein gar nichts Spannendes finden. Die Menschen machten einen riesigen Wirbel um Kleinigkeiten, die ihren eintönigen Leben etwas Bedeutung verleihen sollten, aber wofür? Als Bruder der Königin erwartete man von Liam, dass er sein Leben mochte. Nun – er konnte sich wohl wahrlich nicht beklagen. Er lebte auf der Erdburg in ansehnlichen Räumlichkeiten, hatte seine Bediensteten, bekam jeden Tag gute Mahlzeiten serviert und konnte abends guten Wein trinken. Aber besonders spannend war das nun wirklich nicht. Denn egal, ob man ein Bauer oder ein Prinz war – ein Tag war genau wie jeder andere. Es war einfach lästig.
Als Alissa ihn in den Ilyrischen Rat berufen hatte, war ihm klar gewesen, dass sie ihm damit etwas Gutes tun wollte. Er war ja nicht töricht. Seit Pettra geboren war, war er in der Thronfolge dramatisch in den Hintergrund gerückt, was ihm im Grunde nur recht gewesen war. König sein war sicher anstrengend. Er konnte es seinem Schwager ansehen. Jonah sah selten besonders entspannt aus. Aber Alissa schien zu glauben, dass Liam sich vernachlässigt fühlte. Und unwichtig. Und deshalb hatte sie ihn in den Ilyrischen Rat geschickt.
Es handelte sich dabei um eine überraschend sinnvolle Institution, die die vier Königreiche von Feuer, Wasser, Erde und Luft vereinte und somit eine Kontrollinstanz für ganz Ilyria darstellte. Der Rat war vor einigen Jahren – wie viele mochten vergangen sein? Zwanzig? Mehr? – entstanden. Als Folge der Schlacht um die Erdburg. Alle vier Königreiche hatten ihre Vertreter im Rat. Und alle hatten ein Stimmrecht, wenn es um wichtige Entscheidungen ging.
Obwohl – nein.
Das stimmte ja gar nicht. Obwohl es Liam nicht besonders interessierte, musste er sich doch korrigieren. Denn die Feuerseite hatte deutlich weniger Stimmrechte. Die Feuerseite war für die Schlacht um die Erdburg verantwortlich gewesen, hatte nach mehr Macht gestrebt und unzählige Tode zu verantworten gehabt.
Alles war irgendwie auf einen einzelnen Mann zurückzuführen gewesen, aber das hatte Liam nie so ganz verstanden und es hatte ihn auch wirklich nicht interessiert.
Fakt war aber, dass die Feuerseite in den Friedensverhandlungen nach dieser Schlacht eine Auszeit verordnet bekommen hatte. Eine Auszeit von fünfundzwanzig Jahren, in denen ihr Stimmrecht im Ilyrischen Rat verfiel und wichtige Reichsentscheidungen von Vertretern der anderen Königreiche getroffen wurden. Der Thron wurde zwar von einem der Kinder des ehemaligen Feuerkönigs sozusagen warmgehalten, doch war der Familie vorübergehend jegliche Macht genommen worden. Der Handel wurde strikt kontrolliert und es gab noch eine ganze Hand voll Auflagen, die erfüllt werden mussten, aber Liam wurde schon bei dem Gedanken daran ganz schläfrig. Die Feuerseite war in jedem Fall sozusagen auf Eis gelegt. Was für eine Metapher! Wäre Liam Lengston nicht ungewöhnlich schwer zu begeistern, hätte ihm dieses Wortspiel sicher mehr Freude bereitet. So aber brachte er gerade einmal ein verhaltenes Schmunzeln zustande.
»Eure Hoheit?«, hörte Liam eine Stimme hinter sich. Er drehte sich um und blickte den Stadtwächter an, der dort vor ihm stand. Fragend zog er eine Augenbraue in die Höhe.
»Was gibt es?«
»Eure Schwester verlangt nach eurer Anwesenheit beim Essen. Ich geleite Euch in den Speisesaal.«
Auch das noch. Liam stöhnte ungehalten, folgte dem Soldaten aber dennoch. Alissa bestand in letzter Zeit mehr als sonst darauf, dass Liam an solch unwichtigen Zeremonien wie dem gemeinsamen Einnehmen von Mahlzeiten teilnahm. Viel lieber würde er in aller Ruhe in seinen Gemächern speisen, aber er war nicht der König. Er tat also, was man von ihm wollte, und ansonsten tat er nach Möglichkeit relativ wenig. Wie gesagt: Es war ein Tag wie jeder andere.
Der Speisesaal der Erdburg war groß. Zu groß für so wenig Menschen. Aber das störte hier keinen. An der übermäßig langen Tafel saß bereits die königliche Familie. Jonah, Alissa und Pettra. Die Prinzessin war an diesem Tag in ein ekelerregend hübsches Kleid gesteckt worden und hatte die blonden Haare galant zurückgebunden.
»Onkel Liam!«, sagte sie fröhlich. »Es ist schön, dich zu sehen.«
Liam seufzte leise. »Es ist mir natürlich auch eine Freude, dich zu sehen«, gab er zurück.
Alissa runzelte die Stirn, als würde sie ihm seine Worte nicht so recht glauben, winkte ihn aber herbei und er nahm Platz. Das Essen wurde serviert und zunächst gelang es Liam, die Tischgespräche vollkommen auszublenden. Sie interessierten ihn nicht sonderlich. Als er mit einem Mal seinen Namen hörte, horchte er jedoch auf.
»Nicht wahr, Liam?«
»Verzeih mir, Schwester. Ich habe nicht zugehört«, sagte er ehrlich und trank einen Schluck aus seinem Kelch.
Alissa lächelte nachsichtig, wie sie es immer tat. »Ich sagte gerade, dass du dich sicher bereits auf die Ratssitzung vorbereitet hast.«
Liam runzelte die Stirn. »Vorbereitet? Warum sollte ich das getan haben?«
Jonah – so königlich, dass man kaum vermuten würde, dass er einmal ein einfacher Soldat gewesen war – lehnte sich vor und sah Liam ernst an.
»Weil es dieses Mal um mehr geht, als um Handelsverträge und Friedenssicherung.«
»Ist das so?« Liam kramte in seinem Kopf. Um was ging es bei dem Ratstreffen noch gleich? Man hatte es ihm sicher gesagt, aber es war nicht sehr spannend gewesen, deshalb hatte er nur mit einem Ohr zugehört. Es ging um verwüstete Dörfer im Königreich des Wassers, so viel wusste er. Aber was war daran so besonders?
Jonah schloss für einen Moment die Augen und betrachtete seinen Schwager eindringlich. »Liam, du vertrittst deine Schwester und damit das gesamte Königreich der Erde im Ilyrischen Rat.«
Liam zuckte mit den Schultern. »Da bin ich nicht der einzige. Es gibt doch eine Hand voll Lords dieses Königreichs, die genau die gleiche Funktion haben.«
»Das ist richtig«, sagte Jonah, sichtlich um Ruhe bemüht. »Aber du bist von königlichem Blut. Du repräsentierst diese Familie. Du musst über die Vorgänge in Ilyria Bescheid wissen!«
Alissa räusperte sich und sah Liam liebevoll an. »Ich weiß, dass du das kannst, Liam. Du tust stets so vollkommen unberührt, aber ich weiß, dass du dazu geboren wurdest, Entscheidungen für diese Familie zu fällen. Denk daran, was Vater gewollt hätte.«
»Vater ist schon länger tot, als ich ihn lebend gekannt habe«, sagte Liam.
Jonah seufzte. »Ich habe deinem Vater treu gedient und versuche, ein ebenso weiser und gütiger König zu sein. Du trägst seinen Namen. Du bist sein Sohn. Führe sein Erbe fort. Triff dich in den nächsten Tagen mit unseren Beratern und lass dich über die Vorgänge in Ilyria informieren. Ich befürchte, etwas Dunkles kommt auf uns alle zu.«
»Etwas Dunkles?«, fragte Liam skeptisch. »Ein paar verwüstete Dörfer auf der Wasserseite und du sprichst davon, dass etwas Dunkles auf uns zukommt?« In den letzten Tagen und Wochen waren häufiger als sonst Botschafter von der Wasserseite eingetroffen und hatten von zerstörten Dörfern berichtet. Bislang konnte niemand erklären, wer oder was diese Verwüstung angerichtet hatte. Liam vermutete, dass es sich um ein Rudel wilder Tiere oder eine Räuberbande handelte. Aber das alles geschah weit entfernt im Süden Ilyrias. Warum sollte er sich darum kümmern?
»Gestern traf ein Mann auf der Burg ein«, erklärte Jonah. »Ein Magier aus dem Königreich des Feuers. Er wünscht seitdem, mit dir zu sprechen. Hast du ihn empfangen?«
Liam schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich schätze, das werde ich nachholen müssen.«
Alissa nickte. »Danke, Liam. Empfang ihn noch heute. Er drängt darauf, mit dir zu sprechen. Es schien wirklich wichtig zu sein.« Das würde sich wohl nicht vermeiden lassen. Liam nickte und war dankbar, das Gespräch damit beendet zu wissen.
Nach dem Essen kehrte Liam in seine Gemächer zurück. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und dachte nach. Er würde diesen Magier empfangen müssen. Lästig. Liam hatte nicht viel für Magier übrig. Nun – er kannte nicht gerade besonders viele. Genau genommen hatte er nur zwei kennen gelernt. Einer davon war eine alte Frau auf der Luftseite gewesen, die ihn während der Schlacht um die Erdburg in ihrem stinkenden Häuschen versteckt hatte. Der andere war ein Mann in Liams Alter, obwohl er damals noch ein Junge gewesen war. Coly Jones. Ein nervtötender, kleiner Mensch, den Liam hoffentlich niemals wiedersehen würde. Seine bisherigen Erfahrungen mit Magiern waren jedenfalls kaum als sehr angenehm zu bezeichnen.
Liam seufzte. Er hatte ja doch keine Wahl. Er rief einen Dienstboten zu sich und ließ nach dem Mann schicken. Es dauerte nicht lange, da klopfte es auch schon an der Tür.
»Tretet ein!«, rief Liam und beobachtete, wie die Tür sich öffnete. Ein glatzköpfiger, älterer Mann betrat den Raum, gehüllt in einen rubinfarbenen Mantel, den er bis zum Kinn zugeknöpft hatte. Er deutete eine Verbeugung an und murmelte: »Eure Hoheit.«
Liam wartete, bis der Mann sich wieder vollends aufgerichtet hatte. »Ich hörte, Ihr wollt mich sprechen. So setzt Euch und sprecht.«
Der Mann durchquerte den Raum und nahm auf einem Holzstuhl Platz.
»Es ist mir eine Ehre, zu Euch sprechen zu dürfen, Eure Hoheit«, sagte er und verschränkte seine Hände auf dem Schoß. »Mein Name ist Ian Rox. Ich stamme von der Feuerseite Ilyrias und bin Träger einer uralten…«
»…Magie«, unterbrach ihn Liam. »Ihr seid ein Magier, Rox. So viel wurde mir bereits angekündigt. Wenn es Euch nichts ausmacht, so kommt direkt zum Grund Eures Besuchs.«
»Sicher, sicher.« Ian Rox nickte ehrfürchtig. »Vermutlich habt ihr von den Unruhen auf der Wasserseite gehört.«
Liam nickte. »Und ob. Eine Bande von Plünderern, wie ich vermute.«
»Keineswegs«, sagte Rox mit dunkler Stimme und machte ein bedeutsames Gesicht.
Liam runzelte die Stirn. »Was verwüstet dann die Dörfer?«
Ian Rox atmete tief durch und lehnte sich ein Stück vor.
»Nicht was. Wer. Ich glaube genau zu wissen, wer für die Zerstörung verantwortlich ist. Die Menschen sprechen vom Flammenden Schatten. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, will ich es Euch erklären.«
Liam wusste zwar nicht genau, wie es Ian Rox gelungen war – aber der Mann hatte in dem Prinzen der Erdburg tatsächlich so etwas wie ein Fünkchen Neugier geweckt.
»So sprecht«, forderte Liam.
Und Rox begann zu erzählen.
Jay verzog das Gesicht. Er hasste Fisch. Er hasste den Geruch, die glitschige Haut, die seelenlosen Augen und die unheimlichen Mäuler. Er mochte nicht einmal den Geschmack besonders. Das war bei den Göttern keine besonders praktische Eigenschaft, wenn man mit seinen Eltern in einem Dorf in der Nähe der Küste lebte und Fisch das Einzige war, was die Familie sich als Abendessen leisten konnte. Also lag auch heute wieder ein besonders graues und stinkendes Exemplar auf dem wackligen Holztisch.
Jay konnte es kaum erwarten, dass er älter und größer wurde. Er war erst acht – was konnte man mit acht schon erreichen? Aber wenn er erst einmal älter war, dann würde er dafür sorgen, dass seine Familie ein gutes Abendessen bekam. Ein Abendessen ohne Fisch. So viel war sicher.
Jay starrte den toten Fisch an. Der tote Fisch starrte zurück. Na gut. Er starrte natürlich nicht wirklich zurück. Immerhin war der Kerl – dem Geruch nach auch schon eine ganze Weile – mausetot. Aber es sah tatsächlich irgendwie so aus, als würden die dunklen Augen Jay ansehen.
Seine Mutter betrat die Hütte und Jay war froh, sich von dem stinkenden Fisch abwenden zu können. »Jay, komm mit!« Ihre Stimme klang merkwürdig. So sorgenvoll. Beinahe, als hätte sie Angst.
»Wohin denn?«, fragte Jay.
Doch anstatt ihm eine Antwort zu geben, durchquerte sie hektisch den Raum, griff seine Hand und zog ihn mit sich zur Tür hinaus.
Jay war verwirrt. Eben noch hatte er den toten Fisch angestarrt und jetzt befand er sich plötzlich mitten auf der Straße? Draußen war erstaunlich viel los. Normalerweise waren nach Einbruch der Dunkelheit kaum mehr Menschen in den Gassen unterwegs. Die Bewohner des Dorfes blieben sonst in ihren Hütten und Häusern und mieden die raue Nacht.
Irgendetwas war anders.
Alle hatten Angst.
Also hatte Jay auch Angst. Es ließ sich gar nicht vermeiden.
Männer mit Fackeln rannten umher und trieben die Menschen auf die Straßen. Aber sie waren keine Bedrohung. Jay kannte sie. Das dort war der Wirt aus dem Gasthaus. Und da der alte Jenkins. Und hinten bei der Weide – ja, das war sein Vater!
Auf einmal begann eine Frau zu schreien. Aus einem Schrei wurden viele und es wurde so laut, dass Jay sich die Ohren zugehalten hätte, würde seine Mutter nicht immer noch seine Hand umklammern.
»Ich will nach Hause!«, jammerte er, doch seine Stimme ging in der allgemeinen Panik unter.
Die Luft wurde kälter. Jay begann zu zittern. Weitere Angstschreie. Überall. Was geschah hier? Dann ging die erste Fackel aus. Jay sah es genau. Zunächst brannte die Fackel, doch im nächsten Moment – nicht einmal mehr Rauch. Dann verschwand die nächste Flamme. Und es wurde immer kälter. Es war, als würde sich ein schwerer, kalter Schatten über das Dorf legen und sie alle verschlingen wollen.
Jays Mutter zog ihn hinter einen hölzernen Karren und drückte ihn fest an sich. »Wir kommen nicht mehr fort«, murmelte sie. »Mögen die Götter uns beistehen.«
Jay wollte nicht fort. Jay wollte nur in sein Bett. Das hier war kein schöner Abend. Er wollte notfalls die ganze Nacht den toten Fisch anstarren, wenn bloß diese Schreie endlich aufhörten. Die Dunkelheit nahm zu. Nicht einmal der Mond schaffte es, bis zu ihnen durchzudringen. Jay riss die Augen weit auf, aber es war kaum mehr etwas zu erkennen. Einen Augenblick lang wurde es ruhiger. Es war fast sogar still.
»Mögen die Götter uns beistehen«, murmelte Jays Mutter immer noch vor sich hin. »Gott des Wassers, deine Ruhe, deine Kraft erbitte ich. Beschütze uns. Steh uns bei.«
Doch offensichtlich konnte der Gott des Wassers Jays Mutter nicht hören. Denn in diesem Augenblick ging alles in Flammen auf. Zunächst dachte Jay, er würde erblinden, so hell war das Licht. Alles brannte, als hätte es schon immer gebrannt. Jede Hütte, jeder Zaun, jedes Gebüsch, jeder Baum. Jays Mutter stieß ihn von sich, denn auch der Wagen, hinter dem sie Schutz gesucht hatten, bot nun sicher keinen mehr. Jay begann zu schreien. Das ganze Dorf begann zu schreien. Menschen rannten weiterhin umher. Manche standen in Flammen.
Jay sah sich um. Wo war seine Mutter? Gerade eben war sie noch da gewesen. Gerade eben hatte sie doch noch seine Hand gehalten! Er stolperte zurück auf die Straße, wurde von Leibern umhergestoßen und fiel beinahe zu Boden. Tränen liefen über sein Gesicht. Die vorherige Kälte war verschwunden. Nun war es zu heiß. Viel zu heiß. Der Rauch des brennenden Dorfes stach in seiner Lunge. Das Atmen fiel ihm zunehmend schwer.
Die Menschenmenge schien sich mit einem Mal zu teilen. Jay wurde ebenfalls beiseitegedrängt. Irgendetwas kam dort. Oder irgendjemand? Jay konnte durch den dichten Rauch nichts erkennen, außer einer schwarzen Silhouette. Rechts und links von der Gestalt fielen die Menschen zu Boden. Sie fielen einfach um, als wären sie Puppen, denen man die Strippen durchtrennt hatte. Was passierte denn bloß?
Die Gestalt kam näher. Jay konnte sich nicht rühren. Die Angst lähmte ihn. Wo war seine Mutter? Wo war sein Vater? Was war das für eine dunkle Gestalt, die dort immer näherkam? Diese Menschen starben. Jay spürte es. Wusste es. Anders konnte es nicht sein. Und er würde auch sterben. Er würde tot sein.
Genau wie der Fisch.
Der blöde stinkende Fisch.
Tatsächlich sah Jay die kalten, leeren Fischaugen vor sich, als die dunkle Gestalt ihn erreichte. Es war das letzte, an das er dachte.
Es war ein anstrengender Tag gewesen. Voller schöner Momente – das ließ sich nicht leugnen. Aber auch voller Streit. Voller Wut. Voller Worte, die entgleisten Emotionen entsprungen und gar nicht so hart gemeint gewesen waren. Fin seufzte und rieb sich die Augen. Er war eine Weile draußen gewesen. Hatte einen ausgedehnten Spaziergang in der zunehmenden Dunkelheit unternommen, doch inzwischen war es Nacht und sein Bein tat weh. Das war immer so, wenn er längere Fußmärsche unternahm. Früher war er oft tagelang zu Fuß unterwegs gewesen. Doch seit er vor vielen Jahren sein rechtes Bein verloren hatte, musste er im wahrsten Sinne des Wortes kürzertreten. Heute hatte er die Bewegung dennoch gebraucht. Die Ablenkung. Er hatte Zeit gebraucht, um seine Gedanken zu ordnen und nach einer Lösung zu suchen. Denn so ging es nicht weiter.
Er verstand sie beide. Myra und Freya. Und es brach ihm das Herz, die beiden wichtigsten Menschen seines Lebens so unglücklich zu sehen. Sie waren einander so ähnlich und doch so verschieden. Und das machte es so schwer.
Myras Kummer war von Angst geprägt. Der Verlust ihrer Brüder – im Grunde ihrer ganzen Familie – hatte sie verändert. Nun – sie war natürlich noch immer sie selbst. Noch immer die wilde, ehrliche, gutherzige und gerechte Frau, die Fin vor vielen Jahren mitten im unendlichen Wald kennen und einige Zeit später lieben gelernt hatte. Myra hatte ihm mehr gegeben, als er jemals zu träumen gewagt hatte. Ein Zuhause. Eine Familie. Ein Leben, auf das er stolz sein konnte. Sie hatte seinem Dasein einen Sinn gegeben und das war mehr Wert als alles andere auf der Welt. Sie hatte ihm über den Verlust seines Beins hinweggeholfen, ihn gesund gepflegt und nie wieder gehen lassen. Und er war so unendlich dankbar. Er wünschte bloß, er könnte sie ebenso glücklich machen.
Fin wusste, dass Myra ihn brauchte. Ihn liebte. Daran zweifelte er nicht. Aber er wusste ebenso, dass Myra ihre Brüder so sehr vermisste, dass sie es kaum ertragen konnte. Vor allem in der letzten Zeit. Und je mehr sie daran zu zerbrechen drohte, desto mehr versuchte sie, ihre Familie zusammen zu halten. Und damit legte sie ihrer Tochter unbewusst Fesseln an, die das starke Band zwischen den beiden mehr gefährdete als sie sich vorzustellen vermochte.
Aber Fin konnte es sehen.
Er sah bereits seit Jahren, dass Freya ihrer Mutter zwar wie aus dem Gesicht geschnitten war, sie aber das Fernweh ihres Vaters im Herzen trug. Fin kannte das Gefühl nur zu gut. Das Gefühl, in diesem Haus eingesperrt zu sein. Er hörte den Ruf des Abenteuers. Er träumte von den Welten, die außerhalb des Alltags lauerten. Und Freya tat das auch. Sie wollte nicht zuhause sitzen, Bücher lesen und Kleider nähen. Sie wollte frei sein. Etwas erleben. Und Myra hatte zu große Angst davor, ihre Tochter zu verlieren, um es zuzulassen. Dabei verstand Myra besser als jeder andere, wie es sich anfühlte, eine Rolle zu spielen, die einem nicht so recht passte.
Es war ein Dilemma. Denn Fin konnte nichts tun, um einer von beiden zu helfen, ohne die andere zu verletzen. Und er hatte inzwischen entsetzliche Angst, dass seine kostbare, kleine Familie daran zerbrechen würde. Es musste etwas passieren. Etwas musste sich ändern. Nur was?
Er seufzte erneut. Er hatte bis eben auf einer Bank vor der Haustür gesessen, aber allmählich fröstelte ihn, also erhob er sich und betrat das Haus. Im Flur kam ihm Lydia mit Haarnetz und Nachthemd entgegen. Sie trug eine kleine Petroleumlampe und wollte gerade das Licht im Flur löschen. Als ihn erblickte, erschrak sie kurz, knickste dann und schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Zu so später Stunde, Mylord! In der Dunkelheit treibt sich das Gesindel herum!«
Fin lächelte. »Das weiß ich nur zu gut, Lydia. Aber mach dir keine Sorgen. Ich bin ja wohlbehalten zurückgekehrt.«
Lydia nickte. »Ihr seid nicht die einzige schlaflose Seele in dieser Nacht, Mylord. Eure Lady sitzt noch im Kaminzimmer und liest. Wünscht Ihr noch etwas? Sonst würde ich nun zu Bett gehen.«
»Geh nur, Lydia. Ich kümmere mich um Myra.«
Dankbar senkte Lydia den Kopf und verschwand mit ihrer Lampe in Richtung Treppe. Fin lenkte seine Schritte zum Kaminzimmer und fand dort tatsächlich Myra vor, die neben dem ausgehenden Feuer saß und über einem Buch brütete. Er sah ihr an, dass sie die Buchstaben nicht wahrnahm. Ihre Gedanken waren ganz woanders.
»Myra«, sagte er leise, um sie nicht zu erschrecken. Sie hob den Kopf. Ihre Augen waren gerötet. Sie hatte geweint.
»Ich war furchtbar zu ihr«, sagte sie leise.
Fin durchquerte den Raum und setzte sich in einen Sessel neben sie. »Freya weiß, dass du es nicht böse mit ihr meinst.«
Myra schloss die Augen. »Das glaube ich nicht. Ich denke, sie beginnt allmählich, mich zu hassen. Und sie hat jeden Grund dazu.«
»Das ist Unsinn«, sagte Fin und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Freya liebt dich sehr. Und sie weiß, dass du sie auch liebst. Wenn du möchtest, spreche ich morgen nochmal mit ihr.«
»Ich sollte das tun«, sagte Myra. »Ich weiß bloß nicht, wie. Jedes Mal, wenn sie davon spricht, sich mit Bartleys verfluchten Söhnen im Wald zu prügeln oder auf eine verdammte Abenteuerreise zu gehen, sehe ich dieses Leuchten in ihren Augen. Und es erwärmt mein Herz. Doch im nächsten Moment schnürt es mir die Luft ab, weil ich das Gefühl habe, sie zu verlieren. Ich darf sie nicht verlieren, Fin. Beim ewigen Höllenfeuer! Das darf niemals geschehen.«
Fin erhob sich und zog Myra in seine Arme. Sie klammerte sich an ihn und er hielt sie fest. »Du wirst sie niemals verlieren, Myra. Aber du musst sie ihren Weg gehen lassen. Sie wird zurückkehren. Das weiß ich genau. Aber wenn du sie in einen Käfig sperrst, wird sie irgendwann fliehen und nur die Götter wissen, was sie dann tut.«
Myra löste sich ein Stück von ihm und sah ihn mit schief gelegtem Kopf an. »Teufel aber auch, ich hasse es, wenn du Recht hast.«
Fin lächelte. »Ich denke viel eher, du hast mich wegen meiner unermesslichen Weisheit geheiratet.«





























