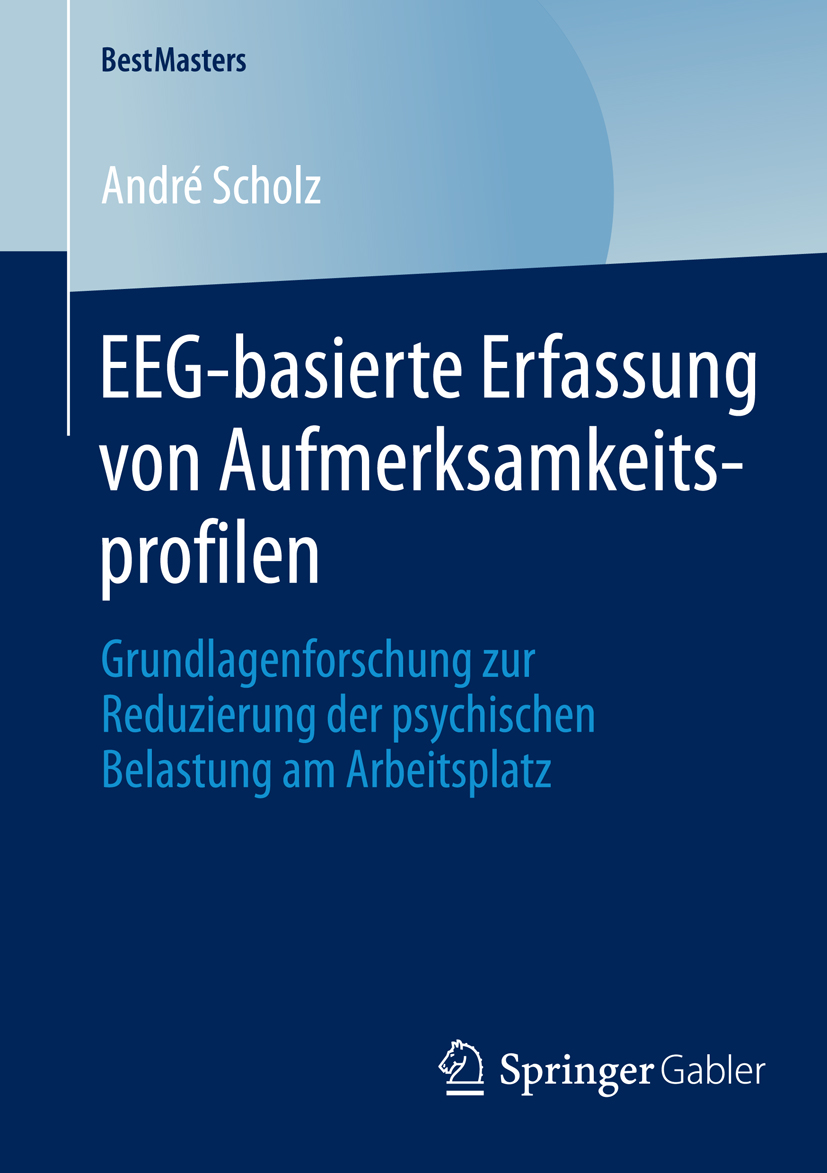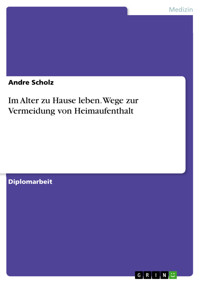
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Pflegewissenschaft - Pflegemanagement, Note: 1,3, Alice-Salomon Hochschule Berlin , Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitender Teil In der vorliegenden Diplomarbeit beschäftigt sich der Autor mit der Situation hilfe- und pflegebedürftiger alter Menschen in der häuslichen Umgebung. Es sollen Bedingungen und Ressourcen aufgezeigt werden, unter denen ein Heimaufenthalt bei Hilfe und Pflegebedürftigkeit vermeidbar ist. Dazu wurden im Einzelnen u. a. Regelungen des Pflegeversicherungsgesetzes, die Wohnsituation alter Menschen, Helfernetzwerke und mögliche Heimeintrittsgründe genauer betrachtet. Empirische Untersuchung Für die entsprechende Datengewinnung wurden neun Interviews mit hilfe- und pflegebedürftigen Menschen geführt. Ein halbstandardisierter Interviewleitfaden fand Verwendung. Auswahlkriterium waren neben einem Alter von mindestens 80 Jahren der Erhalt von Leistungen der Pflegeversicherung. Vier der Interviewpartner lebten zum Zeitpunkt des Interviews im häuslichen Bereich, fünf in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Die Datenauswertung wurde mit Hilfe des Codierverfahrens von Glaser und Strauss durchgeführt. Ergebnisse Im Ergebnisteil der empirischen Untersuchung lassen sich erste Gründe benennen, die bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit Einfluss auf den Verbleib im häuslichen Umfeld nehmen. Die Betrachtung im Diskussionsteil stellt im Folgenden einen Theorie- Praxis- Vergleich dar. Sie erläutert weitere relevante Themenbereiche und zeigt erste Änderungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten für den gesetzlich geforderten Anspruch „Ambulant vor Stationär“ auf. Gemeinsam mit den gegebenen Handlungsempfehlungen wird ein Ausschnitt eines möglichen Rahmens aufgezeigt, durch den ein ungewollter Heimaufenthalt vermieden werden kann. Mit dem Ausblick wagt der Autor einen Blick in die Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsübersicht
Einleitender Teil
In der vorliegenden Diplomarbeit beschäftigt sich der Autor mit der Situation hilfe- und pflegebedürftiger alter Menschen in der häuslichen Umgebung. Es sollen Bedingungen und Ressourcen aufgezeigt werden, unter denen ein Heimaufenthalt bei Hilfe und Pflegebedürftigkeit vermeidbar ist.
Dazu wurden im Einzelnen u. a. Regelungen des Pflegeversicherungsgesetzes, die Wohnsituation alter Menschen, Helfernetzwerke und mögliche Heimeintrittsgründe genauer betrachtet.
Empirische Untersuchung
Für die entsprechende Datengewinnung wurden neun Interviews mit hilfe- und pflegebedürftigen Menschen geführt. Ein halbstandardisierter Interviewleitfaden fand Verwendung. Auswahlkriterium waren neben einem Alter von mindestens 80 Jahren der Erhalt von Leistungen der Pflegeversicherung. Vier der Interviewpartner lebten zum Zeitpunkt des Interviews im häuslichen Bereich, fünf in vollstationären Pflegeeinrichtungen.
Die Datenauswertung wurde mit Hilfe des Codierverfahrens von Glaser und Strauss durchgeführt.
Ergebnisse
Im Ergebnisteil der empirischen Untersuchung lassen sich erste Gründe benennen, die bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit Einfluss auf den Verbleib im häuslichen Umfeld nehmen.
Die Betrachtung im Diskussionsteil stellt im Folgenden einen Theorie- Praxis- Vergleich dar. Sie erläutert weitere relevante Themenbereiche und zeigt erste Änderungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten für den gesetzlich geforderten Anspruch
„Ambulant vor Stationär“ auf.
Gemeinsam mit den gegebenen Handlungsempfehlungen wird ein Ausschnitt eines möglichen Rahmens aufgezeigt, durch den ein ungewollter Heimaufenthalt vermieden werden kann.
Mit dem Ausblick wagt der Autor einen Blick in die Zukunft.
Nachtrag März 2010
Als Leserkreis angesprochen sind betroffene, pflegende und beratende Personen.
Die Diplomarbeit wurde im Oktober 2008 mit dem Willi Abs Preis ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
1.4 Recherche
1.5 Persönliche Erfahrungen
2 Relevanz der Thematik
3 Die Versorgungssituation alter Menschen
3.1 Das Alter
3.2 Das Pflegeversicherungsgesetz
3.3 Pflegebedürftigkeit und Leistungsempfang
3.4 Die Wohnsituation alter Menschen in Deutschland
3.5 Hilfenetzwerke
3.5.1 Informelle Hilfe
3.5.2 Formelle Hilfe
3.6 Finanzielle Situation
3.7 Autonomie
3.8 Heimeintrittsgründe
3.9 Zusammenfassung
4 Die Empirische Untersuchung
4.1 Methodenauswahl
4.2 Fragestellung
4.3 Der Untersuchungsplan
4.4 Die Interviews
4.5 Feldzugang/ Datenerhebung
4.5.1 Kontaktaufnahme und Vorgespräch
4.5.2 Interviewleitfaden und Kontextprotokoll
4.5.3 Interviewdurchführung
4.6 Datenaufbereitung
4.7 Datenauswertung
4.8 Auswertung
4.9 Kategorienbildung
5 Ergebnisse
5.1 Hilfe - und Pflegebedarf
5.2 Häuslicher Alltag
5.3 Vorsorge und Notfall
5.4 Privates Netzwerk
5.5 Professionelle Hilfe
5.6 Kompetenz
5.7 Verändertes Wohnen
5.8 Fallbetrachtung
5.9 Zusammenfassung
6 Diskussion
6.1 Wohnraumsituation
6.2 Das holländische Beispiel
6.3 Beratungsbedarf und Informationsdefizite
6.4 Verantwortung und Möglichkeiten des Gesetzgebers
6.5 Ehrenamtliches Engagement
6.6 Vernachlässigte Prävention
6.7 Ambulant vor Stationär
7 Handlungsempfehlungen
7.1 Wohnraumumfeld
7.2 Schwierige Entscheidung
7.3 Wohnraumberatung
7.4 Wohnraumanpassung
7.5 Alltagskompetenz
7.5.1 Soziale Partizipation
7.5.2 Der Alltag
7.5.3 Mobilität
7.5.4 Hauswirtschaftliche Versorgung
7.5.5 Hilfe- und Mobilitätsdienste
7.6 Das Hilfenetzwerk
7.6.1 Die Hauptpflegeperson
7.6.2 Die Familie
7.6.3 Professionelle Hilfe
7.6.4 Ärztliche Versorgung
7.7 Hilfsmittel
7.7.1 Notfallsituation und Übergangslösungen
8 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:Vorstellungen vom Wohnen im Alter (eigene Darstellung)
Tabelle 2:Zusammenfassung der Kategorien und Vorkommen in den Interviews
Tabelle 3 (a-g): Hauptkategorienbildung
1 Einleitung
Zu vermuten ist, dass es als optimale Situation gilt, den Lebensabend in seinem gewohnten Lebensumfeld verbringen zu können, idealerweise umsorgt von der Familie. Die wenigsten Menschen können sich in der Blüte ihres Lebens vorstellen, pflegebedürftig zu werden und die Hilfe anderer zu beanspruchen. Den Wunsch, im Alter nicht in einem Pflegeheim leben zu müssen, haben viele.
Er geht einher mit dem gesetzlichen Vorrang, die häusliche Versorgung bei Pflegebedürftigkeit zu unterstützen[1], Heimaufenthalte zu vermeiden.
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen ein Heimaufenthalt bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit vermeidbar ist.
1.1 Problemstellung
Der sich momentan abzeichnende demografische Wandel in Deutschland hat verschiedenste Auswirkungen. Einerseits führt er auf individueller Ebene zu einer höheren Lebenserwartung und auf der gesellschaftlichen Ebene zu einem Zuwachs alter und sehr alter Menschen in der Gesellschaft. Das hat zur Folge, dass viele Menschen eine lange Phase des Altseins erleben. Diese ist zum Teil einhergehend mit reduzierten Alltagskompetenzen, der Zunahme von gesundheitlichen Problemen und dem erhöhten Risiko von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Gerade aber gesundheitliche Voraussetzungen und persönliche Alltagskompetenzen sind maßgeblich entscheidend für eine selbstbestimmte häusliche Lebensführung im Alter.
Um dem häufig auftretenden Wunsch alter Menschen gerecht zu werden, auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit in der vertrauten Wohnung zu bleiben, gilt es Wege für die Versorgung dieser Personengruppe zu finden.
Aber alte und pflegebedürftige Menschen sind so unterschiedlich und leben so verschiedenartig wie Menschen anderer Altersgruppen auch. Das Alter mit seinen Einschränkungen bietet somit kein einheitliches Bild. Es bestehen große Unterschiede hinsichtlich der Steuerungsmöglichkeiten, der psychischen und der körperlichen Gesundheit, einem möglichen Hilfearrangement, dem entstammenden Milieu und weiterer Faktoren, die den Alltag und das Leben im Alter beeinflussen können. Diese Verschiedenheiten machen es so komplex wie schwierig, gewünschte und effektive Angebote an Alltags- und Versorgungskonzepten für die häusliche Versorgung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit bereitzustellen.
1.2 Ziel der Arbeit
Es werden die Lebenssituationen alter, pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Umfeld untersucht und erarbeitet, welche Ressourcen und Bedingungen gegeben sein sollten, um ungewollte Heimaufenthalte zu vermeiden.
Dabei geht es keinesfalls um das „Infragestellen“ der Notwendigkeit von Pflegeheimen. Es gibt es Versorgungssituationen, die im häuslichen Umfeld nicht zu bewältigen sind.
Nicht alle Menschen haben die Voraussetzungen, sich im häuslichen Umfeld bei Hilfe und Pflegebedürftigkeit versorgen zu lassen. Kleine oder keine Netzwerke, gesundheitliche Grenzen (hierbei sei vor allem eine fortgeschrittene Demenz zu nennen), der Wunsch nach einem Leben im Pflegeheim und andere Gründe sprechen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen.
1.3 Aufbau der Arbeit
Im Zentrum steht die Betrachtung der wesentlichen Einflussfaktoren, unter denen sich ein Heimeinzug vermeiden lässt. Hierzu werden im ersten Teil der Arbeit Aspekte betrachtet, die vermutlich Einfluss auf den Verbleib im häuslichen Umfeld haben. Dazu gehören die Wohnsituation, die Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, der Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung, das Hilfenetzwerk, das Selbstbestimmungsrecht alter Menschen und ihre finanzielle Situation.
Der zweite Teil dokumentiert Methodik und Ergebnisse der empirischen Erhebung. Daten aus neun Interviews wurden analysiert und ausgewertet. Im Detail ging es um die Erfahrungen Pflegebedürftiger, die im häuslichen Umfeld leben oder nach der Zunahme unlösbarer Probleme, in ein Pflegeheim gezogen sind. Es wurden dazu Situationen aufgegriffen und näher betrachtet, die ein Leben mit Pflege- und Hilfebedürftigkeit im häuslichen Umfeld ermöglicht oder verhindert haben.
Im dritten Teil der Arbeit werden Themengebiete diskutiert, die sich aus Erkenntnissen des Theorieteils und der empirischen Erhebung ergeben haben und eine Rolle bei der Umsetzung der Ergebnisse des empirischen Anteils der Arbeit spielen können.
Abschließend werden Handlungsempfehlungen gegeben, welcher Rahmen bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit für den Verbleib im häuslichen Umfeld geschaffen sein sollte. Sie basieren auf Ergebnissen des theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit und Erkenntnissen der empirischen Erhebung. Punktuell finden sie durch Themenbereiche der Diskussion Ergänzung.
1.4 Recherche
Bei der Themenbearbeitung fanden fast ausschließlich Quellen Berücksichtigung (Literatur, Studien, sonstige Veröffentlichungen), die nicht älter als sieben Jahre waren[2]. Sie garantieren die Aktualität der Daten bzw. der gegebenen Situation in der Gesellschaft und den Stand der Forschung. Hervorzuheben sind hierbei die Ergebnisse der MuG- Studien (Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger Lebensführung). Mit ihnen wurden zum ersten Mal in Deutschland repräsentative Daten zu Hilfe und Pflegebedürftigkeit in Privathaushalten sowie vertiefende Untersuchungen zu den Bedingungen und Konsequenzen von Hilfe und Pflegebedürftigkeit erhoben. Im Rahmen des Folgeprojektes MuG III wurden 2002 durch Infratest Sozialforschung München unter der Leitung von Ulrich Schneekloth vertiefende Zusatzstudien durchgeführt und Daten erhoben.
Zur ersten Recherche war die Publikation: „Altenpflege in Deutschland, Bestandsaufnahme und Perspektiven“ des Informationszentrums Sozialwissenschaften, sehr hilfreich. Da viele Studien zur Thematik im Internet (World Wide Web) veröffentlicht werden, begann die Recherche in diesem Medium. Verwendet wurden Datenbanken wie GeroLit, WISE und DIMDI. Schlagworte waren: Wohnen im Alter, Selbstbestimmung und Autonomie, Informationsstand und Informationsdefizit alter Menschen, Hilfebedarf, soziale Netzwerke formelle und informelle Hilfe und andere.
Eine umfassende Literaturrecherche wurde in den Beständen der Bibliothek an der Alice Salomon - Fachhochschule durchgeführt. Veröffentlichungen verschiedener Bundesministerien sowie Zahlen des Statistischen Bundesamtes stützen die gemachten Aussagen.
1.5 Persönliche Erfahrungen
Seit sieben Jahren ist der Autor ehrenamtlich für das Bezirksamt Pankow von Berlin tätig. In diesem Rahmen werden von ihm Senioren ab 80 Jahre im häuslichen Umfeld besucht. Sie erhalten Gratulationen zu Geburtstagen oder Ehejubiläen.
Im Laufe der Jahre konnte er einige der Besuchten näher kennen lernen. Persönliche Gespräche und Kontakt zu Familienangehörigen wurden dann die Regel. Den Wunsch, ihren Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen, haben fast alle Senioren.
Als examinierter Altenpfleger hat der Autor in seiner beruflichen Tätigkeit in einer vollstationären Pflegeeinrichtung einige pflegebedürftige Menschen kennen gelernt, die ungewollt im Heim leben. Sie kamen häufig nach gravierenden gesundheitlichen Ereignissen, haben sich häufig schnell erholt, und leben dann neben den schwerst-pflegebedürftigen und nicht selten hochgradig dementen Mitbewohnern als „normales Bewohnerklientel“ im Pflegeheim. Sie sind sich häufig ihrer Situation bewusst und wünschen eine Trennung von den (jährlich zunehmenden) pflege- und betreuungsintensiven Bewohnern. Durch gesonderte Wohnbereiche, Wohngruppen, Wohnzimmer oder Sitzplatzkonstellationen am Tisch, wird im Pflegeheimalltag versucht, dieser Situation zu begegnen.
Im Rahmen seines studienbegleitenden Praktikums beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) war der Autor im April 2006 stiller Beobachter bei ca. 60 Begutachtungsverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§18 SGB XI). Ihn überraschte dabei der große Anteil von Antragstellern, die Hilfebedarf hatten, der sich aber nicht überwiegend auf die Pflege bezog. Die Begutachteten gaben häufig Bedarf und Defizite im Rahmen der Mobilität und der hauswirtschaftlichen Versorgung an.
Die Wohnung reinigen, eine Begleitung beim Einkauf, Hilfe bei der Beantwortung von Ämterpost, das Stellen von Anträgen und Probleme bei der ärztlichen Versorgung wurden u. a. thematisiert.
Hohe Zahlen zur Ablehnung einer Pflegestufe bestätigten die gemachten Beobachtungen. Von 674.101 durchgeführten Erstbegutachtungsverfahren 2005 wurden 29,3 % der Anträge abgelehnt.[3] Das bedeutete 197 511 Antragsteller hatten einen Hilfe- oder Pflegebedarf, erfüllten aber nicht die unter § 14 SGB XI [4] definierten Voraussetzungen zum Erhalt von Leistungen nach SGB XI.
Für eine Projektarbeit an der Alice Salomon Hochschule wurden vom Autor vier pflegebedürftige Menschen interviewt. Eine Person lebt nach einem viermonatigen Heimaufenthalt wieder in ihrer Wohnung, die drei anderen wohnen in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Nur eine der vier Personen ist freiwillig in ein Pflegeheim gezogen.
Für die vorliegende Arbeit wurden weitere fünf pflegebedürftige Menschen interviewt. Keiner der Interviewten hätte sich in der Vergangenheit vorstellen können, im Pflegeheim zu leben. Zwei leben nun dort.
Diese Untersuchung hat nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Sie repräsentiert den erfahrenen und analysierten Ausschnitt einer erlebten Wirklichkeit.
2 Relevanz der Thematik
In den kommenden Jahrzehnten wird es zu einer Zunahme alter und hochbetagter Menschen in unserer Gesellschaft kommen (siehe Abbildung 1: Alterspyramide).
Abbildung 1: Alterspyramide (Quelle: Statistisches Bundesamt; 2003)
Auf der Grundlage der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung ist ein Anstieg der Anzahl von Personen, die über 60 Jahre alt sein werden, von 2005 bis zum Jahr 2030 um 8 Millionen Menschen zu erwarten. Das entspricht bei einer durchschnittlichen Gesamtbevölkerungszahl von 80 Millionen Einwohnern einem Anstieg von derzeit 25 % auf rund 36 % der Bevölkerung, von 20,5 auf 28,5 Millionen Einwohner.
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Pflegebedürftigkeit zu. Sie tritt als Risiko für Hochbetagte in Erscheinung und lässt sich als Zusammenspiel von Krankheit, Funktionseinbußen und Hilfebedürftigkeit erklären. Die Prognosen zur Entwicklung der Pflegebedürftigkeit beruhen auf demografischen Prämissen und Annahmen über lebensaltersbedingte Pflegewahrscheinlichkeiten. Vor allem Letztere haben einen großen Einfluss auf das quantitative Ausmaß der Pflegebedürftigkeit. Nach einer Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen (nach § 14 SGB XI) von heute etwa 2,14 Millionen auf 2,83 Millionen im Jahr 2020 ansteigen[5]. Das entspricht einem Zuwachs von knapp 40 %. Für die folgenden Zeiträume werden die Prognosen immer unsicherer; dementsprechend schwankt die Zahl der erwarteten Pflegebedürftigen für das Jahr 2050 zwischen 3,2 und 5,9 Millionen. [6]
Eine gesündere Lebensweise, gute medizinische Versorgung, Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen sind u. a. Gründe dafür, dass die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, aber mit ihr auch das Risiko für Pflegebedürftigkeit.
In Deutschland beträgt die Lebenserwartung (Sterbetafel 2004/2005) derzeit für: [7]
Damit einhergehend liegt das Risiko für Pflegebedürftigkeit des Einzelnen: [8]
In Deutschland sind derzeit über zwei Millionen Menschen pflegebedürftig. Mehr als zwei Drittel, also ca 70 % der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt.
Zirka eine Million Pflegebedürftige erhalten Pflegegeld, das bedeutet, sie werden im häuslichen Bereich durch Angehörige gepflegt. Weitere 450.000 Pflegebedürftige leben ebenfalls in Privathaushalten. Bei ihnen erfolgte die Pflege und Betreuung jedoch zum Teil oder vollständig durch Sozialstationen.
Zirka 30 %, das entspricht etwa 640.000 Leistungsempfänger, werden in stationären Pflegeeinrichtungen versorgt.[9]