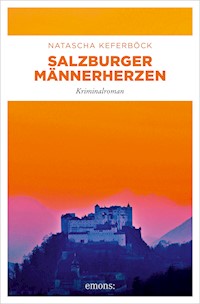Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Raphael Aigner
- Sprache: Deutsch
Ein herrlich schräger Krimi aus dem Salzburger Land. Mitten in der Flachgauer Raunacht geschieht ein Mord, der das beschauliche Örtchen Koppelried in den Ausnahmezustand versetzt – und mit ihm den Dorfpolizisten Raphael Aigner, der das Opfer nur allzu gut kannte. Mit Unterstützung alter Kollegen nimmt Aigner die Fährte auf und trifft bei der Suche nach dem Täter nicht nur auf überhebliche Pfaffen, windige Geschäftsmänner und kauzige Dorfbewohner, sondern kommt auch einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten zu erzählen hat für Natascha Keferböck, Jahrgang 1969, schon als Kind eine wichtige Rolle gespielt. Mit dem Aufschreiben hat sie allerdings erst später begonnen. Die Autorin ist seit vielen Jahren beruflich in der Technik- und Finanzwelt zu Hause. Schon in ihrem Debütroman hat die leidenschaftliche Menschenbeobachterin ihrer Liebe zum Salzburger Land und seinen Menschen humorvoll Tribut gezollt. »Im Flachgau wartet der Tod« ist ihr zweiter Krimi.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen, realen Organisationen oder Institutionen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang befindet sich ein Glossar.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/Arnt Haug
Bildmotiv mit freundlicher Genehmigung von Romantikhotel Zell am See
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-778-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Sonntag, Stefanitag
Am zweiten Weihnachtsfeiertag sitzen der Sepp und die Hanni wie immer bei ihren Besuchen stocksteif auf meiner Wohnzimmercouch und warten auf Kaffee und Kekse, die meine Schwester Gabi oben in ihrer Wohnung anrichtet. Das Klappern der Blechbüchsen und der Tassen auf den Untertassen ist bis zu uns zu hören.
Mein Sohn Felix ist komplett überdreht, weil er gerade einige der Geschenke der beiden ausgepackt hat. Seine Großeltern lassen sich nie lumpen. Allerdings können sie sich nur zweimal im Jahr überwinden, bei uns vorbeizuschauen. Die beiden sprechen es nicht aus, aber sie geben mir die Schuld an dem Unfalltod meiner Frau Sabine, ihrer Tochter, vor über fünf Jahren. Daran hat sich auch mit der Zeit nichts geändert. Und ich kann es ihnen nicht verübeln, habe ich es mir doch selbst bis heute nicht verziehen, meine Frau nicht zum Klassentreffen gefahren und abgeholt zu haben. Dann wäre sie heute noch am Leben.
Seither reden meine Schwiegereltern, die Marolds, nur mehr das Allernötigste mit mir.
Die Gabi, meine Schwester, ist gar nicht gut auf die beiden zu sprechen. Ihrer Meinung nach haben sie nach Sabines Tod nicht nur mich, sondern auch den kleinen Felix im Stich gelassen. Ich denke mir, sie können den Verlust halt selber nicht verwinden und brauchen einen Sündenbock. Und eigentlich bin ich froh, dass ich ihnen zumindest diesen Gefallen tun kann.
Meine Schwester hat uns jedenfalls nicht im Stich gelassen. Nachdem ich als Kriminalpolizist und alleinerziehender Vater eines Babys völlig überfordert war, hat sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns beide aus Salzburg zurück ins Elternhaus nach Koppelried und damit in ihren Einflussbereich zu holen. Deshalb bewohne ich die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss unseres schon sehr in die Jahre gekommenen Zwei-Familien-Hauses und bin zum Inspektionskommandanten der hiesigen Polizei mutiert.
Felix leidet nicht wirklich unter der Abwesenheit seiner Großeltern. Die beiden sind zwar nach dem Tod ihrer Tochter von Koppelried nach Schladming gezogen, laden ihren Enkelsohn aber übers Wochenende zu sich ein, sooft es geht.
»Papa, schau, ein Handy. Juchhu, endlich hab ich auch eins! Du wolltest mir ja keins kaufen! Danke, Opa, danke, Oma!« Mein Sohn rastet regelrecht aus und hüpft mit dem funkelnagelneuen iPhone in der Hand vor Freude durch unser kleines Wohnzimmer.
»Wir haben schon oan Vertrag abg’schlossen, und die Rechnungen übernehmen selbstverständlich wir.« Der Sepp wagt nur einen kurzen Blick auf mich, bevor er sich gleich wieder freundlich lächelnd seinem Enkel widmet. »Kimm her, Felix, i zoag dir, wia das Ding funktioniert. Der Verkäufer im Gschäft hat es mir ganz genau erklärt.«
Der Bub springt übermütig auf den Schoß seines Opas. Auch die Hanni beugt sich übers Handy, ganz offensichtlich will sie sich nicht mit mir unterhalten.
Also speichere ich die neue Nummer meines Sohnes, die er mir diktiert, in mein Telefon ein und checke bei der Gelegenheit meine WhatsApp-Nachrichten. Ich weiß nicht, womit ich mich sonst beschäftigen soll, bis meine Schwester zurück ist. Dabei stolpere ich über eine schon gut eine Woche alte Nachricht von der Moni, die ich bis jetzt übersehen haben muss. Die brünette und immer gut gelaunte Krankenschwester hab ich im letzten Sommer kennengelernt. Nach ein paar Treffen haben wir uns aus den Augen verloren, aber vor etwa zwei Wochen zufällig in der Jakobi Stubm wiedergetroffen, meinem Stammlokal in Salzburg. Und was soll ich sagen, wie es halt so kommt, hab ich bei ihr übernachtet. Da sich das Kinderzimmer meines Sohnes in Gabis Wohnung im Obergeschoss befindet, sind aufgrund einer stillschweigenden Übereinkunft mit meiner Schwester spontane Auswärtsnächtigungen ab und an kein Problem, solange diese nicht überhandnehmen.
Danach haben die Moni und ich nichts mehr voneinander gehört; bis eben auf ihre WhatsApp-Nachricht. Ich überlege kurz. »Wir können uns gerne mal wieder treffen«, schreib ich und drücke auf »Senden«.
»OH DEAR!«
Nicht nur ich, auch meine Schwiegereltern fahren erschrocken hoch, und der Felix lässt vor Schreck sein Handy in Opas Schoß fallen. Im Türrahmen meines Wohnzimmers lehnt lässig eine sehr kräftige Frau mittlerer Größe und undefinierbaren Alters. Niemand hat ein Läuten an der Haustür vernommen, aber das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn unser Haus ist so gut wie nie abgesperrt.
Die dicken Beine der Frau stecken in einer rosafarbenen, hautengen Hose, dazu trägt sie rote Stiefel und eine weiße Felljacke, hoffentlich aus Kunstpelz. Das Haar, tiefschwarz, ist kurz und gelockt wie meins. Ich habe diese Frau ganz bestimmt noch nie gesehen, aber irgendwie kommt sie mir trotzdem bekannt vor.
»OH MY GOD, ABSOLUTELY NOTHING HAS CHANGED IN THIS ROOM – NO-THING!«
Die Frau hat ein äußerst lautes Organ. Verblüffend ähnlich dem meiner Schwester Gabi, stelle ich etwas unangenehm berührt fest.
»Unbelievable! Get up, my dear!« Sie geht direkt auf mich zu und bedeutet mir aufzustehen.
Etwas perplex erhebe ich mich tatsächlich von meinem Stuhl.
»Na, des gibt’s net«, sagt die Hanni beeindruckt, und ihr Mund geht vor Staunen gar nicht mehr zu.
»I glaub, i spinn.« Der Sepp kratzt sich verlegen seine Glatze.
»You’re looking great, honey. Such a handsome guy.«
Sie taxiert mich von oben bis unten, dreht eine kurze Runde um mich, mustert mich noch mal von Kopf bis Fuß und tätschelt dann mit ihrer Hand ausgiebig meine Wange. An ihren wurstigen Fingern hängt gut und gern ein halbes Kilo Schmuck, das jetzt gegen meine Backe donnert. Ich kapiere überhaupt nichts mehr, vergesse sogar, mich zu wehren, und stehe nur da wie ein Vollidiot.
»Darling, please show some restraint«, meint plötzlich eine männliche Stimme hinter ihr. Dass sie in Begleitung gekommen ist, fällt mir erst jetzt auf. Der Mann ist klein und schmächtig, hat ledrig gegerbte, runzelige Haut und das lange weiße Haar zu einem Zopf geflochten. Mit seiner engen Lederhose wirkt er wie ein Rock-Opa. Außerdem hat er eines dieser Ohr-Piercings, die ein Riesenloch in das Ohrläppchen dehnen. Bei einem Mann in seinem Alter sieht das nun wirklich so lächerlich aus, dass ich mein Grinsen nicht unterdrücken kann.
»Kannst jetzt nimmer Deutsch wegen deinem Scheißamerika?« Laut scheppernd lädt die Gabi das Tablett mit Kaffeekanne, -tassen und Keksen am Tisch ab, sodass der Kaffee überschwappt. Meine Schwester fixiert die Frau mit einem so grimmigen Gesichtsausdruck, wie ich ihn noch nie an ihr gesehen habe. Selbst der Felix drängt sich bei dem Anblick erschrocken an die Brust seines Opas.
»Und jetzt schleich dich da raus! Aber flott! Wir müssen uns erst überlegen, ob wir dich überhaupt zu uns hereinlassen oder nicht! Hast mich, Mutter?« Sie kocht vor Wut.
Die Frau zuckt nur mit den Schultern, tätschelt der beinahe explodierenden Gabi unbeeindruckt die Wange und dreht sich dann ohne ein weiteres Wort um, um unser Haus wieder zu verlassen. Das kleine Männlein trabt brav hinter ihr her. Meine Schwiegereltern werden unmittelbar darauf von Gabi im Befehlston zu einem Spaziergang mit dem Felix verdonnert, obwohl es draußen wie schon in den letzten Tagen in Strömen regnet. Doch niemand wagt es, ihr zu widersprechen, nicht mal mein Bub.
Am Küchentisch in der Wohnung meiner Schwester im Obergeschoss unseres Elternhauses kippe ich mit ihr erst mal einen Schnaps. Diese Frau ist tatsächlich meine Mutter. Das heißt, sie ist natürlich auch Gabis Mutter. Die Frau, die uns beide und unseren Vater vor unzähligen Jahren verlassen hat und über die mir meine Familie offensichtlich bisher nur die kindgerechte Light-Version offenbart hat. Darum will ich jetzt mehr wissen.
»Raphi, du kannst dich halt an nichts mehr erinnern. Du warst so ein armes Hascherl damals, ganz ohne Mama, grad so wie der Felix jetzt.«
»Jetzt übertreibst du aber gewaltig, Gabi. Mein Bub ist alles andere als ein armes Hascherl«, widerspreche ich ihr.
»Aber geh, du weißt doch, wie ich das mein. Eh wurscht«, wehrt die Gabi ab. »Jedenfalls hat es sich irgendwie nie ergeben, dass der Papa oder ich dir alles erzählt haben, frag mich nicht, warum. Aber du wolltest nie etwas über sie wissen, hast dich nicht ein einziges Mal nach ihr erkundigt.«
Vorsichtshalber wirft mir meine Schwester einen vorwurfsvollen Blick zu. Stimmt, ich hab mich wirklich nie für meine Mutter oder die Umstände, warum sie uns verlassen hat, interessiert. Komisch, aber für mich war Familie immer nur der Vater und die Gabi, denke ich mir.
»Der Papa hatte nur Probleme mit ihr. Sie war beileibe keine treue Ehefrau, das hab ich schon als kleines Mädel mitgekriegt. Trotzdem hat er ihr immer wieder verziehen. Mein Gott, der Mann hat sie unheimlich gerngehabt. Viel zu gern, wenn du mich fragst. Irgendwann hat sie dann in Salzburg diesen Ami kennengelernt und sich ständig mit dem getroffen. Aus Angst, sie endgültig zu verlieren, hat der Papa einfach die Augen vor allem verschlossen.« Meine Schwester fixiert kurz den Küchentisch und dreht versonnen ihre Handflächen hin und her. »Immer öfter war sie auch über Nacht weg, aber der Papa hat ihr nie Vorwürfe gemacht. Er wollte, dass sie bei ihm bleibt, koste es, was es wolle. Ich an seiner Stelle hätt die Frau längst hochkant rausgeschmissen. Ein Depp war der Vater halt, ein verliebter Depp.« Die Gabi schüttelt verbittert den Kopf. »Eines Tages, ich war mit dir allein, ist sie mit diesem Scheißami nach Haus gekommen. Der Kerl hat sich auf unsere Couch fallen lassen, Vaters Zigaretten geraucht und mich dabei blöd angegrinst. In der Zwischenzeit hat sie oben rasch ihre Habseligkeiten in einen Koffer gepackt. Ich hab geweint, Raphi, und du hast wie am Spieß gebrüllt, warst ja schon immer ein Schreihals.« Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, doch gleich darauf runzelt sie die Stirn. »Aber das hat sie nicht im Geringsten berührt. Sie hat mir nur die Wange getätschelt – grad so wie vorhin – und gemeint, das könne ich erst verstehen, wenn ich älter bin. Zum Abschied hat sie uns beiden einen raschen Kuss gegeben und mir einen Brief für den Papa in die Hand gedrückt. Ich hab sie nie wiedergesehen, bis heute.« Die Gabi hält inne, atmet tief durch und trinkt ihr Stamperl leer.
Meine Schwester ist nun wirklich keine Zimperliese, aber unsere Eltern haben ihr, einem Kind von acht Jahren, da in der Vergangenheit eindeutig zu viel zugemutet. Daher nehme ich sie mitfühlend in den Arm. Sie lässt es kurz mit sich geschehen, bevor sie sich wieder aus der Umarmung befreit.
»Aber geh, Raphi, ich bin doch kein Mimoserl, und zum Glück ist alles schon recht lange her. Aber mich ärgert, dass die da jetzt so mir nix, dir nix hereinspaziert, wo sie sich in den letzten achtunddreißig Jahren einen Dreck um uns geschert hat. Der Papa wird vor Schreck tot umfallen, wenn er erfährt, dass diese Kanaille zurück ist. Was will die bloß von uns?« Die Gabi wirft einen besorgten Blick auf ihre Armbanduhr. »Wo bleiben eigentlich deine depperten Schwiegereltern? Die sind schon über eine Stunde mit dem Buben im Regen draußen, und dunkel ist es auch längst.« Jetzt ist sie wieder ganz die Alte.
Wie bestellt leuchtet plötzlich die neue Telefonnummer meines Sohnes auf meinem Handy auf.
»Papa!«, schreit der Felix mir von fern ins Ohr. »Der Opa hat gesagt, ich soll dich anrufen. Uns hat es zu viel geregnet, deshalb sind wir zur Marie ins Wirtshaus. Und stell dir vor, die dicke Frau von vorhin ist auch da und sitzt jetzt bei Oma und Opa im Extrastüberl. Ich darf an der Bar bleiben, das hat die Marie erlaubt. Sie baut grad ein Haus aus Bierdeckeln für mich. Das ist schon ganz hoch und noch gar nicht umgefallen.«
Bevor ich ein Wort sagen kann, reißt mir die Gabi das Handy aus der Hand. »Bleibt dort, wo ihr seid, Felix. Der Papa und ich, wir kommen sofort.« Damit legt sie einfach auf, springt behände vom Stuhl, holt sich hohe blaue Stiefel von der Garderobe und quetscht ihre strammen Waden hinein.
»Wir fahren jetzt beide ins Rieglerbräu. Marie hin oder her, Raphi, das ist mir grad so was von wurscht. Da musst du jetzt einfach durch.«
Also bleibt mir nichts anderes übrig, als nach unten in meine Wohnung zu gehen, die dicke Daunenjacke überzuziehen und in meine Schuhe zu schlüpfen. Wegen des immer noch andauernden Regens nehmen wir Gabis alten Fiesta, obwohl man zu Fuß nicht mal eine Viertelstunde zur Wirtschaft braucht.
Die Marie ist neuerdings Wirtin vom Rieglerbräu. Nach einer rekordverdächtig kurzen Ehe mit dem Brauwirt, die mit dessen gewaltsamem Tod endete, hat sie das Brauwirtshaus und alles, was dazugehört, geerbt. Damals, im letzten Sommer, bin ich wohl etwas auf die Marie gestanden, muss ich zugeben. Aber dann wurde mein Bub in die Geschichte hineingezogen und war in Gefahr, damit war die Sache für mich erledigt. Im Rieglerbräu war ich daher schon lange nicht mehr, was mir nicht zuletzt auch wegen des ausgezeichneten Biers, das es dort gibt, wirklich schwergefallen ist.
»Komm, sitz halt nicht wie angewurzelt herum, lass uns endlich reingehen«, kommandiert die Gabi, weil ich nicht in Sekundenschnelle aus dem Wagen hüpfe. Am Parkplatz springt mir sofort ein neuer BMW X3 mit Wiener Kennzeichen ins Auge. Kunststück, am zweiten Weihnachtsfeiertag stehen da inklusive unserem nur drei Autos rum.
Die Gabi tritt vor lauter Elan beinahe die schwere Holztür vom Rieglerbräu ein. Sogar mir fällt sofort die Veränderung auf. Hier wurde offensichtlich kräftig modernisiert. Da, wo früher nur ein Windfang war, ist jetzt an der Wand eine Garderobe aus dunklem Holz angebracht. Danach führt eine moderne Glastür in die Schankstube. Die Wirtshausbänke aus hellem Buchenholz wurden mit modernen Tischen und Stühlen aus dunklem Holz kombiniert, was irgendwie gediegener wirkt.
Ich muss zugeben, ich bin schon etwas angespannt. Wohl weil ich meine Mutter bis auf die paar Minuten vorhin noch nie bewusst wahrgenommen habe, aber auch, weil ich gleich zum ersten Mal nach einem halben Jahr der Marie wieder in die Augen sehen werde. Natürlich konnte ich ihr die letzten sechs Monate in unserem kleinen Koppelried nicht zur Gänze aus dem Weg gehen, aber außer dem einen oder anderen Zunicken von Weitem hab ich den Kontakt zu ihr vermieden.
Da entdecke ich sie auch schon, genauer gesagt ihre blonden Naturlocken, die ihr beinahe bis zum sehr ansehnlichen Hinterteil reichen. Ebendieses Hinterteil, das in einer schmalen schwarzen Hose steckt, zieht meinen Blick auf sich. Ich kann gar nichts dagegen tun, weil die Marie auf einem Barhocker meinem Sohn gegenüberhockt. Beide unterhalten sich angeregt und versuchen vorsichtig, zwei weitere Bierdeckel auf einen bereits sehr hohen Bierdeckelturm zu stellen.
Mein Sohn ist ganz vernarrt in die Marie, hab ich das schon erwähnt? Im vergangenen halben Jahr hat er mir kein einziges seiner Erlebnisse im Rieglerbräu, speziell mit der Marie, vorenthalten. Auch meine Schwester berichtet mir beinahe täglich von der neuen Wirtin im Ort. Sie würde uns beide nämlich liebend gern als Paar sehen. Nur: Daraus wird nix. An festen Beziehungen hab ich seit dem Tod meiner Frau kein Interesse mehr.
»Papa. Tante Gabi«, haucht der Felix ganz leise, ohne uns dabei auch nur anzusehen, damit er die Stabilität des Bierdeckelturms nicht gefährdet. Die Marie dreht sich vorsichtig um und lächelt uns zu. Sie sieht viel besser aus als vor einem halben Jahr. Kunststück, damals war sie schließlich nervlich ziemlich am Ende und stand noch dazu unter Mordverdacht. »Grüß dich, Gabi. Raphi, lang nicht mehr gesehen.« Sie hält mir ihre schmale, elegante Hand zum Gruß hin.
»Servus, Frau Wirtin«, lächle ich und schüttle sie ihr kurz.
»Nicht stören, Papa. Der Opa, die Oma und die dicke Frau sitzen hinten im Extrastüberl«, wittert mein Sohn sofort seine Konkurrenz, wenn es um die Marie geht.
»Sie und ihr Begleiter haben sich schon vor ein paar Tagen in zwei unserer nagelneuen Gästezimmer einquartiert. Also, ich wollte nur sagen: Ich weiß, wer sie ist. Die Erni hat mich quasi aufgeklärt, dass es sich um eure, äh, Mutter handelt.« Die Marie gleitet vom Hocker und blickt verlegen von mir zur Gabi. Logisch, dass die Erni meine Mutter erkannt hat. Die alte Wirtin vom Rieglerbräu kennt schließlich alle Hiesigen, auch wenn diese schon längst nicht mehr im Ort wohnen.
»Dank dir auch recht schön, dass ihr uns nicht informiert habt.« Die Stimme meiner Schwester klingt vorwurfsvoll. »Zumindest ein Anruf wär angebracht gewesen, damit wir gewarnt sind. Frechheit.« Die Gabi schnaubt beleidigt durch die Nase und verschwindet wutentbrannt in Richtung Extrastüberl.
»Ich wollte euch nicht verärgern, die Erni und ich, wir konnten ja nicht ahnen …« Die Marie blickt betroffen hinter der Gabi her.
Der Felix zieht an meinem Hosenbein und schaut mich irritiert an. »Papa, das soll deine Mama sein? Aber wieso kennst du die dann nicht? Und wieso kenn ich sie nicht?«
»Tja, das ist eine arg komplizierte Geschichte, von der ich auch noch nicht alle Details kenne.« Ich will ihm kurz über den Kopf streicheln, aber das kann er gar nicht leiden.
Mein Bub zuckt zurück und schmeißt dabei den Bierdeckelturm um. »Papa! Jetzt ist alles umgefallen, nur wegen dir!« Er verschränkt seine kleinen Arme und schiebt trotzig seine Unterlippe vor.
»Aber, Felix, das ist doch kein Problem«, besänftigt ihn die Marie. »Den bauen wir ruckzuck wieder auf, noch höher als vorhin. Ich hole gleich noch einen weiteren Packen Bierdeckel. Wirst sehen, die werden nahezu magisch gut halten, fast wie mit Superkleber.« Sie zwinkert ihm zu. Während sie die Bierdeckel hinter der Bar hervorkramt, erhasche ich noch mal einen Blick auf ihr hübsches Hinterteil.
»Franziska, bringst du bitte der Gabi und dem Raphi eine Halbe von Gerhards Spezial-Weihnachtsbock ins Extrastüberl?«
Jetzt erst fällt mir die dünne Kellnerin auf, die schon seit ewigen Zeiten im Rieglerbräu arbeitet und auch heute hinter der Schank steht, um Gläser in den Spüler zu räumen.
Die Marie kommt wieder an die Bar vor und reicht meinem Buben zwei mit Gummiringen umspannte Packen Bierdeckel. »Unsere neue Biersorte wird dir schmecken, Raphi.« Sie kräuselt leicht die Lippen, um gleich wieder eine ernste Miene aufzusetzen. »Ich hatte mir schon gedacht, dass da etwas nicht stimmt, als Frau Bishop bei uns zur Tür hereingekommen ist.«
»Wann genau war das eigentlich?« Jetzt bin ich doch neugierig.
Die Marie überlegt kurz. »Am Mittwoch, also vor vier Tagen. Sie hat gleich bis Ende Jänner bezahlt. Die Erni wollte übrigens wirklich schon bei euch anrufen, aber dann waren die beiden Gäste über Weihnachten zwei Tage weg, und wir haben angenommen, dass sie bei euch sind und der Anruf unnötig ist.« Während die Marie noch spricht, drückt mir die Franziska mit einem leisen Gruß eine Halbe in die Hand und verschwindet mit der zweiten in Richtung Stüberl.
»Nun, du schaust ihr übrigens sehr ähnlich, dieser Frau Bishop … deiner Mutter, meine ich.« Da ich nicht antworte, klettert die Marie etwas verlegen auf den Barhocker zurück und widmet sich wieder meinem Sohn, der schon konzentriert an einem neuen Bierdeckelturm baut.
Ich hingegen mache mich wortlos auf in Richtung Extrastüberl, vorbei an einem mächtigen Christbaum im Schankraum und dann durch eine moderne Glasschiebetür, die sich wie von Zauberhand vor mir öffnet. Auch in diesem Bereich wurde umfassend modernisiert, das frühere Fichtenholzstüberl ist als solches nicht mehr wiederzuerkennen. Genauso wie in der Schankstube sind die neuen Tische aus dunklem massiven Holz, und die ehemalige einfache Tür zum großen Saal wurde durch eine breite Schiebetür ersetzt, die momentan geschlossen ist.
Meine Schwiegereltern stehen sofort von ihren Stühlen auf, als sie mich erblicken. Vermutlich wollen sie die Flucht ergreifen, denke ich mir.
»Also, wir machen uns jetzt auf den Weg hoam, ist a lange Fahrt.« Der Sepp kratzt sich wie so häufig verlegen die Glatze. »Außerdem wollen wir net stören, habts bestimmt so einiges zu bereden. Pfiat enk, alle miteinand.« Während die Hanni nach einem knappen Gruß durch die Glastür verschwindet, reicht er mir die Hand und blickt mir zum ersten Mal seit Jahren wieder pfeilgrad in die Augen. »Kannst den Felix gerne über die nächsten Tage und Silvester zu uns bringen. Wir täten uns recht narrisch freuen, wenn der Bub mal länger bei uns ist.«
Ich wiederum freue mich über seine versöhnliche Art. Nachdem auch er durch die Glastür verschwunden ist, nehme ich solidarisch neben meiner Schwester Platz. Zurückgelehnt im Stuhl und mit verschränkten Armen sitzt die Gabi der dicken Frau gegenüber, fixiert sie grimmig und schimpft in einem unglaublichen Tempo vor sich hin. Ich überlasse die Bühne vorerst ihr und nutze die Zeit, um die Frau eingehend zu betrachten, die ganz offensichtlich meine Mutter ist. Sie sieht mir tatsächlich ähnlich, denke ich mir. Oder ich ihr, wie man es halt nimmt. Kurze schwarze Locken umrahmen ihr kantiges, stark geschminktes Gesicht mit hohen Backenknochen, ihre Nase ist lang und schmal wie meine. Nur meine weit weniger fleischigen Lippen hab ich Gott sei Dank vom Vater geerbt. Im Gegensatz zu mir ist die Frau mächtig dick, weit dicker noch als die Gabi. Dafür hat sie keine einzige Falte im Gesicht. Ich rechne kurz nach; sie hat meine Schwester sehr jung zur Welt gebracht, also sollte sie erst knapp über sechzig sein. Aber noch nicht mal danach sieht sie aus.
»Liza, how are you, darling?« Der kleine, dünne Mann steckt vorsichtig seinen Kopf ins Stüberl herein. Meine Mutter hieß früher Elisabeth Aigner, erinnere ich mich. Mein Vater nennt sie, wenn er von ihr spricht, heute noch »Liesl«.
Die dicke Liza scheucht ihn wortlos mit den Händen weg, und der Mann verschwindet folgsam. »My kids, I never thought I’d have the chance –«
»Wennst jetzt net gleich Deutsch mit uns redest, dann wirst du mich kennenlernen, das schwöre ich dir.« Die Lippen meiner Schwester beben vor Wut.
»Gabi, wie sie laibd und lebd. Maine wunderschone Tochter.« Ihr Akzent ist grauenhaft.
»Ich bin net deine Gabi. Und jetzt sag, was du plötzlich von uns willst. Wir sind die letzten Jahrzehnte ganz gut ohne dich zurechtgekommen.«
»Und du, main süßer Raphael! Was hab ich dir vermisst in all die Jahre! Euch baide.« Die Frau ignoriert Gabis Worte und quetscht sich theatralisch eine Träne aus dem linken Auge.
»Na ja, so schlimm kann’s nicht gewesen sein. Sonst hätte ich nicht neununddreißig Jahre alt werden müssen, um mal wieder die Stimme meiner Mutter zu hören. Gell, Liesl?« Das hab ich mir jetzt nicht verkneifen können.
Die viel zu grell geschminkte Frau wirkt nun doch ein wenig irritiert. »Glaub mir, Raphael, wenn euer Vater ein bissel cooperative gewesen wäre, dann hätte ich mich bei euch gemeldet.« Sie legt ihre fleischige Hand auf meinen Arm. »Immer wieder over the past years hab ich an mainen süßen klainen Jungen gedacht.«
Ich fühle mich im wahrsten Sinne des Wortes unangenehm berührt.
»Pah, dass ich nicht lach.« Meine Schwester kriegt vor Empörung kaum Luft. »Unser Vater soll nicht erlaubt haben, dass du Kontakt zu uns hast, oder wie? So einen Schmarrn hab ich ja noch nie gehört! Der Papa hat dir doch alles verziehen, obwohl du ihn nach Strich und Faden betrogen hast. Ich war zwar noch klein, aber ich kann mich an alles ganz genau erinnern. Unser armer Vater hat sich noch Jahre später wegen dir die Augen ausgeweint.«
Die Liesl nimmt ruckartig die Hand von meinem Arm. »Ich muss euch baiden so viel erklären. That’s why I’m here. Main Leben lang habe ich euch vermisst, und jetzt möchte ich mit maine kids Frieden schließen.«
»Wer’s glaubt. Von mir aus kannst du das deiner Großmutter erzählen. Langsam wird mir die Luft zu knapp hier. Warum rückst du nicht einfach mit der Wahrheit raus?« Die Gabi holt tatsächlich tief Luft und springt auf. »Tut mir leid, Raphi, aber ich pack die Lügerei keine Minute länger. Ich fahr mit dem Felix heim.« Dann dreht sie sich zur Liesl und hält ihr drohend den Zeigefinger vor die Nase. »Und du, lass dir eine bessere Gschicht einfallen, wenn du jemals wieder mit mir reden willst.« Und weg ist sie.
Die fette Liesl schaut ihr mit offenem Mund nach. »So habe ich sie mir vorgestellt, ganz genau so«, sagt sie dann, und es schwingt sogar etwas Stolz in ihrer Stimme mit. Aber gleich darauf setzt sie erneut einen leidenden Blick auf, der so gar nicht zu ihr passen will. »Raphael, gib wenigstens du mir eine Chance.«
Ich bin etwas durch den Wind; ich weiß eigentlich nur das wenige über sie, das mir meine Schwester vor gut einer Stunde erzählt hat. Die ganze Situation kommt mir reichlich grotesk vor. »Von mir aus, dann höre ich mir halt deine Geschichte an. Garantieren kann ich dir allerdings nichts, Liesl.« Ich nenne sie absichtlich so, das Wort »Mutter« kommt mir garantiert nicht über die Lippen. Allerdings muss ich ja nicht gleich so hysterisch tun wie die Gabi und proste ihr mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht zu.
Die Frau nimmt einen kräftigen Schluck vom Bier, ein weiteres Anzeichen dafür, dass sie mit mir verwandt sein muss. Dann wirft sie einen Blick auf ihr blinkendes Handy, das am Tisch vor ihr liegt, wischt kurz übers Display und lässt es anschließend rasch in der Tasche ihrer Weste verschwinden.
»To be honest, son, I’m completely exhausted this evening. Actually, I really need eine klaine Pause. Außerdem muss ich dringend telefonieren. Komm doch morgen Nachmittag hier vorbai, dann reden wir. Dann wirst du auch verstehen, dass deine Mom bald eine ganz große Nummer in this shitty Koppelried sain wird.« Sie steht auf, trinkt den Rest des wirklich ausgezeichneten Biers in einem Zug aus und tätschelt mir zum Abschied schon wieder wie einem kleinen Kind die Wange. »You’re a good guy, just like Simon, your little brother.«
Damit quetscht sie ungerührt ihren massiven Körper aus der Bank und lässt mich total durcheinander alleine zurück. Was war denn das jetzt, bitte schön? Wollte die mir nicht grad vorhin noch alles erklären? Also? Und wer soll dieser Simon sein? Mein kleiner Bruder? Ich glaub, ich spinn.
Ein paar grüblerische Minuten später lasse ich das noch halb volle Bierglas stehen und verlasse ebenfalls das Stüberl. Der Schankraum ist um einiges voller geworden, zahlreiche Gäste wollen im Rieglerbräu am zweiten Feiertag nach Weihnachten zu Abend essen. Auf jedem Tisch verbreiten Kerzen heimelige Stimmung, der Christbaum tut sein Übriges. Außerdem steht die Erni in der Küche, die alte Wirtin vom Rieglerbräu. Ihre Salzburger Gerichte, vor allem ihre in Butterschmalz herausgebackenen Schnitzel, sind mittlerweile weit über die Grenze zu Deutschland bekannt und locken seit Kurzem sogar schon manchen Bayern in unser kleines Koppelried. Apropos Bayern, ganz hinten beim Ausgang zum Gastgarten entdecke ich einen für sein Alter gar nicht schlecht aussehenden Endfünfziger. Ich kenne den Mann noch von meinen Ermittlungen im Sommer, als ich nach Maries Verhaftung auf eigene Faust nach dem Mörder von Max Riegler gesucht hatte. Es ist Paul Deinhard, seines Zeichens Münchner und der frühere Lebensgefährte von Marie. Die neben ihm sitzt. Vor ihnen zwei langstielige, gut gefüllte Rotweingläser, in der Mitte des Tisches eine schmale, flackernde Kerze. Schaut ganz danach aus, dass der Kerl immer noch an ihr interessiert ist. Keine Ahnung, warum, aber ich beschließe spontan, doch noch ein Bier an der Bar zu trinken.
Erfreut stelle ich fest, dass sich der neue Barhocker so in Position drehen lässt, dass ich die Marie im Blick behalten kann. Ich hatte ganz vergessen, wie hübsch diese Frau ist.
»Oha, der Aigner. Lang haben wir dich da nimmer g’sehen. Ihr Aigners habts a Glück, dass wir heut offen haben. Weihnachtsromantikdinner, a Idee von der Marie. Ist ausgebucht.« Die Erni ist hinter der Bar aufgetaucht.
Gut schaut sie aus, denke ich mir. Zwar trägt sie immer noch das schwarze Dirndl und den grauen Dutt am Kopf, kommt aber frisch und schwungvoll daher. Obwohl die kleine Frau so dünn ist, sind die vielen Sorgenfalten der letzten Monate beinahe vollständig aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie sieht um Jahre jünger aus. Es scheint, als täte die Marie ihr gut.
»Viel zu lang, wiest sehen kannst.« Vorwurfsvoll nickt sie Richtung Marie. »Der oide Latsch da will unserer Wirtin den Kopf verdrehen. Aber der passt gleich gar net da her zu uns. Nicht nur a Bayer! Noch schlimmer, a Münchner! I kann den eitlen Geck net leiden. Der will sie nur wegholen von uns, und da sei mir der Herrgott davor und alle seine Heiligen.«
Wer hätte noch vor einem halben Jahr gedacht, dass die Erni, Tante des ermordeten Brauwirts, jemals so über die Marie sprechen würde. Ich nicht.
»Was magst trinken, Aigner? A Riegler Helles?« Ohne meine Antwort abzuwarten, zapft sie mir eins und schenkt sich selbst ihren obligatorischen Schnaps ein. Die Erni war schon immer eine kleine Schnapsdrossel, übertreibt es aber nie. Oder sie verträgt einfach nur unheimlich viel, denke ich mir.
»Geht aufs Haus. Sag, willst net wieder öfter mal bei uns vorbeischauen? Das kann ja net sein, dass du als Oanziger im Ort immer noch bös auf die Marie bist, oder?« Die Erni runzelt die Stirn und fixiert mich listig mit ihren kleinen Schweinsaugen.
Aber böse bin ich ihr nicht mehr. Oder doch? Ich weiß es nicht, darüber hab ich nie nachgedacht. Was ich hingegen weiß, ist, dass mir der Geck dort drüben nicht gefällt.
Erst als ich sie schon minutenlang frech angestarrt habe, bemerkt mich die Marie endlich und nickt mir zu. Der Deinhard legt sofort besitzergreifend seine Pranke um sie, von der sie sich aber gleich wieder befreit. Nachdem sie kurz etwas zu ihm gesagt hat, kommt sie tatsächlich zu mir an die Schank. »Und, Raphi, konntest du mit der Frau reden?«
Die Erni begibt sich dezent wieder zu den Gläsern hinter dem Tresen und tut geschäftig.
»Wie man’s nimmt, reden ist wohl nicht das richtige Wort dafür. Aber sag, wie geht’s dir eigentlich so, Marie?« Ihr Lächeln lässt mich ganz unvermutet an unsere gemeinsame Nacht auf ihrem weißen Sofa denken, obwohl die schon Monate zurückliegt. Schnell schieb ich die Erinnerung wieder weg.
»Wie soll es mir schon gehen? Du musst dich nur umschauen, Raphi. Das Schicksal hat es wirklich gut mit mir gemeint. Neben meinem Onkel kümmert sich nun auch die Erni um mich. Mit ihrer sehr bestimmten, aber lieben Art.« Sie schmunzelt, als ihr Blick die ältere Frau hinter der Bar streift.
Die Erni wiederum grinst bis über beide Ohren, bevor sie in die Küche abrauscht. Die beiden Frauen scheinen wirklich ein gutes Verhältnis zueinander zu haben, denke ich mir.
»Meinen Onkel hab ich heute Morgen nach Bad Vigaun gebracht, er macht dort eine Kur wegen seiner Herzprobleme«, fährt die Marie fort. »Ehrlich gesagt bin ich erleichtert, dass die beiden Streithanseln so wenigstens mal für ein paar Wochen getrennt sind. Die Erni und er liegen sich ständig in den Haaren, wenn es um mich geht. Aber ich verstehe mich wirklich prächtig mit ihr. Und auch mit unserer Belegschaft. Das Geschäft floriert, vor allem die Brauerei, die Koppelrieder haben mich voll und ganz akzeptiert, und das, obwohl ich hier so etwas wie eine Persona non grata war.« Sie sieht richtig glücklich aus.
»Und ganz offensichtlich hast du auch einige hartnäckige Verehrer«, ergänze ich und proste ihr augenzwinkernd zu.
»Stimmt, Raphi. Sehr ernsthaft interessierte sogar.« Sie lächelt geheimnisvoll.
»Wenn du noch kurz Zeit hast, setz dich doch her zu mir, Marie. Ich glaub, mir war gar nicht bewusst, wie sehr mir das Rieglerbräu gefehlt hat.«
Sie blickt mich erstaunt an, nimmt aber am freien Barhocker neben mir Platz. »Aha, das Rieglerbräu hat dir also gefehlt.«
»Tja, wer hätte das gedacht, das Rieglerbräu«, bestätige ich schmunzelnd. »Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich jetzt wieder öfter hier auftauche. Im Moment hat sich ja auch sozusagen ein Teil meiner Familie bei euch einquartiert.« Die dicke Frau schiebt sich wieder vor mein geistiges Auge. »Marie, ich sag dir, nie hätte ich mir gedacht, noch einmal die Stimme meiner Mutter zu hören. Das haut mich schon ziemlich um.«
Mitfühlend legt sie ihre Hand auf meine, zieht sie aber gleich wieder weg. Erstaunlicherweise hat mich die kurze Berührung bis in die Haarspitzen elektrisiert. »Ich kann mir gut vorstellen, wie es dir und der Gabi jetzt geht.«
»Na ja, bei mir überwiegt vorerst die Überraschung. Stell dir vor, ich habe offenbar noch einen Bruder.« Ich erzähle ihr alles, von dem Überfall der Frau bei uns heute Nachmittag bis hin zu dem kurzen Gespräch vorhin. Eigenartigerweise tut es gut, sich mit ihr darüber zu unterhalten, die Marie ist eine gute Zuhörerin. So ins Gespräch vertieft, bemerken wir gar nicht, dass der Deinhard auf einmal neben uns steht. Dann vernehmen wir ein Räuspern und sehen seinen säuerlichen Gesichtsausdruck.
»Ich muss jetzt wirklich zurück nach München, Marie. Schade, dass du gar keine Zeit mehr für mich erübrigen konntest und ich alleine dinieren musste. Zu zweit hätte es mir mehr Freude bereitet.«
Dem sein Abend ist wohl gelaufen, denke ich mir schadenfroh.
Etwas zerknirscht rutscht die Marie vom Stuhl und verabschiedet sich unter Entschuldigungen von ihm.
Der Münchner küsst sie demonstrativ auf die rechte und die linke Wange. Mich bedenkt er anschließend mit einem ziemlich unfreundlichen Blick. »Der Herr Polizist, falls ich mich recht erinnere; es ist ja schon ein Weilchen her. Auf Wiedersehen.« Mit leicht hängenden Schultern verlässt er das nun schon beinahe leere Lokal. Ganz in unsere Unterhaltung versunken, haben wir offenbar völlig die Zeit übersehen, stelle ich erstaunt fest.
Die Erni schwirrt zufrieden an uns vorbei und zwinkert mir verschwörerisch zu, nachdem sie auch die letzten beiden Gäste abkassiert hat.
Ich finde, ich sollte besser auch von hier verschwinden, und rutsche vom Barhocker. Doch so schnell kann ich gar nicht schauen, da schiebt mich die alte Wirtin wieder zurück.
»Aber geh, ihr jungen Leut könnts ruhig noch dableiben. Wozu haben wir denn so a gmiatliches Wirtshaus. I sperr derweil schon mal zua, aber unterhaltets euch ruhig weiter, ihr zwoa.«
Weil ich austreten muss, steh ich trotzdem kurz auf, und als ich wieder zurückkomme, ist die Schankstube leer bis auf die Marie, die am Barhocker sitzt und nachdenklich ihr Weinglas zwischen den Fingern dreht. Die Hängelampen sind aus, nur mehr die Bar ist dezent und stimmungsvoll beleuchtet. Dafür hat sicher die Erni gesorgt, bin ich überzeugt. Als sich die Marie auch noch die langen Locken aus der Stirn streicht und lächelt, werfe ich alle meine Bedenken über Bord. Was soll’s, ein kleiner Flirt wird ja noch erlaubt sein. Also greife ich nach dem für mich bereits gefüllten Rotweinglas und komme ihr beim Zuprosten sehr nahe.
Da stürmt auf einmal der dünne alte Mann mit geflochtenem Zopf im hellgrünen Flanellpyjama die Treppe herunter in den Schankraum. »Please help! It’s a matter of life and death! My wife fell out of bed. Please, come with me! Hurry up!«
Die Marie und ich schauen uns kurz erstaunt an, stellen dann aber unsere Gläser ab und laufen mit dem Mann hoch zu den Gästezimmern. Dort, wo früher die beiden riesigen Wohnungen vom Riegler und seinen Eltern waren, sind zwei Gästezimmertrakte entstanden. »Zimmer 1–4«, steht über der Tür zum rechten Trakt, »Zimmer 5–10« über der zum linken. Am Ende der Treppe angekommen folgen wir dem kleinen Mann durch die schon offen stehende Tür nach rechts und dann bis zum Zimmer Nummer zwei, dessen Tür ebenfalls sperrangelweit geöffnet ist.
»Wir haben zwei Zimmer an die beiden vermietet, sie sind unsere einzigen Gäste. Es ist alles noch ganz neu«, erklärt die Marie rasch, bevor ich nach ihr das Zimmer betrete.
Ein unübersehbarer Fleischberg in rotem Satinnachthemd hebt und senkt sich schwer atmend links neben dem Bett. Das Hemd ist der Frau fast bis über den unförmigen linken Busen gerutscht und beschert uns einen unappetitlichen Anblick. Vor allem mir, ihrem potenziellen Sohn, denke ich mir, und will eigentlich nicht näher rangehen.
Die Marie erkennt sofort die Lage und zieht der Liesl flink das Hemd nach unten. Also bewege ich mich doch vor zum Bett und beuge mich über die am Boden liegende Frau, die meine Mutter ist. Zur Belohnung weht mir eine Alkoholfahne entgegen, die mich kurz nach Luft schnappen lässt. Ich tippe auf Schnaps, da eine zur Hälfte geleerte Flasche am mit Krimskrams vollgeräumten Nachttisch steht.
Auch die Marie weicht zurück, um die Tür zum Balkon zu öffnen. Danach hieven wir beide die dicke Frau hinauf aufs Bett. Die arme Marie muss sich dabei gehörig anstrengen.
Dann klatsche ich der Liesl ein paarmal mit der Hand ins Gesicht, und sie öffnet die Augen.
»Fine, honey. Like it, lllike youuu«, lallt sie, und gleich darauf setzt ein geräuschvolles, schmatzendes Schnarchen ein.
Die Marie hat inzwischen im Bad ein Handtuch angefeuchtet und legt es ihr auf die Stirn.
Die Liesl schnarcht indessen ungerührt weiter wie ein Holzfäller.
Mehr können wir nicht tun.
Immerhin ist der kleine Mann im Flanellpyjama, der die ganze Zeit über unbeholfen vor dem Bett auf und ab gegangen ist, nun sichtlich beruhigter und bedankt sich überschwänglich. Kurz kramt er in Liesls Handtasche und will der Marie ein paar Geldscheine zustecken, aber die lehnt entrüstet ab.
Wir sehen zu, dass wir so rasch wie möglich aus dem streng riechenden Zimmer hinauskommen, und lehnen uns, nachdem ich die Tür leise hinter uns geschlossen habe, einander gegenüber mit dem Rücken an die Flurwand. Als wir gleichzeitig loslachen, blicke ich in Maries schönes Gesicht, und es überkommt mich einfach. Ich gehe auf sie zu, drücke sie sanft gegen die Wand, und mein Mund ist ihrem so nahe, dass ich sie eigentlich küssen müsste.
Halt, Aigner, denke ich mir plötzlich. Halt, halt, halt. Was tust du Irrer denn da schon wieder!
Rasch lasse ich sie los und trete einen Schritt zurück. »Marie«, ich muss mich räuspern, »ich glaube, ich gehe jetzt doch besser heim.« Weil ich schließlich weiß, wohin das sonst führt. Und das geht auf keinen Fall. Schon gar nicht vor dem Zimmer meiner schnarchenden Mutter.
Die Marie atmet tief ein und aus und stimmt mir schließlich zu. »Du hast vollkommen recht, Raphi. Der Wein ist uns zu Kopf gestiegen.« Verlegen zupft sie an ihrem Pulli, begleitet mich noch bis zur schweren hölzernen Eingangstür vom Rieglerbräu, aber verabschiedet sich nicht. Als ich draußen bin, schließt sie einfach wortlos die Tür hinter mir.
Vorm Wirtshaus bleibe ich wie angewurzelt stehen. Na super, ich werde doch auf meine alten Tage kein Weichei. Sonst hab ich doch auch keinerlei Hemmungen bei den Frauen. Das Auftauchen der Liesl wie aus dem Nichts hat mich wohl komplett durcheinandergebracht. Ich atme tief durch, ziehe mir die Kapuze meiner Jacke über den Kopf und mache mich im Salzburger Schnürlregen zu Fuß auf den Weg nach Hause. Gut so, denke ich mir schließlich. Noch mal eine Bettgeschichte mit der Marie, und meine Familie und der halbe Ort würden mich steinigen. Warum nur bringt diese Frau mich immer wieder in solche Situationen, sobald ich allein mit ihr bin?, überleg ich. Ich will doch nichts von der Marie, wiederhole ich dabei wie ein Mantra mehrmals. Ich will doch wirklich überhaupt nichts von ihr.
Zu Hause krame ich in meiner Hosentasche nach dem Haustürschlüssel, denn wenn meine Schwester abends alleine daheim ist, sperrt sie ausnahmsweise ab. Im selben Moment vibriert mein Handy in der Jackentasche, und ich ziehe es heraus.
»Schau an, der Raphi lebt noch. Bist noch munter?« Es ist Monis Antwort auf meine WhatsApp-Nachricht von heute Nachmittag. Das Handy vibriert noch mal, diesmal in meiner Hand. »Fahr grad vom Dienst heim. Magst mich besuchen?«
Natürlich weiß ich, wo die Moni wohnt, ich war ja vor zwei Wochen bei ihr.
Ich hab den Schlüssel schon ins Schloss gesteckt, aber noch nicht umgedreht, da vibriert das Handy wieder. »Wenn nicht, geh ich halt in den Club.«
Aigner, das kannst du nicht machen, denke ich mir, noch während ich tippe: »Bin in 25 Minuten bei dir.«
»Freu mich ganz doll. Kuss, Moni«, kommt es flugs zurück.
Montag
»And it burns, burns, burns – the ring of fire«, singt Johnny Cash zum wiederholten Mal mit penetrant lauter und tiefer Stimme. Das ist der Klingelton für meine Schwester. Ich taste langsam mit der linken Hand unters quietschende Metallbett, während die Moni schwer auf meinem rechten Arm liegt und mir auf die Schulter sabbert. Obwohl, schwer ist sie nun wirklich nicht, eher das komplette Gegenteil. Ich ziehe meinen Arm vorsichtig unter ihr heraus, aber sie schläft unbeeindruckt weiter.
»Jaaa?«, krächze ich mit belegter Stimme ins Handy.
»Wo bist du?« Meine Schwester ist auf hundertachtzig oder noch mehr. »Oder besser: Wo ist mein Auto?«
Ach, stimmt ja, ich hab mir gestern Nacht ihre Rostlaube quasi ausgeliehen. »Ich hab dir doch eine Nachricht geschickt, dass ich es mir kurz ausborge.«
»Mag sein, aber du hast mir nicht mehr meine Frage beantwortet, nämlich wann der Herr Aigner gedenkt, es mir wieder zurückzubringen und seinen Hintern nach Hause zu bewegen. Wir haben schließlich so einiges zu besprechen. Kommt nicht alle Tage vor, dass die verschollene Mutter aus dem Nichts auftaucht.«
Sie legt auf, und ich krieche etwas schuldbewusst aus dem Bett. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass es schon kurz vor elf ist, ich sollte mich also schleunigst fertig machen. Zu allem Überfluss hab ich heut auch noch Nachmittagsdienst. Also nehme ich eine Fünf-Minuten-Blitzdusche, verlasse die Wohnung und laufe die drei Stockwerke zu Fuß hinunter, um wach zu werden.
Mein Auto, oder eigentlich der alte Fiesta meiner Schwester, steht nicht mehr vor dem Haus. Genauer gesagt steht er nicht mehr im Halte- und Parkverbot vor dem kleinen Supermarkt, obwohl ich mir sicher bin, dass ich ihn gestern Nacht dort abgestellt habe. Während ich mich noch wundere, bleibt eine alte Frau in braunem Mantel mit Stock und Hut samt Fasanenfeder am Hutband direkt vor mir stehen.
»I kenn solchane Burschen wia Eana, immer wieder sag i’s euch, immer wieder. Genau da lassen s’ die Autos alle abschleppen. Dann ziagt euch der Staat das Geld aus den Taschen, und recht hat er.« Während sie schimpft, klopft sie unablässig mit ihrem Stock gegen mein Schienbein. Ich greife nach dem Stock, weil sie mir wehtut.
»Aber ihr Jungen wollts nia drauf hören, was unsereiner zu sagen hat, gell. Schon deppert, aber des haben S’ jetzt davon. Das g’schiacht Eana schon recht.« Sie lacht mich schadenfroh aus.
Und ich stehe wie ein Depp neben ihr und starre auf die Stelle mit dem nicht mehr geparkten Wagen.
Die Moni hat einen gesegneten Schlaf, die weckt so schnell nichts und niemand, daran kann ich mich leider jetzt auch wieder erinnern. Nachdem ich etwa zehn Minuten an der Eingangstür Sturm geläutet, damit sämtliche Nachbarn verärgert und sie viermal vergeblich am Handy angerufen habe, öffnet sie mir schließlich doch noch just in dem Moment verschlafen die Tür, in dem ich beschlossen hab, sie brachial einzutreten. Dabei falle ich der jungen Frau fast in die Arme.
»Oha, so stürmisch, Aigner. Hast schon wieder Sehnsucht nach meinem Körper, gell?« Die Moni grinst, ihre kurzen Haare stehen strubblig in alle Richtungen ab. Bekleidet ist sie nur mit einer Unterhose, was den Nachbarn, der neugierig den Kopf durch die Wohnungstür gegenüber steckt, äußerst nervös zu machen scheint. Obwohl die Moni, nicht nur von Weitem betrachtet, mit ihrer neuen Stachelfrisur beinahe schon als Bursche durchgeht. Einen Busen hat sie auch kaum. Als ich das Mädel vor ein paar Monaten kennengelernt habe, war sie noch eine sehr attraktive Brünette mit flottem kinnlangen Haar.
»Also, ich würde mir mal was anziehen, zumindest ein T-Shirt.« Unsanft schiebe ich sie in die Wohnung zurück, wo ich ihr mein Dilemma erkläre.
»Ja mei, dann bring i dich halt nach Koppelried. Schlafen kann i nachher auch noch.«
Während die Moni ausgiebig duscht, läutet mein Handy. Diesmal ist es dienstlich.
»Chef, die Erni vom Rieglerbräu hat grad ang’rufen.« Es ist die Gerti, Verwaltungsangestellte und gute Seele meiner Inspektion. »Dein Vater, der schreit in ihrer Schankstuben rum. Du musst unbedingt sofort dorthin. Die Erni hat g’sagt, der Bus mit den Gästen für das Brauseminar käme gleich, und wenn der net zum Schreien aufhört, dann kann sie für gar nix mehr garantieren. Die ist fuchsteufelswild. Ich wollt niemand anders hinschicken, weil es ja dein Vater ist.«
Ich beruhige die Gerti und versichere ihr, mich sofort auf den Weg zu machen. Dann drehe ich der Moni unsanft den Duschhahn zu, obwohl sie protestiert.
Munter vor sich hin schimpfend schlüpft sie flott in Jeans und Pulli, rubbelt sich mit einem Handtuch die streichholzkurzen Haare in Rekordzeit trocken, und endlich sind wir unterwegs.
»So, da simma schon. Aber ohne Busserl kimmst mir net aus, wenn i dich da schon herbringen hab müssen.« Die Moni grinst frech, und ich beuge mich seufzend zu ihr rüber, obwohl es grad wirklich pressiert.
Da klopft es auch schon wie wild gegen die Scheibe vom kleinen Opel Corsa. Die Moni lässt lässig meine Seitenscheibe per Knopfdruck herunter, und ich sehe in einen sehr attraktiven Ausschnitt eines blauen Salzburger Dirndls mit Froschgoscherl. In dem Ausschnitt ist nicht zu viel und nicht zu wenig, ich kenne ihn.
»Könnt ihr euch bitte anderswo abschmusen, der Lois muss da parken. Das ist nämlich der Busparkplatz«, schnauzt mich die Marie an und deutet nach hinten.
Als ich mich umdrehe, seh ich dort tatsächlich einen Bus, der uns anblinkt. Ich wünsche mir, eben mal kurz im Boden versinken zu können, aber leider wird mir der Wunsch nicht erfüllt. Was für eine Schnapsidee, ausgerechnet hier mit der Moni aufzutauchen.
Die beugt sich neugierig über mich zum Fenster hin. »Wir san grad fertig worden, Frau Wirtin. Sie kriagn ihn schon wieder, koa Sorge. Den Parkplatz, moan i«, fügt die Moni noch immer frech grinsend im breitesten Bayrisch hinzu. Ich bereue es ehrlich, dass ich dem Mädel gestern in einem schwachen Moment von meiner verkorksten Beziehung zur Marie erzählt hab.
Die Marie ignoriert die Moni und blafft mich wütend an. »Du solltest besser sofort deinen Hintern in Bewegung setzen und deinen Vater einsammeln. Mit seinem Geschrei vergrault der mir noch alle Gäste.« Mit verschränkten Armen stellt sie sich wütend neben das Auto.
Ich steige wortlos aus. Mir fällt überhaupt nichts ein, was ich spontan zu meiner Verteidigung sagen könnte. »Also, es tut mir leid … äh … Marie«, stammle ich wie ein Schulbub.
Ihr verächtlicher Blick sagt alles. Derweil reversiert die Moni mit ihren Strubbelhaaren lässig ihren Kleinwagen, wirft mir eine Kusshand zu und braust als klare Siegerin der Situation davon.
Die Marie hingegen atmet hörbar durch, bevor sie mich anschreit: »Hol endlich deinen Vater und dann verschwinde von hier! Aber flott!« Mit eisigem Blick lässt sie mich stehen und winkt den Busfahrer herbei, dem sie ein übertrieben aufreizendes Lächeln schenkt.
Ich mache mich nun doch lieber aus dem Staub und betrete die Gaststube, wo mein Vater tatsächlich laut herumschreit.
»Kimm runter da! Red mit mir, Liesl, das bist mir schuldig!« Er steht vor der breiten Treppe, die nach oben zu den Gästezimmern führt, und hält sich so verkrampft mit der linken Hand am Treppengeländer fest, dass seine Knöchel an der Hand weiß hervortreten. Mit dem Zeigefinger der rechten droht er in Richtung erster Stock. Diese Geste ist mir wohlbekannt von seinen zahlreichen Amateur-Predigten, die er mir in meiner Kindheit und vor allem Jugend gehalten hat.
Er weiß also auch schon, dass uns seine Liesl mit ihrer Anwesenheit beehrt, denke ich mir und seufze laut auf.
Im Schankraum sitzt trotz Mittagszeit nur ein älteres Paar an einem Tisch und verfolgt, genauso wie die beiden Kellnerinnen hinter der Schank, neugierig die peinliche Vorstellung meines Vaters.
Also mache ich die paar Schritte auf ihn zu und versuche, ihn zu beruhigen. »Komm, Vater, lass es gut sein. Ich bringe dich jetzt nach Hause.« Meine Worte klingen eine Spur schärfer als gewollt, wie meistens, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Ich greife nach seiner rechten Hand, aber er entreißt sie mir wie ein trotziges Kind. Erst jetzt bemerke ich, dass ihm die Tränen nur so die Wangen hinunterlaufen, und auf einmal tut er mir leid. Ich habe den Mann noch nie weinen gesehen und weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Er atmet schwer und starrt nach oben auf die schmale Galerie, die zu den beiden Trakten mit den Gästezimmern führt, als säße dort der leibhaftige Teufel.
»›Der Huren Mund ist eine tiefe Grube; wem der Herr ungnädig ist, der fällt hinein.‹« Mein Vater und seine Bibelverse; ich glaube, ich kenne sie alle auswendig. Leider. Seine Stimme überschlägt sich nahezu vor Bitterkeit. »Kimm da runter, Liesl, sonst kimm i rauf! I lass mir das net von dir bieten! Du muasst mit mir reden!«
»Lass es, Vater. Das hat doch keinen Sinn.« Als ich ihn sanft, aber doch bestimmt in Richtung Tür ziehen will, geht er kraftlos in die Knie und hockt plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.
»Junger Mann, jetzt seien Sie doch nicht so brutal«, ergreift die ältere Dame am Tisch neben dem großen Christbaum beherzt das Wort.
»Franzl.« Die dicke Liesl kommt endlich durch die Tür zum rechten Trakt und bleibt oben am Treppenansatz kurz stehen, um die Situation zu erfassen. Dann wälzt sie sich schnaufend und bedächtig, die dicke Hand zur Sicherheit immer am Geländer, zu uns herunter. Dabei klackern ihre zahllosen Ringe an den Fingern.
Mein Vater sitzt einem Häufchen Elend gleich am Boden und beobachtet wie hypnotisiert seine geschiedene Frau, die meine Mutter ist. »Liesl«, stammelt er. »Liesl, meine Liesl.«
Als sie endlich unten angekommen ist, schiebt sie mich ungerührt zur Seite, greift nach den Händen meines Vaters und stellt ihn wie einen Spielzeugsoldaten wieder auf die Beine. »Geh, Franzl, lass es guat sein.« Sie spricht unseren Dialekt, als wäre sie nie in Amerika gewesen.
Meinem Vater laufen immer noch unaufhörlich die Tränen über seine eingefallenen Wangen.
»Komm, gemma raus«, schlägt sie vor, und mein großer Vater lässt sich widerstandslos von ihr an der Hand aus dem Wirtshaus führen. Wie ein kleiner Bub, denke ich mir.
Keine Minute zu spät, denn gleich darauf lotst die Marie im blauen Dirndl eine Gruppe von etwa dreißig Leuten in die Schank, und der Gerhard, der Münchner Braumeister vom Rieglerbräu, öffnet die neue Doppeltür zum Braukeller. Auch hier ist umgebaut worden, bemerk ich jetzt. Die Tür ist nicht mehr hinter der Bar, sondern links davon, frei zugänglich. Der Gerhard geht der Gruppe mit offenen Armen entgegen, in Lederhose, kariertem Hemd und Janker. Er und die Marie im Dirndl kommen mir vor wie das berühmte Trachtenpärchen auf dem Etikett einer bekannten Getränkemarke.
»Schleich dich endlich, Aigner«, zischt der Braumeister mir im Vorbeigehen zu, bevor er sehr freundlich und im breitesten Bayrisch die Gäste begrüßt. »Liabe Leut, herzlich willkommen zur allerersten Weihnachtsführung im Rieglerbräu.« Er macht eine künstlerische Pause. »Erlebts mit mir in der nächsten hoiben Stund die reinste Bierseligkeit, mit ana warmen Brezen und am süffigen Rieglerbier. Danach werden euch unsere Wirtin und ihr Eins‑a-Team ein Biermenü servieren, das ihr so schnell nimmer vergessen werdets.« Und schon führt er die Besucher in den großen Braukeller.
Die Marie wartet lächelnd, bis alle verschwunden sind, dann schickt sie die beiden Kellnerinnen mit den Tabletts voller Begrüßungspfiff hinterher. Schließlich folgt auch sie der illustren Truppe und schließt die Tür von innen.
Sie hat mich keines einzigen Blickes mehr gewürdigt, aber das hätte ich auch nicht verdient gehabt, denke ich mir zerknirscht.
Um mein Unglück endgültig zu vervollständigen, taucht auch noch Ernis Gesicht vor mir auf. »Schleich dich, Aigner! Du Falott, kimmst da oafoch mit deinem Krispindl zu uns her. Wenn i das Madl noch amoi da seh, dann schmeiß i euch zwoa hochkant raus. So was wia dich brauchen wir da net«, keift sie mir nach, während ich schon fluchtartig das Lokal verlasse und mich zu Fuß auf den Weg zur Inspektion am nördlichen Ortsrand machen muss.
Es ist kalt, aber wenigstens regnet es nicht. Der Himmel ist grau verhangen und passt damit blendend zu meiner Stimmung. Immer wenn die Marie im Spiel ist, verhalte ich mich wie das letzte Arschloch. Ich kann mich beim besten Willen selber nicht verstehen.
»Du denkst nur an dich, Raphael.« Am Abend marschiert meine Schwester wie ein Soldat vor mir auf und ab.
Ich habe gerade noch den Felix zu Bett gebracht und ihm eine Geschichte vorgelesen. Er hat sein eigenes Zimmer oben in Gabis Wohnung, weil in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss dafür leider kein Platz ist.
Die Gardinenpredigt meiner Schwester behagt mir gar nicht, denn eigentlich hatte ich vor, den Andi zu einem gemütlichen Männerabend einzuladen und mit ihm die Sache mit der Liesl zu besprechen. Der Baumgartner Andi ist seit Kindertagen mein bester Freund und wohnt sozusagen ums Eck. Zwar immer noch wie sein Bruder Schorsch als eingefleischter Junggeselle mit knapp zweiundvierzig bei der Mutter, aber man kann nicht alles haben.
»Du kannst dich an nix halten, an rein gar nix, was wir ausmachen. Die zweihundert Euro fürs Abschleppen bezahlst du, Raphael Aigner, dass das klar ist. Und den Zweitschlüssel für meinen Wagen, den gibst mir auch zurück. Her damit.« Sie streckt mir fordernd ihre rechte Hand entgegen.
»Aber Gabi, wir haben doch ausgemacht, dass wir beide das Auto benützen können«, protestiere ich.
»Ich glaube eher, wir haben ausgemacht, dass du mein Auto fahren darfst, wenn du mich vorher fragst.« Sie nimmt mir gerade unbarmherzig den Schlüssel ab, als der Andi den Kopf in ihre Küche steckt.
»Dicke Luft, Andi. Am besten wartest du unten und nimmst dir schon mal ein Bier aus meinem Kühlschrank«, rate ich ihm und verdrehe übertrieben grinsend die Augen.
»Ähm, danke. Aber eigentlich will ich zur Gabi, net zu dir, Raphi.«
Fassungslos schüttle ich den Kopf. Neuerdings scharwenzelt mir mein Freund etwas zu oft um meine Schwester herum.
Als der Andi meine Reaktion sieht, lacht er laut und herzlich und schlägt mir mit der rechten Hand mit voller Wucht auf die Schulter, sodass es mich fast aus dem Sessel hebt. »Geh, Raphi, jetzt schau net so beleidigt drein. Deine Schwester ist doch weit schöner als du, da fällt mir die Entscheidung zwischen euch zwei net wirklich schwer.«
Die Gabi lächelt geschmeichelt und holt für ihn ein Bier aus ihrem Kühlschrank. Für mich nicht.
Mein bester Freund nimmt mir gegenüber am Tisch Platz und macht es sich gemütlich. »Sag, was hast denn schon wieder ang’stellt? Ich hab eben von meiner Mutter erfahren, dass du zuerst mit einem Mädel, das fast noch unter Jugendschutz steht, bei der Marie aufgekreuzt bist und danach im Wirtshaus deinen Vater niedergeschlagen hast. Also, Raphi, das muss jetzt wirklich net sein.«
Der Nachrichtendienst in Koppelried hat wie immer beeindruckend rasch funktioniert, denke ich mir, wenn dabei auch faktenmäßig etwas durcheinandergeschmissen wurde.
Mein Freund zwinkert mir vergnügt zu und haucht meiner Schwester dann ein Luftbusserl zu. Die beiden werden mir schön langsam unheimlich. Kennen sich seit ihrer Geburt und tun seit Kurzem so, als hätten sie sich eben erst kennengelernt.
»Weißt, ich hör schon gar nicht mehr hin, wenn die Leut über ihn reden«, seufzt die Gabi und quetscht sich nahe an den Andi ran. »Und wegen seiner Weibergschichten reg ich mich auch nicht mehr auf; wenigstens verschont er mir den Buben damit.« Sie dreht sich kurz in meine Richtung und funkelt mich böse an. »Die Marie hat der da sowieso nicht verdient, die ist viel zu gut für den.«
Hat die Marie etwa gepetzt? Obwohl ich mir meiner Schuld bewusst bin, setze ich meinen treuherzigsten Blick auf. Es nützt nichts. Meine Schwester ignoriert mich und prostet dem Andi zu. Dass sich die beiden bei der Gelegenheit viel zu lange in die Augen schauen, fällt selbst mir auf.
»Du bist schon ein Depp, Raphi. Such dir endlich mal eine feste Freundin, der Felix wird es schon verkraften«, fällt mir der Andi in den Rücken.
»Den Felix lasst mir dabei aus dem Spiel«, hebt die Gabi drohend ihren Zeigefinger.
»Ehrensache. Aber ich glaub, der Raphi sollte endlich mal seine Beziehungsunfähigkeit überwinden«, faselt mein Freund neunmalklug daher.
Über so einen Vorschlag kann ich nur lachen, da redet nämlich genau der Richtige. Der Andi hatte, seit ich ihn kenne, noch nie länger als vier Wochen ein und dieselbe Freundin. Und ich kenne ihn schon ewig.
»Das ist mir mittlerweile eh wurscht, aber was mich wirklich ärgert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der er annimmt, ich wär nur für ihn da. ›Die Gabi kocht, die Gabi wäscht und bügelt, die Gabi putzt‹«, äfft mich meine Schwester völlig talentfrei nach.
»Einspruch«, werfe ich zaghaft ein, »meine Wohnung putze ich immer selber.«
Sie würdigt mich keines Blickes. »Er nimmt sich sogar sein Essen aus meinem Kühlschrank.«
»Gabi, ich bezahle alle unsere Einkäufe, auch deine, falls du das vergessen hast.«
Wieder wird meinem Einwand keine Beachtung geschenkt, meine Schwester ist schon zu sehr in Fahrt. »Und auf einen Dank dafür, dass ich den Felix quasi alleine großziehe, kann ich ewig warten. Dabei hab ich doch auch ein eigenes Leben.«
Jetzt ist sie ungerecht; ich verbringe beinahe jede freie Minute mit meinem Buben. Aber ich kann die unbeliebten Dienstzeiten nicht immer meinen Leuten aufs Auge drücken, da muss ich auch mal selber ran. Vor allem jetzt, nachdem unsere Mannschaft wegen Sparmaßnahmen der Landespolizeidirektion um ganze zwei Leute reduziert worden ist. »Das ist nicht fair, Gabi, und das weißt du auch.«
»Gabi, der Raphi ist wirklich ein guter Vater«, springt der Andi dann doch noch für mich in die Bresche. »In dem Punkt kann man nichts gegen ihn sagen.« Er legt seine Hand um ihre Schulter und zieht sie etwas zu vertraulich an sich ran.
Meine Schwester lässt sich das nicht nur gefallen, sondern presst sich geradezu an ihn. »Aber egoistisch ist er trotzdem. Er nimmt sich einfach mein Auto, wann immer es ihm passt, und schert sich einen Dreck darum, ob er es im Parkverbot abstellt oder nicht. Dabei ist der Kerl doch Polizist.« Sie stößt einen kläglichen Ton aus. »Und alles das gerade jetzt, wo unser Leben wegen dieser furchtbaren Frau kopfsteht.«
»Hallo? Ich bin noch da und höre alles, was du sagst. Und wegen des blöden Autos brauchst du nicht sauer zu sein, ich zahl das Abschleppen, und das Service lass ich auch gleich machen.«
»Ich hab auch mein eigenes Leben«, wiederholt die Gabi überflüssigerweise, rückt zwar etwas vom Andi ab, aber ignoriert mich immer noch. »Nachdem die Sabine verunglückt ist, haben wir ihn nur mit Müh und Not aus seiner Trauer rausziehen können. Und jetzt? Jetzt glaubt er, er sei Giacomo Casanova höchstpersönlich, und da bist du nicht ganz unschuldig dran, Andi.« Sie zwickt meinen Freund etwas verstimmt in die Seite, der daraufhin seinen Arm von ihrer Schulter nimmt, den Kopf einzieht und bedauernd die Hände hebt.
»Also, mir reicht es echt. Entweder redet ihr beide jetzt sofort mit mir und hört auf, so zu tun, als wäre ich Luft, oder ich zisch ab. Das muss ich mir wirklich nicht geben.« Ich versuche aufzustehen, aber die Gabi klopft drohend mit ihren langen rot lackierten Fingernägeln auf den Tisch.
»Wage es ja nicht. Du bleibst schön hier sitzen, Raphael Aigner, bis ich mit dir fertig bin.«
Der Andi scheint sich mittlerweile doch etwas unwohl in seiner Haut zu fühlen und wetzt unruhig am Stuhl hin und her. »Also, Raphi«, er räuspert sich, »tja, weil wir grad so nett beieinandersitzen … Nun, wir wollten dir eh schon lange was sagen …« Unschlüssig schaut er meine Schwester an, die ihm ermutigend zunickt.
»Wir?« Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
»Tja, weißt, also, äh …« Entgegen seiner sonst so selbstbewussten Art stammelt mein Freund nur mehr unsinnig herum.
Schließlich macht die Gabi dem ein Ende, nimmt besitzergreifend seine Hand in die ihre und hält mir beide demonstrativ entgegen. »Wir sind zsamm, Raphi, schon eine ganze Weile. Nur damit du es weißt. Und damit basta.«