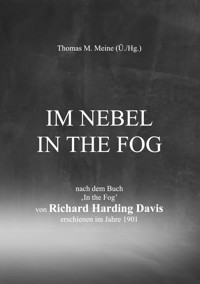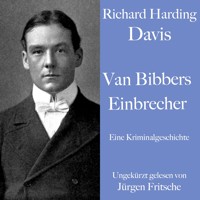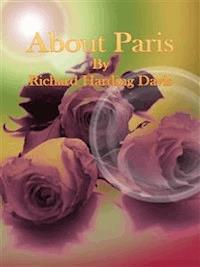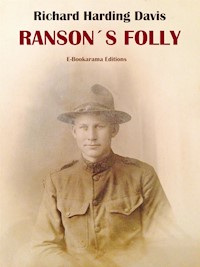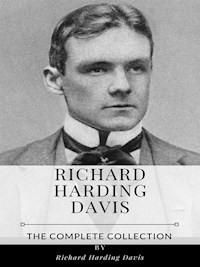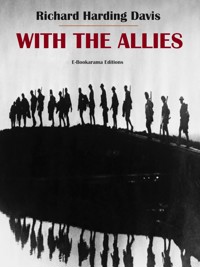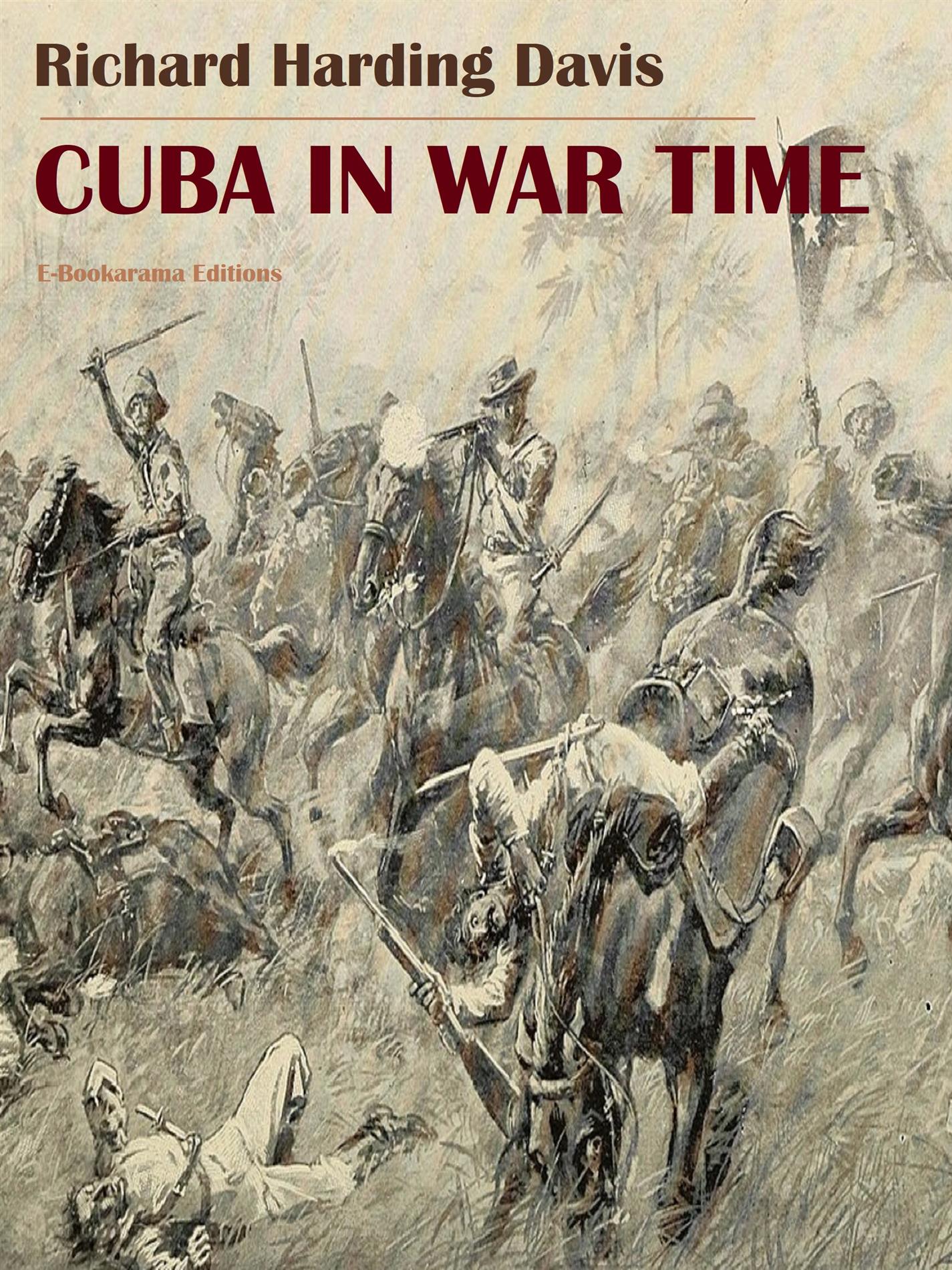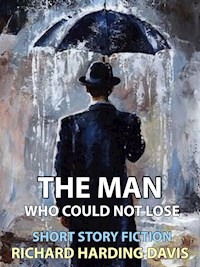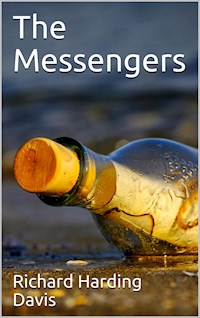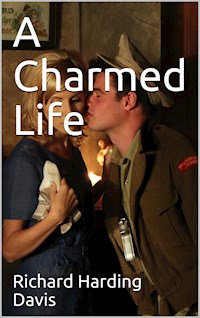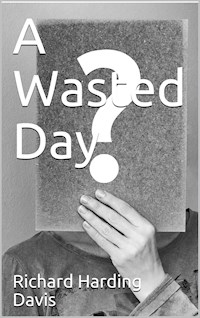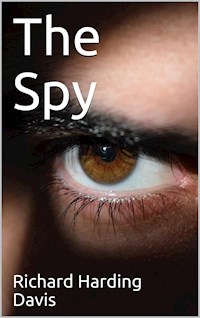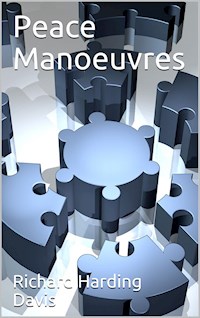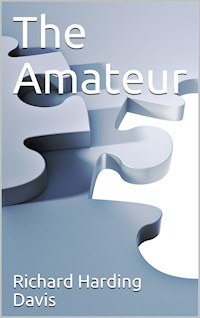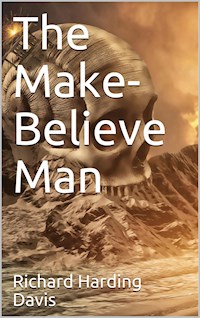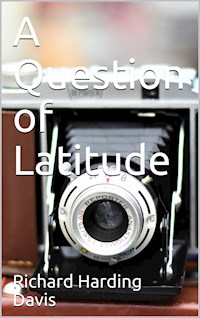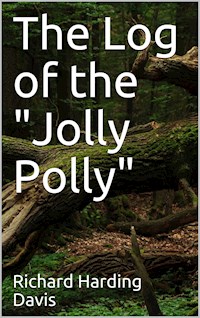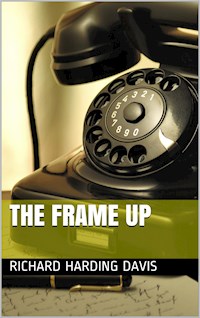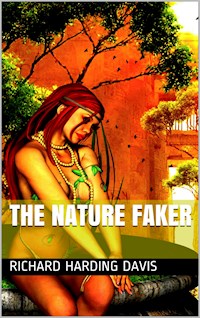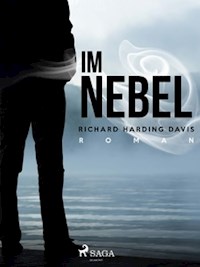
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als fünf Herren im legendären Grill-Club in London ins Gespräch kommen, sorgt in London ein Nebel für Aufregung, wie es ihn lange nicht mehr gegeben hat. Einer der Herren, ein junger Amerikaner berichtet von einem Verbrechen, in das er gestern verwickelt worden sei und das geheimnisvoller nicht sein könnte. Im tiefsten Neben sei er gestern Abend durch die Stadt geirrt und mehr zufällig in ein Haus geraten, aus dem ein Mann gestürzt sei und dabei die Haustür offen gelassen habe. Er habe das Haus betreten, um dann zu seinem Schrecken in einem der Nebenräume auf zwei Leichen gestoßen zu sein. Zudem stellte sich bald heraus, dass es sich bei beiden Leichen – einer Frau und einem Mann – um Menschen gehandelt habe, die der Öffentlichkeit durchaus nicht unbekannt seien. Voller Spannung lauschen die anderen Herren dieser Geschichte. Und genauso geht es dem Leser!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Harding Davis
Im Nebel
Autorisierte Uebersetzung von Margarete Jacobi
Saga
Ebook-Kolophon
Richard Harding Davis: Im Nebel. © Richard Harding Davis. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711462164
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Im Nebel
I.
Es hat die grösste Schwierigkeit von der Welt, im Grill-Klub Aufnahme zu finden. Für ein neues Mitglied, dessen Name in die Liste eingetragen wird, ist dies keine geringere Auszeichnung, als wenn es den Hosenbandorden erhalten hätte, oder in Thackerays »Vanityfair« karikiert worden wäre.
Wer zum Grill-Klub gehört, redet nie davon. Fragt man ein Mitglied, welche Klubs es zu besuchen pflegt, so wird es alle andern aufzählen, nur diesen nicht, aus Furcht, dass man denken könnte, es wolle mit seiner Mitgliedschaft prahlen.
Der Grill-Klub stammt aus der Zeit, da noch Shakespeares Theater auf dem Platz stand, wo sich jetzt die Expedition der »Times« befindet. Ein goldener Bratrost, den Karl II. dem Klub zum Geschenk gemacht hat, und das echte Manuskript von »Tom und Jerry in London« sind Eigentum des Klubs, und wenn die Mitglieder in ihrem Lokal Briefe schreiben, gebrauchen sie noch Streusand, um die Tinte zu trocknen.
Die Gesellschaft ist stolz darauf, dass sie mit politischer Unparteilichkeit beim Ballotieren einen liberalen und einen konservativen Premierminister hat durchfallen lassen, während in der letzten dieser beiden Sitzungen der Irländer Quiller, Q. C., der damals ein Advokat ohne Geld und Praxis war, um seiner witzigen Einfälle willen gewählt wurde.
Als der französische Maler Paul Préval, der auf Befehl des Königs nach London kam, um den Prinzen von Wales zu malen, zum Ehrenmitglied des Grill-Klubs ernannt wurde — nur Ausländer können Ehrenmitglieder sein — sagte er, als er seine erste Weinkarte unterschrieb: Es ist mir lieber, meinen Namen auf dieser Karte zu lesen, als auf einem Gemälde im Louvre.
Darauf erwiderte ihm Quiller: Das ist nicht gerade eine Schmeichelei. Die einzigen Menschen, die heutzutage ihren Namen im Louvre lesen können, sind schon seit fünfzig Jahren tot.
Am Abend nach dem grossen Nebel des Jahres 1897 waren fünf Herren im Klub anwesend. Vier davon waren eifrig mit ihrem Nachtessen beschäftigt, der fünfte sass lesend am Kaminfeuer. Es gibt nur ein Gesellschaftszimmer im Klub und einen langen Tisch. Am einen Ende des Zimmers sieht man das Feuer unter dem Bratrost rot glühen und jedesmal aufflammen, wenn das Fett herabträufelt; am andern Ende befindet sich ein grosses Erkerfenster mit Butzenscheiben, das nach der Strasse hinausgeht. Die vier Männer, die am Tisch sassen, kannten einander nicht, aber während sie ihren Rostbraten verzehrten und Sodawasser mit Kognak dazu tranken, führten sie eine so reizend angeregte Unterhaltung, dass ein Gast des Klubs — Fremde haben übrigens keinen Eintritt — sie für langjährige Freunde hätte halten können; sicherlich nicht für Engländer, die einander zum erstenmal trafen, ohne vorgestellt zu sein. Im Grill-Klub ist es nämlich Sitte und Herkommen, dass wer eintritt, mit jedem ein Gespräch anknüpfen muss, den er dort findet. Damit diese Regel streng befolgt wird, ist eben nur ein langer Tisch da, und ob nur zwei Leute anwesend sind oder vielleicht zwanzig, so werden die Kellner, dieser Regel getreu, nie verfehlen einen neben den andern zu setzen.
Aus diesem Grunde sassen also auch die vier Unbekannten zusammen beim Abendessen, und während eine Gruppe Lichter vor ihren Plätzen stand, lag der übrige Raum im Dunkel; nur der gedeckte Tisch zog sich in seiner ganzen Länge wie eine weisse Strasse durch das Zimmer.
Wie gesagt, äusserte der Herr, der eine schwarze Perle als Hemdknopf trug, die Zeiten der romantischen Abenteuer, der tollkühnen Wagestücke, sind vorüber, und zwar aus sehr naheliegenden Gründen. Wenn einer nach dem Nordpol reist, so nenne ich das noch kein Abenteuer. Jener Afrikaforscher, der junge Chetney, der gestern wieder aufgetaucht ist, während man glaubte, er sei in Uganda gestorben, hat nichts Wagehalsiges getan. Er hat Karten gezeichnet und die Quelle verschiedener Flüsse erforscht; zwar war er fortwährend in Gefahr, aber das Gefährliche an sich ist noch kein Abenteuer. Sonst würde der Chemiker, der Explosionsstoffe ausprobiert oder mit tödlichen Giften umgeht, täglich Abenteuer erleben. Ein richtiges Abenteuer muss ein Wagestück sein. Aber wer wagt denn heutzutage noch etwas? Wir sind zu gleichgültig geworden oder vielleicht zu praktisch, zu gerecht und vor allem zu verständig. Hier in dem Zimmer, wo wir sitzen, haben sich ehemals Mitglieder des Klubs mit gezogenen Schwertern darum gestritten, wie man einen von Popes Versen richtig skandieren müsse. Als einem Mitglied zufällig ein paar Tropfen Burgunder auf die Manschette gegossen wurden, war das eine so wichtige Angelegenheit, dass zehn Männer deswegen quer über diesen Tisch in Kampf gerieten. In einer Hand das Rapier, in der andern ein Licht, fochten sie miteinander und wurden alle zehn verwundet. Bei dem vergossenen Burgunder waren nur zwei beteiligt, aber die andern acht nahmen Partei, weil sich die Gemüter erhitzten. Es waren tatsächlich die angesehensten Männer ihrer Zeit. — Wenn mir heute einer der Herren Burgunder auf die Manschette gösse, ja wenn er mich selbst gröblich beleidigte, so würden sich die übrigen nicht verpflichtet fühlen, einander umzubringen. Sie würden uns einfach trennen und morgen früh als Zeugen gegen uns vor dem Polizeigericht erscheinen. Den besten Beweis dafür, wie sich die Zeiten verändert haben, liefern wir beide, Sir Andrew und ich, Ihnen heute abend in eigener Person.
Die andern drehten sich um und sahen nach dem Herrn hin, der am Kamin sass. Er war ältlich und etwas wohlbeleibt; auf seinem freundlichen Gesicht voller Fältchen lag ein beständiges, gutmütiges Lächeln und der Ausdruck eines beinah kindlichen Vertrauens. Jedermann kannte diesen Kopf zur Genüge aus den illustrierten Blättern. Der Herr hielt sein Buch auf Armeslänge wie um besser sehen zu können und zog vor gespanntem Interesse die Augenbrauen zusammen.
Lebten wir noch im achtzehnten Jahrhundert, fuhr der Mann mit der schwarzen Perle fort, so würde ich Sir Andrew heute abend, wenn er den Klub verlässt, binden, knebeln und in eine Sänfte werfen lassen. Die Wache würde ein Auge zudrücken, die Vorübergehenden das Hasenpanier ergreifen, und meine gedungenen Schergen brauchten ihn nur bis zum Morgen an einem abgelegenen Ort in Sicherheit zu bringen. Mir würde das nichts schaden, sondern nur meinen Ruf als kühner Abenteurer erhöhen; höchstens brächte der »Tattler« vielleicht einen Artikel mit der Ueberschrift: »Der Baronet und das Budget«, in dem Sternchen statt der Namen stünden.
Aber zu welchem Zweck? fragte das jüngste Mitglied. Und warum in aller Welt gerade Sir Andrew? Weshalb wählen Sie seine Person für Ihr Abenteuer?
Der Herr mit der schwarzen Perle zuckte die Achseln.
Ich möchte verhindern, dass er heute abend im Parlament das Wort ergreift. Es handelt sich nämlich um die Marinevorlage, fuhr er mit düsterm Blick fort, und Sir Andrew will für den Antrag der Regierung sprechen. Kommt es dazu, dann bringt er auch die Vorlage durch, so gross ist sein Einfluss und so zahlreich sein Anhang. Wenn nun der Wagemut unserer Vorfahren noch in mir lebte, so würde ich mir aus der nächsten Apotheke Chloroform holen, ihn dort auf dem Stuhl betäuben, den Bewusstlosen dann in eine Droschke schaffen und ihn bis zum Tagesgrauen gefangen halten. Täte ich das, so ersparte ich den britischen Steuerzahlern die Kosten von fünf neuen Kriegsschiffen, das heisst, viele tausend Pfund Sterling.
Der Sprecher wandte sich abermals um und betrachtete den Baronet mit lebhaftem Interesse, während der dritte Herr, ein Ehrenmitglied des Grill-Klubs, der sich schon durch seinen Akzent als Amerikaner gekennzeichnet hatte, leise lachend sagte:
Wenn man ihn so dasitzen sieht, sollte man nicht glauben, dass er sich viel um Staatsgeschäfte kümmert.
Die andern nickten schweigend.
Seit wir das Zimmer betreten haben, hat er kein Auge von dem Buch verwandt, bemerkte der jüngste der Anwesenden. Er beabsichtigt doch gewiss nicht, noch heute im Hause zu sprechen.
Jawohl, ohne Zweifel, versicherte der Mann mit der schwarzen Perle trübselig. Nun die Sitzungsperiode zu Ende geht, dauern die Verhandlungen oft bis tief in die Nacht. Aber bei der dritten Lesung der Marinevorlage wird er zur Stelle sein und sie durchbringen.
Das vierte Mitglied, ein starker, rotwangiger Herr in kurzer Juppe und schwarzer Krawatte, der wie ein Sportliebhaber aussah, stiess einen neidischen Seufzer aus.
Ob wohl einer von uns so kaltblütig sein könnte bei dem Gedanken, dass er, ehe noch eine Stunde vergeht, im Parlament auftreten und eine Rede halten müsste! Ich selbst würde schauderhaftes Lampenfieber kriegen. Er dagegen ist so erpicht auf das Buch, das er liest, als wenn er vor dem Schlafengehen nichts anderes mehr vorhätte.
Ja, sehen Sie nur, wie er es verschlingt, flüsterte das jüngste Mitglied. Selbst wenn er, wie eben jetzt, die Seiten aufschneidet, verwendet er keinen Blick davon. Es wird wohl ein Bericht der Admiralität sein, oder irgend ein anderes wichtiges Werk über Statistik, das sich auf seine Rede bezieht.
Das wichtige Werk, in das der berühmte Staatsmann so vertieft ist, sagte der Mann mit der schwarzen Perle in finsterm Ton, heisst: »Der grosse Raub auf der Randmine«. Es ist ein Detektivroman, den man in jedem Buchladen kaufen kann.
Der Amerikaner zog die Augenbrauen in die Höhe. »Der grosse Raub auf der Randmine«, wiederholte er mit ungläubigem Kopfschütteln. Was für ein wunderlicher Geschmack!
Es ist mehr als das — es ist sein Laster, seine Leidenschaft, die einzige Zerstreuung die er hat, versetzte der Mann mit der schwarzen Perle. Sie, als Fremder, können von dieser Idiosynkrasie natürlich nichts wissen, aber es ist allgemein bekannt. Gladstone suchte Erholung bei den griechischen Dichtern, Sir Andrew findet Zerstreuung bei Gaboriau. Seit ich Parlamentsmitglied bin, habe ich ihn nie anders auf der Bibliothek gesehen, als mit einem derartigen Roman in der Hand. Er bringt seinen Schmöker sogar in die heiligen Hallen des Unterhauses und liest ihn verstohlen in seinem Hut am Ministertisch. Hat er einmal eine Geschichte angefangen, in der Raub, Mord und Todschlag vorkommen, so kann er sich nicht wieder losreissen; weder die Abstimmungsglocke noch Hunger vermögen etwas über ihn. Sein Landhaus hat er aufgegeben, weil er sich jedesmal bei der Fahrt dorthin so sehr in seinen Detektivroman vertiefte, dass er an der Haltestation vorbeifuhr. Wenn er nur jetzt die ersten Seiten des Romans läse, statt der letzten, fuhr der Parlamentarier fort, während er die schwarze Perle unruhig hin und her drehte und verdriesslich an seinem Bart kaute. Mit noch solchem Buch könnte man ihn — so wahr ich lebe — bis zum Morgen hier festhalten, damit er nicht in die Sitzung käme — man brauchte gar kein Chloroform.
Aller Augen hefteten sich jetzt wie gebannt auf Sir Andrew, der eben mit dem Zeigefinger die beiden letzten Seiten seines Buches aufriss.
Ich gäbe gleich hundert Pfund darum, flüsterte der Parlamentarier und schlug leise mit der flachen Hand auf den Tisch, wenn ich ihm in diesem Augenblick eine neue Geschichte von Sherlock Holmes zustecken könnte, — tausend Pfund — fügte er erregt hinzu — fünftausend Pfund! —
Während der Herr sprach, beobachtete ihn der Amerikaner scharf, als hätten seine Worte für ihn eine besondere Bedeutung; dann schien ihm auf einmal ein Gedanke zu kommen, der ihm ein verlegenes Lächeln entlockte.
Sir Andrew hatte aufgehört zu lesen, aber er sass stumm da, als beschäftige er sich noch mit dem Buch und starrte in das Kaminfeuer. Eine Weile regte sich niemand, bis der Baronet die Augen aufschlug; er schien sich zu besinnen, fuhr plötzlich zusammen und tastete ängstlich nach seiner Uhr. Erregt schaute er auf das Zifferblatt und richtete sich in die Höhe.
Sofort unterbrach der Amerikaner mit heller Stimme das Schweigen.
Und doch, rief er, könnte selbst Sherlock Holmes das Geheimnis nicht enthüllen, mit dem sich die Londoner Polizei heute abend vergeblich abquält.
Bei diesen überraschenden Worten, die fast wie eine Herausforderung klangen, schraken die Herren am Tisch so plötzlich zusammen, als hätte der Amerikaner eine Pistole in die Luft gefeuert; Sir Andrew aber blieb wie angewurzelt stehen und betrachtete ihn ernst und verwundert.
Der Herr mit der schwarzen Perle fand zuerst seine Fassung wieder.
Wie so? fragte er begierig und beugte sich über den Tisch vor. Ein Geheimnis, dem die Londoner Polizei vergeblich nachspürt? Davon ist mir noch nichts zu Ohren gekommen. Bitte, teilen Sie es uns mit; erzählen Sie es uns nur gleich!
Der Amerikaner wurde rot und zupfte in grosser Verwirrung am Tischtuch.
Ausser der Polizei hat noch kein Mensch etwas davon erfahren, murmelte er, und sie weiss es nur durch mich. Es ist ein aussergewöhnliches Verbrechen, und ich bin leider die einzige Person, die Zeugnis ablegen kann. Als einziger Zeuge, werde ich von der Direktion der Kriminalpolizei hier in London festgehalten, trotzdem ich in meiner Eigenschaft als Diplomat immun bin. Mein Name, fuhr er fort, sich höflich verbeugend, ist Sears, Ripley Sears, Leutnant in der Marine der Vereinigten Staaten und jetzt Marineattaché am russischen Hofe. Wäre ich nicht heute durch die Polizei aufgehalten worden, so würde ich diesen Morgen nach Petersburg abgereist sein.
Hier stiess der Herr mit der schwarzen Perle einen solchen Freudenruf aus und geriet in so grosse Aufregung, dass der Amerikaner zu stottern begann und seine Rede unterbrach.
Haben Sie es gehört, Sir Andrew, rief der Parlamentarier frohlockend. Unsere Polizei hat einen amerikanischen Diplomaten nicht abreisen lassen, weil er der einzige Zeuge bei einem aussergewöhnlichen Verbrechen ist — dem geheimnisvollsten Verbrechen — sagten Sie nicht so, Herr Leutnant, fuhr er zu dem Amerikaner gewandt eifrig fort — das seit vielen Jahren in Londen verübt worden ist.
Der Marineoffizier nickte zustimmend mit dem Kopf und schaute die beiden andern Mitglieder an, die ihn höchst verblüfft und mit zweifelnden Blicken betrachteten.
Sir Andrew trat jetzt näher herzu, wo die Lichter hell brannten und zog sich einen Stuhl an den Tisch.
Das Verbrechen muss allerdings ungewöhnlich sein, äusserte er, sonst würde die Polizei kein Recht haben, den Vertreter einer uns befreundeten Macht zu belästigen. Wenn ich nicht genötigt wäre mich sofort zu entfernen, würde ich mir erlauben Sie zu bitten, uns das Nähere mitzuteilen.
Der Herr mit der schwarzen Perle rückte Sir Andrew den Stuhl hin und nötigte ihn zum Sitzen. Sie können uns jetzt nicht verlassen, rief er. Herr Sears steht eben im Begriff, uns zu erzählen, was er von dem merkwürdigen Verbrechen weiss.
Er nickte dem Marineoffizier und dem jüngsten Mitglied lebhaft zu, nachdem er zuerst einen zweifelnden Blick auf die Diener am untersten Ende des Zimmers geworfen hatte und lehnte sich erwartungsvoll über den Tisch. Die andern rückten ihre Stühle dichter zusammen und beugten sich vor, während der Baronet unschlüssig auf seine Uhr schaute und mit ärgerlicher Miene den Deckel schloss.
Sie können warten! murmelte er, nahm rasch Platz und bedeutete dem Leutnant anzufangen. Darf ich Sie bitten, sagte er ungeduldig.
Natürlich verlasse ich mich darauf, begann der Amerikaner, dass ich zu Ehrenmännern rede. Verschwiegenheit gilt in diesem Klub als selbstverständlich. Bis die Polizei der Presse die Tatsachen mitteilt, muss ich Sie als meine Eidgenossen betrachten. Sie haben von nichts gehört; Sie kennen niemand, der mit diesem Geheimnis in Verbindung steht. Selbst mein Name darf nicht genannt werden.
Sämtliche Herren nickten mit ernster Miene.
Das versteht sich von selbst, versicherte der Baronet eifrig, — das versteht sich von selbst.
Wenn die Rede darauf kommt, wollen wir nur von der »Geschichte des Marineattachés« sprechen, sagte der Herr mit der schwarzen Perle.
Erst vor zwei Tagen bin ich hier eingetroffen und im Bath Hotel abgestiegen, nahm der Amerikaner das Wort. Ich habe nur wenige Bekannte in London; selbst die Mitglieder unserer Gesandtschaft sind mir fremd. Als ich in Hongkong war, hatte ich jedoch grosse Freundschaft mit einem englischen Marineoffizier geschlossen, der seitdem den Dienst verlassen hat und jetzt in Rutlands Gardens gegenüber der Knightsbridgekaserne ein eigenes Häuschen bewohnt. Auf meine telegraphische Anzeige, dass ich in London sei, erhielt ich gestern früh die dringende Einladung, mit ihm in seinem Hause am Abend zu speisen. Er ist Junggeselle; wir tafelten daher allein, plauderten von alten Erlebnissen auf unserer Offizierstation in Asien und erzählten einander, wie sich unser Schicksal verändert hätte, seit wir uns damals dort kennen lernten.