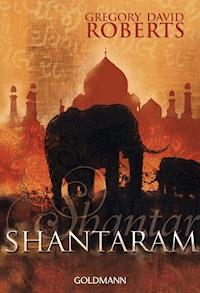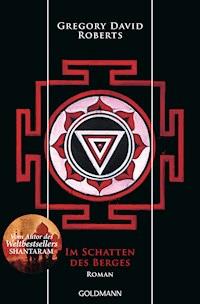
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebeserklärung an Bombay und an das Leben!
„Shantaram“ hat Millionen Leser auf der ganzen Welt berührt. Die Geschichte von Lindsay Ford, dem Australier, der aus dem Gefängnis ausbrach, in Mumbai untertauchte, als Arzt im Slum arbeitete und um die Liebe seines Lebens kämpfte, lebt in ihren Herzen weiter. Lindsay Ford wurde zu Shantaram, und die Stadt Mumbai zu seiner Heimat. Am Ende verlor er einen Menschen, den er über alles liebte, wie einen Vater verehrte: den Mafiaboss Khaderbhai.
Zwei Jahre sind seitdem vergangen, und seit Khaderbhai nicht mehr mehr da ist, bekämpfen sich die verschiedenen Gangs der Stadt immer unerbittlicher, die Gewalt eskaliert. Auf der Suche nach einem Ausweg begegnet Lin einem heiligen Mann, der alles infrage stellt, was Lin zu wissen glaubte. Am liebsten würde er die Stadt verlassen, ein neues Leben beginnen. Doch zwei Dinge halten ihn zurück: Karla, seine große Liebe, und ein fatales Versprechen, das er nicht brechen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1406
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Als »Shantaram« hat er das Herz von Millionen von Lesern berührt: der von Interpol gesuchte Australier Lindsay Ford, der aus dem Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses ausbrach und in Indien untertauchte. Zwei Jahre ist es her, dass er die zwei Menschen, die er am meisten liebte, verloren hat: zum einen Khaderbhai, den großen Anführer des örtlichen Mafia-Klans, den er wie einen Vater verehrte und den er nicht vor dem Tod retten konnte. Zum anderen seine Seelenverwandte Karla, die einen anderen heiratete.
Doch nicht nur für Lin selbst hat sich vieles verändert, auch seine Stadt, das Bombay der Armen und Vergessenen, das er sich zu eigen gemacht hat, erkennt Shantaram kaum mehr wieder: Die verschiedenen Gangs bekämpfen sich immer unerbittlicher, die Gewalt eskaliert, die Kämpfe werden zunehmend persönlicher. In einer besonders dunklen Stunde zeigt ein weiser Mann vor den Toren der Stadt Shantaram einen Ausweg, die Möglichkeit zu einem anderen Leben. Ein Leben, in dem sogar Karla wieder eine Rolle spielen könnte. Doch der Weg dorthin ist beschwerlich– und voller Gefahren…
Der Autor
Gregory David Roberts zog sich 2014 aus dem öffentlichen Leben zurück, um seine Zeit seiner Familie und dem Schreiben zu widmen.
Gregory David Roberts im Goldmann Verlag:
Shantaram. Roman ( auch als E-Book erhältlich)
Gregory David Roberts
IM SCHATTEN DES BERGES
Roman
Deutsch von Sibylle Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2015
unter dem Titel »The Mountain Shadow« by Grove Press,
an imprint of Grove Atlantic, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2015
by Gregory David Roberts
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
unter Verwendung eines Designs von Duncan Spilling
Umschlagkonzept: Gregory David Roberts
Umschlagmotiv: Detail eines Kali Yantra, 2015, Harland Miller
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-18856-6V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für die Göttin
ERSTERTEIL
ERSTESKAPITEL
Der Quell aller Dinge, das Leuchten, erscheint in so mannigfacher Gestalt wie die Sterne am Himmel. Ein guter Gedanke reicht aus, um es erstrahlen zu lassen. Doch ein einziger Fehler kann die wilden Wälder im Herzen verbrennen und alle Sterne an allen Himmeln verdunkeln. Und während jener Fehler noch wütet und man auf zerstörte Liebe oder verlorene Zuversicht blickt, mag man glauben, alles wäre vergebens und man wäre am Ende.
Doch das ist falsch. Es geht immer weiter. Was du auch tust, wo du auch in die Irre gingst – das Leuchten verlässt dich nie. Alles Gute, was im Inneren erstirbt, kann zu neuem Leben erstehen, wenn nur dein Wille stark genug ist. Das Herz kann nicht aufgeben, denn es kann nicht lügen. Man blickt unversehens auf, stürzt ins Lächeln eines wundervollen Menschen, und die Suche beginnt aufs Neue. Sie ist nie wie zuvor. Sie ist immer anders. Doch die jungen Wälder, die in einem versehrten Herzen heranwachsen, sind manchmal kräftiger und üppiger als vor dem Feuer. Wenn du dort verweilst, in diesem inneren Leuchten, an diesem neuen Ort des Lichts, wenn du alles verzeihst und niemals aufgibst, wirst du dich früher oder später wiederfinden, wo aus Liebe und Schönheit die Welt entstand: am Anfang. Am Anfang. Am Anfang.
»Hey, Lin! Starker Anfang für den Tag!«, hörte ich Vikrams Stimme von irgendwoher aus dem dunklen, stickigen Raum. »Wie hast du mich gefunden? Seit wann bist du wieder da?«
»Gerade angekommen«, antwortete ich und blieb in der breiten Flügeltür zur Veranda stehen. »Einer der Jungs sagte, du bist hier. Komm kurz raus.«
»Nee, nee, komm du rein, Mann!«, lachte Vikram. »Du musst diese Jungs hier kennenlernen!«
Ich zögerte. Meine Augen, geblendet vom Himmel, sahen in dem dunklen Raum nur klobige Schatten und zwei Schwerter aus Sonnenlicht, die durch geschlossene Jalousien drangen und träge wirbelnde Wolken aus Rauch durchbohrten. Die Luft roch nach würzigem Haschisch und dem verbrannten Vanillearoma von braunem Heroin.
Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, an den rauchigen Geruch der Drogen, an die Schatten, das scharf glimmende Licht in der Dunkelheit dieses Zimmers, frage ich mich, ob mich Vorahnung dort auf der Schwelle hielt. Und ich frage mich, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, hätte ich mich damals abgewandt und das Weite gesucht.
Entscheidungen, die wir treffen, sind Äste am Baum der Möglichkeiten. Nach diesem Tag wurden Vikram und die Fremden in jenem Raum drei Monsune lang neue Äste in einem Wald, den wir eine Zeitlang gemeinsam durchstreiften – in einer Stadtwildnis aus Liebe, Tod und Auferstehung.
Nach dem Zögern, diesem Augenblick, der mir damals nicht bedeutsam erschien, trat Vikram aus der Dunkelheit, packte mich am Arm und zog mich in den düsteren Raum. Und ich erinnere mich noch genau an mein Frösteln, als seine schweißnasse Hand meine Haut berührte.
An der linken Wand des großen, rechteckigen Zimmers stand ein gewaltiges Bett, etwa drei Meter lang, auf dem ein Mann lag, der wie tot wirkte. Der Mann trug einen silbrigen Pyjama, die Hände waren auf der Brust gefaltet.
Soweit ich erkennen konnte, bewegte sich die Brust des Mannes nicht. Neben der reglosen Gestalt saß links und rechts jeweils ein Mann auf der Bettkante und füllte ein Chillum.
An der Wand über dem toten oder tief schlafenden Mann hing ein ausladendes Gemälde von Zarathustra, dem Propheten der Parsen.
Als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, erkannte ich zwei wuchtige antike Kommoden an der Wand gegenüber, flankiert von drei breiten Sesseln. In jedem der Sessel saß ein Mann.
Am Boden lag ein großer, wertvoller Perserteppich, an den Wänden hingen Fotografien von Menschen in der traditionellen Kleidung der Parsen. Rechts von mir, dem Bett gegenüber, stand eine Hi-Fi-Anlage auf einer Kommode mit Marmorplatte. An der Decke rotierten zwei Ventilatoren so langsam, dass die Rauchschwaden im Zimmer gänzlich unberührt davon blieben.
Vikram führte mich am Bett vorbei zu dem ersten der drei Sessel. Der Mann, der darin saß, war wie ich Ausländer, aber erheblich größer als ich; sein Oberkörper und seine Beine waren extrem lang, und er hing so lässig in dem Sessel, als entspanne er sich in einem heißen Bad. Ich schätzte den Mann auf etwa fünfunddreißig.
»Das ist Concannon«, sagte Vikram und schob mich vorwärts. »Er ist in der IRA.«
Die Hand, die meine ergriff, war warm, trocken und sehr kräftig.
»Scheiß auf die IRA!«, sagte Concannon. »Ich bin ein Ulster-Mann, von der UDF. Aber dass ein heidnisches Arschloch wie Vikram das kapiert, kann man wohl nicht erwarten, wie?«
Mir gefiel das kraftvolle Funkeln in seinen Augen. Die kraftvollen Worte in seinem Mund gefielen mir nicht im Mindesten. Ich zog meine Hand zurück und nickte knapp.
»Wenn der redet, hört man am besten weg«, sagte Vikram. »Faselt einen Haufen wirren Dreck. Aber ich hab noch nie einen Ausländer kennengelernt, der so feiern kann wie der, das sag ich dir.«
Vikram führte mich zu dem zweiten Sessel. Der junge Mann, der darin saß, zog an einem Haschisch-Chillum, das der Mann im dritten Sessel gerade anzündete. Eine Flamme loderte jäh aus dem Pfeifenkopf.
»Bom shankar!«, schrie Vikram und griff nach der Pfeife. »Lin, das ist Naveen Adair. Er ist Privatdetektiv. Ganz im Ernst. Naveen, das ist Lin, der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Der Doktor aus dem Slum.«
Der junge Mann stand auf und gab mir die Hand. »So ein richtiger Detektiv bin ich aber noch nicht«, sagte er mit schiefem Grinsen.
»Kein Problem.« Ich erwiderte das Grinsen. »Ich bin auch kein richtiger Doktor. So viel dazu.«
Der dritte Mann, der das Chillum angezündet hatte, nahm einen Zug und bot es mir an. Ich lächelte ablehnend, und es wurde an einen der Männer auf dem Bett weitergereicht.
»Ich bin Vinson«, sagte der dritte Mann, dessen Händedruck mich an einen munteren, tapsigen Welpen erinnerte. »Stuart Vinson. Hab schon jede Menge von dir gehört, Mann.«
»Jeder Arsch hat doch schon von Lin gehört«, warf Concannon ein und nahm eine Pfeife in Empfang. »Vikram quatscht so viel von dir, als sei er dein scheiß Groupie. Lin hier, Lin da und Lin dieser oder jener Scheiß. Hast du ihm auch schon den Schwanz gelutscht, Vikram? Taugt der was, oder ist das alles nur Geschwätz?«
»Herrje, muss das denn sein, Concannon!«, sagte Stuart Vinson.
»Was?«, erwiderte Concannon mit Unschuldsblick. »Was denn? Ich stell dem Mann doch bloß eine Frage. Indien ist immer noch ein freies Land, oder etwa nicht? Zumindest da, wo Englisch gesprochen wird.«
»Scher dich nicht um den«, sagte Vinson mit entschuldigendem Achselzucken. »Der kann nicht anders. Hat Arschloch-Tourette-Syndrom oder so was.«
Stuart Vinson, ein kräftiger, breitschultriger Typ, war Amerikaner. Mit seinen klaren Gesichtszügen und den zerzausten dichten blonden Haaren wirkte er wie ein abenteuerlustiger Seefahrer, ein Weltumsegler vielleicht. In Wirklichkeit war er Drogendealer, und sein Geschäft lief gut. Ich hatte einiges über ihn gehört, so wie er über mich.
»Das hier ist Jamal«, sagte Vikram. Er achtete nicht mehr auf Stuart Vinson und Concannon, sondern stellte mir den Mann auf der linken Bettseite vor. »Er importiert es, reibt es, rollt es und raucht es. Er ist eine One-Man-Show.«
»One-Man-Show«, wiederholte Jamal, ein dürrer Typ mit Chamäleonaugen, der mit etlichen religiösen Amuletten behängt war. Ich fing an zu zählen, hypnotisiert von so viel Heiligkeit, und kam auf fünf große Glaubensrichtungen, bevor meine Augen zu seinem Lächeln wanderten.
»One-Man-Show«, sagte ich.
»One-Man-Show«, wiederholte er.
»One-Man-Show«, sagte ich.
»One-Man-Show«, wiederholte er.
Ich hätte es noch mal gesagt, aber Vikram redete weiter.
»Das da drüben ist Billy Bhasu«, sagte Vikram und deutete auf einen kleinen, zierlichen Mann mit sahneweißer Haut, der auf der rechten Seite des Betts saß. Billy Bhasu legte die Hände zum Gruß zusammen und fuhr dann fort, eines der Chillums zu reinigen.
»Billy Bhasu ist ein Bringer«, erklärte Vikram. »Der bringt dir alles, was du brauchst, ob’s ein Mädchen ist oder ein Eis. Probier’s aus. Es stimmt wirklich. Sag ihm, er soll dir ein Eis bringen, dann macht er das auf der Stelle. Sag’s ihm!«
»Ich will aber kein …«
»Billy, hol Lin ein Eis!«
»Kommt sofort«, sagte Billy und legte das Chillum beiseite.
»Nein, Billy.« Ich hob die Hand. »Ich will kein Eis.«
»Aber du bist doch sonst immer ganz verrückt nach Eis«, wandte Vikram ein.
»Aber nicht so verrückt, dass ich es mir von jemandem bringen lasse. Entspann dich, Mann.«
»Wenn er schon was bringt«, meldete sich Concannon aus den Schatten zu Wort, »dann wär ich für Eis und Mädchen. Zwei Mädchen. Und er soll sich verflucht noch mal ranhalten.«
»Hast du gehört?«, drängte Vikram.
Er trat zu Billy und zerrte an ihm. In diesem Moment begann die Gestalt auf dem Bett mit tiefer volltönender Stimme zu sprechen, und Vikram erstarrte, als hielte ihm jemand eine Pistole an die Schläfe.
»Vikram«, sprach der leblos wirkende Mann. »Du versaust mir mein High, Mann.«
»Oh, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Tut mir total leid, Dennis!«, stotterte Vikram. »Ich wollte Lin hier nur den Jungs vorstellen und …«
»Lin«, sagte die Gestalt auf dem Bett, schlug die Augen auf und starrte mich an.
Die Augen waren grau, erstaunlich hell, mit einem samtigen Schimmer.
»Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mach es dir bequem. Mi casa es su casa.«
Ich trat vor, schüttelte die schlaffe Hand, die Dennis mir hinhielt, und ging wieder zum Fußende des Bettes. Dennis ließ mich nicht aus den Augen. Ein entrücktes, wohlwollendes Lächeln war auf sein Gesicht getreten.
»Wow!«, sagte Stuart Vinson leise neben mir. »Dennis, Mann! Gut, dass du wieder da bist! Wie war’s denn so da drüben?«
»Still«, verkündete Dennis, noch immer lächelnd und ohne den Blick von mir zu wenden. »Sehr still. Bis vor wenigen Minuten.«
Concannon und Naveen Adair, der junge Detektiv, traten zu uns. Alle starrten auf Dennis.
»Das ist eine ganz große Ehre, Lin«, sagte Vikram. »Dennis schaut dich an.«
Ein kurzes Schweigen entstand, das von Concannon beendet wurde.
»Na, das ist ja mal nett von dir, Dennis!«, knurrte er grinsend. »Ich sitz hier seit sechs scheiß Monaten, mach geistreiche Sprüche, rauch dein Dope und sauf deinen Whisky, und du öffnest gerade zweimal kurz die Augen. Dann kommt Lin hier reinspaziert, und du starrst den an, als würd er lichterloh brennen. Bin ich der totale Arsch oder was?«
»Oh Mann, und wie du der totale Arsch bist«, sagte Stuart Vinson leise.
Concannon lachte lauthals, und Dennis zuckte zusammen.
»Concannon«, flüsterte er, »ich liebe dich wie einen netten Geist, aber du versaust mir mein High.«
»’tschuldigung, Meister Dennis«, sagte Concannon grinsend.
»Lin«, murmelte Dennis, ohne sich zu rühren, »halte mich bitte nicht für unhöflich, aber ich muss mich jetzt ausruhen. War mir eine Freude, dich kennenzulernen.«
Dann wandte er den Kopf ein wenig Richtung Vikram.
»Vikram«, murmelte er mit seiner tiefen, klangvollen Bassstimme. »Bitte sorg für Ruhe. Du versaust mir mein High, Mann. Ich möchte dich bitten, damit aufzuhören.«
»Natürlich, Dennis. Tut mir furchtbar leid.«
»Billy Bhasu?«, raunte Dennis.
»Ja, Dennis?«
»Lass das Scheiß-Eis.«
»Ich soll das Scheiß-Eis lassen?«
»Ja, lass das Scheiß-Eis. Keiner kriegt Eis. Heute nicht.«
»Okay, Dennis.«
»Ist das mit dem Eis jetzt klar?«
»Ich lass das mit dem Scheiß-Eis, Dennis.«
»Ich will das Wort Eis mindestens drei Monate lang nicht mehr hören.«
»Geht klar, Dennis.«
»Gut. Und jetzt mach mir bitte noch ein Chillum, Jamal. Ein großes und starkes. Ein gigantisches. Ein legendäres. Das wäre ein Akt der Gnade, beinahe ein Wunder. Adieu, ihr alle, hier und da und dort.«
Dennis faltete erneut die Hände auf der Brust, schloss die Augen und begab sich in seinen Ruhezustand – todesgleiche Starre mit fünf Atemzügen pro Minute.
Niemand regte sich oder sprach, nur Jamal bereitete hastig und konzentriert ein legendäres Chillum vor. Die anderen starrten auf Dennis, und ich packte Vikram am Hemd.
»Los, raus hier«, sagte ich und zog ihn mit mir. »Adieu, ihr alle, hier und da und dort.«
»Hey, wartet auf mich!«, rief Naveen und kam hinter uns nach draußen gehastet.
In der frischen Luft wurden die beiden wacher und hielten mit meinem Tempo Schritt.
Durch eine schattige Gasse zwischen dreistöckigen Gebäuden und üppig belaubten Platanen trug ein leichter Wind die Gerüche der Fischereiflotte vom Sassoon Dock herüber.
Sonnenteiche lagen zwischen den Bäumen, und wenn ich aus den schattigen Inseln in die weißglühende Hitze trat, überfluteten mich Wellen aus Licht.
Der Himmel war dunstig blau – vom Meer geschliffenes Glas. Krähen hockten auf Bussen, ließen sich in die kühleren Viertel der Stadt kutschieren. Die durchdringenden Rufe der Straßenverkäufer klangen hoffnungsvoll.
Es war einer dieser klaren Tage, an denen die Mumbaiker, die Bewohner von Bombay, gerne fröhlich singen, und als ich an einem Mann vorüberging, merkte ich, dass wir beide den gleichen Song aus einem Bollywood-Liebesfilm summten.
»Witzig«, sagte Naveen. »Ihr singt beide das Gleiche, Mann.«
Ich lächelte und wollte gerade weitersingen, wie wir es in Bombay immer tun an glasblauen Tagen, als Vikram uns mit einer Frage unterbrach.
»Und, wie lief’s? Hast du sie?«
Einer der Gründe, warum ich selten nach Goa reise, ist, dass mir dann immer jemand einen Auftrag aufs Auge drückt. Als ich Vikram vor drei Wochen erzählt hatte, ich habe eine Mission in Goa, hatte er mich gebeten, etwas für ihn zu erledigen.
Er hatte ein Stück aus dem Hochzeitsschmuck seiner Mutter in Goa bei einem Pfandhai gelassen, als Sicherheit für ein Darlehen. Vikram hatte die Schuld abbezahlt, aber der Pfandhai hatte sich geweigert, die mit Rubinen besetzte Goldkette zurückzuschicken, und hatte darauf bestanden, dass Vikram sie persönlich abholen solle. Da er wusste, dass der Pfandleiher Respekt hatte vor der Sanjay Company, dem Mafia-Klan, für den ich arbeitete, hatte Vikram mich gebeten, den Typen aufzusuchen.
Was ich getan hatte, und es war mir auch gelungen, die Kette an mich zu bringen. Aber Vikram hatte den Respekt des Pfandleihers für meinen Klan überschätzt. Der Typ hielt mich eine Woche lang hin, verschob den Termin für das Treffen immer wieder und hinterließ mir Nachrichten mit abfälligen Bemerkungen über mich und die Sanjay Company.
Als er dann endlich einwilligte, mir die Kette auszuhändigen, war es zu spät. Er war ein Hai, aber mein Klan war auf Haie spezialisiert. Ich organisierte vier Männer vor Ort, die für uns arbeiteten, und wir verprügelten die Gangster des Pfandhais, bis sie machten, dass sie wegkamen.
Danach stellten wir den Pfandhai zur Rede, und er rückte die Kette raus. Hinterher verdrosch ihn einer unserer Männer in einem fairen Kampf und traktierte ihn noch weiter in einem nicht mehr fairen Kampf, bis die Sache mit dem Respekt geklärt war.
»Also?«, fragte Vikram. »Hast du sie nun oder nicht?«
»Hier«, antwortete ich, zog das Säckchen mit der Kette aus der Jackentasche und reichte es Vikram.
»Wow! Du hast es geschafft! Wusst ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hat Danny Stress gemacht?«
»Die Geldquelle streichst du von deiner Liste, Vikram.«
»Thiik«, erwiderte er. Okay.
Vikram nahm die Kette aus dem blauen Seidenbeutel. Die Rubine flammten in der Sonne auf, und blutrotes Licht sickerte in Vikrams gewölbte Hände.
»Hör mal, ich … ich bring die sofort nach Hause zu meiner Mutter. Jetzt sofort. Kann ich euch irgendwohin mitnehmen?«
»Du fährst in die andere Richtung«, antwortete ich, als Vikram ein Taxi herbeiwinkte. »Ich hol meine Maschine, die steht beim Leopold’s.«
»Wenn du nichts dagegen hast«, sagte Naveen leise, »würde ich dich gern ein Stück begleiten.«
»Hab nichts dagegen«, erwiderte ich und sah zu, wie Vikram das Seidensäckchen unter seinem Hemd verstaute.
Als er ins Taxi steigen wollte, hielt ich ihn fest und beugte mich vor, damit niemand mithören konnte.
»Was tust du?«, fragte ich.
»Was meinst du?«
»Mir kannst du in puncto Drogen nichts vormachen, Vik.«
»Mach ich doch gar nicht!«, brauste er auf. »Scheiße, ich hab nur ein paar kleine Züge braunen Zucker gehabt, weiter nix. Na und? Ist auch sowieso Concannons Zeug. Er hat’s bezahlt. Ich …«
»Halt dich zurück.«
»Mach ich immer. Kennst mich doch.«
»Manche Leute können der Sucht aus dem Weg gehen, Vikram. Concannon mag so einer sein. Aber du bist nicht so, und das weißt du genau.«
Er lächelte, und für ein paar Sekunden war er wieder der alte Vikram: der Vikram, der sich die Kette ohne fremde Hilfe zurückgeholt hätte; der Vikram, der gar nicht erst ein Stück aus dem Hochzeitsschmuck seiner Mutter einem Pfandhai überlassen hätte.
Das Lächeln erstarb, als Vikram ins Taxi stieg. Ich sah ihm nach, als er davonfuhr, in Sorge um ihn – einen Optimisten, den die Liebe zerstört hatte.
Ich ging weiter, und Naveen schloss sich mir an.
»Vikram redet oft über dieses Mädchen, diese Engländerin«, sagte er.
»Das ist so eine Geschichte, die hätte gutgehen sollen. Aber das klappt eben selten.«
»Über dich redet er auch oft«, fügte Naveen hinzu.
»Er redet zu viel.«
»Er redet auch über Karla, Didier und Lisa. Aber vor allem über dich.«
»Er redet zu viel.«
»Er hat mir erzählt, dass du aus dem Knast entkommen bist«, sagte Naveen. »Und dass du noch immer auf der Flucht bist.«
Ich blieb stehen. »Jetzt redest du zu viel. Was ist das – eine Seuche?«
»Nein, lass mich das erklären. Du hast einem Freund von mir geholfen, Aslan …«
»Was?«
»Ein Freund von mir …«
»Wovon redest du?«
»Er war spätnachts am Ballard Pier, vor ein paar Wochen. Du hast ihm aus der Klemme geholfen.«
Ein junger Mann, der nach Mitternacht im Ballard Estate auf mich zu rannte, auf beiden Seiten verschlossene Geschäftsgebäude, kein Fluchtweg. Als seine Verfolger ihn einholten, blieb der junge Mann stehen, in den Baumschatten, um alleine zu kämpfen. Und dann doch nicht alleine.
»Und?«
»Er ist gestorben. Vor drei Tagen. Ich habe versucht, dich zu finden, aber du warst in Goa. Und jetzt bot sich die Gelegenheit, es zu erzählen.«
»Was zu erzählen?«
Naveen zuckte zusammen. Ich war so schroff zu ihm, weil er über meine Flucht geredet hatte und weil ich wollte, dass er zur Sache kam.
»Aslan war ein Studienfreund von mir«, sprach Naveen ruhig weiter. »Er war gerne nachts an gefährlichen Orten unterwegs. So wie ich. Und wohl auch du, denn sonst wärst du in dieser Nacht nicht dort gewesen und hättest ihm nicht helfen können. Ich dachte mir, du würdest das vielleicht wissen wollen.«
»Soll das ein Witz sein?«
Wir standen auf einem löchrigen Schattenfleck, umgeben vom wogenden Verkehr des Causeway.
»Wieso?«
»Du kommst auf meine Flucht aus dem Knast zu sprechen, damit du mir die traurige Kunde von Aslans Dahinscheiden überbringen kannst? Willst du das damit sagen? Bist du irre oder wahrhaftig so nett und freundlich?«
»Ich vermute mal«, antwortete Naveen, sichtlich gekränkt und zornig, »dass ich wohl so nett und freundlich bin. So nett, dass ich geglaubt hatte, du würdest nicht irgendwelchen Unrat wittern hinter dem, was ich gesagt habe. Tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Das wollte ich ganz bestimmt nicht. Ich entschuldige mich und gehe jetzt.«
»Warte!«, sagte ich. »Warte!«
Alles an Naveen hatte seine Richtigkeit: der aufrichtige Blick, die ruhige Gelassenheit, sein strahlendes Lächeln. Der Instinkt wählt seine Begleiter im Alleingang aus. Und mein Instinkt mochte den Burschen, diesen jungen Mann, der da vor mir stand und so mutig und gekränkt aussah. Alles an ihm fühlte sich richtig an, und das kommt nicht häufig vor.
»Gut, war mein Fehler«, erklärte ich und hob die Hand.
»Kein Problem«, sagte er, wieder entspannt.
»Also, zurück zu Vikram, der dir von einem Gefängnisausbruch erzählt. Diese Art von Information kann schnell das Interesse von Interpol wecken, und mein Interesse weckt so was immer. Das verstehst du sicher, nicht wahr?«
Das war keine Frage, und er wusste es.
»Scheiß auf Interpol.«
»Du bist doch Detektiv.«
»Scheiß auch auf Detektive«, erwiderte Naveen. »Das ist die Art von Information über einen Freund, die man einem anderen Freund nicht vorenthält. Hat dir das keiner gesagt? Ich bin in diesen Straßen hier aufgewachsen und weiß das.«
»Aber wir sind keine Freunde.«
»Noch nicht«, erwiderte Naveen lächelnd.
Ich betrachtete ihn forschend.
»Gehst du gerne zu Fuß?«, fragte ich.
»Ich geh gerne zu Fuß und rede dabei«, antwortete er und wand sich mühelos neben mir durch das Menschengewühl.
»Scheiß auf Interpol«, wiederholte er nach einer Weile.
»Du redest wirklich gerne, wie?«
»Und ich geh gerne zu Fuß.«
»Okay, dann erzähl mir doch drei kurze Fußmarsch-Geschichten.«
»Klar. Gerne. Wovon soll die erste handeln?«
»Dennis.«
Naveen lachte. »Weißt du«, sagte er, während er einer Frau mit einem riesigen Packen Altpapier auf dem Kopf auswich, »ich war da heute auch zum ersten Mal. Ich kann dir nur erzählen, was ich außerdem gehört habe.«
»Dann erzähl mir, was du gehört hast.«
»Seine Eltern sind gestorben. Hat ihn übel erwischt, heißt es. Die waren steinreich. Hatten ein Patent für irgendwas, das jede Menge Geld wert war. Sechzig Millionen Dollar, sagt Dennis wohl.«
»Das ist aber kein Sechzig-Millionen-Dollar-Zimmer, in dem er da liegt.«
»Sein Geld wird in einem Trust verwahrt«, erwiderte Naveen, »während er in seiner Trance ist.«
»Während er da herumliegt, meinst du?«
»Er liegt nicht nur herum. Dennis ist im Zustand des Samadhi, während er schläft. Sein Herzschlag und seine Atmung sind so weit reduziert, dass sie kaum noch vorhanden sind. Manchmal ist er eigentlich klinisch tot.«
»Jetzt erzählst du mir aber Scheiß, Detektiv.«
»Nein«, sagte Naveen lachend. »Im letzten Jahr haben mehrere Ärzte Todesurkunden ausgestellt, aber Dennis ist immer wieder aufgewacht. Jamal, die One-Man-Show, hat die Urkunden gesammelt.«
»Gut, Dennis ist also gelegentlich klinisch tot. Muss hart sein für seinen Priester und seinen Buchhalter.«
»Während Dennis in Trance ist, wird sein Vermögen so verwaltet, dass ihm genug Geld bleibt, um die Wohnung zu bezahlen, in der er jetzt liegt, und ihn entsprechend seinem Zustand zu versorgen.«
»Hast du das alles gehört oder detektivisch erschnüffelt?«
»Bisschen von beidem.«
»Okay«, sagte ich und blieb stehen, um ein Auto vorbeizulassen, das vor uns wendete. »Ich muss sagen, ich hab noch nie in meinem Leben jemanden besser ausruhen sehen.«
»Konkurrenzlos.« Naveen grinste.
Wir dachten beide eine Weile nach.
»Zweite Geschichte?«, fragte Naveen dann.
»Concannon«, antwortete ich und ging weiter.
»Boxt in meinem Studio. Viel weiß ich nicht über ihn, aber zwei Sachen kann ich dir sagen.«
»Und zwar?«
»Er hat einen fiesen linken Haken, mit dem er ’ne Glocke läuten könnte. Aber wenn er nicht trifft, muss er abtauchen.«
»Aha?«
»Jedes Mal. Er setzt den Jab mit der Linken, den Punch mit der Rechten und ist dann vollkommen ungedeckt, wenn er nicht trifft. Aber er ist schnell, es kommt selten vor, dass er nicht trifft. Er ist ziemlich gut.«
»Und weiter?«
»Er ist der einzige Typ, den ich kenne, der es geschafft hat, mich zu Dennis reinzubringen. Dennis liebt ihn. Für Concannon ist er länger wach geblieben als für jeden anderen. Ich hab gehört, dass er Concannon offiziell adoptieren will. Was schwierig werden könnte, weil Concannon älter als Dennis ist. Und ich weiß auch nicht, ob es rechtlich schon mal den Fall gegeben hat, dass ein Inder einen Weißen adoptiert.«
»Was meinst du mit ›Er hat es geschafft, dich zu Dennis reinzubringen‹?«
»Tausende Menschen wollen mit Dennis sprechen, während er in Trance ist. Sie glauben, dass er während seines Scheintod-Zustands mit den echten Toten kommunizieren kann. Deshalb kommt da so gut wie keiner rein.«
»Es sei denn, man geht einfach hin und klopft an die Tür.«
»Du verstehst es nicht. Das würde überhaupt niemand wagen, während Dennis in Trance ist.«
»Und das soll ich glauben?«
»Ja. Vor dir hat das noch keiner gemacht.«
»Okay, Dennis hatten wir schon durch«, sagte ich und blieb stehen, um vier Männer mit einem Handkarren vorbeizulassen. »Zurück zu Concannon.«
»Wie gesagt – er boxt in meinem Studio. Ist ein Straßenfighter. Ich weiß nicht viel über ihn. Scheint auf jeden Fall gerne zu feiern. Ist wohl für eine Party immer zu haben.«
»Der reißt gewaltig die Klappe auf. In seinem Alter kann man sich das nur leisten, wenn auch was dahinter ist.«
»Willst du damit sagen, dass ich ihn im Auge behalten soll?«
»Nur die falsche Seite von ihm.«
»Und die dritte Geschichte?«, fragte Naveen.
Ich bog von der Straße auf einen handbreiten Fußpfad ab.
Naveen folgte mir. »Wo gehen wir hin?«
»Saft trinken.«
»Saft?«
»Es ist heiß, Mann. Was ist los mit dir?«
»Nichts, nichts. Find ich cool. Ich liebe Saft.«
Neununddreißig Grad in Bombay, gekühlter Wassermelonensaft, Ventilatoren auf Stufe drei dicht am Kopf: pures Glück.
»Also … was hat’s mit dieser Privatdetektiv-Nummer auf sich? Ist das ernst gemeint?«, fragte ich.
»Ja. Hab im Grunde durch Zufall damit angefangen, aber ich mach das jetzt schon seit fast einem Jahr.«
»Durch welchen Zufall wird man zum Detektiv?«
»Ich hab Jura studiert«, antwortete Naveen lächelnd. »War schon fast fertig. In meinem letzten Studienjahr hab ich für eine Seminararbeit eine Recherche über Privatdetekteien und deren Einfluss auf die Rechtsprechung gemacht. Dann hat mich plötzlich nur noch das interessiert, und ich hab abgebrochen, um mich selbst als Detektiv zu versuchen.«
»Und wie läuft’s?«
Naveen lachte. »Scheidungen sind sicherer als die Börse und laufen immer nach den gleichen Mustern ab. Ich hatte ein paar Scheidungsfälle, hab dann aber keine mehr angenommen. Zu Anfang hatte ich mich mit einem anderen Typen zusammengetan und mich einarbeiten lassen. Der macht seit fünfunddreißig Jahren Scheidungen und findet das grandios. Ich nicht. War immer derselbe traurige Film für mich: Nur die Männer haben die Affären.«
»Und seit du die einträglichen Scheidungen an den Nagel gehängt hast?«
»Hab ich zwei verschwundene Haustiere, einen verschwundenen Ehemann und eine verschwundene Kasserolle aufgespürt. Meine Klienten sind offenbar, dem Himmel sei’s gedankt, zu träge oder zu höflich, sich selbst auf die Suche zu machen.«
»Aber dir gefällt die Detektivrolle, wie? Turnt dich an, oder?«
»Weißt du«, antwortete Naveen, »ich glaube daran, dass man in der Rolle immer die Wahrheit erfährt. Als Anwalt darfst du dir nur eine Version der Wahrheit erlauben. Meine Arbeit ist echt und direkt – bevor dann alle zu lügen anfangen.«
»Willst du dabei bleiben?«
»Weiß ich noch nicht«, sagte er lächelnd und schaute an mir vorbei. »Kommt wohl drauf an, wie gut ich bin.«
»Oder wie schlecht.«
»Oder wie schlecht.«
»Jetzt sind wir schon bei der dritten Geschichte angelangt«, sagte ich. »Naveen Adair, indisch-irischer Privatdetektiv.«
Seine weißen Zähne blitzten auf, als er lachte, aber das Lachen verebbte rasch.
»Da gibt’s nicht viel zu erzählen.«
»Naveen Adair«, sagte ich. »Von welchem Teil kriegst du mehr Arschtritte – vom indischen oder vom irischen?«
»Zu britisch für die Inder«, antwortete er grinsend, »und zu indisch für die Briten. Mein Vater …«
Zerklüftete Felsen und lichtlose Täler – daraus besteht für viele das Land, das sich Vater nennt. Ich wartete, bis Naveen wieder ins Gespräch einstieg, mit mir an seiner Seite.
»Wir haben auf der Straße gelebt, nachdem er meine Mutter verlassen hatte. Bis ich fünf war, bin ich auf den Gehwegen aufgewachsen. Aber ich hab nicht viel Erinnerung daran.«
»Was ist dann passiert?«
Naveen blickte zur Straße hinüber, ließ den Blick treiben auf den Wellen aus Farben und Gefühlen.
»Er starb an Tuberkulose«, antwortete der junge Detektiv dann. »Hatte ein Testament gemacht und meine Mutter eingesetzt, und dann stellte sich raus, dass er irgendwie ziemlich viel Geld verdient hatte, und wir waren plötzlich reich, und …«
»Alles war anders.«
Naveen sah mich an, als hätte er mir schon zu viel erzählt.
Mein Kopf fühlte sich inzwischen eisig an und schmerzte, weil der Ventilator so dicht neben uns stand. Ich winkte den Kellner her und bat ihn, das Ding eine Stufe runterzuregeln.
»Ihnen ist kalt?«, sagte er spöttisch und bewegte den Schalter. »Ich zeig Ihnen mal, was kalt ist!«
Er stellte den Ventilator auf Stufe fünf, was einem Schneesturm gleichkam. Meine Wangen wurden taub vor Kälte. Wir zahlten und brachen auf.
»Tisch zwei wieder frei!«, hörten wir den Kellner hinter uns rufen.
»Gefällt mir super, das Lokal«, sagte Naveen.
»Echt?«
»Ja. Exzellenter Saft, unverschämte Kellner. Geniale Mischung.«
»Könnte sein, dass wir uns gut verstehen, Detektiv. Könnte wirklich sein.«
ZWEITESKAPITEL
Die Vergangenheit, jener geliebte Feind, erscheint oft zur Unzeit. Diese Tage in Bombay kehren manchmal mit solcher Wucht unvermittelt zu mir zurück, dass ich aus der Stunde herausgerissen werde und vollkommen aus dem Tritt gerate. Ein Lächeln, ein Song, und ich bin wieder dort, verschlafe sonnige Vormittage, bin mit dem Motorrad unterwegs auf einer Bergstraße oder werde gefesselt und misshandelt und flehe das Schicksal um Gnade an. Und ich liebe jede einzelne Minute, jede einzelne Minute mit Freund oder Feind, Flucht oder Vergebung – jede einzelne Minute des Lebens. Doch die Vergangenheit hat die Angewohnheit, einen zur falschen Zeit an den richtigen Ort zu befördern, und das kann einen Orkan im Inneren heraufbeschwören.
Ich sollte wohl verbittert sein wegen manchem, was ich getan habe und was mir angetan wurde. Man hat mich immer wieder zur Bitterkeit aufgefordert. Ein Typ im Knast sagte einmal zu mir: Wenn du nur ein bisschen Hass in dir hättest, könntest du locker an der Spitze sein. Aber das wurde mir bei der Geburt nicht mitgegeben, und ich habe nie Hass und Bitterkeit empfunden. Ich war wütend, und ich war verzweifelt und in Rage und habe deshalb Schlimmes getan, bis ich damit aufhörte. Aber ich habe nie jemanden gehasst und nie jemandem gezielt Böses gewünscht, nicht einmal Männern, die mich gefoltert haben. Ein klein wenig Bitterkeit hätte mich von Zeit zu Zeit vielleicht schützen können. Doch ich habe gelernt, dass schöne Erinnerungen nicht durch die Tür des Zynismus treten. Und ich liebe meine Erinnerungen, auch wenn sie überraschend und zur Unzeit erscheinen: Muster aus Sonnenlicht unter den Bäumen an Bombays Straßen, kühne Mädchen, die auf Motorrollern durch den Verkehr sausen, Männer, die ächzend ihre Karren ziehen, dabei aber ein Lächeln auf dem Gesicht tragen. Und diese ersten Erinnerungen an einen jungen indisch-irischen Detektiv namens Naveen Adair.
Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinander her, schlängelten uns im Rhythmus des Straßentanzes zwischen Autos und Menschenströmen, Fahrrädern und Handkarren hindurch.
Im breiten Tor der Feuerwache standen lachend und schwatzend Männer in schweren dunkelblauen Uniformen. Die beiden großen Einsatzwagen im Inneren des Gebäudes glitzerten rot und silbrig im Sonnenlicht.
An einer Wand befand sich ein exquisit geschmückter Hanuman-Schrein, und auf einem Schild daneben stand:
Wenn die Hitze zu stark ist,
das brennende Gebäude verlassen.
Als wir zum Einkaufsviertel am Colaba Market kamen, wanderten wir zwischen Glasereien, Bilderrahmenhändlern, Holz- und Eisenwarenläden, Geschäften für Elektrowaren und Klempnerbedarf hindurch, die nach und nach Boutiquen, Juwelieren und Lebensmittelgeschäften Platz machten. Am breiten Eingang zum Markt mussten wir stehen bleiben, weil mehrere schwere Laster sich in das Verkehrsgetümmel auf der Hauptstraße einfädelten.
»Hör mal«, sagte Naveen, während wir warteten. »Du hast recht – Vikram redet zu viel. Aber das bleibt bei mir. Ich werde niemals mit jemandem außer dir darüber sprechen. Niemals. Und solltest du mich mal brauchen – hey, Mann, dann bin ich für dich da. Das wollte ich dir nur sagen. Für Aslan und weil du ihm geholfen hast, wenn du es schon nicht für dich selbst annehmen willst.«
Nicht zum ersten Mal blickte ich aus der roten Wüste des Exils, in die sich mein Leben verwandelt hatte, in Augen, in denen das Wort Flucht Flammen zum Lodern brachte. In meinen Jahren der Flucht fand ich manchmal Freundschaft im gemeinsamen Lied der Rebellion – in Treue, die andere mir zuteilwerden ließen, weil sie meinen Ausbruch aus dem System guthießen.
Sie wollten, dass ich frei sein konnte, nicht zuletzt damit überhaupt irgendjemand entkommen und in Freiheit leben konnte. Ich lächelte Naveen an. Es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass ich mich meinem inneren Fluss anvertraute.
»Freut mich, dich kennenzulernen«, sagte ich und hielt ihm die Hand hin. »Ich bin Lin. Und ich bin kein Doktor im Slum.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte Naveen und schüttelte mir die Hand. »Ich bin Naveen, und vielen Dank. Es ist immer gut zu wissen, wer kein Doktor im Slum ist.«
»Und wer nicht bei der Polizei ist«, fügte ich hinzu. »Was hältst du von einem Drink?«
»Hätte nichts dagegen«, antwortete Naveen erfreut.
In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass jemand zu dicht hinter mir stand, und fuhr abrupt herum.
»Nur die Ruhe!«, protestierte Zwilling-George. »Schone bitte mein Hemd, Meister! Das ist die Hälfte meiner gesamten Garderobe, solltest du wissen!«
Ich spürte die Knochen in seinem dürren Körper, als ich Zwilling-George losließ.
»Tut mir leid, Mann«, sagte ich und strich sein Hemd glatt. »Aber du solltest dich auch nicht so anschleichen. Müsstest du doch besser wissen, Zwilling. Das gibt eines Tages Tränen.«
»Hast recht, Meister«, sagte Zwilling entschuldigend und blickte nervös um sich. »Ich hab ’n kleines Problem, weißt du.«
Ich griff in meine Tasche, aber Zwilling packte mich am Arm.
»Nicht so ein Problem, Meister. Na ja, um ehrlich zu sein, das ist schon auch ein Problem, aber weißt du, keine Kohle zu haben ist so ein Dauerproblem, dass es schon zu einer Art metakultureller Aussage geworden ist, einem tristen, aber faszinierenden Soundtrack der Armut, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Nee, Mann, versteh ich nicht«, erwiderte ich und reichte ihm Geld. »Was ist denn nun das Problem?«
»Kannst du bitte warten? Ich hol rasch Skorpion.«
»Klar.«
Zwilling schaute nach links und rechts.
»Du wartest auch bestimmt?«
Ich nickte, und er huschte an einem Stand vorbei, der kleine Marmorstatuetten von Gottheiten verkaufte.
»Was dagegen, wenn ich hierbleibe?«, fragte Naveen.
»Gar nicht«, antwortete ich. »Bei Zwilling und Skorpion ist kein Geheimnis sicher außer ihren eigenen. Die könnten einen eigenen Radiosender betreiben. Ich würd ihn mir auch anhören.«
Kurz darauf erschien Zwilling, im Schlepptau den widerstrebenden Skorpion.
Die Sternzeichen-Georges waren ein unzertrennliches Gespann von Straßenstreunern. Der eine George kam aus Süd-London, der andere aus Kanada. Beide waren mäßig abhängig von sieben Drogen und komplett abhängig voneinander. Sie nächtigten im halbwegs komfortablen Eingang eines Lagerhauses und verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie Nachrichten überbrachten, für Ausländer Drogenkäufe vermittelten und gelegentlich Informationen an Gangster verhökerten.
Sie zankten und stritten vom Aufwachen bis zum Einschlafen, aber sie liebten einander, und ihre Freundschaft war so unzerstörbar, dass jeder, der die Sternzeichen-Georges kannte, sie deshalb unweigerlich gern hatte: Zwilling-George aus London und Skorpion-George aus Kanada.
»’tschuldige, Lin«, murmelte Skorpion, als Zwilling ihn zu mir zerrte. »Ich war sozusagen im Untergrund. Es gibt Ärger mit der CIA. Du hast bestimmt davon gehört.«
»Mit der CIA? Kann ich nicht behaupten, nein. Aber ich war auch in Goa. Was ist los?«
»Da läuft so ein Typ durch die Gegend«, sagte Zwilling, während sein größerer Freund eifrig nickte. »Schneeweiße Haare, ist aber noch gar nicht alt. Dunkelblauer Anzug und Krawatte, sieht aus wie ein Geschäftsmann …«
»Oder einer von der CIA«, raunte Skorpion.
»Du bist doch bescheuert, Skorpion!«, meckerte Zwilling. »Was soll denn die CIA von jemandem wie uns wollen?«
»Die haben diese Maschinen, mit denen sie unsere Gedanken lesen können«, flüsterte Skorpion. »Sogar durch Wände.«
»Wenn sie Gedanken lesen können, brauchst du auch nicht zu flüstern, oder?«, versetzte Zwilling.
»Vielleicht haben sie uns schon darauf programmiert zu flüstern, während sie unsere Gedanken lesen.«
»Wenn die deine Gedanken lesen, werden sie schreiend durch die Straßen rennen, du dämlicher Idiot. Ist ja schon ein Wunder, dass ich nicht schreiend durch die Straßen renn und so.«
Es gab keine verlässliche Vorlage, um abzusehen, in welche Richtungen eine Streiterei der Sternzeichen-Georges mäandern und wie lange das dauern würde. Meist hörte ich mir diesen Zirkus gerne an. Aber nicht immer.
»Erzähl mir mehr über den weißhaarigen Typen im Anzug«, forderte ich Zwilling auf.
»Wir haben keine Ahnung, wer der ist, Lin«, sagte Zwilling, nachdem er sich abgeregt hatte. »Aber seit zwei Tagen fragt er im Leopold’s und an anderen Stellen nach Skorpion.«
»Er ist von der CIA«, wiederholte Skorpion und hielt Ausschau nach Fluchtwegen.
Zwilling sah mich mit einer Miene an, die besagte: Womit hab ich das verdient? Dann holte er tief Luft. Er versuchte sich in Geduld zu fassen. Es nützte nichts.
»Wenn der von der CIA ist und unsere Gedanken lesen kann«, knurrte er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, »würde er doch wohl kaum rumrennen und nach uns fragen, oder? Sondern er würde auf uns zumarschieren, uns auf die Schulter tippen und sagen: ›Hey, alter Junge, wir haben mit unserer Gedankenlesemaschine grade deine Gedanken gelesen, und wir müssen nicht durch die Gegend laufen und nach dir fragen oder dich verfolgen, wir haben nämlich Maschinen zum Gedankenlesen, weil wir von der Scheiß-CIA sind.‹ Meinst du nicht, es würde so laufen? Ja oder nein?«
»Na ja …«
»Kennt der Mann eure Namen?«, fragte Naveen ernsthaft. »Und fragt er nach euch beiden oder nur nach Skorpion?«
Die beiden starrten Naveen an.
»Das ist Naveen Adair«, erklärte ich. »Er ist Privatdetektiv.«
Ein Schweigen entstand.
»Heiliger Strohsack«, murmelte Zwilling. »Find ich nicht sehr privat, wenn man das hier im Markt rausposaunt. Wohl eher ein Öffentlichkeitsdetektiv, wie?«
Naveen lachte. »Ihr habt meine Fragen nicht beantwortet.«
Wieder schwiegen die beiden.
»Was für eine … Art von Detektiv ist der denn?«, fragte Skorpion dann misstrauisch.
»Er ist Privatdetektiv«, antwortete ich. »So was wie ein Priester, nur dass er bezahlt wird. Beantworte die Fragen, Skorpion.«
»Also weißt du«, sagte Skorpion und betrachtete Naveen sinnend. »Wenn ich es mir recht überlege, hat er nur nach mir gefragt, nicht nach Zwilling.«
»Wo wohnt er?«, fragte Naveen.
»Wissen wir noch nicht«, antwortete Zwilling. »Zuerst haben wir es nicht so ernst genommen. Aber jetzt geht das schon zwei Tage so. Wird allmählich ein bisschen bedrohlich für Skorpion, und der fühlt sich auch so schon bedroht genug, wenn ihr versteht, was ich meine. Einer der Straßenjungs bleibt dem weißhaarigen Typen heute auf den Fersen. Wir werden bald wissen, wo er wohnt.«
»Wenn ihr wollt, nehme ich mich der Sache an«, sagte Naveen leise.
Zwilling und Skorpion blickten mich fragend an. Ich zuckte die Achseln.
»Ja«, sagte Skorpion dann rasch. »Verdammt gerne. Bitte bring in Erfahrung, wer dieser Kerl ist.«
»Wir müssen der Sache auf den Grund gehen«, fügte Zwilling aufgeregt hinzu. »Skorpion hat mich schon so verrückt gemacht, dass ich mir heute früh beim Aufwachen selbst den Hals zugedrückt hab. Ist ein übles Schlamassel, wenn es so weit kommt, dass man sich im Schlaf selbst erwürgt.«
»Was sollen wir tun?«, fragte Skorpion.
»Lasst euch so wenig wie möglich blicken«, riet Naveen. »Wenn ihr erfahren habt, wo der Typ wohnt, sagt es Lin. Oder hinterlasst eine Nachricht für mich im Natraj Building an der Merewether. Naveen Adair mein Name.«
Die Sternzeichen-Georges warfen sich einen Blick zu und sahen dann mich und Naveen an.
»Klingt nach einem guten Plan«, sagte ich und schüttelte Zwilling die Hand.
Das Geld, das ich ihm gegeben hatte, reichte aus für mindestens zwei Lieblingsdrogen der beiden, ein paar angenehme Tage in einem wüsten Hotel, saubere Kleider von ihrem häufig unbezahlten Wäschemann und diverse Portionen der bengalischen Süßigkeiten, die beide Georges liebten.
Die zwei tauchten im Gewühl der Straße ab. Skorpion machte sich ein bisschen kleiner, damit er nicht höher aufragte als der Londoner George.
»Was meinst du?«, fragte ich Naveen.
»Riecht nach Anwalt«, antwortete der junge Detektiv bedächtig. »Ich strecke mal die Fühler aus. Kann aber keine Erfolge garantieren. Ich bin Amateur, vergiss das nicht.«
»Amateur ist jeder, der nicht gelernt hat, wie man es nicht macht.«
»Nicht übel. Zitat?«
»Ja.«
»Vom wem?«
»Von einer Frau, die ich kenne. Wieso fragst du?«
»Kann ich sie treffen?«
»Nein.«
»Bitte.«
»Wieso willst du dauernd Leute treffen, die man nicht leicht treffen kann?«
»Es ist von Karla, oder? Amateur ist jeder, der nicht gelernt hat, wie man es nicht macht. Find ich gut.«
Ich blieb stehen, dicht neben Naveen.
»Wir müssen was klären. Du sprichst nicht mehr über Karla in meiner Gegenwart.«
»Geht klar«, erwiderte Naveen mit gelassenem Lächeln.
»Freut mich, dass wir uns verstehen. Wir hatten beide nichts gegen einen Drink einzuwenden, weißt du noch?«
Der Geruch von Bier und Curry hüllte uns ein, als wir in die Höhle des Leopold’s traten. Es war Spätnachmittag, die Ruhe vor dem Sturm, bevor Touristen, Drogendealer, Schwarzmarkthändler, Gauner aller Art, Schauspieler und Studenten beiderlei Geschlechts, Gangster und brave Mädchen mit einer Schwäche für böse Buben durch die breiten Torbögen drängten, um wild zu debattieren, zu essen, zu bechern und ihre Seele aufs Spiel zu setzen beim trunkenen Roulette an den dreißig Tischen.
Um diese Zeit hielt sich Didier am liebsten im Leopold’s auf, das quasi sein zweites Zuhause war. Auch jetzt saß er alleine an seinem Stammplatz an der hinteren Wand mit Blick auf alle drei Eingänge und las eine Zeitung, die er auf Armeslänge von sich weghielt.
»Was zum Henker, Didier! Eine Zeitung! Du kannst den Leuten doch nicht ohne Vorwarnung so einen Schock versetzen!«
Ich wandte mich dem hinter mir herumlungernden Kellner zu, der von allen schlicht Sweetie genannt wurde. Sein rosa Namensschild hing schief an seiner Jacke. »Was ist los mit dir, Sweetie? Du hättest ein Warnschild oder so was raushängen sollen.«
»Du kannst mich mal. Und zwar kreuzweise«, erwiderte Sweetie und beförderte ein Streichholz mit der Zunge vom einen in den anderen Mundwinkel.
Didier ließ die Zeitung fallen, sprang auf und umarmte mich.
»Die Sonne steht dir gut zu Gesicht!«, rief er aus, schob mich ein Stück von sich weg und betrachtete mich forschend. »Du siehst aus wie der Strohmann. Heißt das so? Nicht der Star im Film, sondern der, der immer Dresche einsteckt.«
»Du meinst das Double oder den Stuntman. Darf ich dir einen weiteren Stuntman vorstellen: Das ist Naveen Adair.«
»Ah, der Detektiv!«, sagte Didier, schüttelte Naveen herzlich die Hand und musterte den großen, durchtrainierten jungen Mann mit Profiblick. »Ich hab schon viel von dir gehört. Durch meine Journalistenfreundin Kavita Singh.«
»Über dich hat sie auch schon viel geschrieben«, erwiderte Naveen lächelnd. »Und es ist mir eine Ehre, den Mann aus den Reportagen kennenzulernen, wenn ich das mal so sagen darf.«
»Welch exzellente Manieren, das hätte ich nicht erwartet«, sagte Didier rasch, wies auf die Plätze an seinem Tisch und winkte Sweetie zu sich. »Was möchtet ihr? Bier? Sweetie! Drei eiskalte Bier, bitte!«
»Du kannst mich mal«, knurrte Sweetie und tappte mit Ich-hab-gleich-Feierabend-Schlurfen widerwillig gen Küche.
»Er ist ein abscheulicher Rohling«, bemerkte Didier, während er Sweetie nachsah. »Doch seltsamerweise behagt mir die Leichtigkeit seiner Trübsal.«
Wir setzten uns alle drei mit dem Rücken zur Wand, so dass wir die Tische und die drei Torbögen zur Straße im Auge behalten konnten. Didier ließ den Blick durch den Raum schweifen wie ein Schiffbrüchiger, der den Horizont absucht.
»Nun«, sagte er dann gedehnt und wies mit dem Kopf auf mich. »Das Goa-Abenteuer?«
Ich zog ein mit blauen Bändern umwickeltes Päckchen Briefe aus der Tasche und reichte es Didier. Er nahm es in Empfang und wog es einen Moment so sachte in den Händen, als wäre es ein verletzter Vogel.
»Musstest du … musstest du ihn verprügeln, damit er sie rausrückte?«, fragte er, ohne den Blick von den Briefen zu wenden.
»Nein.«
»Ach«, seufzte Didier und schaute rasch auf.
»Hätte ich das tun sollen?«
»Nein, natürlich nicht.« Didier schniefte, um eine Träne zu vertreiben. »Für so etwas würde Didier nicht bezahlen wollen.«
»Du hast mich gar nicht bezahlt.«
»Obwohl ich nichts bezahlt habe, bezahle ich doch. Nicht wahr, Naveen?«
»Ich habe keine Ahnung, was du meinst«, antwortete Naveen. »Deshalb pflichte ich allem bei.«
»Es ist nur so«, sagte Didier und seufzte erneut, »ich hätte gehofft, dass er sich vielleicht ein klitzekleines bisschen gewehrt hätte, um meine Liebesbriefe zu behalten. Als Zeichen seiner … anhaltenden Zuneigung sozusagen.«
Das hassverzerrte Gesicht von Didiers einstigem Geliebten Gustavo trat mir vor Augen, als er, Didiers Geschlechtsorgane mit unflätigen Ausdrücken verwünschend, das Briefbündel in die Abfallgrube am Rückfenster seines Bungalows feuerte.
Ich musste Gustavos Ohr mit meinem Daumennagel durchbohren, damit der Bursche in die Grube stieg, die Briefe herausfischte, sie säuberte und mir aushändigte.
»Nein«, sagte ich. »Die Zuneigung ist weitergezogen.«
»Nun, ich danke dir jedenfalls, Lin«, murmelte Didier und legte die Briefe auf seinen Schoß, als das Bier eintraf. »Ich wäre ja selbst hingefahren, um mir die Briefe zu holen. Aber da war dieses kleine Hindernis, dass ich in Goa mit Haftbefehl gesucht werde.«
»Du musst das jetzt mal in den Griff kriegen mit diesen Haftbefehlen, Didier«, sagte ich. »Ich komm ja gar nicht mehr hinterher. Ich könnte allmählich ein Zimmer tapezieren mit meinen gefälschten Papieren für dich. Stresst mich enorm, dir dauernd eine reine Weste zu verschaffen.«
»Aber ich habe in ganz Indien nur vier Haftbefehle, Lin.«
»Nur vier?«
»Es waren schon mal neun. Ich bin wohl inzwischen … gemäßigt«, seufzte Didier und kräuselte angewidert die Oberlippe.
»Das schadet dem Ruf«, warf Naveen ein.
»Ganz recht. Du bist ein sehr … erfreulicher junger Mann. Hast du was übrig für Knarren?«
»Für Beziehungen tauge ich nicht«, antwortete Naveen, leerte sein Bier und stand auf. »Nur die Knarre in meiner Hand gibt mir was.«
»Dazu könnte ich auch was beitragen«, sagte Didier und lachte.
»Glaub ich wohl«, erwiderte Naveen grinsend. »Lin, der Typ im Anzug, der die Georges verfolgt. Ich nehm mich der Sache an und erstatte dir dann hier Bericht.«
»Sieh dich vor. Wir wissen noch nicht, was es damit auf sich hat.«
»Kein Problem«, sagte er mit sorglosem Lächeln, in jugendlichem Glauben an Unsterblichkeit. »Ich geh dann mal. War mir eine Ehre und ein Vergnügen, Didier. Bis bald.«
Wir sahen ihm nach, als er hinaustrat in den Dunst des frühen Abends. Didier zog die Augenbrauen zusammen.
»Was?«, fragte ich.
»Nichts!«, antwortete er abwehrend.
»Was ist, Didier?«
»Ich sagte doch: nichts!«
»Ja, aber ich kenne diesen Blick.«
»Welchen Blick?«, erwiderte er so bockig, als hätte ich behauptet, er hätte meinen Drink geklaut.
Didier Levy war vielleicht Mitte vierzig. Der erste Pulverschnee des Winters stäubte weiße Wellen in Didiers dunkle Locken. Seine Augen leuchteten strahlend blau inmitten eines Geflechts roter Äderchen und ließen ihn bei ein und demselben Lächeln jung und verlebt zugleich wirken – ein schelmischer Bube im Körper eines verfallenden Mannes.
Didier trank zu jeder Tages- und Nachtzeit jede Art von Alkohol, kleidete sich wie ein Dandy, während andere Dandys längst vor der Hitze kapituliert hatten, rauchte perfekt gedrehte Joints aus einem edlen Etui, konnte in den meisten Verbrechen als Profi und in einigen als Meister bezeichnet werden und war offen schwul in einer Stadt, in der das noch immer ein Widerspruch in sich war.
Ich kannte ihn seit fünf Jahren, hatte Seite an Seite mit ihm gegen Feinde von innen und außen gekämpft. Er war mutig: ein Mann, der gegen jede Waffe antritt und niemals kneift, so übel die Lage auch sein mag.
Didier war auch authentisch. Er hatte den Punkt erreicht, an dem es uns gelingt, wir selbst zu sein, weil wir frei wählen können, wer wir sein wollen. Ich hatte verlorene Lieben ebenso mit ihm durchgemacht wie verstörendes Verlangen und unser beider erschütternde Erkenntnisse. Und ich hatte genügend dieser langen, einsamen Wolfsnächte mit ihm durchlebt, um ihn zu lieben.
»Dieser Blick«, insistierte ich. »Dieser Blick, der ausdrückt, dass du was weißt, was die anderen auch wissen sollten. Der Blick, der ausdrückt: ›Ich hab’s dir doch gesagt‹, obwohl du gar nichts gesagt hast. Also sag’s mir, statt ›Ich hab’s dir doch gesagt‹ zu sagen.«
Didiers grantige Miene verzog sich zu einem Grinsen, das zu einem herzhaften Lachen wurde.
»Es ist mehr ein ›Hätte ich das gewusst‹«, sagte er. »Dieser junge Mann gefällt mir ausnehmend gut. Besser, als ich erwartet hätte. Und besser, als gut ist, denn diesem Naveen Adair eilt ein gewisser Ruf voraus.«
»Wenn wir beide für unseren Ruf irgendwo Stimmen kriegen könnten, wären wir Präsidenten großer Staaten.«
»Stimmt. Aber mit dem Ruf dieses Jungen geht eine Warnung einher. Dem Weisen genügt ein Wort, sagt man das nicht so?«
»Genau. Ich hab mich aber immer schon gefragt, weshalb der Weise überhaupt ein Wort braucht.«
»Es heißt, dass dieser Naveen sehr gut mit seinen Fäusten umgehen kann. An seiner Universität war er Boxmeister, und er hätte wohl der beste Boxer von ganz Indien werden können. Seine Fäuste sind tödliche Waffen. Und ich habe gehört, dass er gerne provoziert und sie dann sehr schnell – und wohl des Öfteren auch zu schnell – zum Einsatz bringt.«
»Du bist auch nicht grade eine Niete im Provozieren, Didier. Und ich gerate auch recht schnell in Rage.«
»Vor diesem jungen Mann sind schon viele Männer in die Knie gegangen. Es ist nicht gut für einen jungen Menschen, so viel Unterwerfung zu erleben. Hinter diesem charmanten, jungenhaften Lächeln ist jede Menge Blut.«
»Hinter deinem charmanten Lächeln ist auch jede Menge Blut, mein Freund.«
»Danke.« Didier nahm das Kompliment mit einem Nicken entgegen, das seine ergrauenden Locken erzittern ließ. »Will nur sagen: Nach dem, was mir zu Ohren gekommen ist, würde ich es vorziehen, auf diesen jungen Burschen zu schießen, anstatt im Faustkampf gegen ihn anzutreten.«
»Dann kannst du ja von Glück sagen, dass du bewaffnet bist.«
»Ich meine es zur Abwechslung mal ernst, Lin. Und du weißt wohl, wie wenig Freude ich an Ernsthaftigkeit habe.«
»Ich merke es mir. Versprochen. Muss jetzt los.«
»Du lässt mich hier sitzen und alleine weitertrinken, um zu ihr nach Hause zu gehen?«, spöttelte Didier. »Und du glaubst, sie wartet da auf dich, nachdem du fast drei Wochen in Goa warst? Meinst du nicht, sie hat sich inzwischen anderweitig umgetan?«
»Ich liebe dich auch, Bruder«, erwiderte ich und drückte ihm die Hand.
Ich trat hinaus ins Gewühl und drehte mich noch einmal nach Didier um. Er winkte mir zum Abschied mit dem Bündel Liebesbriefe.
Das bremste mich. Viel zu oft hatte ich das Gefühl, Didier zurückzulassen. Was idiotisch war, und das wusste ich auch, denn Didier konnte man mit Fug und Recht als den autarksten Verbrecher der Stadt betrachten. Er war einer der letzten unabhängigen Gangster, einer, der den Mafia-Klans, den Bullen und den Straßengangs, die seine illegale Welt beherrschten, nichts schuldig war – nicht einmal Angst.
Aber von manchen Menschen, geliebten Menschen, fällt der Abschied immer schwer. Sie zurückzulassen fühlt sich an, als verließe man sein Geburtsland.
Didier, mein alter Freund, Naveen, mein neuer Freund, und Bombay, meine Inselstadt, so lange sie mich duldete – auf unterschiedliche Art waren wir alle gefährlich.
Der Mann, als der ich Jahre zuvor in Bombay eintraf, war damals ein Fremder in einem ihm fremden Dschungel. Der Mann, zu dem ich geworden war, blickte jetzt aus der Deckung seiner Dschungelstraße auf die neuen Fremden. Ich war zuhause hier, ich kannte mich aus. Und ich war wohl härter als damals, denn etwas in mir war verlorengegangen: etwas, das sich eigentlich dicht bei meinem Herzen befinden sollte.
Ich war aus dem Gefängnis entkommen, Didier war der Verfolgung entkommen, Naveen war der Straße entkommen, und die Stadt im Süden war dem Meer entkommen und Stein für Stein von fleißigen Männern und Frauen in eine Insel verwandelt worden.
Ich winkte zurück, und Didier lächelte und berührte seine Stirn mit dem Bündel Briefe. Auch ich lächelte, und dann war alles gut; ich konnte weggehen.
Jedes Lächeln wäre ohne Zauber, jeder Abschied wäre bedeutungslos, jede gütige Geste wäre vergeblich, wenn wir nicht die Schönheit unserer Wahrheiten in uns trügen. Und das ist es, was uns Menschen ausmacht: dass wir im besten Falle verknüpft sind durch eine Wahrhaftigkeit der Liebe, die nur unserer Spezies eigen ist.
DRITTESKAPITEL
Es war nicht weit vom Leopold’s zu meiner Wohnung. Ich ließ den Touristentrubel auf dem Causeway hinter mir, fuhr am Colaba Polizeirevier vorbei und weiter zu der Ecke, die jedem Taxifahrer von Bombay als »Electric House« bekannt ist.
Als ich in die von Bäumen überschattete Straße rechts vom Revier einbog, fiel mein Blick auf den Trakt mit den Arrestzellen, in denen ich auch schon eingesessen hatte.
Rebellion tobte in mir, als ich die hohen vergitterten Fenster sah, und eine Welle von Erinnerungen brach sich Bahn: der Gestank der offenen Latrinen, Scharen von Männern, die um einen etwas weniger beschmutzten Platz beim Tor kämpften.
An der nächsten Ecke fuhr ich durchs Tor in den Innenhof des Beaumont-Villa-Gebäudes und parkte das Motorrad. Ich nickte dem Wachmann zu und sprintete die Treppe in den dritten Stock hinauf, immer drei Stufen auf einmal nehmend.
Nachdem ich ein paarmal an der Wohnungstür geklingelt hatte, schloss ich auf, marschierte durchs Wohnzimmer in die Küche, legte die Schlüssel und meine Tasche auf den Tisch. Als ich Lisa auch im Schlafzimmer nicht entdeckte, wanderte ich ins Wohnzimmer zurück.
»Hi, Süße«, rief ich mit amerikanischem Akzent. »Bin wieder zuhause!«
Hinter den flatternden Vorhängen an der Terrasse hörte ich ihr helles Lachen. Als ich den Stoff beiseiteschob, sah ich Lisa auf den Knien vor einem Mini-Garten, nicht größer als ein Koffer, die Hände in der Erde. Aufgeregt gurrende Tauben spazierten umher, pickten nach Krümeln und versuchten die Konkurrenten zu verscheuchen.
»Du machst dir so viel Mühe mit dem Gärtchen hier, Süße«, sagte ich, »und dann lässt du die Vögel darauf rumtrampeln.«
»Du verstehst das nicht«, erwiderte Lisa und sah mich mit ihren wasserblauen Augen an. »Ich hab den Garten angelegt, damit die Vögel kommen. Ich wollte vor allem die Vögel hier haben.«
»Du bist meine Vogelschar«, sagte ich, als sie aufstand und mich küsste.
»O super«, spottete sie. »Der Schriftsteller ist heimgekehrt.«
»Und freut sich enorm, dich zu sehen«, sagte ich lächelnd und zog sie Richtung Schlafzimmer.
»Meine Hände sind schmutzig!«, protestierte sie.
»Das will ich hoffen.«
»Nein, im Ernst jetzt«, sagte sie lachend und riss sich los. »Wir müssen duschen …«
»Auch das will ich hoffen.«
»Du musst duschen«, insistierte sie und wich zurück, »und dich jetzt sofort umziehen.«
»Wieso das denn?«, wandte ich ein. »Kleidung find ich grade sehr überflüssig.«
»Doch, Kleidung ist nötig. Wir gehen nämlich aus.«
»Lisa, ich bin eben gerade zurückgekommen. Nach zwei Wochen.«
»Fast drei Wochen«, verbesserte sie mich. »Und wir können uns noch ausreichend begrüßen, bevor wir schlafen gehen. Das versprech ich dir.«
»Wieso hört sich ›begrüßen‹ grade so nach ›verabschieden‹ an?«
»Begrüßen ist immer der Beginn eines Abschieds. Los, mach dich nass.«
»Wohin gehen wir?«
»Wird dir gefallen.«
»Heißt so viel wie ich werd’s scheußlich finden, oder?«
»Kunstgalerie.«
»Oh. Großartig.«
»Komm, sei kein Arsch«, sagte sie mit einem Lachen. »Diese Leute sind richtig gut. Die sind am Puls der Zeit, Lin. Wahrhafte Künstler mit Leib und Seele. Du wirst sie lieben, ganz sicher. Es ist eine total wichtige Ausstellung, und wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir zu spät zur Vernissage. Ich freu mich sehr, dass du noch rechtzeitig zurückgekommen bist.«
Ich runzelte die Stirn.
»Ach, komm schon, Lin. Was kann denn wichtiger sein als Kunst?«
»Sex«, antwortete ich. »Essen. Mehr Sex.«
»Es gibt jede Menge Essen in der Galerie«, sagte sie und schob mich Richtung Dusche. »Und denk daran, wie dankbar deine Vogelschar sein wird, wenn wir zurückkommen von der Vernissage, zu der sie unbedingt mit dir hingehen möchte und die wir versäumen werden, wenn du nicht auf der Stelle unter die Dusche gehst!«
Als ich mir in der Duschkabine das Hemd über den Kopf zog, drehte Lisa hinter mir schon das Wasser auf. Es prasselte mir auf den Rücken und die Jeans, die ich noch nicht aufgemacht hatte.
»Hey!«, schrie ich. »Das ist meine beste Jeans!«
»Ja, und du trägst sie seit Wochen!«, rief Lisa, die inzwischen in die Küche gewandert war. »Heute Abend bitte die zweitbeste Jeans!«
»Und ich hab auch noch dein Geschenk hier!«, schrie ich. »In der Tasche dieser Jeans, die du grade klatschnass gemacht hast!«
Lisa erschien wieder in der Tür.
»Du hast ein Geschenk für mich?«, fragte sie.
»Na sicher.«
»Gut. Das ist lieb von dir. Ich guck’s mir später an, ja?«
Sie verschwand wieder.
»Ja, ist gut!«, rief ich ihr nach. »Nach dem tollen Abend in der Galerie!«
Als ich mit Duschen fertig war, hörte ich Lisa einen Song aus einem Bollywood-Film trällern. Durch Zufall oder aber durch die Fügungen in den mysteriösen Spiralen der Liebe war es der gleiche Song, den ich kurz zuvor gesummt hatte, als ich mit Vikram und Naveen unterwegs war.
Und später, als Lisa und ich unsere Sachen zusammensuchten, sangen wir diesen Song gemeinsam.
Der Verkehr von Bombay ist ein System, das Akrobaten für kleine Elefanten erfunden haben müssen. Nach zwanzig Minuten mehr oder minder vergnüglicher Fahrt landeten wir in Cumballa Hill, einem Reichenviertel an einem der prominentesten Hügel von Süd-Bombay.
Ich stellte mein Motorrad auf einem Parkplatz gegenüber der angesagt umstrittenen Backbeat Gallery ab, am Anfang der Edelmeile Carmichael Road. Kostspielige Importautos mit kostspieligen VIPs fuhren vor dem Eingang vor.
Drinnen bahnte sich Lisa einen Weg durch die Menschenmassen. In dem langgestreckten Raum drängten sich vermutlich an die dreihundert Leute, doppelt so viele, wie laut Brandschutzschild am Eingang hier erlaubt waren.
Wenn die Hitze zu stark ist, das brennende Gebäude verlassen.
Lisa sichtete eine ihrer Freundinnen und stellte uns vor. »Das ist Rosanna«, sagte Lisa.
Die eher kleine junge Frau, die dicht bei uns stand, trug ein ausladendes schnörkliges Kruzifix um den Hals. Die genagelten Füße des Heilands ruhten zwischen ihren Brüsten. »Und das ist Lin«, fuhr Lisa fort. »Er ist grade aus Goa zurückgekommen.«
»So lernen wir uns endlich kennen«, sagte Rosanna. Als sie die Hand hob und sich durch das kurz geschnittene stachlige Haar strich, streifte ihr Busen meine Brust.
Rosannas Akzent war amerikanisch, aber die Vokale klangen indisch.
»Was hat dich nach Goa geführt?«, fragte sie.
»Liebesbriefe und Rubine«, antwortete ich.
Rosanna warf einen raschen Seitenblick auf Lisa.
»Schau mich nicht an«, seufzte Lisa und zuckte die Achseln.
»Du bist ja unglaublich schräg, Mann!«, kreischte Rosanna mit einer Stimme, die mich an die Warnrufe von Papageien erinnerte. »Komm mit! Du musst Taj kennenlernen. Der steht total auf schräge Leute, yaar.«
Rosanna schlängelte sich durch die Menge und machte schließlich Halt bei einem großen jungen Mann, der ausgesprochen gut aussah. Parfümiertes Öl verlieh seinen schulterlangen Haaren einen besonderen Glanz. Er stand vor einer etwa drei Meter hohen Steinskulptur, die eine Art wildes männliches Wesen darstellte. ENKIDU stand auf einem Schild neben der Figur.
Der Künstler küsste Lisa auf die Wange und reichte mir die Hand. »Ich bin Taj«, sagte er lächelnd, und in seinem Blick lag unverhohlene Neugierde. »Du musst Lin sein. Lisa hat mir schon viel von dir erzählt.«