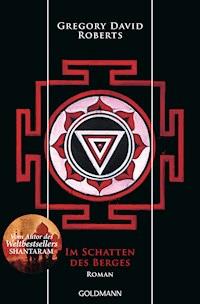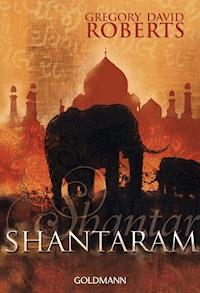
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann auf der Flucht – Eine Stadt, die nie schläft – Und die Gnade einer befreienden Liebe
Shantaram erzählt in fiktionaler Form die Geschichte von Roberts’ eigenem Leben: Als der Australier Lindsay in Bombay strandet, hat er zwei Jahre seiner Gefängnisstrafe abgesessen und ist auf der Flucht vor Interpol. Zu seinem Glück begegnet er dem jungen Inder Prabaker, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Auf ihren Streifzügen durch die exotische Metropole schließen die beiden eine innige Freundschaft. Von Prabaker lernt Lindsay nicht nur die Landessprache, sondern auch, mit sich ins Reine zu kommen: Er wird zu „Shantaram“, einem „Mann des Friedens“ und kämpft für die Ärmsten der Armen. Doch dann verfällt Lindsay der geheimnisvollen Karla, einer Deutsch-Amerikanerin mit dubiosen Kontakten zur Unterwelt …
Ein Roman, so leidenschaftlich wie der Herzschlag Indiens, voller Wahrheit und Poesie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1886
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Buch
Als der Australier Lindsay in Bombay strandet, hat er bereits einiges hinter sich: Seine Heroinabhängigkeit hat seine Ehe zerstört, und ein bewaffneter Raubüberfall trug Lindsay eine 19-jährige Gefängnisstrafe ein. Nach zwei Jahren Haft gelingt ihm das Unmögliche: Er flieht mit einem falschen Pass nach Indien. In der chaotischen und überbevölkerten Metropole Bombay fällt ein Mensch mehr nicht weiter auf, weiß Lindsay. Dort kümmert es niemanden, ob er auf der Fahndungsliste von Interpol steht – weil die Einwohner Bombays ganz andere Probleme haben.
Dass das Überleben in seiner neuen Heimat jedoch überaus schwer ist, wenn man weder Sprachkenntnisse besitzt noch über Kontakte verfügt, muss Lindsay schnell lernen. Zu seinem Glück begegnet er dem jungen Inder Prabaker, der in den Slums von Bombay lebt und sich ihm als Reiseführer anbietet. Auf den Streifzügen der beiden Männer durch die exotische, schillernde, aber auch brutale und gnadenlose Stadt freunden sie sich die beiden an, und Lindsay lernt die Metropole aus einer vollkommen neuen Perspektive kennen: Das Elend, das Lindsay dort sieht, erschüttert ihn, und er beschließt zu helfen, wo er nur kann. Am wichtigsten ist die medizinische Versorgung der Ärmsten der Armen. Um ihr Leid zu lindern und Medikamente zu organisieren, scheut Lindsay auch nicht davor zurück, sich mit dem einflussreichen afghanischen Mafiaboss der Slums einzulassen. Dass er sich in große Gefahr begibt und dass der Preis hoch ist, den er für seine Kontakte zahlen muss, erkennt er erst, als es bereits zu spät ist …
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die australische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Shantaram« bei Scribe Publications Pty Ltd, Australia
Taschenbuchausgabe Mai 2010 Copyright © der Originalausgabe 2003 by Gregory David Roberts Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotive: getty images/Glen Allison (Stadtansicht); corbis/Frans Lanting (Elefant) AG · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-01217-5V008
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutter
ERSTER TEIL
ERSTES KAPITEL
Viel Zeit und viel Welt brauchte ich, um zu lernen, was ich weiß über die Liebe, über das Schicksal und über die Entscheidungen, die wir treffen, doch das Wesentliche verstand ich in einem einzigen Augenblick, als ich an eine Wand gekettet war und gefoltert wurde. Trotz der Schreie in meinem Kopf wurde mir plötzlich bewusst, dass ich, gefesselt, blutend und hilflos, noch immer meine Freiheit besaß – die Freiheit, jene Männer, die mich quälten, zu hassen oder ihnen zu vergeben. Ich weiß, das klingt nicht großartig. Doch wenn Ketten ins Fleisch schneiden und man nichts anderes mehr hat, verheißt diese Freiheit ein ganzes Universum von Möglichkeiten. Ob man den Hass wählt oder die Vergebung, bestimmt die weitere Geschichte des eigenen Lebens.
In meinem Fall ist diese Geschichte lang und vielfältig. Ich war ein Revolutionär, der seine Ideale dem Heroin opferte, ein Philosoph, der seine Glaubwürdigkeit im Gefängnis einbüßte, ein Dichter, dem seine Seele im Hochsicherheitstrakt verloren ging. Als ich über die von zwei Wachtürmen flankierte Frontmauer aus diesem Gefängnis flüchtete, wurde ich zum meistgesuchten Mann meines Landes. Das Glück floh mit mir und begleitete mich quer durch die Welt nach Indien, wo ich mich der Mafia von Bombay anschloss. Ich verdiente mein Geld als Waffenschieber, Schmuggler und Fälscher. Ich wurde auf drei Kontinenten in Ketten gelegt, verprügelt, mit Messern traktiert und ausgehungert. Ich zog in den Krieg und geriet unter feindliches Feuer. Und ich überlebte, während andere Männer neben mir starben. Die meisten von ihnen waren bessere Menschen als ich, Männer, deren Leben versehentlich zertreten wurde, fortgeworfen im falschen Augenblick – aus Hass, Liebe oder Gleichgültigkeit. Ich begrub diese Männer – zu viele von ihnen –, und in meiner Trauer verwob ich ihre Geschichte und ihr Leben mit meinem eigenen.
Doch meine Geschichte beginnt nicht bei ihnen und auch nicht bei der Mafia; sie beginnt mit jenem ersten Tag in Bombay. Das Schicksal brachte mich dort ins Spiel. Das Glück teilte die Karten aus, die mich zu Karla Saaranen führten. Und dieses Blatt begann ich auszuspielen, vom ersten Moment an, als ich in ihre grünen Augen blickte. So beginnt diese Geschichte also wie alles andere – mit einer Frau, einer Stadt und ein klein wenig Glück.
Was ich zuerst bemerkte, an jenem ersten Tag in Bombay, war der besondere Geruch der Luft. Ich roch sie bereits, bevor ich Indien sah oder hörte, roch sie schon in dem Korridor, der das Flugzeug wie eine Nabelschnur mit dem Gebäude verband. Berauscht von der weiten Welt und meiner Flucht aus dem Gefängnis, fand ich den Geruch aufregend und wunderbar, doch ich konnte ihn nicht deuten. Heute weiß ich, dass es der süße, saftige Duft der Hoffnung ist, des Gegenteils von Hass; und es ist der säuerliche stickige Geruch der Gier, des Gegenteils von Liebe. Es ist der Geruch von Göttern, Dämonen, Weltreichen und Kulturen in ihrer Wiederauferstehung und ihrem Verfall. Es ist der blaue Hautgeruch des Meeres, allgegenwärtig in der Inselstadt, und der blutig-metallische Geruch von Maschinen. Die Luft riecht nach der Unruhe und dem Schlaf und dem Unrat von sechzig Millionen Tieren, von denen mehr als die Hälfte Menschen und Ratten sind. Sie riecht nach gebrochenen Herzen, dem Kampf ums Überleben und den entscheidenden Irrwegen und Lieben, aus denen unser Mut erwächst. Sie riecht nach zehntausend Restaurants, fünftausend Tempeln, Schreinen, Kirchen und Moscheen und nach hundert Basaren, in denen es nur Duftwasser, Gewürze, Räucherwerk und frische Blumen zu kaufen gibt. Karla nannte diesen Geruch einmal den übelsten Wohlgeruch der Welt, und damit hatte sie recht, so wie sie auf ihre Art immer recht hat. Und wenn ich heute nach Bombay zurückkehre, ist es dieser Geruch, vor allem anderen, der mich willkommen heißt und mir bedeutet, dass ich wieder zu Hause bin.
Dann erst bemerkte ich die Hitze. Ich stand in einer Schlange, der klimatisierten Flugzeugluft kaum fünf Minuten entwöhnt, und die Kleider klebten mir am Leib. Mein Herz hämmerte. Jeder Atemzug war ein zorniger kleiner Sieg. Bald wusste ich, dass der Dschungelschweiß nie versiegt, weil die Hitze, die Tag und Nacht die Stadt regiert, eine feuchte Hitze ist. Die erstickende Feuchtigkeit verwandelt uns alle in Bombay in Amphibien, die mit der Luft gleichzeitig auch Wasser atmen; man lernt in diesem Zustand zu leben und beginnt ihn zu mögen. Oder man verlässt Bombay.
Und dann waren da die Menschen. Assamesen, Jats und Punjabis; Menschen aus Rajasthan, Bengal und Tamil Nadu; aus Pushkar, Cochin und Konarak; Angehörige der Kriegerkaste, Brahmanen und Unberührbare; Hindus, Muslime, Christen, Buddhisten, Parsen, Jainas, Animisten; helle und dunkle Haut, grüne und goldbraune und schwarze Augen; jegliche Gesichtsform dieser verschwenderischen Vielfalt, dieser unvergleichlichen Schönheit, Indien.
All die Millionen Einwohner von Bombay, und noch ein weiterer. Die beiden besten Freunde des Schmugglers sind das Maultier und das Kamel. Maultiere transportieren heiße Ware durch die Grenzkontrolle. Kamele sind ahnungslose Touristen, die dem Schmuggler behilflich sind, über die Grenze zu kommen. Wenn sie mit falschen Papieren reisen, heften sich Schmuggler zur Tarnung an andere Reisende – die Kamele –, die sie dann durch Flughafen- oder Grenzkontrollen schleusen, ohne es zu ahnen.
Von alldem wusste ich damals nichts. Die Schmugglerkunst erlernte ich erst viele Jahre später. Bei dieser ersten Reise nach Indien folgte ich nur meinem Instinkt und schmuggelte nur eine einzige Ware: mein Selbst, meine zerbrechliche und gehetzte Freiheit. Ich hatte einen gefälschten neuseeländischen Pass bei mir, mit meinem Foto anstelle des Originals. Das Passbild hatte ich selbst ausgetauscht, und die Fälschung war alles andere als makellos. Bei einer Routinekontrolle kam ich wohl damit durch, aber wenn jemand Verdacht schöpfte und bei der neuseeländischen Hochkommission nachfragte, würde die Fälschung sofort auffliegen. Auf dem Flug von Auckland nach Indien streifte ich durch die Reihen und hielt Ausschau nach geeigneten Neuseeländern. Ich stieß auf eine kleine Gruppe Studenten, die bereits zum zweiten Mal auf den Subkontinent reisten. Ich drängte sie, mir von ihren Erfahrungen zu berichten und mir Reisetipps zu geben, und schloss mich ihnen an, als wir von Bord gingen. So kam ich unbehindert durch die Flughafenkontrolle. Die Angestellten nahmen an, dass ich zu dieser fröhlichen, harmlosen Reisegruppe gehörte, und blickten nur flüchtig auf meinen Pass.
Allein drängte ich mich durch das Getümmel im Flughafen nach draußen und trat in die stechende Sonne, berauscht und beflügelt: wieder eine Wand bezwungen, eine Grenze passiert, einen Tag und eine Nacht gewonnen, um zu flüchten, um mich zu verstecken. Fast zwei Jahre waren vergangen, seit ich aus dem Gefängnis geflohen war, aber wer einmal auf der Flucht ist, der flüchtet weiter, Tag und Nacht. Ich war nicht wirklich frei, niemals wirklich frei, doch alles Neue bedeutete mir Hoffnung und angstvolle Aufregung: ein neuer Pass, ein neues Land, neue Linien der Furcht in meinem jungen Gesicht, unter den grauen Augen. Nun stand ich da, unter der blauen Himmelsschale über Bombay, und mein Herz war so rein und hungrig nach Verheißungen wie ein Monsunmorgen in den Gärten von Malabar.
»Sir, Sir!«, rief eine Stimme hinter mir.
Eine Hand packte meinen Arm. Ich erstarrte. Spannte jeden Muskel an und verbiss mir die Angst. Nicht rennen. Keine Panik. Ich wandte mich um.
Vor mir stand ein kleiner Mann in einer schmuddeligen braunen Uniform, meine Gitarre im Arm. Er war nicht nur klein, sondern geradezu winzig, ein Zwerg mit großem Kopf und der erstaunten Unschuld des Down-Syndroms in den Gesichtszügen. Er streckte mir die Gitarre hin.
»Ihre Musik, Sir. Sie verlieren Ihre Musik, oder?«
Es war tatsächlich meine Gitarre. Ich hatte sie offenbar an der Gepäckausgabe stehen lassen. Woher der kleine Mann wusste, dass sie mir gehörte, war mir ein Rätsel. Ich lächelte, verblüfft und erleichtert, und der Mann grinste mich mit dieser absoluten Arglosigkeit an, die wir fürchten und als beschränkt bezeichnen. Als er mir die Gitarre reichte, fiel mir auf, dass er Schwimmhäute zwischen den Fingern hatte, wie ein Stelzvogel an den Füßen. Ich zog ein paar Geldscheine aus der Tasche und hielt sie ihm hin, doch er stolperte auf seinen dicken Beinen ungelenk rückwärts.
»Nicht Geld!«, sagte er. »Wir sind hier, zu helfen, Sir. Willkommen in Indien.« Dann trottete er davon und verschwand in dem Menschendickicht auf der unbefestigten Straße.
Ich kaufte mir ein Ticket, um mit dem Veterans’ Bus Service, der von Exsoldaten der indischen Armee betrieben wurde, in die Stadt zu fahren. Nachdem ich gesehen hatte, wie mein Rucksack und meine Reisetasche mit unbekümmerter Achtlosigkeit zielsicher auf den Gepäckberg auf dem Dach des Busses geschleudert wurden, beschloss ich, meine Gitarre bei mir zu behalten. Ich ließ mich auf der Rückbank im hinteren Teil des Busses nieder, und zwei langhaarige Reisende setzten sich zu mir. Der Bus füllte sich rasch mit Indern und jungen Ausländern, die billig reisen wollten.
Als er fast voll war, wandte sich der Fahrer um, blickte drohend in die Runde, spuckte einen Strahl leuchtend roten Betelsafts durch die offene Tür und tat die bevorstehende Abfahrt kund.
»Thik hain, challo!«
Der Motor erwachte grollend zum Leben, das Getriebe knirschte und krachte, und schon rasten wir mit beängstigendem Tempo durch Menschenmengen aus Gepäckträgern und Fußgängern, die gerade noch beiseitespringen, -hüpfen oder -humpeln konnten und dabei vom Schaffner, der auf der untersten Trittstufe des Busses hockte, mit einer Tirade erlesener Schmähungen bedacht wurden.
Die Fahrt vom Flughafen in die Stadt begann auf einer modernen, von Sträuchern und Bäumen gesäumten Autobahn, die mich an die akkurate und funktionale Gegend am Flughafen meiner Heimatstadt Melbourne erinnerte. Als sich die Straße dann aber unversehens verengte, wurde dieser vertraute Effekt so plötzlich und so nachhaltig zerstört, als geschähe das mit Kalkül. Denn als aus den vielen Spuren der Autobahn eine einzige wurde, als die Bäume verschwanden und die Slums in Sicht kamen, packten die Klauen der Scham mein Herz.
Wie schwarzbraune Dünen unter flirrenden staubigen Luftschwaden erstreckten sich die Slums meilenweit. Die elenden Hütten waren dicht nebeneinander aus Lumpen, Plastikstücken und Pappfetzen, aus Schilfmatten und Bambusstäben errichtet worden und durch schmale Wege verbunden. Bis zum Horizont war nichts zu sehen, das höher gewesen wäre als ein Mensch.
Es schien mir unfassbar, dass ein moderner Flughafen voller wohlhabender zielstrebiger Menschen nur wenige Kilometer von diesen zu Schutt und Asche zerfallenen Träumen entfernt sein konnte. Mein erster Gedanke war, dass es hier eine Katastrophe gegeben haben musste und die Slums Flüchtlingslager für die Überlebenden waren. Monate später sollte ich erfahren, dass die Menschen in den Slums in der Tat Überlebende waren; die Katastrophen, die sie aus ihren Dörfern hierher getrieben hatten, hießen Armut, Hungersnot und Blutvergießen. Und jede Woche trafen fünftausend weitere Menschen ein, Woche für Woche, Jahr um Jahr.
Als draußen kilometerlang nur Slums zu sehen waren, als aus Hunderten von Menschen Tausende und Abertausende wurden, wand sich mein Gewissen in Qualen. Ich fühlte mich von meiner eigenen Gesundheit und dem Geld in meinen Taschen geschändet. Wenn man sie überhaupt spürt, diese erste Begegnung mit dem Elend dieser Welt, empfindet man eine peinigende Schuld. Ich hatte Banken überfallen und Drogen verkauft, und ich war von Gefängniswärtern geschlagen worden, bis mir die Knochen brachen. Ich war niedergestochen worden und hatte andere niedergestochen. Ich war aus einem brutalen Gefängnis voller brutaler Männer geflüchtet, auf die harte Tour – über die Frontmauer. Und dennoch war diese erste Begegnung mit dem grenzenlosen Elend der Slums, mit diesem erbarmungslosen Kummer bis zum Horizont, wie ein Schnitt ins Herz und in die Augen. Eine Weile lief ich in Messerklingen.
Dann flammte die Glut aus Scham und Schuldgefühlen auf, wurde zu Zorn, zu rasender Wut über diese Ungerechtigkeit: Was für eine Regierung, was für ein System, dachte ich, duldet solches Leid?
Doch dort draußen nahmen die Slums kein Ende, wurden nur hie und da verhöhnt durch kleine florierende Geschäfte und heruntergekommene, halb überwucherte Wohnhäuser der vergleichsweise Wohlhabenden. Die Slums waren endlos, und so erlahmte mein innerer Widerstand, und ich begann mit anderen Augen zu sehen. Ich nahm nicht mehr nur die Endlosigkeit der Slums wahr, sondern die Menschen, die dort lebten. Eine Frau beugte sich vornüber, um ihre seidigen schwarzen Haare zu bürsten. Eine andere Frau wusch ihre Kinder mit Wasser aus einer Kupferschale. Ein Mann trieb drei Ziegen voran, an deren Halsbändern rote Schleifen befestigt waren. Ein anderer Mann rasierte sich vor einer Spiegelscherbe. Überall spielten Kinder. Männer schleppten Wassereimer. Männer besserten eine Hütte aus. Und wo mein Blick auch hinfiel, sah ich Menschen lächeln und lachen.
Der Bus musste in einem Stau anhalten, und vor meinem Fenster trat ein Mann aus einer der Hütten. Er war Ausländer, so bleich wie alle Fremden im Bus, und hatte nur ein Tuch mit Hibiskusblütenmuster um die Hüfte geschlungen. Er reckte sich, gähnte und kratzte sich gedankenverloren am Bauch. Auf eine einfältige Art wirkte er froh und zufrieden, und ich beneidete ihn um seine Gelassenheit und das Lächeln, mit dem ihn die Vorübergehenden begrüßten.
Als der Bus sich ruckartig wieder in Bewegung setzte, verlor ich den Mann aus den Augen. Doch sein Anblick hatte meine Einstellung zu den Slums von Grund auf verändert. Er gehörte dieser Welt ebenso wenig an wie ich, und unwillkürlich sah ich mich nun an seiner Stelle. Was unfassbar fremd für mich gewesen war, erschien mir plötzlich möglich, vorstellbar und zuletzt faszinierend.
Nun achtete ich noch mehr auf die einzelnen Menschen, und ich sah, wie geschäftig sie waren – wie sehr ihr Fleiß und ihre Energie ihr Leben bestimmten. Hie und da konnte ich in eine der Hütten blicken und sah dort die erstaunliche Sauberkeit der Armut: frisch gekehrte Böden, ordentlich gestapelte, schimmernde Kochtöpfe. Und dann, ganz zuletzt, fiel mir auf, was ich gleich zu Anfang hätte bemerken müssen: die Schönheit dieser Menschen. In Purpur, Blau und Gold gehüllte Frauen; Frauen, die mit ruhiger, erhabener Anmut durch diese ärmliche Umgebung schritten; die Würde der Männer mit ihren blendend weißen Zähnen und mandelförmigen Augen; die herzliche Ausgelassenheit und die liebevolle Kameradschaft der feingliedrigen Kinder: Ältere spielten mit jüngeren, und viele trugen ein Geschwisterkind auf der Hüfte umher. Nach einer halben Stunde Busfahrt lächelte ich zum ersten Mal.
»Ist echt nicht schön«, sagte der junge Mann neben mir, als er durchs Fenster schaute. Das aufgestickte Ahornblatt an seiner Jacke wies ihn als Kanadier aus: groß und breitschultrig, helle Augen, schulterlange braune Haare. Sein Begleiter wirkte wie eine kleinere kompaktere Ausgabe seines Freundes – die beiden trugen sogar dieselben künstlich verwaschenen Jeans, dieselben Sandalen und weichen Baumwolljacken.
»Wie war das?«
»Zum ersten Mal hier?«, fragte er. Ich nickte. »Dachte ich mir. Keine Sorge, ab jetzt wird’s etwas besser. Nicht ganz so viele Slums und so. Aber toll ist es nirgendwo in Bombay. Die fertigste Stadt der Welt, sag ich dir.«
»Stimmt«, pflichtete ihm der andere bei.
»Wo wir gleich hinkommen, gibt’s ein paar hübsche Tempel und ein paar große britische Gebäude, die okay sind – mit Steinlöwen und Messinglaternen und so. Aber das ist nicht Indien. Das richtige Indien ist am Himalaya, in Manali oder in der heiligen Stadt Varanasi oder an der Küste, in Kerala. Du musst raus aus der Stadt, wenn du das echte Indien erleben willst.«
»Und wohin seid ihr unterwegs?«
»Wir wollen zu einem Ashram«, erklärte der Kleinere. »Der von den Rajneesh-Leuten, in Poona. Das ist der beste Ashram im ganzen Land.«
Zwei Paar blassblauer Augen starrten mich mit dem anklagenden Zweifel all jener an, die überzeugt davon sind, den einzigen Weg zur Wahrheit gefunden zu haben.
»Checkst du ein?«
»Wie?«
»Checkst du in Bombay in ein Hotel ein, oder bist du nur auf der Durchreise?«
»Ich weiß noch nicht«, antwortete ich und sah wieder zum Fenster hinaus. Das stimmte; ich wusste nicht, ob ich eine Weile in Bombay bleiben oder weiterfahren wollte … irgendwohin. Ich wusste es nicht, und es war mir nicht wichtig. In diesem Augenblick war ich, was Karla einmal das gefährlichste und faszinierendste Tier der Welt nannte: ein mutiger harter Mann ohne Ziel. »Ich hab noch keine Pläne. Aber ich werd vielleicht eine Weile bleiben.«
»Also, wir übernachten und fahren morgen mit dem Zug weiter. Wenn du willst, können wir uns zusammen ein Zimmer nehmen. Für drei ist es billiger.«
Ich blickte in diese arglosen blauen Augen. Wäre vielleicht nicht dumm, mit denen ein Zimmer zu teilen, dachte ich. Ihre legalen Papiere und ihr freundliches Lächeln würden von meinem gefälschten Pass ablenken. Vielleicht war das sicherer.
»Und es ist auch sicherer«, fügte er hinzu.
»Stimmt«, pflichtete sein Freund ihm bei.
»Sicherer?«, fragte ich mit einer Lässigkeit, die ich nicht empfand.
Der Bus fuhr jetzt langsam zwischen drei- und vierstöckigen Häusern hindurch. Auf wundersame Art wälzte sich der Verkehr reibungslos durch die Straßen – ein wilder Tanz von Bussen, Lastwagen, Fahrrädern, Autos, Ochsenkarren, Motorrollern und Fußgängern. Durch die offenen Fenster unseres klapprigen Busses drangen in einer hitzigen, aber nicht unangenehmen Mischung die Gerüche von Gewürzen, Duftwassern, Dieselabgasen und Ochsenmist herein, und über die Klänge fremder Musik erhob sich Stimmengewirr. Überall sah man gigantische Werbeplakate für indische Filme, und die künstlichen Farben der Bilder zogen hinter dem sonnenbraunen Gesicht des großen Kanadiers vorbei.
»Ja, klar, viel sicherer. Das hier ist Gotham City, Mann. So schnell, wie die Straßenkinder dir das Geld aus der Tasche ziehen, kannst du gar nicht gucken.«
»Eben typisch Großstadt, Mann«, ergänzte der Kleinere. »Große Städte sind doch immer alle gleich – New York, Rio oder Paris –, überall ist es dreckig, und überall sind die Leute verrückt. Typisch Großstadt, verstehst du? Der Rest von Indien wird dir bestimmt gefallen. Ein tolles Land, aber die Städte sind echt am Arsch, kann ich nur sagen.«
»Und die verfluchten Hotels gleich mit«, ergänzte der andere. »Die nehmen dich aus, nur weil du in deinem Hotelzimmer hockst und ein bisschen Gras rauchst. Die stecken mit den Bullen unter einer Decke, die dich dann verhaften und dir deine ganze Kohle wegnehmen. Am sichersten ist es, wenn man zu mehreren ist und zusammenbleibt, das kannst du mir glauben.«
»Und wenn man so schnell wie möglich aus den Städten abhaut«, sagte der Kleinere. »Verfluchte Scheiße, hast du das gesehen?«
Der Bus war auf dem breiten Boulevard in eine Kurve gebogen, in der große Felsblöcke wie zufällig am türkisblauen Meer verstreut lagen. Auf diesen Felsen hockte eine kleine Kolonie schwarzer halb verfallener Slumhütten wie das Wrack eines düsteren Schiffs aus uralter Zeit. Die Hütten brannten.
»Verfluchte Scheiße! Schau dir das an! Der Typ brutzelt, Mann!«, schrie der große Kanadier und deutete auf einen Mann, der mit brennenden Kleidern und Haaren zum Meer rannte. Er stolperte und stürzte zwischen den großen Felsblöcken zu Boden. Eine Frau und ein Kind holten ihn ein und erstickten die Flammen mit ihren Kleidern und Händen. Andere versuchten, das Feuer in ihren eigenen Hütten zu löschen oder standen einfach nur da und sahen zu, wie ihre dürftigen Behausungen in Flammen aufgingen. »Habt ihr das gesehen? Der Typ ist hinüber, das sag ich euch.«
»Glaub ich auch!«, keuchte der andere erschrocken.
Unser Bus hatte das Tempo verlangsamt, wie die anderen Fahrzeuge auch, beschleunigte jetzt jedoch wieder. Niemand hielt an. Ich drehte mich um und schaute durchs Rückfenster, bis die verbrannten Hütten zu kleinen Punkten wurden und der braune Qualm des Brands nur noch ein Hauch von Verderben war.
Am Ende des langen Küstenboulevards bog der Bus linker Hand in eine breite Straße mit modernen Gebäuden ein. Ich sah exklusive, von Gärten umgebene Restaurants neben eleganten Hotels, vor denen livrierte Pagen unter bunten Markisen warteten. Die Sonne glitzerte in den Glas- und Messingfassaden von Fluggesellschaften und anderen Unternehmen. Straßenstände schützten sich mit bunten Schirmen vor der Morgensonne. Die männlichen Inder, die hier unterwegs waren, trugen feste Lederschuhe und westliche Anzüge, die Frauen teure Seidenkostüme. Sie alle wirkten effektiv und nüchtern und strebten mit ernster Miene den hohen Bürogebäuden zu.
Überall stieß ich auf den Gegensatz zwischen dem Vertrauten und dem Außergewöhnlichen. An einer Ampel stand ein Ochsenkarren neben einem modernen Sportwagen. Hinter einer Satellitenschüssel ging ein Mann in die Hocke, um sein Geschäft zu verrichten. Mit einem elektrischen Gabelstapler wurden Waren von einem altertümlichen Karren mit Holzrädern heruntergehoben. Es kam mir vor, als sei eine schwerfällige, unermüdliche, ferne Vergangenheit durch die Grenzen der Zeit in ihre eigene Zukunft eingebrochen. Das gefiel mir.
»Wir sind gleich da«, verkündete der große Kanadier. »Ein paar Straßen weiter ist das Zentrum. Allerdings nicht wirklich die City, eher die Touristenmeile, wo es billige Hotels gibt. Der letzte Halt. Colaba heißt das Viertel.«
Die beiden jungen Männer zogen ihre Pässe und Reiseschecks aus ihren Taschen und verstauten sie vorne in ihrer Hose. Der Kleinere nahm sogar seine Uhr ab und ließ sie mitsamt Geld, Pass und anderen Wertsachen in seiner Unterhose verschwinden. Als er merkte, dass ich ihn beobachtete, grinste er und sagte: »Hey, man kann nicht vorsichtig genug sein, Mann.«
Ich stand auf und schob mich zum Ausgang. Als der Bus anhielt, stand ich ganz vorne an der Tür, aber eine Menschenmenge hinderte mich am Aussteigen. Die Männer, die sich vor dem Bus drängten, waren Schlepper, die für Hotelbesitzer, Drogenhändler und andere Geschäftsleute im Einsatz waren. Sie schrien uns in gebrochenem Englisch Angebote für günstige Hotelzimmer und billige Waren zu. Ganz vorne befand sich ein kleiner Mann mit einem großen, beinahe kugelrunden Kopf. Er trug ein Jeanshemd und eine blaue Baumwollhose. Ihm gelang es, die anderen zum Schweigen zu bringen. Dann sprach er mich an, mit dem breitesten und strahlendsten Lächeln, das ich jemals gesehen hatte.
»Guter schöner Morgen, Sirs!«, begrüßte er uns. »Willkommen in Bombay! Wollen Sie billig und prima Hotel, nicht wahr?«
Er starrte mir direkt in die Augen, ohne dass sein Lächeln sich veränderte. Etwas in diesem Lächeln – eine Art schelmische Lebensfreude, ehrlicher und begeisterter als Zufriedenheit – berührte mich zutiefst. Es war das Werk einer Sekunde, dieser Blickkontakt. Und in dieser Sekunde kam ich zu dem Schluss, dass ich ihm vertraute – diesem kleinen Mann mit dem großen Lächeln. Ich konnte es damals noch nicht wissen, aber das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
Einige Leute schlugen nach den Männern, als sie aus dem Bus stiegen. Die jungen Kanadier drängten sich unbehelligt durch die Menge und lächelten die aufdringlichen Schlepper ebenso freundlich an wie die gereizten Touristen. Als ich sah, wie ruhig und gelassen die beiden sich durch diese Menschenmenge bewegten, fiel mir zum ersten Mal auf, wie gesund und kraftvoll und attraktiv sie wirkten. Und ich beschloss, auf ihr Angebot einzugehen und mit ihnen ein Zimmer zu nehmen. Ihre Nähe würde das Verbrechen meiner Flucht, das Verbrechen meiner Existenz unsichtbar machen.
Der kleine Mann zog mich am Ärmel hinter den Bus. Unterdessen kletterte der Schaffner flink wie ein Affe aufs Dach und warf mir meinen Rucksack und meine Reisetasche in die Arme. Andere Taschen landeten mit beunruhigendem Krachen und Klatschen unsanft auf dem Boden. Während andere Fahrgäste angerannt kamen, um der Misshandlung ihres Gepäcks Einhalt zu gebieten, zog mich der kleine Mann zu einer ruhigeren Stelle ein paar Meter vom Bus entfernt.
»Heiße ich Prabaker«, stellte er sich in melodischem Englisch vor. »Wie ist er Ihr guter Name?«
»Lindsay«, sagte ich; der Name aus meinem falschen Ausweis.
»Bin ich Bombay Führer. Sehr erstklassig Bombay Führer bin ich. Alles das Bombay kenne ich sehr, sehr gut. Wollen Sie alles sehen? Weiß ich, wo Sie finden das Beste von alles. Kann ich sogar mehr zeigen als alles.«
Die beiden Kanadier stießen zu uns, im Gefolge eine Schar hartnäckiger Führer und Schlepper. Prabaker schrie seine Kollegen an, die daraufhin ein paar Schritte Abstand nahmen und begehrlich unser Gepäck beäugten.
»Was ich jetzt gerne sofort sehen würde«, sagte ich, »ist ein billiges und sauberes Hotelzimmer.«
»Oh, ist es das kein Problem, Sir!«, strahlte Prabaker. »Kann ich Sie bringen zu billiges Hotel und sehr billiges Hotel und zu ein zu viel billiges Hotel und sogar zu so billiges Hotel, wo nur wohnt, wenn man ist ganz verrückt im Kopf.«
»Okay, gehen wir, Prabaker. Schauen wir uns das mal an.«
»Hey, Augenblick mal«, warf der große Kanadier ein. »Willst du diesem Typen Geld geben? Ich weiß selber, wo die Hotels sind. Sorry, Kumpel – ich meine, du bist bestimmt ein guter Führer und so –, aber wir brauchen dich nicht.«
Ich sah Prabaker an. In seinen großen braunen Augen lag ein Lachen, als er mich eingehend betrachtete. Niemals habe ich einen Mann gekannt, der weniger Feindseligkeit in sich trug als Prabaker Kharre. Er war außerstande, jemandem etwas zuleide zu tun, und das spürte ich schon damals, in diesen ersten Minuten mit ihm.
»Brauche ich Sie, Prabaker?«, fragte ich mit gespieltem Ernst.
»Oh ja!«, rief er aus. »Brauchen Sie mich so sehr, dass ich muss beinahe weinen für Sie! Weiß das nur Gott, was passieren für ganz schreckliche Sachen, wenn Sie nicht geführt sind von mein gute Selbst in Bombay!«
»Ich bezahle ihn«, sagte ich zu den Kanadiern. Die zuckten die Achseln und griffen nach ihrem Gepäck. »Okay. Gehen wir, Prabaker.«
Ich hob meinen Rucksack hoch, aber Prabaker packte ihn hastig.
»Trage ich Ihr Gepäck«, verkündete er höflich.
»Nein danke, es geht schon.«
Anstatt des strahlenden Lächelns bekam ich nun eine bestürzte und bittende Miene zu sehen.
»Bitte, Sir. Ist es das meine Arbeit. Ist meine Pflicht. Habe ich viel starke Rücken. Kein Problem. Schauen Sie.«
Ich fand die Vorstellung unerträglich.
»Nein, wirklich …«
»Bitte, Mr. Lindsay, ist es das eine Ehre für mich. Sehen Sie Leute.«
Er wies mit der Hand auf die Schlepper und Führer, denen es gelungen war, Kunden zu ergattern. Jeder von ihnen schleppte nun ein Gepäckstück und marschierte entschlossen in den mörderischen Verkehr hinein, seine Kundschaft im Gefolge.
»Also gut …«, murmelte ich widerwillig. Dies war meine erste von zahllosen Kapitulationen, die sich im Laufe der Zeit zwischen uns abspielen sollten. Das strahlende Lächeln kehrte auf Prabakers Gesicht zurück, und er hievte meinen Rucksack hoch und befestigte mit meiner Hilfe die Schulterriemen. Der Rucksack war so schwer, dass Prabaker ihn nur leicht gebückt aufladen konnte und ins Schwanken geriet, als er losmarschierte. Ich holte ihn rasch ein und blickte in sein angestrengtes Gesicht. Ich kam mir vor wie ein weißer bwana, der einen Menschen als Lasttier benutzt, und fand das Gefühl widerwärtig.
Doch dieser kleine indische Mann lachte nur, erzählte in einem nicht enden wollenden Redeschwall von Bombay und wies mich auf Sehenswertes hin. Mit den beiden Kanadiern unterhielt er sich mit erlesener Höflichkeit. Er lächelte und rief unterwegs Bekannten Grüße zu. Und er war stark, viel kräftiger, als ich geglaubt hätte: Während des fünfzehnminütigen Marschs zum Hotel blieb er nicht ein Mal stehen.
Vier steile Stiegen in einem modrigen düsteren Treppenhaus im hinteren Teil eines großen Gebäudes am Meer brachten uns schließlich ins Foyer des India Guest House. An jedem Stockwerk sahen wir ein anderes Schild – Apsara Hotel, Star of Asia Guest House, Seashore Hotel –, was darauf schließen ließ, dass es in diesem Gebäude auf jeder Etage ein separates Hotel mit eigener Belegschaft und eigenem Stil gab.
Die beiden Kanadier, Prabaker und ich platzten mit unseren Taschen und Rucksäcken in den engen Empfangsraum. Ein großer muskulöser Inder mit blendend weißem Hemd und schwarzer Krawatte saß hinter einem Stahltisch am Anfang des Korridors, der zu den Gästezimmern führte.
»Willkommen«, sagte er mit vorsichtigem Lächeln. »Willkommen, junge Herren.«
»Ziemliche Absteige«, murmelte der große Kanadier mit einem Blick auf die abblätternde Farbe an den Wänden und die Trennwände aus Billigfurnier.
»Ist das Mr. Anand«, warf Prabaker rasch ein. »Ist er bester Chef von bestes Hotel in Colaba.«
»Schluss damit, Prabaker!«, knurrte Mr. Anand.
Prabakers Lächeln geriet noch breiter.
»Sehen Sie, wie er ist prima Chef dieser Mr. Anand?«, raunte er und grinste mich verschwörerisch an. Dann wandte er sich lächelnd dem prima Chef zu. »Bring ich drei großartige Touristen zu Ihnen, Mr. Anand. Allerbeste Kunden für allerbestes Hotel, nicht wahr?«
»Ich hab gesagt, du sollst den Mund halten!«, fauchte Anand.
»Wie viel?«, fragte der kleinere Kanadier.
»Bitte?«, murmelte Anand und warf Prabaker einen finsteren Blick zu.
»Drei Personen, ein Zimmer, eine Nacht, wie viel?«
»Hundertzwanzig Rupien.«
»Was?«, rief der Kleinere empört. »Soll das ein Witz sein?«
»Das ist zu teuer«, fügte sein Freund hinzu. »Komm, lass uns abhauen.«
»Kein Problem«, knurrte Anand. »Sie können gerne woanders hingehen.«
Die Kanadier griffen nach ihrem Gepäck, aber Prabaker brachte sie mit einem panischen Aufschrei zum Innehalten.
»Nein! Nein! Ist es dies das allerschönstes Hotel! Bitte, gucken Sie nur an die Zimmer! Bitte, Mr. Lindsay, gucken Sie an dieses so viel hübsches Zimmer! Gucken Sie an das prima hübsches Zimmer!«
Ein Schweigen trat ein. Die beiden Kanadier blieben in der Tür stehen. Anand studierte eingehend das Hotelregister. Prabaker hielt mich am Ärmel fest. Der Führer erweckte mein Mitgefühl, und der Hotelchef rang mir Achtung ab. Anand würde nicht bitten oder uns von dem Zimmer zu überzeugen versuchen. Wenn wir es wollten, mussten wir es zu seinen Konditionen nehmen. Als er von dem Register aufblickte, warf er mir einen festen ehrlichen Blick zu, ein aufrechter Mann dem anderen. Ich fing an ihn zu mögen.
»Ich würde es gerne sehen, das hübsche Zimmer«, sagte ich.
»Ja!«, lachte Prabaker.
»Na gut, dann los!«, seufzten die Kanadier lächelnd.
»Am Ende des Flurs«, sagte Anand, ebenfalls lächelnd, nahm einen Schlüssel mit einem schweren Messinganhänger vom Brett hinter sich und warf ihn mir zu. »Letztes Zimmer rechts, mein Freund.«
In dem geräumigen Zimmer standen drei mit Laken bezogene Einzelbetten. Durch eines der Fenster blickte man aufs Meer, durch die anderen auf eine belebte Straße. Jede Wand war in einem anderen Kopfschmerzgrün gestrichen, die Decke von Rissen zerfurcht. Der Betonboden wies sonderbare Wölbungen und Wellen auf und war zur Straßenseite hin abschüssig. Von den Betten abgesehen, bestand das Mobiliar aus drei kleinen Sperrholztischen und einer ramponierten Holzkommode mit gesprungenem Spiegel. Diverse Hinterlassenschaften zeugten vom Aufenthalt ehemaliger Gäste: eine Baileys-Flasche, in der eine geschmolzene Kerze steckte, ein Kalenderblatt mit einer Straßenszene aus Neapel an der Wand, zwei einsame schrumpelige Luftballons am Deckenventilator. Es handelte sich um jene Art von Zimmer, die Menschen dazu veranlasst, ihre Namen und irgendwelche Botschaften an die Wände zu schreiben, wie man es in einer Gefängniszelle tut.
»Ich nehme es«, sagte ich.
»Ja!«, schrie Prabaker und flitzte begeistert den Flur entlang in Richtung Empfangsraum.
Die Kanadier sahen sich an und lachten.
»Dieser Typ ist nicht zum Aushalten. Der ist doch völlig durchgeknallt«, äußerte der Große.
»Kann man so sagen«, grinste der andere, bückte sich und schnüffelte an dem Laken auf einem Bett, bevor er sich vorsichtig darauf niederließ.
Prabaker kehrte mit Anand zurück, der das schwere Hotelregister schleppte. Wir schrieben uns nacheinander ein, während Anand unsere Pässe prüfte. Ich zahlte für eine Woche im Voraus. Dann gab Anand den anderen ihre Pässe zurück, meinen behielt er jedoch noch einen Moment in der Hand und klopfte sich nachdenklich damit an die Wange.
»Neuseeland?«, murmelte er.
»Ja«, sagte ich stirnrunzelnd und fragte mich, ob er etwas bemerkt hatte. Schließlich war ich der meistgesuchte Mann Australiens, geflüchtet vor einer zwanzigjährigen Haftstrafe, verurteilt wegen bewaffneter Raubüberfälle, und ein heißer neuer Name auf der Interpol-Liste entflohener Straftäter. Was will er? Was weiß er?
»Hmmm. Okay, Neuseeland, Neuseeland, Sie möchten bestimmt etwas rauchen, viel Bier, paar Flaschen Whisky, Geld wechseln, schicke Mädchen, gute Party. Wenn Sie was kaufen wollen, Sie sagen mir Bescheid, ja?«
Er klatschte mir den Pass in die Hand und ging hinaus, wobei er Prabaker noch einen giftigen Blick zuwarf. Der kleine Führer zog den Kopf ein, lächelte aber äußerst zufrieden.
»Prima Mann. Prima Chef«, sprudelte er heraus, sobald Anand verschwunden war.
»Gibt es viele Neuseeländer hier, Prabaker?«
»Nicht so sehr viele, Mr. Lindsay. Oh, aber sind sie sehr nette Burschen. Lachen, rauchen, trinken, machen Sexe mit die Frauen die ganze Nacht, und dann lachen sie noch mehr und rauchen und trinken.«
»Aha. Sie wissen nicht zufällig, wo ich ein bisschen Haschisch herkriegen könnte, Prabaker?«
»Keeeein Problem! Kann ich beschaffen ein toola, ein Kilo, zehn Kilo, kenne ich ein ganzes Lagerhaus, das ist voll …«
»Ich brauche kein ganzes Lagerhaus voller Hasch. Nur genug für einen Joint.«
»Hab ich grade ein Toola, zehn Gramm, von das beste afghanisches Charras hier in meine Tasche. Wollen Sie kaufen?«
»Was soll das kosten?«
»Zweihundert Rupien«, schlug er mit hoffnungsvoller Miene vor.
Ich ging davon aus, dass es hierzulande höchstens halb so viel wert war, aber zweihundert Rupien – damals etwa zwölf US-Dollar – war nur ein Zehntel des Preises, den man in Australien zahlte. Ich warf Prabaker ein Päckchen Tabak und Zigarettenpapier zu. »Okay. Rauchen wir mal einen Probejoint. Wenn ich es gut finde, kaufe ich.«
Meine zwei Zimmergenossen hatten es sich auf zwei Betten nebeneinander bequem gemacht. Als Prabaker den Brocken Haschisch zutage förderte, warfen die beiden sich einen Blick zu und beobachteten das Geschehen mit gerunzelter Stirn und geschürzten Lippen. Fasziniert und ängstlich zugleich sahen sie zu, wie der kleine Führer sich auf die Knie niederließ, um auf der staubigen Kommode den Joint zu drehen.
»Hey, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee, Mann?«
»Ja, die könnten uns doch verpfeifen, und dann sind wir dran!«
»Ich habe ein gutes Gefühl, was Prabaker angeht. Ich glaube nicht, dass die uns reinlegen wollen«, antwortete ich und breitete meine Reisedecke auf dem Bett unter den hohen Fenstern aus. Dann legte ich meine Habseligkeiten, meine Andenken und Glücksbringer auf dem Fenstersims aus – einen schwarzen Stein, den ein Kind in Neuseeland mir geschenkt hatte, eine versteinerte Schnecke, die ein Freund von mir gefunden hatte, und ein Armband aus Habichtkrallen, das ein anderer Freund mir gemacht hatte. Ich hatte kein Zuhause mehr und kein Heimatland. Meine Taschen waren angefüllt mit Dingen, die ich von Freunden bekommen hatte: ein großer Verbandskoffer, für den sie zusammengelegt hatten, Zeichnungen, Gedichte, Muscheln, Federn. Sogar meine Kleider und die Stiefel an meinen Füßen hatten Freunde mir geschenkt. Jeder Gegenstand war ein Talisman; in meinem Exil der Flucht war das Fenstersims mein Zuhause und die Glücksbringer waren meine Heimat.
»Aber wenn euch nicht wohl ist dabei, dann geht doch spazieren oder wartet draußen, Jungs. Ich stoße wieder zu euch, wenn ich den Joint geraucht hab. Es ist einfach so, dass ich Freunden von mir versprochen habe, dass ich als Erstes Haschisch rauche und an sie denke, wenn ich nach Indien komme. Und dieses Versprechen möchte ich gerne halten. Außerdem schien der Chef es doch locker zu nehmen. Kann es Probleme geben, wenn man hier einen Joint raucht, Prabaker?«
»Rauchen, trinken, tanzen, Musik, Sexsache, ist es das alles kein Problem hier«, versicherte uns Prabaker fröhlich und blickte einen Moment auf. »Ist es alles erlaubt und kein Problem hier. Nur nicht schlagen. Schlägerei ist viel schlecht Benehmen in das India Guest House.«
»Seht ihr? Kein Problem.«
»Und sterben«, fügte Prabaker hinzu und wackelte nachdenklich mit dem Kopf. »Mag er das gar nicht, der Mr. Anand, wenn sie hier sterben, die Leute.«
»Was? Was redet er da vom Sterben?«
»Meint er das ernst? Wer will denn verflucht noch mal hier sterben? Großer Gott!«
»Ist das kein Problem mit Sterben, baba«, verkündete Prabaker beruhigend und reichte den verstörten Kanadiern den akkurat gedrehten Joint. Der Große nahm ihn in Empfang und zündete ihn an. »Sterben nicht viele Leute in das India Guest House, nur diese Junkies, die mit das dürres Gesicht, wisst ihr. Für euch ist es das alles kein Problem mit eure wunderschön fette Körper.«
Mit entwaffnendem Lächeln brachte er mir den Joint. Als ich ihn zurückgab, zog er mit sichtlichem Genuss daran und gab ihn wieder den Kanadiern.
»Ist es das gutes Charras, ja?«
»Wirklich gut, das Zeug«, bestätigte der Große. Sein Lächeln war offen und herzlich – so warm und freundlich, wie ich es in all den Jahren danach immer wieder bei Kanadiern erlebt habe und wie ich es seither mit Kanada verbinde.
»Ich nehme es«, sagte ich zu Prabaker, der mir daraufhin den Haschischbrocken übergab. Ich brach das Zehn-Gramm-Stück entzwei und warf eine Hälfte dem großen Kanadier zu. »Hier. Für eure Zugfahrt nach Poona morgen.«
»Danke, Mann«, sagte der und zeigte das Piece seinem Freund. »Du bist echt okay. Verrückt, aber schwer in Ordnung.«
Ich holte eine Flasche Whisky aus meinem Rucksack und brach das Siegel. Auch das war ein Ritual; ich hatte einer Freundin aus Neuseeland versprochen, einen Whisky zu trinken und an sie zu denken, sollte es mir gelingen, mit meinem falschen Pass nach Indien zu gelangen. Diese kleinen Rituale – der Joint und der Whisky – bedeuteten mir viel, weil ich mir sicher war, diese Freundin und alle anderen Freunde ebenso für immer verloren zu haben wie meine Familie. Ich war mir sicher, dass ich sie niemals wiedersehen würde. Ich war allein auf der Welt, ohne Hoffnung auf Rückkehr, und mein Leben bestand aus Erinnerungen, Glücksbringern und Versprechen.
Ich wollte die Flasche gerade ansetzen, doch dann bot ich sie, einer Eingebung folgend, Prabaker zuerst an.
»Viel großer Dank, Mr. Lindsay«, sprudelte er begeistert hervor. Er legte den Kopf in den Nacken und goss sich einen großen Schluck Whisky in den Rachen, ohne die Flasche mit den Lippen zu berühren. »Ist er sehr gut, erste Klasse, Johnnie Walker, oh ja.«
»Sie können ruhig noch mehr trinken.«
»Nur ein winzig Stückchen, danke sehr.« Gluckernd ließ Prabaker noch einen Schluck in seinen Mund rinnen. Dann ließ er die Flasche sinken, leckte sich die Lippen und hielt sie ein drittes Mal über den geöffneten Mund. »Verzeihung, aaah, bitte um Verzeihung. Ist er so sehr gut, diese Whisky, dass ich bekomme schlechte Manieren.«
»Wenn er Ihnen so gut schmeckt, behalten Sie die Flasche doch. Ich habe noch eine zweite. Ich hab sie zollfrei im Flugzeug gekauft.«
»Oh, danke sehr …«, erwiderte Prabaker, aber sein Lächeln hatte einen schmerzhaften Zug.
»Was ist los? Wollen Sie ihn nicht?«
»Ja, ja, Mr. Lindsay, sehr viel ja. Aber hätte ich gewusst, dass dies ist mein Whisky und nicht der von Sie, wäre ich nicht so großzügig gewesen mit das mein gute Selbst.«
Die Kanadier lachten.
»Ich sag Ihnen was, Prabaker. Sie kriegen die zweite Flasche, und wir vier teilen uns die angebrochene. Was halten Sie davon? Und hier sind die zweihundert Rupien für das Haschisch.«
Das Lächeln erstrahlte wieder, und Prabaker nahm die volle Flasche in Empfang und wiegte sie zärtlich im Arm.
»Aber, Mr. Lindsay, machen Sie ein Fehler. Sage ich Ihnen jetzt was: dieses sehr bestes Charras kostet hundert Rupien, nicht zweihundert.«
»Hm.«
»Oh ja. Nur hundert Rupien«, erklärte er und gab mir entschieden einen der Geldscheine zurück.
»Okay. Hören Sie, Prabaker, ich habe Hunger. Ich habe im Flugzeug nichts gegessen. Könnten Sie mir vielleicht ein gutes sauberes Restaurant zeigen?«
»Aber sicher ja, Mr. Lindsay, Sir! Kenne ich ein viel prima Restaurant mit solches Wunder von Essen, dass Sie werden ganz krank sein vor Glück!«
»Überredet«, sagte ich, stand auf und steckte Geld und Pass ein. »Kommt ihr zwei mit?«
»Was, da raus? Ist nicht dein Ernst.«
»Na, später vielleicht. Eher viel später. Aber wir passen hier auf dein Zeug auf und warten auf dich.«
»Okay, wie ihr meint. Ich bin in ein paar Stunden wieder da.«
Prabaker verbeugte sich formvollendet und verabschiedete sich. Ich folgte ihm zur Tür. Als wir gerade rausgehen wollten, rief der große Kanadier mir nach: »Hey, Mann … sei vorsichtig da draußen, okay? Ich meine, du kennst dich hier nicht aus. Du solltest keinem trauen. Das ist kein Dorf hier. Die Inder aus der Stadt sind … na ja, pass einfach auf, okay?«
Am Empfangstisch verstaute Mr. Anand meinen Pass, meine Reiseschecks und den Großteil meines Bargelds in seinem Safe und stellte mir eine ausführliche Quittung aus. Dann begab ich mich auf die Straße, wobei mir die Worte des jungen Kanadiers so aufgeregt im Kopf umherflatterten wie Möwen über der Brandung.
Prabaker hatte uns auf einer breiten, von Bäumen gesäumten und relativ menschenleeren Straße zum Hotel geführt, die vom hohen Steintor des Gateway of India Monument entlang der Küste verlief. Die Straße vor dem Hotel dagegen war voller Menschen und Fahrzeuge, und Stimmengewirr und Verkehrslärm erzeugten ein dumpfes Dröhnen wie prasselnder Regen auf Blechdächern.
Hunderte von Menschen waren hier unterwegs oder standen in Gruppen beisammen. Geschäfte, Restaurants und Hotels drängten sich dicht an dicht, und vor jedem Haus fand sich ein Verkaufsstand, der von zwei oder drei Händlern auf Klappstühlen betrieben wurde – Afrikanern, Arabern, Europäern oder Indern. Mit jedem Schritt drangen neue Sprachen und neue Musik an mein Ohr, und vor jedem Restaurant lag ein anderer aromatischer Geruch in der heißen Luft.
Männer mit Ochsenkarren oder Handwagen manövrierten sich durch den Verkehr, um Wassermelonen, Reissäcke, Limonade, voll gehängte Kleiderständer, Zigaretten oder Eisblöcke zu liefern. Dicke Geldbündel wurden gezählt und wechselten den Besitzer; wir befanden uns auf dem Devisenschwarzmarkt, hatte Prabaker mir erklärt. Ich sah Bettler, Jongleure, Akrobaten, Schlangenbeschwörer, Musiker, Wahrsager, Handleser, Zuhälter und Drogenhändler. Und die Straße war schmutzig. Ohne Vorwarnung wurde Müll aus den Fenstern geworfen, und auf dem Gehweg und in der Straßenmitte lagen große Abfallhaufen, an denen sich fette, furchtlose Ratten gütlich taten.
Am meisten stachen mir jedoch die zahllosen verkrüppelten und siechen Bettler ins Auge. Jede erdenkliche Krankheit, jede Behinderung und jede Form von Entbehrung war in dieser Straße unterwegs, stand am Eingang von Restaurants und Läden oder näherte sich den Fußgängern mit versierten Klagerufen. Wie bei meinem ersten Blick auf die Slums trieb mir auch dieses Erlebnis die Schamesröte ins Gesicht. Doch während Prabaker mich durch das Getümmel führte, lenkte er meine Aufmerksamkeit immer wieder auf Szenen, die das groteske erschreckende Bild etwas milder wirken ließen: Eine Gruppe von Bettlern saß in einem Eingang und spielte Karten, ein paar blinde Männer führten sich genüsslich Reis und Fisch zu Gemüte, und lachende Kinder zankten sich darum, wer als Nächstes auf dem kleinen Rollkarren bei dem Mann ohne Beine mitfahren durfte.
Prabaker warf mir immer wieder Seitenblicke zu.
»Unser Bombay – gefällt es Ihnen?«
»Wunderbar«, sagte ich, und das war die Wahrheit. In meinen Augen war diese Stadt hinreißend schön, aufregend und wild. Romantisch anmutende Kolonialbauten standen neben verspiegelten modernen Bürogebäuden. Vor halb verfallenen niedrigen Wohnhäusern wurde Obst und Gemüse und schimmernde Seide im Überfluss angeboten. Aus jedem Geschäft und jedem Taxi hörte man Musik. Die Farben waren leuchtend und prachtvoll, die Düfte betörend. Und nirgendwo auf der Welt hatte ich in so vielen Augen ein Lächeln gesehen wie bei den Menschen in dieser Straße.
Und Bombay strahlte Freiheit aus – berauschende Freiheit. Ich sah diesen freien ungehinderten Geist, wo ich auch hinblickte, und ich spürte, wie mir das Herz aufging. Selbst die brennende Scham, die ich empfunden hatte, als ich zum ersten Mal die Slums und Bettler sah, verschwand mit der Erkenntnis, dass diese Männer und Frauen frei waren. Niemand vertrieb die Bettler von der Straße. Niemand verbannte die Slumbewohner. Ihr Leben mochte elend sein, doch sie durften es in denselben Gärten und Straßen zubringen wie die Reichen und Mächtigen. Sie waren frei. Diese Stadt war frei, und ich liebte sie.
Dennoch machten mich die Wucht der Bedürfnisse, das wilde Treiben, gezeugt aus Nöten und Begehrlichkeiten, die Heftigkeit der Bitten und Machenschaften auf der Straße innerlich unruhig. Ich sprach keine der Sprachen, die an mein Ohr drangen. Ich wusste nichts über die unterschiedlichen Kulturen dieses Landes, über die Menschen in Saris, fremdartigen Gewändern, Turbanen. Ich kam mir vor wie in einem schwer verständlichen Theaterstück, das ich nicht kannte. Doch ich lächelte, und das Lächeln fiel mir leicht, so fremd und verwirrend meine Umgebung auch auf mich wirkte. Ich war auf der Flucht. Ich wurde gesucht, gejagt, auf meinen Kopf war ein Preis ausgesetzt. Und ich war ihnen immer noch einen Schritt voraus. Ich war frei. Auf der Flucht ist jeder Tag ein ganzes Leben. Jede Minute in Freiheit ist eine Kurzgeschichte mit Happy End.
Und ich war froh, Prabaker an meiner Seite zu haben. Ich merkte, dass er von vielen unterschiedlichen Menschen auf der Straße herzlich gegrüßt wurde.
»Müssen Sie sein viel hungrig, Mr. Lindsay«, äußerte Prabaker. »Sind Sie ein glücklicher Mann, wenn ich sagen darf, und hat er immer gute Appetit ein Glücklicher.«
»Ja, ich habe Hunger, ziemlich sogar. Wo ist dieses Restaurant überhaupt? Wenn ich gewusst hätte, dass es so ein weiter Marsch ist, hätte ich mir einen Imbiss mitgenommen.«
»Nur noch klein bisschen – nicht mehr zu weit«, antwortete Prabaker fröhlich.
»Aha …«
»Oh ja! Bringt es Sie zu bestes Restaurant mein gute Selbst, mit viel köstlichem Essen aus Maharashtra. Genießen sie das sehr prima Essen, kein Problem. Essen sie alle Bombay Führer da. Ist es so gut das Essen, dass sie müssen der Polizei nur Hälfte von normalem Bakschisch zahlen. So gut ist es das Essen.«
»Aha.«
»Oh ja! Aber erst will ich kaufen indische Zigarette für Sie und für mein gutes Selbst. Hier, halten wir hier.«
Er trat zu einem Klapptisch, auf dem ein Karton mit unterschiedlichen Zigarettenschachteln und ein großes Messingtablett mit mehreren Silberschalen standen, die Kokosraspeln, Gewürze und diverse unidentifizierbare Pasten enthielten. Neben dem Tisch trieben spitze Blätter in einem Eimer Wasser. Der Zigarettenverkäufer trocknete die Blätter ab, bestrich sie mit mehreren Pasten, füllte sie mit gehackten Datteln, Kokosraspeln, Betel und Gewürzen und rollte sie fest zusammen. Die Kunden, die sich um den Tisch drängten, rissen ihm die gerollten Blätter aus den Händen, sobald sie fertig waren.
Prabaker drängte sich nach vorne und wartete auf den richtigen Moment, um seine Bestellung anzubringen. Ich reckte mich, um ihn im dichten Gedränge nicht aus den Augen zu verlieren, und ging dabei rückwärts. Als ich vom Gehweg auf die Straße trat, hörte ich einen Aufschrei.
»Vorsicht!«
Zwei Hände packten meinen Ellbogen und rissen mich just in dem Moment zurück, als ein breiter Doppeldeckerbus vorbeidonnerte. Der Bus hätte mich überfahren, wäre ich nicht zurückgehalten worden. Als ich mich umdrehte, um zu erfahren, wem ich meine Rettung verdankte, stand ich vor der schönsten Frau, die ich je gesehen hatte. Sie war schlank, hatte schulterlanges, schwarzes Haar und helle Haut. Obwohl sie nicht groß war, wirkte sie durch ihre aufrechte Haltung und ihren festen Stand kraftvoll und entschlossen. Sie trug Pumphosen aus Seide, flache schwarze Schuhe, ein lose fallendes Baumwollhemd und einen langen breiten Seidenschal. Ihre Kleidung schillerte in unterschiedlichen Grüntönen, und die beiden Enden des Seidenschals wirbelten und flatterten auf ihrem Rücken wie eine Mähne.
Der Schlüssel zu allem, was ein Mann an dieser Frau lieben und fürchten sollte, offenbarte sich schon in jenem ersten Augenblick – in dem ironischen Lächeln, das ihre vollen geschwungenen Lippen umspielte. Stolz zeichnete sich in diesem Lächeln ab und Selbstsicherheit in ihrer schmalen feinen Nase. Ohne auch nur im Geringsten zu verstehen, weshalb, war ich mir sicher, dass viele Menschen ihren Stolz für Überheblichkeit und ihre Selbstsicherheit für Gleichgültigkeit hielten. Diesen Fehler beging ich nicht. Mein Blick verlor sich, schwebte und trieb in der schimmernden Lagune ihres klaren Blicks. Ihre Augen waren groß und unfassbar grün. So grün wie Bäume in besonders intensiven Träumen. So grün wie der Ozean, wenn der Ozean vollkommen wäre.
Ihre Hand ruhte noch immer in meiner Armbeuge, neben dem Ellbogen. Die Berührung war so, wie die Berührung einer Liebsten sein soll: vertraut, und doch so erregend wie eine geflüsterte Verheißung. Ich verspürte den schier unwiderstehlichen Drang, die Hand dieser Frau zu nehmen und sie auf meine Brust zu legen, nahe dem Herzen. Vielleicht hätte ich das damals tun sollen. Heute weiß ich, dass ihr die Geste gefallen und dass sie gelacht hätte. Doch damals waren wir Fremde, und so verharrten wir fünf lange Sekunden in der Bewegung und starrten uns in die Augen, umwirbelt von all jenen anderen Welten, all den möglichen Leben, die es niemals geben würde. Dann sprach sie.
»Das war knapp. Glück gehabt.«
»Ja«, sagte ich und lächelte. »Habe ich immer noch.«
Ihre Hand entfernte sich von meinem Arm. Die Geste wirkte locker und entspannt, doch für mich war sie so erschreckend, als sei ich ruckartig aus einem bunten und beglückenden Traum erwacht. Ich beugte mich vor und blickte links und rechts an der Frau vorbei.
»Was ist?«, fragte sie.
»Ich halte Ausschau nach Ihren Flügeln. Sie sind doch mein Schutzengel, oder nicht?«
»Ich fürchte nein«, erwiderte sie mit einem kleinen Lächeln, das Grübchen in ihren Wangen erscheinen ließ. »Ich habe zu viel vom Teufel in mir.«
»Um wie viel genau handelt es sich denn?«, erkundigte ich mich grinsend.
Auf der anderen Seite des Tabaktisches stand eine Gruppe junger Inder. Einer von ihnen, ein gutaussehender sportlicher Typ Mitte zwanzig, trat auf die Straße und rief: »Karla! Komm schon, yaar!«
Die Frau wandte sich um und winkte ihm zu, dann verabschiedete sie sich mit einem Händedruck, der fest, aber ebenso vieldeutig war wie ihr Lächeln. Vielleicht mochte sie mich, vielleicht war sie aber auch froh, mich wieder loszuwerden.
»Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet«, sagte ich, als sie meine Hand losließ.
»Wie viel Teufel ich in mir habe?«, erwiderte sie, und das ironische Lächeln erschien wieder. »Das ist eine sehr persönliche Frage. Wenn ich’s mir recht überlege, ist das sogar die persönlichste Frage, die mir je gestellt wurde. Aber wenn Sie mal im Leopold’s vorbeischauen, bekommen Sie vielleicht eine Antwort.«
Ihre Freunde standen nun auf unserer Seite des Tabakstands, und sie gesellte sich zu ihnen. Diese jungen Inder trugen die gepflegte westlichmodische Kleidung der Mittelschicht. Sie lachten viel und berührten sich freundschaftlich, doch Karla blieb von dieser Vertrautheit ausgeschlossen. Sie schien von einer Aura umgeben, die anziehend und undurchdringlich zugleich war. Ich trat näher und tat, als beobachte ich den Zigarettenverkäufer mit seinen Blättern und Pasten. Als Karla mit ihren Freunden sprach, horchte ich angestrengt, verstand jedoch die Sprache nicht. Ihre Stimme klang jetzt erstaunlich tief und kehlig, und ich spürte, wie sich die Haare an meinen Armen aufrichteten. Auch das hätte ich wohl als Warnung verstehen sollen. Die Stimme, sagen die afghanischen Ehestifter, macht die halbe Liebe aus. Doch das wusste ich damals nicht, und mein Herz begab sich flugs dorthin, wo sogar die Ehestifter Vorsicht walten lassen.
»Schauen Sie, Mr. Lindsay, hab ich gekauft zwei Zigaretten für uns«, verkündete Prabaker, als er wieder zu mir trat und mir mit großer Geste eine der beiden offerierte. »Ist dies Indien, das Land von die arme Leute. Muss man hier nicht kaufen eine ganze Schachtel Zigaretten. Nur eine, kauft man nur eine. Und muss man auch nicht kaufen Streichhölzer.«
Er beugte sich vor und griff nach einem Hanfseil mit glühendem Ende, das mit einem Haken an dem Telegrafenmasten neben dem Zigarettenstand befestigt war. Prabaker pustete die Asche weg und entzündete seine Zigarette an der Glut.
»Was rollt der Mann da? In diesen Blättern?«
»Heißt es paan. Ist das ein sehr prima Geschmack für Kauen. In Bombay kauen alle und spucken, kauen und spucken mehr, kein Problem, auch Tag und Nacht. Ist es sehr gut für Gesundheit, das viel Kauen und viel Spucken. Wollen Sie probieren? Hole ich für Sie.«
Ich nickte, nicht so sehr wegen meines Interesses an Paan, sondern weil mir die Bestellung Gelegenheit gab, Karla noch länger anzusehen. Sie wirkte so locker und entspannt in ihrer Umgebung, gehörte zu dieser Straße und deren geheimen Geschichten. Was auf mich verwirrend wirkte, schien für sie alltäglich. Ich dachte wieder an den Ausländer, den ich im Slum gesehen hatte. Wie er, schien Karla sich wohlzufühlen in Bombay, und ich beneidete sie um die Zuwendung und Freundlichkeit, die ihr von den anderen zuteilwurde.
Doch vor allem war ich von ihrer Anmut gefesselt. Ich sah sie an, eine Fremde, und jeder Atemzug kämpfte sich den Weg durch meine Brust. Etwas umklammerte mein Herz wie eine Faust, die sich zusammenballt, und eine Stimme in meinem Blut raunte ja, ja, ja … In den alten Sanskritlegenden ist die Rede von der schicksalhaften Liebe, der karmischen Verbindung zwischen zwei Seelen, die bestimmt sind, aufeinander zu treffen und sich zu verzaubern. Die Legenden sagen, dass man die Geliebte augenblicklich erkennt, da man jede Geste, jeden Gedanken, jede Bewegung, jeden Laut und jedes Gefühl liebt, von dem ihre Augen erzählen. Die Legenden sagen, dass wir sie an ihren Flügeln erkennen – Flügeln, die nur wir sehen können – und an dem Verlangen nach ihr, das jedes andere Liebesbegehren ersterben lässt.
Jene Legenden warnen auch davor, dass solch schicksalhafte Liebe manchmal auch nur von einer der beiden verwobenen Seelen Besitz ergreift. Doch Weisheit ist eigentlich das Gegenteil von Liebe. Die Liebe überlebt in uns, weil sie ganz und gar nicht weise ist.
»Ah, schauen Sie das Mädchen«, bemerkte Prabaker, als er mit dem Paan zurückkehrte und meinen Blick verfolgte. »Finden Sie schön diese Mädchen, na? Ist das die Karla.«
»Sie kennen sie?«
»Oh ja! Karla ist sie gekannt von allen«, raunte er so laut, dass ich fürchtete, sie könnte ihn hören. »Wollen Sie treffen?«
»Treffen?«
»Wenn Sie wollen, spreche ich mit ihr. Wollen Sie sein der Freund von ihr?«
»Was?«
»Oh ja! Ist sie eine Freundin von mir, die Karla, und wird sie sicher auch Freundin sein von Sie. Vielleicht können Sie verdienen viel Geld für Ihr prima Selbst in Geschäft mit Karla. Vielleicht werden Sie so gute und prima Freunde, dass Sie haben viele Sex zusammen und machen Ihre Körper große Freude. Bestimmt haben Sie viele freundliche Lust.«
Prabaker rieb sich wahrhaftig schon die Hände. Seine Zähne und seine Lippen waren rot gefleckt vom Paansaft. Ich musste ihn am Arm packen, damit er nicht zu Karla und ihren Freunden marschierte.
»Nein! Halt! Reden Sie doch um Himmels willen leiser, Prabaker! Wenn ich mit ihr sprechen will, kann ich das alleine tun.«
»Oh, verstehe ich das«, sagte er und blickte verlegen. »Ist, was sie nennen Vorspiel die Fremden, nicht?«
»Nein! Vorspiel ist … ach, vergessen Sie das mit dem Vorspiel.«
»Oh, gut! Vergesse ich immer die Vorspiele, Mr. Lindsay. Bin ich indischer Kerl, und kümmern wir indische Kerle nicht um Vorspielen. Wollen wir gleich hopsen und stoßen, oh ja!«
Er umfasste den imaginären Körper einer Frau, machte rhythmische Bewegungen mit seinen schmalen Hüften und entblößte dabei entzückt lächelnd seine rot verfärbten Zähne.
»Hören Sie sofort auf!«, fauchte ich und blickte rasch zu Karla und ihren Freunden hinüber, um zu sehen, ob wir beobachtet wurden.
»Ist gut, Mr. Lindsay«, seufzte Prabaker ergeben und verlangsamte seine Hüftbewegungen, bis sie ganz zum Erliegen kamen. »Aber kann ich immer noch gutes Angebot machen für Freundschaft mit die Miss Karla, wenn Sie wollen?«
»Nein! Ich meine – nein danke. Ich möchte ihr kein eindeutiges Angebot machen. Ich … ach, zum Teufel, was soll’s. Sagen Sie mir nur … der Mann, der jetzt redet – welche Sprache spricht er?«
»Spricht er die Hindi-Sprache, Mr. Lindsay. Warten Sie eine Minute, dann ich sage Ihnen, was er redet.«
Prabaker begab sich auf die andere Seite des Standes und mischte sich ungeniert unter Karlas Freunde. Keiner beachtete ihn. Er nickte, stimmte in das allgemeine Gelächter ein und kehrte nach ein paar Minuten zurück.
»Erzählt er prima komische Geschichte über ein Inspektor bei die Polizei von Bombay, ein Mann mit viel große Macht hier in diese Gegend. Hat er ein sehr viel schlaue Kerl in das Gefängnis gesperrt, der Inspektor, aber hat er der schlauer Kerl überredet den Inspektor, ihn freizulassen, weil hat Gold und Juwelen. Und als er ist dann frei, hat er verkauft Gold und Juwelen der schlauer Kerl dem Inspektor. Aber waren sie nicht echt, Gold und Juwelen. Waren sie Imitat und sehr billig. Und ist es das allerschlimmes Unheil, dass er hat eine Woche gewohnt in Inspektors Haus, der schlauer Kerl, bevor er die unechte Juwelen verkauft. Und gibt es jetzt das großes Gerücht, dass er hatte Sexe mit die Frau von Inspektor, der schlauer Kerl. Und ist er jetzt ganz wild der Inspektor so wütend, dass alle rennen, wenn sie ihn sehen.«
»Woher kennen Sie sie? Wohnt sie hier?«
»Wen kennen, Mr. Lindsay – die Frau von Inspektor?«
»Nein, natürlich nicht! Ich meine diese andere Frau – Karla.«
»Wissen Sie«, sagte Prabaker und runzelte zum ersten Mal ernsthaft die Stirn, »gibt es viele, viele Mädchen in dies Bombay. Sind wir fünf Minuten entfernt von Ihr Hotel. In diese fünf Minuten haben wir gesehen viel hundert Mädchen. In die nächste fünf Minuten sehen wir noch mehr hundert Mädchen. Jede fünf Minuten mehr hundert Mädchen. Und wenn wir gehen weiter, sehen wir hundert und hundert und hundert und hundert –«
»Ja, Hunderte Mädchen, großartig!«, unterbrach ich ihn sarkastisch, lauter als beabsichtigt. Ich blickte mich um. Einige Leute betrachteten mich mit unverhohlener Verachtung. Mit gesenkter Stimme fuhr ich fort: »Ich will nichts wissen über Hunderte von Mädchen, Prabaker. Ich … interessiere mich … nur … für dieses eine Mädchen, okay?«
»Okay, Mr. Lindsay, erzähle ich alles. Die Karla – ist sie ein berühmte Geschäftsmann in Bombay. Sehr lange ist sie auch schon hier. Fünf Jahre vielleicht. Hat sie ein kleines Haus, nicht weit entfernt. Kennt jeder die Karla.«
»Woher kommt sie?«
»Glaub ich, Deutsch oder so.«
»Aber ihre Aussprache hört sich amerikanisch an.«
»Ja, hört an, aber ist sie von Deutsch oder ähnlich dem Deutsch. Und ist jetzt fast sehr indisch. Wollen Sie jetzt Essen?«
»Ja, gleich.«
Karlas Freunde verabschiedeten sich am Paanstand und verschwanden im Getümmel der Straße. Karla schloss sich ihnen an. Auch ihr Gang war aufrecht, fast trotzig. Ich sah ihr nach, bis sie in der wogenden Menschenmenge unterging, doch sie drehte sich nicht um.
»Kennen Sie ein Lokal namens Leopold’s?«, fragte ich Prabaker, als wir zusammen weitergingen.