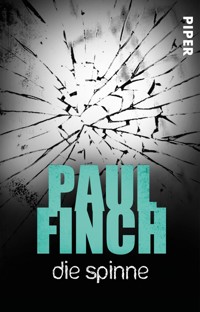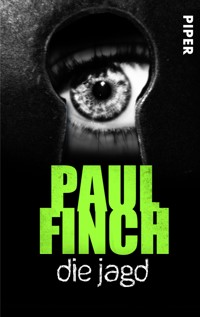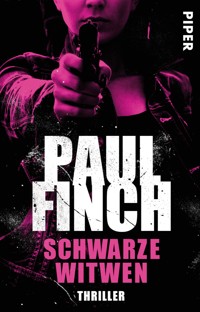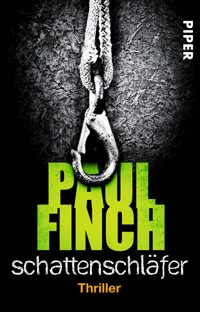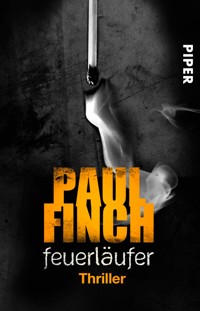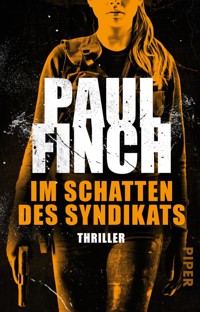
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zunächst sieht es nach ganz gewöhnlichen Raubüberfällen und Morden aus, die Manchester in Atem halten. Doch schon bald findet die junge Polizistin Lucy Clayburn heraus, dass die Mordopfer allesamt Dreck am Stecken haben. Jemand hat es auf die Drahtzieher von Manchesters Unterwelt abgesehen – und auf Lucys Vater, den Chef des gefährlichsten Syndikats der Stadt. Schon bald sieht sich Lucy nicht nur mit dem schwierigsten Fall ihrer Karriere konfrontiert, sondern auch mit der Entscheidung, ob sie zu den Guten oder zu den Bösen gehören will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Meinen Kindern Eleanor und Harry, die, auch wenn sie
inzwischen nicht mehr bei uns wohnen, immer verfügbar
sind, um ein paar Ideen auszutauschen.
Übersetzung aus dem Englischen von Bärbel und Velten Arnold
© Paul Finch 2017
Titel der englischen Originalausgabe:
»Shadows«, Avon, a division of HarperCollins Publishers, London 2017
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2019
Redaktion: Barbara Raschig
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: Lorado/Getty Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
1. Wenn man eine ...
2. Detective Constable Lucy ...
3. Lucy Clayburn war ...
4. Da Crowley einmal ...
5. Lucy war um ...
6. Joe Lazenby mochte ...
7. Detective Inspector Stan ...
8. Die Raubabteilung von ...
9. Den normalen Joe ...
10. Lucy stempelte sich ...
11. Lockvogel-Einsätze zeichneten sich ...
12. Die Wohnungen der ...
13. »Es war sehr ...
14. »Bevor Lee Gaskin ...
15. Lucy brauchte erst ...
16. Andy Northwoods Anwesen ...
17. Harry warf einen ...
18. Der Pub The ...
19. In seiner Eigenschaft ...
20. Lucy und Harry ...
21. Sie erreichten O’Halloran’s ...
22. Cora Clayburn arbeitete ...
23. Obwohl sie zwei ...
24. »Sind Sie sicher, ...
25. Während Detective Sergeant ...
26. An jedem Montagmorgen ...
27. Ursprünglich gehörte Lucys ...
28. Das Astarte war ...
29. Wie immer waren ...
30. »Hallo Lucy, was ...
31. »Boss?«, sagte Spicer. ...
32. Lucy wich über ...
33. »Frank?«, meldete sich ...
34. »Lucy?« Als Danny ...
35. Lucy lief im ...
36. Frank McCracken war ...
37. Die Enthüllung der ...
38. Coras Haus lag ...
39. Bevor Lucy auch ...
40. Der sogenannte Schuppen ...
41. »Und?«, fragte Armstrong ...
42. Kyle Armstrong, der ...
43. »Du bist doch ...
44. Als Lucy von ...
Epilog
Kapitel 1
Wenn man eine Kneipentour mit den Kumpels erfolgreich beenden will – wenn man es also schaffen will, sich wirklich in jedem Pub auf der geplanten Route einen Drink zu genehmigen –, gibt es vor allem ein Problem: Die Gruppe, mit der man losgezogen ist, löst sich unvermeidlich auf, bevor man im letzten Pub angekommen ist.
Klar, die Zechtour startet in der gewohnten Hochstimmung mit lautem Gejohle und gegenseitigem Schulterklopfen, während die aufgedrehte Horde krakeelend in die ersten Pubs einfällt. Doch im Laufe des Abends, wenn der Geräuschpegel steigt und der goldene Nektar in Strömen die gierigen Kehlen hinunterfließt, werden die Köpfe zusehends benebelter, und nach und nach steigt einer nach dem anderen aus, wenn die Gruppe weiterzieht, um die nächste Kneipe anzusteuern. Meistens bleiben Trinkkumpane zurück, weil sie ihr Pint noch nicht ganz geleert oder ein Mädel getroffen haben, das sie kennen, oder weil sie schlicht und einfach den Überblick verloren haben und nicht mehr wissen, welcher Pub als Nächstes auf dem Programm steht. Oder sie verschwinden auf diese geheimnisvolle, bei Zechtouren auf der ganzen Welt anzutreffende Weise schlicht und einfach vom Erdboden – zumindest für den Rest der Nacht, bis sie dann am nächsten Morgen, vom Regen durchnässt und mit brummendem Schädel, in einem Garten, auf einer Parkbank oder zusammengesackt in einem Ladeneingang wiederauftauchen.
Aber wie auch immer, am Ende der Nacht sind normalerweise nur noch die harten Zecher übrig, jene kleine Truppe eingeschworener Getreuer, die immer alles bis zum Ende durchziehen.
Doch obwohl seine Kumpel auf dem Campus als trinkfeste Zecher bekannt waren, fand Keith Redmond sich in dieser Nacht im letzten Pub merkwürdigerweise ganz alleine wieder.
Der Pub hieß The Brasshouse, befand sich an der Broad Street und galt in der Gegend als eine beliebte Abfüllstation. Doch an diesem späten Abend betrat Keith das The Brasshouse bereits in einem ziemlich benebelten Zustand. Mindestens zwölf Pints Lager schwappten in ihm hin und her, und als er es halbwegs schaffte, die Gesichter der vier oder fünf anwesenden Gäste in Augenschein zu nehmen, erinnerte ihn keines auch nur im Entferntesten an eines seiner Kumpel aus dem Rugby-Club. In seinem Zustand hatte er Mühe zu erfassen, was rund um ihn herum vorging. Doch als er zur Theke torkelte und seinen letzten Zehner aus der Hosentasche seiner Jeans pulte, hatte er die vage Ahnung, dass der Rest seiner Truppe zu gegebener Zeit zu ihm aufschließen würde. Entweder das, oder sie hatten wahr gemacht, was sie irgendwann im Laufe des Abends angekündigt hatten, nämlich nicht bis zum bitteren Ende dabeizubleiben, sondern, da erst Mittwoch war, früh nach Hause zu gehen.
Keith hatte keine Ahnung, wo sie abgeblieben waren.
Als er alleine an der Theke stand und die letzten Zecher, die mitten in der Woche trotz der späten Stunde noch unterwegs waren, dem Wirt zunickten und einer nach dem anderen verschwanden, ärgerte er sich, dass die anderen ihn im Stich gelassen hatten. Doch während er halbherzig sein letztes Pint des Abends herunterkippte, kam er zu dem Schluss, dass er wohl doch nicht im Stich gelassen worden war. Wenn er nicht mitbekommen hatte, dass sie gemeinsam beschlossen hatten, die Zechtour vorzeitig zu beenden, war das schließlich sein eigenes Problem. Also hatte er wirklich keinen Grund, auf seine Kumpel sauer zu sein. Das würde ihn natürlich nicht davon abhalten, sie am nächsten Morgen – oder wohl eher am nächsten Nachmittag, wenn er wieder unter den Lebenden weilte – aufzuziehen und sie als Weicheier und Schlappschwänze zu verspotten.
So was passiert nun mal, dachte er, während er auf unsicheren Beinen durch das Zentrum Birminghams zurücktrottete, auf das gerade strömender Oktoberregen niederprasselte und das zu dieser Stunde an einem normalen Wochentag nahezu menschenleer war. Er wusste nicht, wie spät es war. Vermutlich etwa ein Uhr. Das ging ja noch. Er hatte am nächsten Morgen keine Vorlesung, also konnte er bis Mittag schlafen.
Doch er war gerade mal hundert Meter die Straße entlanggegangen und steuerte den im Südwesten liegenden Stadtteil Edgbaston an, als ihm etwas Wichtiges einfiel. Es war purer Zufall, dass es ihm in den Sinn kam. Ihm fiel ein Schild der Ladenkette Poundstretcher ins Auge, das ihn daran erinnerte, dass er sich noch etwas Geld ziehen musste. Er würde am Wochenende zum Junggesellenabschied seines älteren Bruders nach Hause nach Brighton fahren. Keith kicherte. Bei dieser Zechtour an der Strandpromenade würden keine Weicheier geduldet werden. Jeder, der glaubte, vorzeitig schlappmachen und aussteigen zu können, würde am Gummiband seiner Unterhose bis in die letzten Pubs mitgezerrt werden.
Keith würde natürlich bei nichts von alledem dabei sein, wenn er nicht genug Geld hatte. Auf der Suche nach einem Geldautomaten kehrte er auf der Broad Street um, ging ein paar Schritte zurück, überquerte den Kanal und lief in Richtung Stadtzentrum.
Selbst in seinem betrunkenen Zustand war ihm etwas mulmig zumute. Es war im wahrsten Sinne des Wortes keine Menschenseele unterwegs.
Das lag zum einen an der späten Stunde, vor allem aber daran, dass es immer noch in Strömen goss. Das Wasser stürzte in Bächen aus den Abflussrohren und rauschte durch die Gossen. An den Kreuzungen hatten sich Seen gebildet, die vereinzelt vorbeifahrenden Autos ließen das Wasser zu allen Seiten gewaltig aufspritzen. Keith trug seine übliche Kluft: Jeans, Turnschuhe, T-Shirt und darüber einen leichten Anorak mit Reißverschluss, wobei der Anorak ihm in dieser Nacht absolut keinen Schutz bot. Sein T-Shirt war bereits vollkommen durchnässt. Zumindest passte das zu seiner Jeans, die ebenfalls klatschnass war, ganz zu schweigen von seinen Turnschuhen.
Wenn er jetzt darüber nachdachte, wäre es in dieser Nacht vielleicht besser gewesen, sich ein Taxi zu nehmen. Normalerweise war das für Keith, der Student war, nur die letzte Option, da er das wenige Geld, das er hatte, lieber für Alkohol ausgab, aber diese Wetterbedingungen waren ziemlich extrem, ganz egal, was für Maßstäbe man anlegte. Na schön, er konnte immer noch versuchen, ein Taxi anzuhalten, aber erst, nachdem er sich Geld fürs Wochenende gezogen hatte.
Das einzig Gute an dem Wolkenbruch war, dass Keith ganz allmählich aber stetig wieder nüchtern wurde. Sein Kopf bekam die volle Ladung des Platzregens ungeschützt ab, sein kurzes, strohblondes Haar, das klatschnass an seinem Schädel klebte, tropfte. Es war erstaunlich, was für einen wiederbelebenden Effekt so ein Guss auf einen vom Bier benebelten Denkprozess haben konnte. Als er den Centenary Square überquerte, hatte sich der vertraute, nach einer durchzechten Party auftretende Drang, sinnlos ohne jeden Anlass zu kichern, laut zu singen oder einer herumliegenden leeren Getränkedose einen Tritt zu verpassen, bereits verflüchtigt. Keith ging schon wieder festen Schrittes und halbwegs geradeaus.
Doch während er wieder klar im Kopf wurde, fragte er sich, ob das, was er da tat, wirklich eine gute Idee war. Ursprünglich hatte er vorgehabt, sich vor dem Beginn ihrer Zechtour Geld zu ziehen oder wenigstens irgendwann mittendrin, als es noch nicht so spät war und noch andere Leute unterwegs waren. Normalerweise war er nicht der Typ, der befürchtete, überfallen und ausgeraubt zu werden, aber zurzeit war gerade eine ganz spezielle Geschichte im Umlauf, die selbst er beunruhigend fand.
Er überlegte, ob er sein Vorhaben nicht besser aufgeben und sich auf den Heimweg nach Edgbaston machen sollte. Doch dann meldete sich eine andere Stimme in seinem Kopf, die ihm sagte, dass es ein kleines Stück weiter in der Nähe des Rathauses einen Geldautomaten gab und dass er, wenn er jetzt einfach umdrehte, wo er so nah dran war, ein kompletter Volltrottel wäre – und ein jämmerlicher Waschlappen.
Er streckte die Brust raus, reckte das Kinn und ging entschlossen weiter. Immerhin war er Flügelstürmer in der zweiten Rugbymannschaft der Uni. Mit seinen eins zweiundachtzig war er in seinem zarten Alter von zwanzig Jahren zwar noch kein Muskelpaket, aber auf bestem Wege dorthin. Er würde ein Respekt einflößender Gegner sein, selbst für einen Loser wie … Wie nannten sie diesen Kerl noch mal?
Ach ja, den »Grusel-Clown«.
Keith schnaubte höhnisch, während er entschlossenen Schrittes an einer Reihe geschlossener Läden vorbeistapfte, von deren Vordächern über den Eingängen sturzbachartig das Wasser herabschoss. Selbst wenn der Mistkerl aufkreuzen sollte, war es ja nicht so, als ob Keith absolut allein wäre. In einigen der Wohnungen über den Läden brannte noch Licht. Er bildete sich sogar ein, Musik zu hören. Und wenn er sie hören konnte, konnten sie ihn sicher auch hören, wenn er schrie oder um Hilfe rief.
Nicht dass er schreien würde. Das würde ja aus all den Gründen, die er sich selber gerade noch einmal vor Augen geführt hatte, nicht erforderlich sein.
Natürlich war es nicht gerade beruhigend, dass dieser Kerl, der Grusel-Clown, bewaffnet war.
Keith schüttelte die Gedanken ab, als das Objekt, das er suchte, endlich in Sicht kam. Etwa dreißig Meter vor ihm leuchtete auf der linken Seite der grüne Bildschirm eines Geldautomaten. Keith steuerte ihn an und warf im Gehen einen Blick hinter sich.
Angeblich hing dieser Irre spät in der Nacht in der Nähe von Geldautomaten rum. Im Grunde genommen war der Kerl ein Straßenräuber. Er hielt seine Opfer auf offener Straße an, holte sein Messer hervor – den Berichten zufolge ein ziemliches Monstrum von einem Messer – und verlangte von ihnen, ihm das Geld auszuhändigen, das sie gerade gezogen hatten. Doch damit war es offenbar nicht getan, zumindest bisher.
Mit vom Regen glitschigen Fingern tippte Keith auf der Tastatur herum und versuchte, seinen PIN-Code einzugeben. Absurderweise vertippte er sich und erhielt die Nachricht, dass seine Karte abgelehnt wurde. Er zögerte, bevor er es ein zweites Mal versuchte, und sah sich zuerst nach allen Seiten um. Der in Strömen niederprasselnde Regen floss in Rinnsalen die verwaiste Straße entlang. Er war immer noch allein.
Unsicher, wie viele Versuche er hatte, bevor seine Karte gesperrt wurde, tippte er seine Geheimzahl erneut ein, diesmal jedoch sehr viel sorgfältiger. Erleichtert sah er, dass die Transaktion durchgeführt wurde und der Automat ein Bündel frischer Zwanzig-Pfund-Noten ausspuckte. Er stopfte sich das Geld in die Hosentasche und schlenderte an der Ladenzeile entlang zurück.
Bis zu seiner Studentenbude waren es fünfeinhalb Kilometer. Das war normalerweise kein Problem für ihn, doch auch wenn seine Beine nicht gerade bleiern waren, hatte er das Gefühl, dass seine Energiereserven schwanden, was wahrscheinlich sowohl auf die Kälte und Nässe als auch auf den Alkohol zurückzuführen war. Er dachte erneut daran, ein Taxi anzuhalten, aber wie immer, wenn man eins brauchte, kam keins vorbei.
Aber egal. Er kam ja auch zu Fuß gut voran. Hauptsache, er war erst mal aus dem Stadtzentrum raus. Das war im Grunde das Wichtigste. Alle Überfälle hatten sich im Innenstadtbereich zugetragen, in der Gegend um die New Street und den Bullring. So weit draußen wie in Edgbaston war nichts passiert. Während er die Paradise Street entlangging und den Suffolk Street Queensway überquerte, wuchs seine Zuversicht, dass alles gut gehen würde. Der Kerl hatte nicht immer sofort zugeschlagen, nachdem seine Opfer das Geld gezogen hatten. Offenbar war er einigen ein paar Straßen weit gefolgt, bis sie in eine etwas abgeschiedenere Gegend gekommen waren, aber in den Wohnvierteln war absolut nichts passiert.
Keith ärgerte sich über sich selbst. Es war töricht von ihm gewesen, sich überhaupt in diese prekäre Situation gebracht zu haben. Das lag natürlich an seinem beduselten Zustand, aber in Wahrheit war er wahrscheinlich gar nicht wirklich in Gefahr. Nach allem, was er wusste, hatte es nur drei oder vier dieser Überfälle gegeben, und die Innenstadt von Birmingham war mit Überwachungskameras übersät, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Irre geschnappt wurde. Vielleicht war der Grusel-Clown sich dessen selbst bewusst geworden und deshalb bereits abgetaucht. Jeder vernünftige Kriminelle würde genau das getan haben.
Keith ging weiter die Holliday Street entlang, warf einen flüchtigen Blick über seine Schulter – und musste zweimal hinsehen, als er etwas ausmachte, das wie eine dunkle Gestalt aussah, die sich etwa fünfzig Meter hinter ihm in die Dunkelheit zurückzog.
Keith blieb stehen, wirbelte herum und sah genau hin. Sein Herz raste auf einmal in seiner Brust.
Sekunden verstrichen. Hinter ihm war niemand zu sehen.
Er ging schnell weiter und blickte immer wieder über seine Schulter, konnte durch den Regenschleier aber nichts Verdächtiges sehen. Bevor er den Kanal erreichte, bog er links in eine Gasse. Er war nicht sicher, ob dies der schnellste Weg war, war aber jetzt entschlossen, in südwestlicher Richtung weiterzugehen.
Konnte das gerade ein Hirngespinst gewesen sein?
Er eilte eine überdachte Passage entlang und landete auf einer anderen Hauptstraße, der Commercial Road. Von der Stelle, an der er stand, konnte er nach links bis zur Kreuzung Commercial Road und Severn Street sehen. Es waren noch mindestens hundert Meter, doch dort meinte er jemanden oder etwas zu sehen. Er konnte nur einen Umriss ausmachen, vielleicht war es auch irgendeine permanente Vorrichtung, aber es konnte genauso gut ein Mensch sein, der dort herumlungerte und wartete.
Keith eilte die Commercial Street in die andere Richtung entlang, bis er die Granville Street erreichte. Von seinem Standpunkt aus hatte er nach links und rechts freie Sicht. Nicht weit von ihm entfernt sprang eine Ampel auf Grün, aber es gab keine Autos, deren Fahrer dem Signal Folge leisteten und sich in Bewegung setzten, nur Regenvorhänge, die über die verwaiste Kreuzung zogen. Er blickte sich um und schaute, ob der Umriss an der Kreuzung immer noch da war, aber es war unmöglich, das mit Sicherheit zu sagen, der Regen war zu dicht.
Als er weiterging, fiel ihm auf, dass in einigen Läden noch schwaches Licht brannte. Merkwürdigerweise spendete dieses schwache Licht ihm absolut kein Gefühl von Sicherheit, es verstärkte die Botschaft eher noch, dass außer ihm selbst niemand hier war mitten in der Nacht.
Er bog scharf nach rechts auf die Bath Row. Es goss immer noch in Strömen. Keith fragte sich, ob der Regen nachlassen würde, bevor er seine Bude erreichte, wobei das, so durchnässt, wie er war, jetzt auch keine Rolle mehr spielte.
Er drehte sich gefühlt zum hundertsten Mal um und blickte hinter sich.
Und diesmal sah er jemanden, etwa vierzig Meter hinter sich. Die Gestalt war auf der anderen Straßenseite, ging jedoch in die gleiche Richtung wie er. Wie beim Anblick des Umrisses an der Kreuzung hatte er ein mulmiges Gefühl. Doch dann gingen ihm zwei beruhigende Gedanken durch den Kopf. Erstens trug die Gestalt zwar Regenkleidung, hatte die Kapuze aufgesetzt und verbarg ihr Gesicht, aber das konnte in so einer Nacht wohl kaum als unheimlich gelten. Und zweitens hatte sie diesmal keine Anstalten gemacht, sich zu verbergen.
Es musste jemand sein, der wie er auf dem Weg nach Hause war. Nichts, worüber er sich Sorgen machen musste.
Trotzdem legte er einen Schritt zu, stopfte die Hände in die Anoraktaschen und bog eher instinktiv als bewusst kurz entschlossen in eine andere Gasse ein, die um die Rückseite der Shell-Tankstelle herumführte. Er ging jetzt wieder nach Nordwesten und somit nicht in die Richtung, in die er eigentlich wollte, aber er musste sich eingestehen, dass ihm nicht gefallen hatte, wie dieser andere Fußgänger auf dem Nachhauseweg plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht war.
Er sah sich erneut um, während er die Gasse entlangstapfte. Die Stelle, an der sie in die Bath Row mündete, fiel immer weiter hinter ihm zurück. Doch die in Regenkleidung gehüllte Gestalt ging nicht wie erwartet auf der Bath Row an der Einmündung vorbei. Als die Einmündung hundert Meter hinter ihm lag, hatte Keith immer noch niemanden vorbeigehen gesehen.
Und das fühlte sich falsch an.
Er hastete weiter und kollidierte beinahe mit dem Stahlpfosten eines Straßenschildes, auf das er geradewegs zugelaufen sein musste, ohne es gemerkt zu haben. Er wich dem Schild aus, rutschte dabei auf einer glitschigen Gehwegplatte aus und landete mit voller Wucht auf dem Rücken.
Sein Missgeschick hätte eine hübsche Vorlage für ein Video auf Youtube gegeben, dachte er, während er sich wieder hochrappelte. Sein Schmerz wurde von seinem wachsenden Gefühl des Unbehagens betäubt. In Wahrheit hoffte er, dass wirklich jemand filmte. Das würde vielleicht dabei helfen, diesen irren Grusel-Clown zu schnappen.
Als er aus der Gasse auf eine schmale Straße trat, die überwiegend von Wohnhäusern gesäumt wurde und bei der es sich, wie er erkannte, um den Roseland Way handelte, war er erleichtert. Es war nicht mehr weit bis zu seiner Studentenbude.
Nach einigen Minuten erreichte er die A4540, auch als Middleway bekannt, eine große innerstädtische vierspurige Schnellstraße, die einen Teil des Birminghamer Rings bildete.
Auf der anderen Seite dieser Straße lag Edgbaston.
Um hinüberzugelangen, musste man eine Unterführung nehmen. Keith stieg die Steintreppe hinunter und ging schnell durch den quadratischen Betongang, der nach etwa dreißig Metern auf die andere Seite führte. Die Wände waren mit Graffiti übersät. Keith mochte sich als mit allen Wassern gewaschenen Typen sehen, doch er stand nicht darauf, nachts durch solche Unterführungen zu gehen. Sie waren feucht, trostlos und hallten. Doch diese Nacht war eine Ausnahme. Er wollte einfach nur nach Hause, sich duschen und ins Bett. Er hatte es bald geschafft.
Als er vielleicht noch zehn Meter vom anderen Ende des Gangs entfernt war, stieg vor ihm eine Gestalt die Stufen hinunter.
Der Größe und dem Umriss nach zu urteilen, handelte es sich um einen Mann, aber man konnte es nicht mit Gewissheit sagen, weil die Gestalt eine schwere Regenjacke trug und sich die Kapuze so tief heruntergezogen hatte, dass sie das Gesicht verhüllte.
Die Gestalt kam geradewegs durch den Gang auf ihn zu, den Kopf gebeugt, die Hände in den Jackentaschen vergraben.
Keith ging ebenfalls weiter, ohne seinen Schritt zu verlangsamen. Dies lag zum Teil daran, dass er so überrascht war. Er fühlte sich wie betäubt. Sosehr er sich auch einreden mochte, dass er wieder nüchtern geworden war – sein Gehirn war noch zu träge, um seinen Gliedern unmittelbar Botschaften zu übermitteln. Außerdem gab er sich, so glaubte er zumindest, auch ein Stück weit purem Fatalismus hin, weil es sowieso kein Zurück mehr gab.
Er beugte den Kopf ebenfalls, stapfte unbeirrt weiter, vergrub die Hände noch tiefer in den Taschen und wich ein Stück weit nach rechts aus. Auch wenn er betrunken war – er war ein Sportler. Er konnte immer noch zur Seite springen und wegrennen. Doch der Kerl, bei dem es sich eindeutig um die Person handelte, die Keith bereits gesehen hatte, wechselte auf einmal die Seite und kam direkt auf ihn zu.
Als sie noch etwa zwei Meter voneinander entfernt waren, blickte die Gestalt auf, und sie standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
Keith konnte kein Wort herausbringen. Der Anblick des kreidebleichen Gesichts und des in die Gesichtszüge eingravierten irren Grinsens paralysierte ihn. Er konnte sich erst wieder bewegen, als die Gestalt etwas Metallisches, Glänzendes hervorzog, eine gekrümmte glänzende Klinge.
Es war kein Messer, sondern ein altmodischer Kavalleriesäbel.
Keith wich ruckartig zurück, rutschte auf einem weggeworfenen Stück Papier aus und landete zum zweiten Mal in dieser Nacht hart auf dem Rücken. Und zum zweiten Mal spürte er kaum etwas von dem Schmerz, während er versuchte, auf allen vieren rückwärts wegzukrabbeln. Die grinsende Gestalt folgte ihm langsamen, aber entschlossenen Schrittes und hob den Säbel, als wollte sie ihm einen kräftigen Schlag versetzen.
»Alles klar!«, schrie Keith, rappelte sich panisch hoch auf die Füße, riss das Bündel Geldscheine aus seiner Jeanstasche und hielt es vor sich.
Der Grusel-Clown, dessen irrer Gesichtsausdruck sich keinen Augenblick lang veränderte und der den Säbel weiterhin hoch über sich hielt, streckte eine behandschuhte Hand aus und schnappte sich das Geld. Keith konnte nicht anders, als nach oben zu blicken und die glänzende Stahlklinge anzustarren. Das lag zum einen daran, dass er es nicht über sich brachte, in diese kleinen, merkwürdig schimmernden Augen zu blicken. Er hatte in der Zeitung etwas über den irren Gesichtsausdruck und die stechenden, glitzernden Augen des Grusel-Clowns gelesen. Zum anderen wusste er einfach, dass die furchtbare Klinge nicht da oben verharren würde. Doch er hatte nicht damit gerechnet, dass sie mit so blitzartiger Geschwindigkeit niedersausen, ihm einen mörderischen Schlag zwischen seinem Hals und seiner Schulter verpassen und sich tief in seine Muskeln und seine Knochen bohren würde. Keith sank auf die Knie, vor Schmerz und Panik wie gelähmt.
Doch erst als die Klinge aus ihm herausgerissen wurde, spritzte eine Blutfontäne, und er fiel vornüber auf den Boden.
Kapitel 2
Detective Constable Lucy Clayburn fuhr in nördlicher Richtung die M60 entlang und bog am Autobahnkreuz Wardley nach Westen auf die M61 ab. Es war kurz nach zehn Uhr abends, sodass es selbst auf den chronisch verstopften Autobahnen Greater Manchesters relativ ruhig zuging. Das ermöglichte es ihr, auf ihrer blutrot lackierten Ducati M900 Monster mit hundertdreißig Sachen an den Ausfahrten Farnworth, Lostock und Westhoughton vorbeizubrettern. Sie drosselte ihr Tempo erst, als sie die Ausfahrt 6 erreichte. Dort bog sie rechts ab und gelangte auf ein Gewirr aus Kreisverkehren und Autobahnzubringern, die um das Reebok-Stadion herumführten.
Von dort ging es geradeaus weiter nach Nordwesten, zunächst auf der Chorley New Road in Richtung Horwich und dann auf der Rivington Lane nach Norden. Zu ihrer Rechten ragte der massige Winter Hill auf, ein formloser Hügel unter dem sternenübersäten Oktoberhimmel, und erst jetzt, am nördlichsten Rand des Zuständigkeitsgebiets der Greater Manchester Police, verschwanden die dicht an dicht stehenden roten Backsteingebäude des Ballungsgebiets, und die Stadtlandschaft ging in die idyllischen Dörfer, Wälder und die von Steinmauern umgebenen Bauernhöfe des ländlichen Lancashire über. Nach einiger Zeit verließ sie auch diese Gegend, hielt sich östlich und erreichte die Ausläufer der West Pennine Moors, wo sich enge, unglaublich kurvenreiche Sträßchen entlangfädelten. Einige Minuten später war sie mitten im Lever Country Park unweit der Rivington Hall Barn, einem restaurierten landwirtschaftlichen Gebäude im Tudorstil. Dort drosselte sie das Tempo. Diese malerische wenn auch abgelegene Gegend war ein beliebter Treffpunkt für Motorradfahrer aus ganz Nordengland, am späten Abend jedoch normalerweise einsam und verlassen. Doch heute war auf einem speziellen Parkplatz, einem kleinen an drei Seiten von dichtem Wald umgebenen Abstellplatz etwa vierhundert Meter von der Rivington Hall Barn entfernt, mächtig was los. Der Platz war hell erleuchtet, und es war laut.
Lucy bog auf den Parkplatz und bahnte sich einen Weg zwischen den zahlreichen, wahllos auf dem kiesigen Untergrund abgestellten Motorrädern und den umherlaufenden Menschen, die allesamt Jeans und abgetragene Lederkluft trugen. Wie immer waren alle Altersklassen vertreten, von langgliedrigen, pickelgesichtigen Teenagern bis hin zu Männern zwischen fünfzig und sechzig mit gewaltigen Bierbäuchen, kahlen Schädeln und grauen, struppigen Bärten. Frauen unterschiedlichen Alters waren ebenfalls anwesend – Aktivitäten im Stil der Hell’s Angels waren nie ausschließlich Männern vorbehalten gewesen.
Ungeachtet des Geschlechts prangte auf den Rückseiten sämtlicher Jacken in grellen orangefarbenen Lettern der Schriftzug Low Riders.
Die Anwesenden verfielen in Schweigen und bildeten eine Gasse, als Lucy langsam zwischen ihnen hindurchrollte. Am Ende des Parkplatzes hielt sie an, stellte den Motor aus und trat den Ständer herunter. Dann stieg sie von ihrer Maschine, nahm ihren karmesinroten Motorradhelm ab und schüttelte ihr schwarzes Haar aus, das glänzend über ihren Rücken und ihre Schultern fiel.
Im gleichen Augenblick ertönten bewundernde Pfiffe und anzügliche Bemerkungen.
Lucy reagierte nicht. Sie trug ihre Motorradkombi, die zwar nicht hauteng, aber doch ziemlich figurbetont war. Zudem trainierte sie regelmäßig im Fitnessstudio, was bedeutete, dass sie gut in Form war. Doch als sie sich zu den Versammelten umdrehte und sie bemerkten, dass sie eine Polizistin war, räusperte sich jemand und spuckte aus.
Die Low Riders waren nicht einfach nur ein Motorradclub. Sie waren Traditionalisten mit einem Ethos alter Schule: Leb schnell, stirb langsam. Lasst uns in Ruhe, dann lassen wir euch in Ruhe. Für uns gelten unsere Regeln, nicht eure. All dies übertrug sich in endemische Gesetzlosigkeit und ein natürliches Misstrauen gegenüber der Polizei.
Inzwischen waren auf fies und herausfordernd grinsenden Gesichtern gelbe Zähne zum Vorschein gekommen. Lucy sah jede Menge Flaschen Dunkelbier, sowohl weggeworfene leere als auch von ölverschmierten Fäusten umklammerte halb volle, dabei würden die meisten dieser Typen in einer Stunde wieder auf der Straße sein. Sie sah auch Joints. Nicht viele, aber ausreichend dreist zur Schau gestellt, um als Herausforderung gelten zu können. Doch sie war an diesem Abend nicht gekommen, um eine Drogenrazzia durchzuführen, und das war den Versammelten offenbar klar – deshalb ihre Unverfrorenheit.
Einer von ihnen stolzierte nach vorne.
Es war Kyle Armstrong, einer der Anführer der Low Riders aus Crowley.
Lucy hatte ihn eine ganze Weile nicht gesehen. Er war inzwischen Mitte dreißig, sah aber noch genauso aus, wie sie ihn in Erinnerung hatte: groß und schlank, durch und durch der wilde Bad Boy, mit einer pechschwarzen Mähne, die bis zu seinem Kragen herabhing, und dichten schwarzen Koteletten. Mit seinem mit Stahlnieten besetzten Gürtel, seiner engen Jeans und seiner Lederjacke, die er fast immer offen trug, sodass seine nackte, behaarte Brust zu sehen war, hatte er etwas von einem wilden Tier. Er mochte modemäßig nicht ganz auf der Höhe der Zeit sein, aber er hatte Lucy immer an einen dieser tollen Hardrock-Musiker der frühen Tage der Rockmusik erinnert, an Ian Gillan oder an Robert Plant.
Natürlich hatte sie ihm nie gesagt, dass sie so über ihn dachte. Armstrongs Ego hatte auch so schon die Ausmaße eines Sperrballons.
»Neuer Look, was? Du hast dir die Haare wachsen lassen«, stellte er wohlwollend fest. »Wie früher. In Zivil rumlaufen zu können tut dir offenbar gut.«
Als sie noch die Uniform getragen hatte, eine Phase, die gerade mal vor zehn Monaten zu Ende gegangen war, hatte sie penibel darauf geachtet, ihr Haar immer maximal schulterlang zu tragen. Dieser Stil hatte ihr nicht gerade übermäßig gefallen, deshalb lag Armstrong ganz richtig: Detective bei der Kripo zu sein hatte in der Tat Vorteile.
Doch das würde sie ihm gegenüber bestimmt nicht zugeben. Und zwar vor allem, weil sie nicht zum Plaudern aufgelegt war. Wenn irgendein anderer Krimineller niederen oder mittleren Rangs sie um ein Treffen gebeten hätte, hätte sie ihm gesagt, dass er gefälligst zu ihr zu kommen hätte, doch sie und der Präsident der Low Riders hatten gewissermaßen ein Stück weit eine gemeinsame Vergangenheit, was nüchtern betrachtet dafürsprach, dass die Möglichkeit marginal größer war, dass bei der ganzen Nummer etwas mehr herauskam, als es normalerweise der Fall gewesen wäre.
Trotzdem brauchte sie nicht so zu tun, als ob ihr dieses Arrangement gefiel.
»Was willst du, Kyle?«, fragte sie.
Er ging um sie herum und stellte seine Bewunderung für ihre von der engen Lederkluft umhüllte Figur unverhohlen zur Schau, was sie ärgerte, auch wenn es eher reine Unverfrorenheit war als eine wirklich ernst zu nehmende Drohgebärde. Und auf jeden Fall ärgerte es Lucy nicht so sehr wie Kelly Allen, auch unter dem (heimlichen) Spottnamen »Hells Kells« bekannt, unter dem Lucy sie einstmals kennengelernt hatte, eine vollbusige, gut aussehende Motorradbraut, die in der Gruppe nicht nur für ihre beeindruckende Figur berühmt war, sondern auch für ihr taillenlanges karmesinrot gefärbtes Haar, das ziemlich gut zu ihrem Temperament passte. Vor vielen Jahren hatte Kells eifrig um Armstrongs Aufmerksamkeit gebuhlt, und seitdem sie sich seine Zuneigung schließlich gesichert hatte – was alles andere als leicht gewesen war –, verteidigte sie ihren Status wie eine Löwin.
Kelly musterte sie aus einer Entfernung von zehn Metern. In ihrer schäbigen alten Wolljacke war sie, was ihre sexy Ausstrahlung anging, nicht gerade in ihrem besten Outfit, aber ihre kajalumrandeten Augen funkelten unter ihrem blutroten Pony.
Armstrong hatte seine Aufmerksamkeit mittlerweile auf Lucys Motorrad gerichtet.
»Wie ich gehört habe, hast du Il Monstro bei einer Verfolgung von ein paar bösen Buben zu Schrott gefahren.«
»Hab der Maschine ein paar Schrammen zugefügt«, erwiderte sie. »Nichts, was man nicht wieder in Ordnung bringen kann.«
»Und was ist aus den Bösewichten geworden?«
»Sitzen beide lebenslänglich.«
»Aua.« Er grinste. »Hätten sich wohl nicht mit dir anlegen sollen.«
»Das gilt auch für dich. Also, worum geht’s?«
»Keine Sorge«, entgegnete er kichernd. »Ich bin nicht darauf aus, die Flamme der Leidenschaft neu zu entfachen, die mal zwischen uns beiden gelodert hat.«
»Gut. Die ist nämlich komplett erloschen.« Sie spürte, dass die anderen Armstrong und sie in erwartungsvollem Schweigen beobachteten, was sie noch mehr ärgerte. Es mochte ja eine Polizistenmarotte sein, aber Lucy hatte noch nie darauf gestanden, der einzige Mensch am Schauplatz des Geschehens zu sein, der nicht wusste, was los war. »Außerdem ist es spät«, fügte sie hinzu, »und ich muss morgen vor Gericht aussagen. Was auch immer du also willst, spuck’s aus, und zwar schnell.«
»Okay, können wir uns ein bisschen die Beine vertreten?«
»Wenn du nicht willst, dass der Rest deiner Truppe mitkriegt, was du im Schilde führst, solltest du sie nicht mitbringen«, stellte sie klar, während sie einen schmalen, vom Mond beschienenen Weg entlangschlenderten. »Oder ist das so, wie von jemandem zu verlangen, ohne Hose aus dem Haus zu gehen?«
»Genau über die Truppe wollte ich mit dir reden«, entgegnete Armstrong. »Beziehungsweise über einen von ihnen. Aber wenn es ums Eingemachte geht, bringt es ja nichts, alle dabeizuhaben, oder?«
Da hatte er wohl recht, vermutete sie. Der Rest der Truppe würde wissen, dass er sie hergebeten hatte, um irgendeinen Deal mit ihr abzuschließen, aber je weniger von ihnen wüssten, worum es genau ging, desto geringer die Gefahr, dass etwas durchsickerte.
»Es heißt, dass du inzwischen ein hohes Tier bist«, sagte er. »Detective bei der Kripo.«
»Und?«
Er wandte sich zu ihr um, seine wilden Gesichtszüge wirkten in der Dunkelheit des Waldes düster. »Ich brauche deine sachverständige Hilfe.«
Lucy hatte nichts anderes erwartet, doch das Ganze stank ihr immer noch. Es war erstaunlich, wie viele dieser gesetzlosen Gangs auf das Gesetz zurückkamen, wenn es ihnen in den Kram passte.
»Guck mich nicht so an, Baby«, beschwerte er sich. »Wir waren nie Feinde.«
»Ach ja?«
»Na gut, wir stehen auf verschiedenen Seiten. Aber das war nicht immer so, oder?«
»Damals war ich jung und dumm«, erwiderte sie.
»Manch einer würde sagen, du bist heute dumm, weil du tust, was du tust.« Für einen kurzen Moment klang er so, als würde ihn ihre Geringschätzung ihrer einstigen Beziehung treffen. »Du führst ein glückliches Leben, Luce, oder? Siehst du noch all deine Kumpel von früher?«
»Mein persönliches Glück ist irrelevant, Kyle. Und ob ich dumm bin oder nicht, hängt davon ab, wie meine Antwort lautet, wenn du mich gleich um diesen Gefallen bittest.«
Er antwortete nicht sofort und wirkte erneut ein wenig kleinlaut – zum einen, weil sie offensichtlich erraten hatte, weshalb sie da war, was ihr in gewisser Weise einen Vorteil verschaffte, und zum anderen, weil ihm keine andere Wahl blieb, als nett zu ihr zu sein, wenn er wollte, dass bei dem Ganzen irgendetwas herauskam.
»Einer unserer Jungs wurde vom Drogendezernat aus Crowley hochgenommen«, sagte er schließlich.
»Na so was. Man höre und staune.«
»Nein, warte. Diese Sache ist wirklich ernst. Erinnerst du dich an Ian Dyke?«
»Bin mir nicht sicher. Die Erinnerung spielt einem manchmal Streiche. All die Idioten, mit denen du dich umgibst, verschmelzen irgendwie zu einem einzigen.«
»Er wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht drangekriegt.« Armstrong zuckte mit den Schultern. »Wäre eigentlich keine große Sache. Er hatte nur ein bisschen Dope und ein paar Ecstasy-Pillen dabei. Aber er will auf keinen Fall in den Knast.«
»Wie lautet noch mal der bekannte Spruch?«, entgegnete sie. »Wer nicht will, dass Strafe ihn ereile, der soll das Unrecht nicht begehen.«
»Das weiß ich alles. Aber hör mir zu, Luce, Dykeys Freundin hat gerade ein Baby zur Welt gebracht, und er versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Hat einen richtigen Job und so. Aber diese Nummer ist dabei nicht besonders hilfreich.«
»Wenn er nur ein bisschen Molly hatte – dafür kommt er nicht in den Knast.«
»Aber seinen Job verliert er garantiert.«
»Dann muss er sich eben einen neuen suchen.«
»Luce.« Armstrong wirkte ziemlich geknickt. »Dykey ist von all meinen Kumpels derjenige, der so einen Scheiß am wenigsten verdient.«
»Willst du mir damit sagen, dass das Drogendezernat ihm das Ganze nur anhängt?«
»Nein. So lautet seine Verteidigungsstrategie, aber das ist nicht das, was passiert ist.«
»Tja, dann hat er es verdient, oder?«
»Es war seine letzte Lieferung«, stellte der Biker mit Nachdruck klar. »Seine allerletzte. Danach wollte ich ihn von der Leine lassen, damit er ein normales Familienleben führen kann.«
Sie sah ihn erstaunt an. »Sieh mal einer an. Spricht da dein schlechtes Gewissen Kyle? Macht sich der unnahbare General auf einmal Gedanken um die niederen Soldaten, die er in die Schlacht schickt, damit sie für ihn den Kopf hinhalten?«
»He, ich versuche nur, einem Typen zu helfen, der seit Langem ein guter Kumpel von mir ist.«
Sie dachte nach und wägte ab, ob sie das Ganze irgendwie so drehen konnte, dass sie selber einen Vorteil davon hatte. »Gibt es schon einen Gerichtstermin?«
»Ja. Im nächsten Frühjahr.«
»Im nächsten Frühjahr?«
»Der Prozess findet am Manchester Crown Court statt.«
»Er muss vor den Crown Court?« Das überraschte sie. »Und hatte nur ein bisschen Stoff dabei?«
Auf einmal konnte Armstrong ihr nicht mehr in die Augen blicken.
»Hast du mir noch weitere Lügen aufgetischt, über die ich Bescheid wissen sollte?«, fragte sie. »Zum Beispiel, dass er gar keinen Job hat? Und dass seine Freundin vielleicht gar kein Baby bekommen hat? Dass er vielleicht nicht mal eine verdammte Freundin hat? Da ich die Hälfte deiner Kumpanen kenne, erscheint mir das sehr viel glaubhafter.«
»Komm schon, Lucy«, redete er auf sie ein. »Ich kann dafür sorgen, dass für dich auch was dabei herausspringt.«
»Ach ja? Was denn?«
Er senkte die Stimme, sah sich um und blickte den Pfad entlang zu den Lichtern auf dem Parkplatz. »Vielleicht kann ich dir hin und wieder ein paar Informationen zukommen lassen.«
»Oh, du willst mein Informant werden?«
»Um Himmels willen, nicht so laut!«, zischte er. »Und nein, das habe ich nicht gesagt.«
»Aber wir könnten uns ab und zu gegenseitig einen Gefallen erweisen.«
»Komm schon. Ich weiß doch genau, dass du ständig solche Deals machst.«
Sie dachte über sein Angebot nach. »Hast du jetzt irgendwas für mich?«
»Nein, aber …« Er zuckte mit den Schultern. »Aber wenn der Moment kommt, brauchst du nur zu fragen. Komm schon, Lucy. Du kennst mich doch.«
Genau, ich kenne dich, dachte sie. Die Low Riders waren durch und durch finstere Gesellen und kaum so vertrauenswürdig, dass man auf ihre Hilfe bauen konnte, wenn es um den Gesetzesvollzug ging. Aber sie verfügten definitiv über gute Verbindungen, und wenn Armstrong – der für Lucy einmal sehr viel mehr gewesen war als einfach nur ein Bekannter, auch wenn das nur während ihrer rebellischen Teeniezeit gewesen war – sagte, dass er ihr hin und wieder etwas stecken konnte, bestand immer die Chance, dass es sich um heiße Informationen handelte.
Sie seufzte. »Du sagst, dieser Typ heißt Ian Dyke?«
»Genau. Er wohnt an der Thorneywood Lane.«
Lucy kannte die Straße. Es war eine von diesen mit einem nett klingenden Namen in einer Sozialwohnungssiedlung in Crowley, die so heruntergekommen war, dass sie eigentlich am besten planiert worden wäre.
»Das Einzige, was ich tun kann, ist, mit jemandem vom Drogendezernat zu reden«, sagte sie. »Ich habe dort keinen Einfluss, das ist dir doch wohl klar.«
»Natürlich.« Er klang freudiger.
»Ich mag zwar inzwischen Detective sein, aber immer noch nur im Rang eines Constable.«
»Ich kenne dich.« Er sah sie vielsagend an. »Du kannst sehr überzeugend sein, wenn du willst.«
»Kann ich nicht«, versicherte sie ihm. »Und das werde ich auch nicht. Das Beste, was ich tun kann, ist, ein Wort für ihn einzulegen.«
Sie gingen zurück zum Parkplatz, wo Lucy ihren Helm aufsetzte, mit einem Tritt auf den Kickstarter den Motor ihrer Maschine startete, um sie dann in einer engen 180-Grad-Wende zurück zur Ausfahrt zu steuern. Bevor sie losfuhr, hielt sie neben Armstrong und schob ihr Visier hoch. Die versammelten Mitglieder des Chapters sahen schweigend zu. Hells Kells war nach vorne getreten und hatte sich fest bei ihrem wilden Schönling eingehakt. Sie starrte Lucy mit eisiger Intensität an.
»Lass mich wissen, wie wir vorankommen, okay?«, sagte Armstrong.
»Es gibt kein ›wir‹, Kyle. Belästige mich also nicht. Ich rufe dich an, wenn es irgendwas zu berichten gibt. Und wenn es läuft wie gewünscht, will ich was von dir zurückhaben.« Sie stieß ihm warnend einen Finger entgegen. »Und das meine ich ernst.«
Er zuckte mit den Schultern. »Hab ich doch versprochen, oder?«
»Genau, das hast du versprochen.« Sie bedachte ihn mit einem zweifelnden Stirnrunzeln, dann gab sie Gas und brauste vom Parkplatz.
Kapitel 3
Lucy Clayburn war bei der Greater Manchester Police als Motorradfahrerin bekannt, die ihre Ducati M900 ziemlich gut im Griff hatte. Es gab kaum Kollegen, die das nicht in gewisser Weise faszinierend fanden, ob männlich oder weiblich.
Die meisten der Männer, insbesondere die Beamten der Motorradstaffel, hielten es vor allem für cool, und das umso mehr, als sie erfuhren, dass Lucy zudem eine versierte Motorradmechanikerin war, die sich all ihre Fertigkeiten selbst beigebracht hatte. Der eine oder andere etwas altmodischere Kollege war leicht genervt und sah sich in seiner Männlichkeit bedroht, doch diese Typen waren bei der britischen Polizei von Jahr zu Jahr dünner gesät, sodass sie sich im Großen und Ganzen zurückhielten. Unter den Kolleginnen gab es ebenfalls unterschiedliche Meinungen. Einige besonders ernsthafte verurteilten Lucys Motorradfahren als alberne Attitüde und als einen übertriebenen Versuch, die Männer für sich einzunehmen, indem sie die harte Motorradbraut gab. Doch die meisten Kolleginnen waren beeindruckt und fanden es gut, dass Lucy unverfroren auf männliches Territorium vorgedrungen war, und bewunderten den Wagemut, der sicherlich erforderlich war, wenn man auf so einer leistungsstarken Maschine durch den chaotischen Verkehr des 21. Jahrhunderts manövrierte.
All das war natürlich ein wenig absurd, denn Lucy benutzte ihr Motorrad dieser Tage gar nicht mehr so oft. Als sie noch die Uniform getragen hatte, war sie immer mit ihrer Maschine zur Arbeit und nach Hause gefahren, denn im Dienst war sie mit einem gekennzeichneten Polizeiwagen unterwegs gewesen. Seit sie bei der Kripo war, konnte sie entweder einen Wagen aus dem Fuhrpark nehmen – dessen Inneres oft einem Abfalleimer glich und in dem es nach Schweiß, Ketchup und Pommes roch – oder ihr eigenes Auto, die von ihr deutlich bevorzugte Option. Deshalb hatte sie sich einen kleinen allradgetriebenen aquamarinblauen Suzuki Jimny Cabrio zugelegt, der ihr normalerweise als fahrbarer Untersatz diente. Die Ducati war immer noch ihr ganzer Stolz, doch sie stellte die Maschine nach wie vor in dem Schuppen am Haus ihrer Mutter in Saltbridge unter, einem Viertel von Crowley unweit der Stadtgrenze von Bolton. In dem Schuppen verwahrte sie auch alle ihre Werkzeuge. Sie selber war in ihren vor Kurzem rundum renovierten Mansardenbungalow in der Brenner-Siedlung gezogen, die vom Haus ihrer Mutter aus gesehen am entgegengesetzten Ende von Crowley lag. Somit sah sie ihre Ducati nicht einmal besonders oft.
Der vorherige Abend, an dem sie hochgefahren war in die West Pennine Moors, um sich mit Kyle Armstrong und den anderen Low Riders zu treffen, war eine Ausnahme gewesen. Zu diesem Treffen mit dem Motorrad zu fahren konnte nur dazu beitragen, die Anerkennung der Mitglieder der Motorradgang zu gewinnen. Doch als sie später am Abend nach Crowley zurückgekehrt war, hatte sie die Maschine wieder in dem Schuppen abgestellt und war, ohne bei ihrer Mutter reinzuschauen, die zu der späten Stunde wahrscheinlich ohnehin bereits im Bett lag, in ihrem Jimny durch die Stadt zu ihrem Bungalow zurückgefahren. An diesem Morgen saß sie bereits in aller Frühe erneut hinter dem Steuer und mümmelte eine Scheibe Toast, während sie ins Zentrum von Crowley hineinfuhr, jedoch nicht zur Wache Robber’s Row, sondern zum Magistrates Court.
Auf dem Weg stellte sie ihr Handy auf Freisprechen, rief im Büro der Kriminalabteilung an und bat Detective Sergeant Kirsty Banks einzutragen, dass sie im Dienst war. Dann rief sie Detective Chief Inspector Geoff Slater im Drogendezernat an. Slater, mit dem Lucy im Rahmen der »Operation Schnellstraße« zusammengearbeitet hatte – einem Fall, der nichts mit Drogen zu tun gehabt hatte –, konnte den Anruf nicht entgegennehmen, weshalb sie ihm eine Nachricht mit der Bitte hinterließ, sich bei ihr zu melden.
Als sie das Gericht erreichte, ein Respekt einflößendes viktorianisches Gebäude mit hohen Buntglasfenstern und imitierten griechischen Säulen zu beiden Seiten der vorderen Haupttreppe, dessen Außenfassade jedoch im Laufe der Zeit zu einem schmuddeligen Grau verblasst war und zusehends verwitterte, parkte sie auf dem Personalparkplatz auf der Rückseite, betrat das Gebäude durch den Personaleingang und ging die Treppe hinunter zu dem für die Polizei reservierten Raum und den Haftzellen.
»Wo bleibst du denn?«, fragte Detective Constable Harry Jepson gereizt.
»Warum? Ich bin doch nicht zu spät, oder?« Sie hängte ihren Mantel an einen Garderobenhaken.
»Nein, aber ich wollte alles noch mal mit dir durchgehen, bevor wir hochgehen.«
»Jetzt pass mal auf, Harry.« Lucy warf einen Blick auf ihre Uhr und betrat den Küchenbereich. Sie hatten noch gut zwanzig Minuten, bis der Prozess begann. »Wenn du im Gericht die Wahrheit sagst« – sie betonte das Wort »Wahrheit«, als ob es für ihn etwas ganz Neues wäre –, »müssen wir nichts noch mal durchgehen. Dann werden wir ganz automatisch das Gleiche aussagen.«
Jepson sah gekränkt aus. »Ich werde die Wahrheit sagen.«
»Gut.« Sie stellte den Wasserkocher an. »Was ist dann das Problem?«
Zehn Jahre lang hatte Lucy als uniformierte Polizistin im Rang eines Constable in ihrer Heimatstadt Crowley auf diversen Polizeiwachen Dienst geschoben, die dem Zuständigkeitsbereich der berüchtigten November Division – manchmal einfach nur »die N« genannt – der Greater Manchester Police zugeteilt waren. Doch im vorherigen Winter hatte sie ihr lang ersehntes Ziel erreicht und war Detective bei der Kripo geworden. Bis zu einem gewissen Grad hatte sie sich die Beförderung auf dem Schlachtfeld verdient, dank ihres »vorbildlichen Mutes und ihres Einfallsreichtums«, den sie im Laufe eines langwierigen, schwierigen und höchst gefährlichen Undercover-Einsatzes im Rahmen der inzwischen legendären Operation Schnellstraße an den Tag gelegt hatte, um die Worte des stellvertretenden Polizeipräsidenten zu benutzen. Ohne all dies wäre es sehr unwahrscheinlich gewesen, dass sie es je geschafft hätte, zur Kripo zu kommen. Lange vor der Operation Schnellstraße, in einem relativ frühen Stadium ihrer Karriere, hatte sie es bei einem Einsatz einmal dermaßen verbockt, dass sie beinahe aus dem Polizeidienst entlassen worden wäre, und es hatte unzweifelhaft so ausgesehen, dass ihr die Sache ewig anhängen würde. Selbst mit den Lorbeeren ihres Einsatzes bei der Operation Schnellstraße hatte sie es vor allem der Überzeugungskraft von Detective Superintendent Priya Nehwal vom Dezernat für schwere Verbrechen zu verdanken, dass die hohen Tiere der Greater Manchester Police schließlich beschlossen hatten, über ihren Fehltritt hinwegzusehen. Das war die gute Nachricht.
Die schlechte war, dass sie nach ihrer Versetzung in die Kriminalabteilung der Wache Robber’s Row, dem Hauptsitz der Polizei von Crowley, mit Detective Constable Harry Jepson zusammengesteckt worden war, der zwar durchaus umgänglich sein konnte, wenn ihm danach war, aber er war auch ein bisschen rückständig.
Harry war bereits seit fünfzehn Jahren Detective, als Lucy ihm zur Seite gestellt wurde, jedoch während der ganzen Zeit kein einziges Mal befördert worden, was möglicherweise seiner Angewohnheit geschuldet war, sich über vorgesehene Verfahrensweisen hinwegzusetzen und Verdächtige ziemlich hart ranzunehmen. Er war blond, kräftig gebaut und sah halbwegs gut aus – wie ein Rugbyspieler –, allerdings war er bereits Anfang vierzig und machte insgesamt einen leicht ausgelaugten Eindruck. Außerdem war er unglücklich geschieden und musste für mehrere Kinder Unterhalt zahlen, was ihn zutiefst erbitterte. Er trank zu viel, vernachlässigte zusehends sein äußeres Erscheinungsbild und tendierte dazu, Leuten, die er nicht kannte, ziemlich schroff zu begegnen.
Lucy fragte sich manchmal, ob sie Harry zugeteilt worden war, weil ihre Vorgesetzten der Ansicht waren, dass nicht nur sie von ihm lernen konnte, sondern vor allem er von ihr, doch sie hatte diese Frage nie laut gestellt. Wobei sie zugeben musste, dass sie selber auch nicht dafür bekannt war, sich immer strikt an die Vorschriften zu halten.
Zudem bereitete es ihr zusehends Unbehagen, dass er heimlich ein Auge auf sie geworfen zu haben schien. Sie wusste, dass er einsam und frustriert war, und er war sich dessen bewusst, dass sie ebenfalls Single war. Sie hatten zwar ein produktives Arbeitsverhältnis, doch sie hatte ihn einige Male dabei ertappt, wie er sie mit begehrlichen Blicken betrachtete, wenn er dachte, sie würde es nicht mitbekommen. Allerdings war Lucy nicht im Geringsten versucht, etwas mit ihm anzufangen. Harry war nicht unattraktiv – er hatte einen gewissen rauen Charme. Aber sie hatte strikte Regeln, was die Vermischung von Arbeit und Vergnügen anging, sehr zum Leidwesen ihrer Mutter.
»Tee?«, fragte sie. Aber es war keine Frage. Sie reichte ihm eine Tasse Tee und rührte ihren eigenen um.
»Danke«, entgegnete er und ging nervös noch einmal die Einzelheiten der Verhaftung durch, die er in seinem Notizblock notiert hatte.
Lucy amüsierte sich im Stillen über seine Nervosität. Draußen auf der Straße gab er sich megacool und begegnete selbst den übelsten Rüpeln und Kriminellen der Stadt lässig und selbstbewusst – ein Mann, den man gerne an seiner Seite wusste, wenn man in der Klemme steckte. Doch wenn er sich der undurchdringlichen Bürokratie gegenübersah, benahm er sich wie ein Kind. Mit dem Amtsapparat konfrontiert, verlor er jeglichen Sinn dafür, wer er war, und wurde nervös und hibbelig.
Als Zeuge vor Gericht aufzutreten war für ihn jedes Mal eine Tortur.
Der Angeklagte an diesem Morgen war ein gewisser Darren Pringle, ein wiederholt straffällig gewordener Gewalttäter, den sie beide seit Langem kannten. Lucy glaubte nicht, dass Pringle diesmal große Chancen hatte davonzukommen. Er war wieder einmal wegen Körperverletzung angeklagt. Der gewohnheitsmäßige aggressive Trinker war im vorigen August in Crowley aus einem Pub getorkelt und hatte Anstoß an einem jungen Typen genommen, der vor einer Ampel in der Nähe in einem Sportwagen saß. Ohne dass dieser ihn auch nur im Geringsten provoziert hatte, war Pringle um den Wagen herumgegangen, hatte das Fenster an der Fahrerseite eingeschlagen und dem Fahrer einen Hieb verpasst, von dem dieser ein blaues Auge und eine geplatzte Augenbraue davongetragen hatte. Danach war er abgehauen, aber Lucy und Harry, die diverse Aussagen von Augenzeugen aufgenommen hatten und einer Spur von Fotos aus Überwachungskameras gefolgt waren, hatten ihn am nächsten Morgen in seiner Sozialwohnung verhaftet und seine Kleidung beschlagnahmt, in der später bei der kriminaltechnischen Untersuchung Glassplitter und Blutspritzer gefunden worden waren, und zwar sowohl von seinem eigenen Blut als auch von dem des Opfers. Es sah nicht gut für ihn aus, aber in Gerichtssälen passierten immer wieder merkwürdige Dinge.
Sie tranken ihren Tee und besprachen noch einmal die Einzelheiten. Dann gingen sie nach oben in den Vorraum, wo sie sich auch noch einmal kurz mit den zivilen Zeugen austauschten und von einem Vertreter der Staatsanwaltschaft belehrt wurden.
Dann setzten sie sich auf eine Bank und warteten.
»Ach, bevor ich’s vergesse«, sagte Harry. »Ist dir was von der Einbruchsserie in Hatchwood Green zu Ohren gekommen?«
Lucy nickte. Hatchwood Green war eine der heruntergekommensten Wohnsiedlungen in ganz Crowley. Die Kriminalität war dort weit verbreitet. Doch die jüngste Serie an Einbrüchen hatte beträchtliche Ausmaße angenommen, und eine flüchtige Analyse der Tatortberichte hatte ergeben, dass die Einbrüche eine Reihe von Ähnlichkeiten aufwiesen.
»Tja, von heute an sind wir auf die Sache angesetzt«, fuhr Harry fort.
Sie wandte sich interessiert zu ihm um.
»Stan hat die Nase voll und will, dass die Sache aufgeklärt wird«, erklärte er.
Stan Beardmore war der Divisional Detective Inspector auf der Wache Robber’s Row und Lucys und Harrys unmittelbarer Vorgesetzter.
Bevor sie Harry weitere Fragen stellen konnte, erschien der Justizwachtmeister und rief Harry in den Gerichtssaal. Er stand auf, zog seine locker gebundene Krawatte fest und glättete die Aufschläge seines zerknitterten Jacketts.
»Wenn ich fertig bin und entlassen werde, fahre ich zurück zur Wache und trage alle Informationen zusammen«, sagte er. »Dann können wir sofort loslegen.«
Lucy nickte und wartete. Dann klingelte ihr Handy.
»Detective Constable Clayburn«, meldete sie sich.
»Lucy?«
»Guten Morgen, Sir.« Sie erkannte die barsche, jedoch freundliche Stimme von Geoff Slater.
»Wie geht es Ihnen?«
»Ich wurstele mich durch, wie man so sagt.«
»Ach was!« Er lachte. »Lucy Clayburn und ›sich durchwursteln‹ sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Ich dachte, Sie würden inzwischen längst die Streifen tragen.«
Lucy dachte kurz darüber nach. Die bloße Tatsache, dass sie es geschafft hatte, Detective zu werden, war schon Wunder genug. Die Möglichkeit, zur Detective Sergeant befördert zu werden, schien Lichtjahre entfernt, auch wenn sie sich die Beförderung ihrer Meinung nach bereits mehrfach verdient hatte. Slater trug natürlich nicht so einen Mühlstein am Hals mit herum wie sie. Als sie das letzte Mal zusammengearbeitet hatten, war er Detective Inspector im Dezernat für schwere Verbrechen gewesen. Inzwischen war er Detective Chief Inspector, allerdings hatte er sich ins Drogendezernat zurückversetzen lassen müssen, in dem er seine Karriere begonnen hatte, bevor ihm diese Ehre schließlich zuteilgeworden war.
»Niemals, Chief Inspector Slater. Ich glaube, ich bin nicht die Richtige dafür. Hab wohl im Gegensatz zu Ihnen nicht das passende Gesicht.«
»Mein lieber Gott! Wenn es darum ginge, wer das beste Gesicht hat, wären Sie Chief Constable und ich die stellvertretende Klobürste.«
»Schmeicheleien öffnen einem jede Tür, Sir«, entgegnete sie. »Apropos, ich wollte Sie um einen Gefallen bitten.«
»Schießen Sie los. Was immer Sie wollen.«
»Sie haben im kommenden Frühjahr einen Fall vorm Manchester Crown Court. Regina versus Ian Dyke.«
»O ja, dieser kleine Scheißkerl.« Slater lachte finster in sich hinein. »Ein Drogenkurier der Low Riders. Er wird kriegen, was er verdient, darauf können Sie Gift nehmen.«
»Sieht es schlecht für ihn aus?«
»Wollen wir es hoffen. Wir versuchen schon seit einer ganzen Weile, diese Typen dranzukriegen. Bei Dyke hatten wir Glück. Für sich genommen ist er kein großer Fisch. Wir haben ihm den üblichen Deal angeboten, aber er hat nicht angebissen. Sie wissen ja, wie diese Biker sind – eine verschworene Truppe. Aber wie auch immer, er spielt nicht mit. Also wird er für die Taten seiner Kumpels büßen.«
Das erklärte alles, wurde Lucy bewusst. Sie hatte sich schon gedacht, dass Kyle Armstrong sich in Wahrheit Sorgen machte, dass Ian Dyke versucht sein könnte, einen Deal zu schließen und das ganze Chapter mit reinzureißen. Aber versprochen war versprochen, erst recht wenn es sich vielleicht eines Tages auszahlen würde.
»Ich habe mich nur gefragt«, sagte sie mit einem leicht unguten Gefühl, das sie jedoch unterdrückte, »ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt, ihm gegenüber ein bisschen Nachsicht walten zu lassen.«
Am anderen Ende der Verbindung entstand ein kurzes intensives Schweigen.
»Lucy, der Gerichtstermin steht«, stellte Slater schließlich klar. »Er ist für den 3. April angesetzt. Und wir haben nicht gerade wenig Stoff bei ihm gefunden.«
»Ich frage nur, weil es sich bei einer meiner Ermittlungen vielleicht als hilfreich erweisen könnte.«
»Selbst wenn ich wollte, kann ich in diesem Stadium nichts mehr tun, damit die Anklage abgeschwächt wird.«
»Sir, erinnern Sie sich an diesen wirklich heiklen Scheißjob, den Sie mir während der Operation Schnellstraße zugewiesen haben? Als Sie mich als verdeckte Ermittlerin in dieses Bordell in Cheetham Hill geschickt haben?«
»Sie meinen den Job, den Sie unbedingt haben wollten, den Job, um den Sie mich regelrecht angebettelt haben, weil Sie so scharf darauf waren?«, entgegnete er ernst.
»Ja, genau den. Und erinnern Sie sich daran, dass eine dieser Scheißschlampen dort mir sogar angedroht hat, mir die Nase abzufackeln?«
»Versuchen Sie nicht, mir so zu kommen, Lucy.«
»Ich versuche gar nichts. Ich sage nur: Ich habe in dem Jahr einen verdammt guten Job für Sie erledigt. Wir haben ein kriminelles Syndikat hochgenommen und zwei Serienmörder verhaftet.«
»Wofür Sie angemessen belobigt wurden.«
»Sir, ich bitte Sie doch nur um einen kleinen Gefallen.«
»Lucy.« Slater klang ziemlich entgeistert. »Ian Dyke ist ein übler Bursche. Er bringt den Stoff der Low Riders seit Jahren in ganz Crowley unters Volk und wahrscheinlich weit über Crowley hinaus.«
»Sie haben doch gerade selber gesagt, dass er nur ein kleines Rädchen im Getriebe ist. Bringt es die Sache wirklich voran, wenn Sie alles Dyke anhängen, nur weil Sie dem Rest der Truppe nichts anhaben können?«
Es folgte ein weiteres bedeutungsschwangeres Schweigen.
»Na schön«, erwiderte er schließlich. »Ich sage Ihnen, was ich tun kann. Und das tue ich allein auf der Basis unserer Freundschaft, die sich im Moment gerade auf sehr dünnem Eis befindet, Lucy.«
»Das ist mir klar, Sir. Tut mir wirklich leid.«
»Ja, das hört man.« Er machte eine Pause, als überdenke er sein Angebot noch mal. »Wenn Dyke seine Verteidigungsstrategie ändert und sich schuldig bekennt, was er tunlichst machen sollte, da er keine guten Karten hat, werde ich dem Richter persönlich schreiben und ihm mitteilen, dass der Angeklagte sich im Laufe der Ermittlungen hilfreich und kooperativ gezeigt hat, seine Taten aufrichtig bereut und ernsthaft versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass ihm das nicht den Arsch retten wird, aber es könnte dazu beitragen, dass der Richter ihm mit etwas mehr Nachsicht begegnet. Aber wie gesagt, als Erstes muss er seine Verteidigungsstrategie ändern. Und das kommt übrigens nicht von mir. Es muss von seinen Anwälten kommen. Als Erstes muss Dyke das also beigebracht werden. Sorgen Sie dafür, dass er das kapiert, Lucy. Der erste Schritt muss von ihm kommen.«
»Okay, Sir. Ich leite es weiter.« Lucy wusste, dass dies das Beste war, was sie herausholen konnte. »Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Ich habe keine Ahnung, was Sie da mit den Low Riders am Laufen haben, Lucy, aber ich warne Sie: Seien Sie vorsichtig. Die sind kein normaler Motorradclub. Es ist eine harte Truppe, die regelmäßig in kriminelle Machenschaften verwickelt ist.«
»Das weiß ich, Sir.«
»Und ihr Präsident, Kyle Armstrong, ist der Schlimmste von allen.«
»Auch das ist mir bekannt, Sir. Danke.«
Slater räusperte sich. »Wir sehen uns, Lucy. Passen Sie auf sich auf.«
Kapitel 4
Da Crowley einmal ein Zentrum des Kohlebergbaus und der Baumwollindustrie gewesen war, befanden sich die Lagerhallen und Fabriken beinahe im Zentrum der Stadt, was vor allem darauf zurückzuführen war, dass sich dort auch der wichtigste Umschlagbahnhof befand, doch sie lagen auch nur einen Steinwurf vom Haupteinkaufszentrum der Stadt entfernt.
Noch in den Siebzigerjahren waren im inneren Bereich Crowleys jede Menge Baumwollspinnereien und Fabriken in Betrieb gewesen, deren hohe Schlote wie Bäume eines Waldes in den Himmel ragten und Tag und Nacht Rauch in die Luft über dem Stadtgebiet Greater Manchesters gepustet hatten. Dies hatte dem Ort zu jener Zeit zweifellos einen ganz eigenen Charakter verliehen und tat es zu einem gewissen Grad immer noch. Zahllose riesige Fabrikgebäude überragten die Backsteinreihenhäuser in den Wohnvierteln, wo über viele Jahrzehnte lang die Arbeitskräfte gewohnt hatten.
Im 21. Jahrhundert hatten diese Fabrikanlagen natürlich etwas Anachronistisches. Einige waren in durchaus ambitionierter Weise in Wohnblocks mit »begehrten Wohnungen« umgewandelt worden – von denen die meisten immer noch zum Verkauf standen –, andere waren als Industriemuseen für Besucher zugänglich. Von den übrigen standen die meisten leer oder waren mit Brettern vernagelt. Einige hielten dies für einen Schandfleck in der Umgebung, andere sahen darin Potenzial. So hatte zum Beispiel Roy Shankhill alias »der Shank« die Rudyard Row, eine von Unkraut überwucherte Seitenstraße, die sich zwischen mehreren dieser heruntergekommenen leer stehenden Kolosse aus der Zeit Edwards VII. hindurchschlängelte, auserkoren, um dort seine »Geschäfte« zu betreiben.
Die Rudyard Row war keine Straße, auf der man zufällig landete, denn man musste seinen Weg durch ein Gewirr ähnlich verwahrloster Gassen finden, weshalb die meisten Menschen, selbst Ortsansässige, keine Ahnung von der Existenz dieser Straße hatten. Außerdem gab es so gut wie keinen Grund, die Rudyard Row aufzusuchen. Einige der ehemaligen Fabrikgebäude, die die Straßen säumten, wurden zwar noch genutzt, doch bei den meisten handelte es sich um seelenlose Backsteinfassaden mit vernagelten Fenstern.
An diesem trüben, feuchtkalten Oktobertag wirkte die Straße so düster wie immer, als Malcolm Pugh dort aufkreuzte. Es war mitnichten sein erster Besuch und würde höchstwahrscheinlich auch nicht sein letzter sein, doch das bedeutete nicht, dass er deshalb weniger nervös war.
Er war mit dem Bus aus Bullwood in die Stadt gekommen. Es war später Vormittag, die Rushhour war lange vorüber, und so war er auf dem Oberdeck der einzige Gast gewesen und hatte während der gesamten Fahrt über seine zahllosen Probleme nachgedacht. Während er grübelnd die Rudyard Row entlangging, fühlte er sich noch mehr allein, und jetzt hatte er auch noch Angst.
Was er heute vorhatte, war in vielerlei Hinsicht gut. Er erwartete, dass es dazu beitragen würde, sich bei Shankhill lieb Kind zu machen, aber man konnte nie ganz sicher sein, was dabei herauskam, wenn man mit dem Shank zu tun hatte. Er sah nach rechts und nach links, bevor er an die Tür Nummer 38 klopfte. Die beiden rostigen Ziffern hingen zwischen Streifen abblätternder Farbe.
Er vergaß sich zu vergewissern, ob die Luft auch hinter ihm rein war, weshalb er nicht sah, dass die Tür des verfallenen Gebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite leise aufschwang. Die Scharniere waren erst vor Kurzem geölt worden.
Im ersten Moment war aus dem Inneren von Shankhills Gebäude nichts zu hören. Pugh wollte gerade noch einmal klopfen, als er auf der anderen Seite der Tür etwas hörte, das klang wie das Rascheln einer Zeitung. Er wusste, was das war: Turk, dieser Haufen aus Fleisch und Knochen, den Shankhill einen Bodyguard nannte, der sich verärgert von seinem Stuhl erhob, das Käseblatt zusammenrollte, das er gerade las – sicher eins mit vielen Titten, Ärschen und Strapsen –, es in seine Jackentasche stopfte und …
»Wer ist da?«, dröhnte Turks Stimme durch das Holz.
Er hatte einen merkwürdigen Akzent, den Pugh nicht recht zuordnen konnte. Aufgrund des Spitznamens des Kerls, seiner dunklen Hautfarbe und seines kurzen wirren fettigen Haars hatte Pugh immer angenommen, dass er irgendwo aus dem Nahen Osten stammte. Nicht dass das eine Rolle spielte. Das Einzige, was im Hinblick auf Turk wirklich zählte, war, dass er mindestens eins zweiundneunzig groß war, täglich trainierte und höchstwahrscheinlich jede Menge Steroide nahm, was ihm einen Herkuleskörper bescherte. Angeblich tat er nichts lieber, als die Abdrücke seiner zahlreichen Siegelringe auf den Körpern und in den Gesichtern derjenigen zu hinterlassen, mit denen sein Arbeitgeber ein Hühnchen zu rupfen hatte.
»Ich bin’s, Malcom Pugh. Ich muss zu Roy.«
Auf der anderen Seite der Tür ertönte ein Kichern. »Sie kriegen den Hals wohl nie voll, was?«
»Ich bin nicht hier, um einen neuen Kredit aufzunehmen. Ich will ihm was zurückzahlen.«
»Ach ja?« Turk klang belustigt, als ob das ein Scherz sein musste und er ihm nicht abkaufte, dass er wirklich deshalb da war.
»Im Ernst. Komm schon, Turk. Roy erwartet mich.«
Es rumste zweimal, als erst der obere und dann der untere Riegel zur Seite geschoben wurde. Die Tür öffnete sich, und Pugh stellte einen Fuß auf die Stufe, doch im gleichen Moment stieß ihn etwas von hinten. Jemand rannte mit voller Wucht in seinen Rücken hinein.