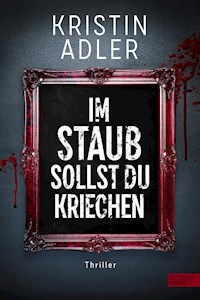
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Mohr
- Sprache: Deutsch
Als in ihrem Museum eine Leiche gefunden wird, ist die Kunstexpertin Clara Mohr fassungslos - und doch scheint ihr die Art und Weise, wie das Opfer zugerichtet wurde, vage vertraut. Die Polizei indes tappt im Dunkeln, und die Ermittlungen laufen ins Leere. Es ist Clara, die den entscheidenden Hinweis liefert: Offenbar hat der Mörder sich bei der Tat vom Gemälde eines alten italienischen Meisters inspirieren lassen. Clara muss so schnell wie möglich die Botschaft des Gemäldes entschlüsseln, um weitere Morde zu verhindern ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Als in ihrem Museum eine Leiche gefunden wird, ist die Kunstexpertin Clara Mohr fassungslos - und doch scheint ihr die Art und Weise, wie das Opfer zugerichtet wurde, vage vertraut. Die Polizei indes tappt im Dunkeln, und die Ermittlungen laufen ins Leere. Es ist Clara, die den entscheidenden Hinweis liefert: Offenbar hat der Mörder sich bei der Tat vom Gemälde eines alten italienischen Meisters inspirieren lassen. Clara muss so schnell wie möglich die Botschaft des Gemäldes entschlüsseln, um weitere Morde zu verhindern ...
Kristin Adler
Im Staub sollst du kriechen
Thriller
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2019 by Kristin Adler
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-327-4
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
„Seufzend sprach der Teufel: Adam, meine ganze Feindschaft, Neid und Schmerz geht gegen dich, weil ich deinetwegen auf die Erde hinabgestoßen ward.
Adam antwortete: Was habe ich dir getan, und was ist meine Schuld dir gegenüber?
Der Teufel antwortete: Als Gott den Lebensodem in dich blies und dein Gesicht und Gleichnis nach Gottes Bild geschaffen wurde, gebot der Erzengel Michael: Betet Gottes des Herrn Ebenbild an, wie Gott der Herr es befiehlt! Aber ich antwortete: Ich brauche Adam nicht anzubeten. Ich werde doch den nicht anbeten, der geringer und jünger ist als ich! Ich bin vor ihm erschaffen worden. Er sollte mich anbeten.
Und Gott der Herr geriet in Zorn über mich und verbannte mich mit meinen Engeln von unserer Herrlichkeit, und so wurden wir um deinetwillen aus unseren Wohnungen in diese Welt getrieben und auf die Erde verstoßen.“
Aus der apokryphen Schrift „Das Leben Adam und Evas“
1.
Als Nicholas das Telefonat beendet hatte, lehnte er sich erleichtert zurück. Er hatte keine Skrupeln, diese Art von Gesprächen zu führen – bereits zu Beginn, als die Sache ins Laufen gekommen war, hatte er moralische Bedenken gekonnt verdrängt –, aber irgendwie war ihm die Sache ... peinlich. Es fühlte sich so an, als würde er mit Übergewicht vor dem Fernseher sitzen und Chips fressen, während dort ein gestählter Diät-Guru seinen Waschbrettbauch in die Kamera hielt.
Nicholas blickte sich in dem Büro um, ein langer aber sehr schmaler Raum, rechts und links mit verstaubten Bücherregalen vollgestellt. Der Schreibtisch war uralt: das einstmals helle Holz hatte sich verdunkelt, und an vielen Stellen war die Tischplatte zerkratzt. Auch der Computer war nicht mehr der Jüngste, sondern ein jener Riesenkisten, die ständig abstürzten oder heißliefen. Jetzt überprüfte er, ob er keine Spuren auf der Festplatte hinterlassen hatte, ehe er ihn herunterfuhr. Es dauerte lange, bis der Bildschirm endlich erlosch. Ungeduldig hämmerte er mit seinen Fingern auf die Tischplatte.
So ein Büro würde ich mir nicht bieten lassen, dachte Nicholas, und sein Blick fiel auf den Linoleumboden, der an einer Stelle Falten warf – entweder, weil man ihn schlampig verlegt hatte, oder weil er an brütend heißen Tagen seine Form verloren hatte.
Nein, dachte er wieder, das ist grauenhaft hier.
Kein Licht leuchtete mehr auf, er erhob sich, streckte sich, packte seine Sachen. Zumindest für heute Abend hatte dieses Büro ihm gute Dienste erwiesen, und in einigen Wochen würde er selbst ein ganz anderes beziehen, groß, luxuriös und hell.
Er überlegte, was er mit dem freien Abend anstellen sollte. Selten genug, dass er mehrere Stunden frei verplanen konnte. Vielleicht sollte er wieder einmal ins Kino gehen, irgendein Actionspektakel lief im Cinestar Metropolis bestimmt, nach schwerer Kost war ihm nicht. Er könnte aber auch einfach nur über den Römer bis zum Main schlendern, am Fluss entlang einen gemütlichen Spaziergang machen, erkunden, wie sich die Stadt, in der er früher gelebt hatte und in die er bald wieder ziehen würde, verändert hatte.
Er freute sich auf Frankfurt, obwohl seine Berliner Kollegen ihn deswegen für verrückt hielten. Berlin – das hatte den Nimbus des Aufstrebenden, Unkonventionellen, Neuen; eine Stadt auf ihrem Weg zur Weltmetropole, die ihren Flair und ihre Lebendigkeit aus den Ecken und Kanten ihrer ungewöhnlichen Geschichte bezog, eine Stadt ohne diesen künstlich gestylten, überteuerten Chic von anderen Großstädte. Frankfurt hingegen war in den Augen der meisten eine öde Bankencity, über deren miefigen Geruch auch der Anblick der Skyline nicht hinwegtäuschen konnte.
Nicholas sah das anders. Die Lebensqualität – unbezahlbar. In Berlin saß man doch stundenlang in der S–Bahn, bis man die Stadt auch nur zur Hälfte durchquert hatte. Hier reichten fünfzehn Minuten, und man konnte einen Spaziergang mitten im Grünen machen. Ganz zu schweigen vom nahen Flughafen. Klar, der Fluglärm. Sollten sich doch die Grünen darüber beschweren, er war klug und praktischerweise reich genug, um in ein Viertel zu ziehen, wo er nicht davon behelligt wurde.
Nicholas nahm seine Jacke, die er um den Schreibtischstuhl gehängt hatte, und zog sie über sein weißes Hemd. Darunter trug er eine Jeans, was selten war, aber zu einem Tag wie heute passte. Er trug keine Akten- oder Laptoptasche, sondern brachte alles, was er bei sich hatte, in Jacke und Hose unter: I-Phone, Schlüssel, Geldbörse.
Er warf einen letzten Blick auf den Schreibtisch, damit er keine verräterischen Spuren oder Notizen hinterließ, prüfte sogar kurz den Mülleimer und wollte das Büro verlassen. Bevor er die Tür erreichte, bemerkte er, dass ein Schnürsenkel offen stand. Mit einem Fluch kniete er sich auf den Boden, griff nach den Bändern und verknotete sie.
Er hatte sich noch nicht wieder aufgerichtet, als ihn ein Geräusch zusammenzucken ließ. Es klang wie ein Hüsteln und Schnauben, und es klang so ... nah. Seine Nackenhaare richteten sich auf, als er noch kniend herumfuhr.
Nichts.
Der Eingangsbereich war ebenso menschenleer wie das Büro. Der schwarze Bildschirm des Computers glotzte ihn gleichgültig an.
Eben, dachte er beruhigt. Hier ist niemand. Hier kann um diese Tageszeit niemand sein.
Er überprüfte noch einmal den Knoten, den er gebunden hatte, und stand auf. Diesmal nahm er kein Geräusch, sondern aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr, einen schwarzen Schatten, der einem vorbeifliegenden Vogel glich.
Doch es war kein Vogel, sondern eine Hand ... eine schwarze Hand.
Sie steckte in einem glänzenden Lederhandschuh.
„Was zum Teufel ...“
Er brachte seine Frage nicht mehr zu Ende. Er kam noch nicht einmal zur Erkenntnis, wo genau sich der Angreifer versteckt hatte. Ein dumpfer Gegenstand traf seinen Hinterkopf, ehe er das Gesicht des Fremden erkannte.
Er spürte noch, wie sein Körper auf den Boden prallte, dann nichts mehr.
Nackt, dachte er, ich bin nackt.
Lange war es nur dieser eine Gedanke, der sich in seinem Gehirn festbiss. Für jede andere Wahrnehmung – Unbehagen, Angst oder gar Panik – war es zu träge. Er fühlte den klebrigen Linoleumboden unter sich, einen säuerlichen Geschmack im Mund und einen kalten Luftzug, der ihn frösteln ließ.
Jemand hatte ihm seine Kleidung vom Körper gezerrt, sehr hastig, unsanft, ein pochender Schmerz an seinem Oberschenkel verriet einen Kratzer, den der Reißverschluss seiner Jeans dort hinterlassen hatte.
„Was zum Teufel ...“, wollte er wieder ansetzen.
Auch vorhin waren das seine letzte Worte gewesen, nun brachte er nicht einmal die hervor. Aus seinem Mund kam nur ein heiseres Flüstern, seine Zunge, die ihm irgendwie größer, regelrecht geschwollen erschien, stieß an einen rauen Widerstand. Er konnte nichts sagen, er war geknebelt.
Umdrehen, dachte er, ich muss mich umdrehen ...
Wie in Zeitlupe war ihm die Erkenntnis gekommen, dass er auf dem Bauch lag, und dass er seine Lage ändern musste, um seinen Angreifer sehen zu können. Er hob den Kopf, wurde augenblicklich von einem gleißenden Schmerz in seinem Kopf bestraft, versuchte sich ächzend aufzustützen. Es gelang ihm nicht, seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt.
Er stöhnte auf, als er einen Fuß fühlte, der sich in seine Seite rammte. Zunächst dachte er, der Angreifer würde ihm die Rippen brechen, doch dann bemerkte er, dass er ihm half, sich auf den Rücken zu drehen. Wer immer ihn niedergeschlagen hatte, wollte von ihm erkannt werden.
Nicholas schluckte gegen den säuerlichen Geschmack in seinem Mund an. Nicht nur, dass ihn die Gestalt, die sich über ihn beugte, ihn auf den Rücken wälzte. Sie schnitt ihm auch die Fesseln an seinem Handgelenk auf.
Seine Finger fühlten sich taub an, und seine Augen tränten. Über alles, was er sah, legten sich kleine, silbrige Sternchen. Erst nach einer Weile lichtete sich dieser Funkenregen, er blickte in das Gesicht des Angreifers – ein vertrautes Gesicht. Der Knebel dämpfte seinen Schrei, aber seine Augen weiteten sich.
Du?, wollte er brüllen, du?
Er war dem Entsetzen noch nicht Herr geworden, als er sah, was der heimtückische Angreifer in den Händen hielt. Wieder ein tonloser Schrei. Er wollte sich aufrichten, irgendwie auf seine Beine kommen, fliehen. Doch seine Füße – das merkte er erst jetzt –, waren ebenfalls gefesselt, und bevor er sich zur Seite wälzen konnte, traf ein Tritt sein Gesicht. Er spürte das kalte Leder der Schuhsohle, roch den Straßendreck, hörte ein knackendes Geräusch – der grässlichste Laut, den er jemals in seinem Leben vernehmen musste. Sein Kopf schien zu explodieren, seine Haut zu zerplatzen, warmes Blut troff aus seiner Nase und sickerte in seinen Knebel. Er bekam Panik, konnte nicht mehr atmen, erst recht nicht, als er wie durch einen roten Schleier sah, dass der Angreifer seine Waffe bedrohlich schwang.
Nicht!, wollte er schreien. Nicht!
Verzweifelt drehte er den Kopf zur Seite, doch sein Angreifer hatte es kein weiteres Mal auf sein Gesicht abgesehen. Die Axt raste auf ihn herab, er sah silbrigen Stahl aufblitzen, fühlte, wie er in sein Fleisch schnitt, sich seinen Weg durch die Muskelmasse bis zum Knochen bahnte. Der Schmerz zerriss ihn, während sich eine rote, warme Blutfontäne über ihn ergoss. Er wusste nicht, welches Körperglied getroffen worden war, ob die Axt weiter wütete oder sich mit diesem einen Schlag begnügte. Es machte keinen Unterschied, denn der Schmerz war überall, wühlte in seinen Eingeweiden, kämpfte sich die Kehle hoch. Er schmeckte Erbrochenes im Mund, aber konnte es wegen des Knebels nicht ausspucken, biss sich auf die Zunge, während noch mehr Blut aus seiner Nase troff und sein Kinn rann.
Sein Körper verkrampfte sich, bäumte sich auf, schien noch gegen den Schmerz ankämpfen zu wollen. Sein Geist hingegen hoffte auf nichts mehr, nur mehr das gnädige Nichts, das ihn von dem Grauen erlösen würde.
Dieses Nichts ließ nicht lange auf sich warten.
„Das war erst der Anfang“, war das Letzte, was Nicholas Roth von dieser Welt hörte.
2.
Clara schreckte hoch, die roten Ziffern des Radioweckers zeigten 5 Uhr 23.
Als sie instinktiv mit der Zungenspitze über die obere Zahnreihe fahren wollte, stieß sie auf Widerstand. Ihr fiel wieder ein – so wie ihr jeden Morgen seit drei Wochen einfiel –, dass ihr der Zahnarzt eine Beißschiene verschrieben hatte. Sie knirschte im Schlaf so stark, das ginge an den Zahnschmelz.
„Haben Sie Stress?“, hatte der Zahnarzt gefragt. Er war etliche Jahre jünger als sie, zumindest sah er jünger aus.
„Ich bin alleinerziehend“, sagte sie. „Und voll berufstätig.“
Er spielte mit seinem Rezeptblock spielte, nickte verständnisvoll, obwohl sein Blick eher gehetzt als mitleidig auf ihr ruhte. Einer der Kugelschreiber, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen, hatte die Form eines Pinguins. Ein Jux-Geschenk. Oder Beweis, dass auch er Kinder hatte.
„Passen Sie auf sich auf!“, sagte er.
Sie öffnete die Türe des Behandlungszimmers, blieb aber auf der Schwelle stehen. „Aber wissen Sie“, sagte sie, „so schlimm ist es gar nicht. Meine Tochter lebt bei ihrem Vater. Und mein Job ist der langweiligste der Welt.“
Der Rezeptblock fiel ihm fast aus der Hand. Irritiert sah er hoch.
„Passen Sie auf sich auf“, sagte sie, lächelte und ging.
Die Zahnschiene also. Als sie sie zum ersten Mal anprobiert hatte, hatte sie sich an das künstliche Vampirgebiss erinnert, dass sie vor vielen Jahren mal auf einer Halloweenparty getragen hatte.
Clara legte sich wieder um. 5:24. Erst als sie die Augen schloss, hörte sie es wieder: Das Vibrieren ihres I-Phones, das nicht zum ersten Mal erklang und sie vorhin geweckt hatte. Ruckartig fuhr sie hoch. Sie hatte vergessen, das I-Phone ans Ladegerät zu stecken. Immerhin hatte es genug Saft, um zum mittlerweile dritten Mal zu vibrieren.
Sie sprang aus dem Bett, stieß mit dem Fuß gegen das Nachtkästchen, rieb sich gedankenverloren die große Zehe. Das Vibrieren klang immer ungeduldiger. Wer immer sie an einem Donnerstag um 5:23, nein, jetzt war es schon 5:25 anrief, ließ sich nicht von der Mailbox abspeisen.
Katharina, dachte sie und der Schreck ließ sie den Schmerz im Fuß vergessen, vielleicht ist etwas mit Katharina passiert ...
Doch als sie das Handy aufs Ohr presste, meldete sich nicht Philip, ihr Ex–Mann, sondern eine undeutliche Frauenstimme.
„Frau Mohr?“, ertönte es inmitten eines Rauschen. „Frau Mohr?“
„Ja, ich bin dran, wer ist da?“
„Oh ...“ Der langgezogene Ton der Frau hörte sich klagend an.
„Wer ist da?“, fragte sie noch einmal. Sie merkte, dass sie nuschelte, weil sie noch die Beißschiene trug, und riss sie sich schnell von den Zähnen.
„Müssen unbedingt ins Museum kommen, jetzt gleich. Müssen kommen ... oh.“
Jetzt erkannte sie die Stimme, sie gehörte Frau Zielińska, der Putzfrau. Neben Pfarrer Berger, dem Kurator, und Frau Marlene Ried, die die Eintrittskarten verkaufte, war es die einzige Person, die außer ihr einen Schlüssel zum Museum besaß. Bis jetzt war sie sich nicht darüber klar gewesen, dass sie so früh am Morgen ihre Arbeit verrichtete, die Fußböden wischte, die Glasvitrinen abstaubte, das Büro aufräumte, oft so gründlich, dass Clara manche Unterlagen mühsam in der Ablage suchen musste. Aber das störte nicht, sie hatte ohnehin nicht viel zu tun.
„Was ist passiert?“, fragte Clara. Sie fröstelte.
„Müssen kommen ... toter Mann hier.“
Die letzten Worte gingen in dem Rauschen unter.
„Ein toter Mann?“
„Toter Mann“, bestätigte Frau Zielińska wenig geistreich, so, als würde die Sprache nur aus diesen beiden Worten bestehen. „Kommen bitte sofort. Polizei hier.“
Das Rauschen schien leiser zu werden, aber in dem Augenblick, da Clara nachfragen wollte, ertönte ein Tüten. Aufgelegt.
Sie ließ das I-Hone sinken, huschte auf Zehenspitzen zurück zum Bett. Am liebsten hätte sie die kalten Füße unter die Bettdecke gesteckt, den Anruf ignoriert oder sich vorgemacht, dass sie nur geträumt hatte.
Aber es war kein Traum. Die roten Ziffern des Radioweckers zeigten auf 5:28.
Dicke Regentropfen klatschen auf die Windschutzscheibe. Obwohl Clara die Scheibenwischer auf die höchste Stufe gestellt hatte, war vom frühmorgendlichen Frankfurt nicht mehr zu sehen als verzerrte Schatten und einzelne Farbtupfer.
Großartig. So früh aus dem Bett geklingelt zu werden und dann noch dieser Regen. Zumindest war nicht viel los, sie kam zügig durch, hatte bereits die Berliner Straße erreicht. Normalerweise ging sie zu Fuß hier entlang, wenn sie sich von ihrer kleinen Wohnung im Ostend auf dem Weg zum Museum gleich gegenüber vom Dom machte. Nur am Abend, wenn sie nach einem Abstecher zur Kleinmarkthalle mit Einkaufstüten beladen war, nahm sie manchmal die S–Bahn und fuhr zwei Stationen.
Wahrscheinlich ein Obdachloser, ging ihr durch den Kopf. Ja, so musste es sein, manchmal kam es vor, dass einer der Obdachlosen im überdachten Eingangsbereich des Museum schlief. Einmal im Winter war sie fast über einen gestolpert. Sie hatte ihn angestupst, und als er sich nicht rührte, hatte sie gedacht, er wäre erfroren. Doch ehe die Polizei eintraf, die sie alarmiert hatte, war der Mann wieder zu sich gekommen, mit grummelnden, ärgerlichen Worten aufgestanden und mit seinen Plastiktüten seines Weges marschiert. Wie peinlich ihr der Fehlalarm gegenüber den beiden Beamten gewesen war.
Jetzt lagen die Temperaturen zwar deutlich über dem Gefrierpunkt, aber sterben konnte man schließlich auch an etwas anderem als an Kälte. Ja, bekräftige Clara innerlich, das hatte Frau Zielińska gemeint, als sie von einem Toten im Museum gesprochen hatte. Genau genommen hatte sie ja auch nicht gesagt, dass sich dieser Tote im Museum befand, er konnte genauso gut vor der Tür liegen.
Eine der Ampeln sprang auf rot, dort vorne musste sie links abbiegen; das vermutete sie zumindest, sie war sich nie sicher, wie man am schnellsten zum Parkhaus am Römer kam. Während sie auf Grün wartete, musterte sie ihr vom Schlaf verquollenes Gesicht im Rückspiegel. Sie hatte es sich vorhin nicht einmal gewaschen, war nur rasch in die Kleidung geschlüpft. Es war das erste Mal seit ihrer Scheidung, dass sie ungeschminkt und unfrisiert das Haus verließ. In der feuchten Regenluft hatten sich an Stirn und Schläfe das Haar gekräuselt, während es an allen übrigen Stellen dünn und glatt runterhing. Suppennudelhaare, hatte ihre Mutter immer gesagt.
Immer noch rot. Clara kramte im Handschuhfach nach einem Lippenstift, hoffte auch, Puder und Wimperntusche zu finden.
Hinter ihr hupte ein Auto, die Ampel war auf Grün gesprungen.
Mist, dachte sie, als sie ungeschminkt weiterfuhr, tröstete sich aber mit dem Gedanken, dass sie um diese Uhrzeit ohnehin niemand sehen würde.
„Überhaupt“, hatte Dora mal zu ihr gesagt, ihre beste Freundin und obendrein auch Schwägerin - Ex–Schwägerin, wenn man es genau nahm -, „warum legst du plötzlich so viel wert auf dein Aussehen? Früher warst du ja nicht so.“
Dora hatte recht. Philip hatte sich von ihr immer mehr Eleganz gewünscht, mehr Stilsicherheit, mehr spektakuläre Outfits.
„Ich will nicht, dass irgendein Fotograf...“
„Die heißen Paparazzi, und in Deutschland lassen sie einen halbwegs in Ruhe!“
„Mir hat vor zwei Wochen einer vor der Haustür aufgelauert“, hatte Clara eingewandt, „Wenn schon ein Schnappschuss, dann nicht im abgewrackten Zustand. Sonst steht im Goldenen Blatt oder was weiß ich, dass die einstige Märchenprinzessin nach ihrer Scheidung Alkoholikerin ist. Oder Drogensüchtige. Oder was noch Schlimmeres. Kein Wunder, dass ihr armer Mann das Kind nicht bei ihr wohnen lässt.“
„So wichtig bist du nicht. Für die Yellow–Press meine ich. Die haben dich bei der Hochzeit belagert, meinetwegen auch bei Katharinas Geburt ... aber jetzt doch nicht mehr. Oder hast du irgendwann mal seit der Scheidung ein Foto von dir in der Zeitung gesehen?“
„Natürlich nicht“, antwortete Clara. „Weil ich eben nicht wie 'ne abgewrackte Drogenabhängige aussehe. So gibt mein Leben doch keine Story her. Kein neuer Mann. Ein langweiliger Museumsjob. Und immer ordentlich gekleidet und geschminkt.“
Wenn sie mit dem Obdachlosen richtig lag, hatte sie genügend Zeit, gleich wieder nach Hause zu fahren und sich zurechtzumachen. Eigentlich lohnte es sich gar nicht, ins Parkhaus zu fahren, vielleicht fand sie ausnahmsweise mal in der Domstraße einen Parkplatz.
Sie kurbelte das Fenster herunter, um besser sehen zu können, da sich die Windschutzscheibe mit Dunst zu beschlagen begann. Kalte Regentropfen trafen sie im Gesicht, einer davon mitten ins Auge. Sie zwinkerte – und dann sah sie es.
Polizeiautos, nicht nur eines, sondern drei, und mehrere hektische Beamte, die herumliefen. Einer war gerade damit beschäftigt, mit orange–weiß gestreiftem Plastikband eine Absperrung zu konstruieren, direkt um den Eingangsbereich des Museum.
Kein toter Obdachloser dachte sie, noch nüchtern, noch sachlich, dann entfuhr ihrem trockenen Mund, in dem es immer noch bitter wie vorhin beim Aufwachen schmeckte, ein entsetzter Aufschrei.
Sie hatte nicht daran gedacht, vielleicht hatte sie es auch verdrängt, aber sie hätte es wissen müssen, wer der Tote im Museum war.
„Bitte nicht“, stammelte sie. „Bitte nicht Nicholas.“
Clara parkte im absoluten Halteverbot und versperrte außerdem den halben Gehsteig, als sie hastig in die erste Lücke fuhr, die sich ihr anbot.
Als sie die Autotüre öffnete, kam ihr ein Schwall Regen entgegen – und die Stimme des Polizisten, der das Museum für Sakrale Kunst absperrte. Er trug eine Lederjacke, auf der der Regen abprallte, doch sein Gesicht war so gnadenlos nass, als hätte er geweint. Die Barthaare seines Schnauzers waren sehr dünn und glichen mehr einem Flaum als richtigen Stoppeln. Zwanzig Jahre war er höchstens alt, vermutete Clara, vielleicht einundzwanzig.
„Sie können hier nicht parken!“
„Was ist da drinnen los?“, fragte Clara und deutete auf das Gebäude. „Das ... das ist mein Museum.“
Was für eine blöde Formulierung. Ihr gehörte noch nichtmal die Wohnung, in der sie lebte. Das Museum befand sich im Eigentum des Bistum Limburgs, wurde aber vom Staat mitfinanziert. Sie war nur eine Angestellte.
Der junge Polizist zog die Schultern hoch, entweder aus Unsicherheit oder zu verhindern, dass der Regen auf seinen Nacken fiel. Die Tropfen fielen mittlerweile so dicht, dass Clara ihre Augen abschirmte, um ihn überhaupt noch sehen zu können. Seine Worte wurden vom Prasseln fast verschluckt.
„Dann gehen Sie mal rein“, meinte er nach längerem Zögern und strich sich hilfesuchend über den viel zu dünnen Schnauzer, „Martin Hartmann von der Kripo ist auch gerade eingetroffen ...“
Clara spürte den Regen plötzlich nicht mehr. „Kripo?“, rief sie entsetzt. „Was ist denn da drinnen passiert?“
Der Polizist zog seine Schultern immer höher.
„Gehen Sie einfach rein!“, forderte er sie auf; er hatte offenbar Angst, einen Fehler zu machen.
Aus Gewohnheit kramte Clara nach ihrem Schlüssel, als sie auf das Museum zulief. Wenn sie am Morgen kam, war Frau Zielińska meist schon gegangen und sie darum die erste, die aufsperrte. Um zehn traf Frau Ried ein, jedenfalls am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, wenn das Museum vormittags geöffnet war. Sie war für den Kartenverkauf gleich am Eingang zuständig, und für den kleinen Museumsladen gegenüber, wo Kataloge, Führer, Plakate von verschiedenen Sonderausstellungen und ein paar Postkarten angeboten wurden. Bis vor kurzem hatten letztere ausschließlich Exponate des Museums gezeigt und waren schlecht oder gar nicht verkauft worden. Seit Clara jedoch vorgeschlagen hatten, Karten vom Dom oder allgemeine Frankfurtbilder mit ins Sortiment zu nehmen, lief es besser. Am Samstag und Sonntag, wenn das Museum von 11.00 bis 17.00 geöffnet war, saßen wechselnde Hilfskräfte an Frau Rieds Platz – meistens Studenten, die sich nebenbei etwas dazu verdienen wollten.
Ehe Clara die Tür aufsperren konnte, wurde sie von Innen geöffnet.
„Gut, dass endlich da sind ...“, rief ihr Frau Zielińska mit starkem Akzent entgegen.
Ihre Stimme zitterte genauso wie ihr restlicher Körper. Das Gesicht war erschreckend bleich, wirkte kränklich, ausgemergelt. Clara selbst hatte dem Bistum Frau Zielińskas Einstellung empfohlen – Pfarrer Berger überließ Personalentscheidungen dieser Art ihr –, aber sie konnte sich nicht erinnern, sie seitdem oft gesehen zu haben.
„Ist es Nicholas?“, fuhr Clara sie an.
Frau Zielińska wich zurück. Sie trug einen braunen, knöchellangen Flanellrock, eine Bluse im gleichen, jedoch viel verwascheneren Farbton und darüber ein farblich unpassendes Kleidchen mit Blumenapplikationen.
„So schrecklich ...“, stammelte Frau Zielińska in einem weinerlichen Singsang, „so schrecklich ...“
Dann wandte sie sich ab, zog aus dem braunen Flanellrock ein Taschentuch hervor und putzte sich umständlich die Nase.
Clara spürte, wie es von ihren Haaren und von den Ärmel ihre rosa Pullover tropfte. Vorhin hatte sie gar nicht bemerkt, was sie angezogen hatte, nun vor allem, dass es zu wenig war, um nicht zu frieren.
„Ist es Nicholas?“, fragte sie wieder.
Frau Zielińska fuhr mit ihrem weinerlichen Singsang fort, allerdings mit unverständlichen polnischen Worten durchsetzt. Sie verknäulte das Taschentuch in ihren Händen, die so mager wie der restliche Körper waren, nur ungleich röter als das weiße Gesicht.
Clara war fast erleichtert, sich abwenden zu können, als sie hinter sich eine Bewegung wahrnahm. Drei Stufen führten von dem Vorraum mit Kassa und Museumsladen hoch zu einem schmalen Gang. Von dort ging es sowohl zum Rundgang durch die drei Ausstellungsräume als auch in ihr kleines Büro. Unmittelbar gegenüber befanden sich die Toiletten - Clara musste dieselben benutzen wie die Besucher - und daneben eine kleine Kaffeeküche.
Auf einer der Stufen stand ein Mann, sein Blick müde, die Haut seines Gesichts grau und um das Kinn herum von Bartstoppeln übersät. Er hatte einen bulligen Oberkörper, um dessen Taille sich die Lederjacke deutlich spannte. Seine Hände waren in den Taschen seiner grauen Jeans vergaben, während er missmutig die Stirne runzelte. Es war schwer, sein Alter einzuschätzen. Er gehörte zu jenen Männern, die schon mit 45 alt aussahen, die sich aber die darauffolgenden zwanzig Jahre kaum mehr veränderten. Wurden sie 65, hieß es dann, sie hätten sich gut gehalten.
„Grade mal sechs Uhr“, stellte er mit Blick auf seine Armbanduhr fest und wurde noch missmutiger. „Ich brauche jetzt erst mal einen Kaffe. Wo steht denn hier ein Automat?“
Clara trat hastig auf ihn zu. Bei jedem Schritt perlten noch mehr Regenwasser von ihrem Kopf.
„Clara Mohr, ich bin die Leiterin dieses Museums. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Ich habe gehört, dass hier ... dass hier ein To ... ein Toter gefunden wurde.“
Trotz des Gestammels klang ihre Stimme sachlich.
Die Stirne des Mannes glättete sich. „Unschöne Sache“, knurrte er missmutig.
„Nicholas?“, fragte Clara und mit der sachlichen stimme war es vorbei, „ist es Nicholas Roth? Ich habe ihn gestern getroffen, er ist ein alter Bekannter ... er wollte am Abend den Computer in meinem Büro benutzen ...“
„Häh?“, grummelte der Mann, um dann entschlossen hinzuzufügen: „Ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Sonst kann ich gar nicht denken.“
„Oben ... gleich neben der ersten Tür links ist ein Automat. Aber ...“
Er hörte ihren letzten Einwurf nicht mehr, stapfte langsam, aber mit festen Schritten hinauf. Frau Zielińska schnäuzte sich lautstark. Sie war auf einen jener Plastikstühle niedergesunken, die eigentlich für Frau Ried bereitstanden. Frau Ried hatte es im Rücken und konnte nie lang stehen, nicht einmal die zwei Minuten, die es bedurfte, um Geld für Ansichtskarten von Frankfurt oder die zwei Euro Eintrittsgeld zu kassieren.
Frau Zielińska sprach jetzt wieder Deutsch. „Wie kann man so was mit Menschen machen“, sagte sie ein ums andere Mal. „Wie kann man so was nur machen ... grässlich zugerichtet ... die Hand ... das Blut ... so etwas noch nie gesehen ... wie kann man so was nur machen.“
3.
Der Beamte kam wieder zurück, ebenso langsam wie er gerade die drei Stufen hinauf gestapft war und mit noch missmutigerem Gesicht.
„Seid ihr wahnsinnig?“, fragte er.
Clara fuhr herum. „Bitte?“
„Ein Euro fünfzig für so 'ne künstliche Scheißbrühe, das kann doch nicht euer Ernst sein!“ Er schnaubte verächtlich. „Und jetzt?“, fragte er Clara.
„Was ... jetzt? Können Sie mir bitte endlich sagen ...“
„Wo kriege ich einen anständigen Kaffee her? Und danach habe ich ein paar Fragen an Sie.“
Was für ein ..., ging Clara durch den Kopf, aber sie brachte den Gedanken nicht zu Ende. Noch größer als der Ärger über diesen Idioten, war ihre Angst.
„Kommen Sie mit. Es gibt eine kleine Kaffeeküche.“
Die Ausstellungsräume sahen aus wie immer. Die Vitrinen, in denen sich Prunkkelche und Strahlenmonstranzen, liturgische Gewänder und Faksimile, Kruzifixe, Weihereliquiare und Siegel des ehemaligen Bartholomäusstiftes befanden, waren dunkel. Sie wurden ausschließlich während der Öffnungszeiten beleuchtet – ebenso wie diverse Heiligenstatuen, die Kreuzblume vom Frankfurter Dom oder die Gemälde, die an den Wänden hingen und von denen eine Mariendarstellung aus der Spätgotik, das älteste der Bilder, das Highlight darstellte. Die Tür zu ihrem Büro war verschlossen.
„Da können Sie jetzt nicht reingehen“, meinte der Mann, der ihr gefolgt war.
Als sie die Kaffeeküche erreicht hatte, merkte Clara, dass ihre Hände zitterten. Hartmann schmiss schwungvoll den noch vollen Kaffeebecher in den Müll. Kleine, braune Spritzer beschmutzen die weißen Fliesen.
„Das ist alles?“, fragte er. Clara folgte seinem Blick. In der Ecke stand eine verkalkte, altmodische Kaffeemaschine. Unter der Spüle befand sich zwar eine italienische Espressomaschine und ein Milchschäumer, mit denen sie sich manchmal einen Cappuccino machte, aber sie nickte, stellte sich unauffällig vor die Spüle und deutete Richtung Wandregal.
Hartmann öffnete es, zog eine Tüte mit Filter und eine Packung Eduscho hervor. Viel Pulver war nicht mehr drinnen, höchsten drei Kaffeelöffel. Er schüttete alles in den Filter, und als ihr der Kaffeeduft in die Nase stieg, begannen ihre Schläfen zu schmerzen.
Als er damit kämpfte, den Stecker der Kaffeemaschine in die Dose zu stecken, kämpfte sie gegen das Bedürfnis, ihm zu helfen.
Bei ihrem ersten Praktikum in einem Museum – damals hatte sie im dritten Semester Kunstgeschichte studiert –, war es neben Kopierarbeiten und Telefonate ihre wichtigste Aufgabe gewesen, Kaffee zu kochen. Ihr Chef hatte behauptet, dass niemand so eine gute Latte macchiato zaubern könnte wie sie. Clara war geschmeichelt gewesen, aber gelernt hatte sie während des Praktikums so gut wie gar nichts.
„Hauptkommissar Martin Hartmann“, knurrte der Mann, während er den Filter in den Behälter gab, eine Tasse aus dem Wandschrank holte, deren Henkel abgebrochen war, sie mit Wasser füllte und es in den Wassertank der Maschine.
„Machen Sie für mich auch eine Tasse!“, forderte Clara ihn auf.
Er hob die Brauen. „Haben Sie noch mehr Kaffee?“
„Nein.“
„Dann wird das aber 'ne schwache Plörre.“
Sie zuckte die Schultern, er kippte eine zweite Tasse Wasser in den Tank.
„Herr Hartmann ...“
„Hauptkommissar Hartmann. Und Sie sind Clara Mohr, habe ich das richtig im Kopf? Die Leiterin des Museums?“
„Es ist Nicholas.“ Es klang wie eine Feststellung, nicht wie eine Frage, auch wenn sie immer noch hoffte, sie würde sich irren.
Doch Hartmann bestätigte ihre Vermutung. „Wenn Sie Nicholas Roth meinen – dann ja. Der Name steht zumindest im Perso, den wie beim Toten gefunden haben. Sie kennen ihn also. Wie gut kennen Sie ihn?“
Clara fühlte, wie sämtliches Blut aus ihrem Gesicht wich. Kurz setzte ihr Zeitgefühl aus, sie wusste nicht, ob nur einige Sekunden oder eine ganze Minute vergangen waren, bis Hartmann seine Frage wiederholte: „Also – wie gut kennen ... kannten Sie ihn?“
„Er ist ein Bekannter ... ein Freund ...“, stammelte sie.
„Eher Bekannter oder eher Freund?“
„Wir haben an der gleichen Uni studiert.“
Sie hatte Nicholas etwa ein halbes Jahr nach besagtem Praktikum kennen gelernt. Sie arbeitete an einer Seminararbeit über das gleiche Thema, dem er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät seine Dissertation widmete – dem Lutherbild von Lucas Cranach dem Älteren. So waren sie ins Gespräch gekommen, und seitdem war Nicholas in regelmäßigen Abständen in ihrem Leben aufgetaucht, zuerst als Lehrer, dann, als sie ihr Studium abgeschlossen hatte und kurzzeitig an der Uni arbeitete, als Kollege. Nachdem sie geheiratet und ihren Job aufgegeben hatte, trafen sie sich weiterhin, nicht, weil sie ihn besonders mochte, sondern weil er sie an ein freies, ungebundenes Leben erinnerte, als sich die Yellow–Press noch keinen Deut um sie geschert hatte und sie noch kein Mitglied eines der größten Adelshäuser Deutschlands war. Und dann ... als ihre Ehe mit Philip zu kriseln begann ...
„Sie wussten also, dass er sich gestern Abend hier im Museum aufgehalten hat?“, fragte Kommissar Hartmann.
Clara schreckte aus ihren Gedanken hoch, fühlte sich ertappt. In der Kaffeemaschine begann es zu brodeln, erste dunkle Tropfen platschten in die gläserne Kanne. Ihre Haare tropften auch noch immer. Sie nahm ein Stück Küchenrolle und wischte über den Kopf und Nacken.
„Nicholas arbeitete die letzten Jahre in Berlin“, sagte sie. „In der Generaldirektion der Städtischen Museen. Aber demnächst wollte er nach Frankfurt umziehen, er ist der designierte Direktor des Städelmuseums. Wir haben uns am Nachmittag auf einen Kaffee getroffen, weil wir uns länger nicht mehr gesehen haben ... Und er hat gefragt, ob er am Abend eine Weile mein Büro benutzen kann.“
Kommissar Hartmann blickte hoch. „Ich verstehe Sie richtig: der künftige Direktor des Städelmuseums muss seine ehemalige Kollegin ... Bekannte ... Freundin um Hilfe bitten, damit er seine Emails checken kann? Hatte er denn kein I-Phone oder einen Laptop?“
„Es ging nicht nur um Emails. Er hat im Städel noch kein eigenes Büro, dort fängt er erst übernächsten Monat an. Er war hier in Frankfurt, weil er eine Wohnung suchte, für sich und seine ... Frau. Und seine beiden Söhne natürlich.“
„Er ist also verheiratet.“
Wieder fühlte sich Clara ertappt. Ja ... seit sie ihn kannte war da immer eine Ehefrau gewesen ...
Sie nickte. „Er wollte gestern in Ruhe an ein paar Sachen arbeiten. Und hier hatte er alles, was er brauchte: Faxgerät, Kopierer, Internetzugang, Telefon.“
„Das heißt, er konnte auf Kosten des Museums so viel telefonieren wie er wollte, obwohl er gar nicht hier arbeitet, sondern nur ein Freund von Ihnen ist.“
„Worauf wollen Sie hinaus? Dass ich meinen Arbeitgeber hintergehe?“
„Wer ist denn Ihr Arbeitgeber? Und wie schaut Ihre Tätigkeit genau aus?“
In der Kaffeemaschine brodelte es lauter als zuvor, dann verstummte sie plötzlich. Die Kanne war halb voll, als Hartmann sie wegzog, obwohl noch weiterer Kaffee durch den Filter tropfte. Es zischte, als ein Tropfen auf die heiße Platte fiel und dort verdampfte.
„Wie gesagt, ich ... ich bin Leiterin des Museums“, erklärte Clara, um rasch hinzuzufügen: „Das klingt nach mehr als es ist. Das Museum ist sehr klein ... sehr überschaubar, wie Sie gesehen haben, es gibt nicht so viel zu tun. Ich schreibe die Pressemeldungen, wenn es Veranstaltungen oder Sonderausstellungen gibt, ich mache manchmal auch Führungen, vor allem mit Schulklassen. Außerdem leite ich eine Arbeitsgruppe, bei der über die künftige Ausrichtung des Museums diskutiert wird. Zum Beispiel ob es auch zeitgenössische kirchliche Kunst zeigen soll. Oder ob es in ‚ars sacrale’ unbenannt werden soll, weil das moderner klingt. Manchmal planen wir auch Ausstellungen mit anderen Museen, zum Beispiel mit dem Liebighaus am Schaumainkai, dort gibt es eine große Skulpturensammlung. Ich kümmere mich auch um die Post ... genau betrachtet ist es nur eine halbe Stelle, die ich hier ausfülle.“
Clara redete immer schneller. Nicht, dass irgendetwas davon wichtig war. Aber so lange sie sprach, musste sie nicht hören, was mit Nicholas geschehen war.
Wie kann man so was nur machen ... grässlich zugerichtet ... die Hand ... das Blut ...
„Ich arbeite aber trotzdem Vollzeit“, fuhr sie fort. „Die übrige Zeit als Kunstexpertin des Bistum Limburgs. Das ist ein wenig kompliziert, weil Limburg ja das Museum und folglich auch meine Stelle als Leiterin hier finanziert.“
„Limburg?“ fragte Hartmann.
„Frankfurt gehört zum Bistum Limburg und nicht zum Bistum Mainz.“
„Aha.“ Hartmann sah weder so aus, als habe er das schon mal gehört, noch wüsste er überhaupt genau, was ein Bistum ist.
„Und was machen Sie so als ... Kunstexpertin? Wie wird man so etwas überhaupt?“
„Ich habe Kunstgeschichte studiert, und ein paar Semester lang Mediävistik ... also mittelalterliche Geschichte. Und Theologie. Mein Schwerpunkt war Sakrale Kunst des Spätmittelalters, darüber habe ich auch meine Dissertation geschrieben. Viele wertvolle Kunstgegenstände befinden sich im Besitz der Kirche. Angenommen, es fällt die Renovierung eines Triptychon ...“
„Eines was?“
„Ein Block aus drei Tafeln. Die Form ist typisch für gotische Altarbilder. In so einem Fall werde ich dann hinzugezogen, ermittle die Kosten, stelle Kontakt zu Restauratoren her. Falls auf dem Dachboden irgendeiner Pfarrei bei der Entrümpelung ein altes Bild oder eine Statue gefunden wird – das kommt gar nicht so selten vor –, werde ich hinzugezogen, um ein Gutachten zu schreiben, also dessen Wert festzustellen.“
Clara schenkte sich den restlichen Kaffee ein, es war nicht viel, er füllte kaum die Hälfte der Tasse aus. Sie nahm einen hastigen Schluck, er war stark und so heiß, dass sie sich ihre Zunge verbrannte. Erst jetzt hatte sie den Mut, selber eine Frage zu stellen.
„Können Sie mir sagen, was genau mit Nicholas passiert ist?“
„Wie es ausschaut ist er durch einen Kopfschuss getötet worden“, sagte Kommissar Hartmann. „Aber das ist leider nicht alles. Zuvor hat ihn der Täter ...“
Er brach ab.
„Ja?“
Hartmann lugte aus dem Fenster. „Die Spusi ist da. Ich fürchte, so bald werden Sie Ihr Büro nicht nutzen können.“
Anstatt seinen Kollegen entgegen zu gehen, trank Kommissar Hartman den Kaffee in raschen Zügen leer. Als er die Tasse mit einem lauten Knall auf die Anrichte stellte, zuckte Clara zusammen. Die Gedanken, in die sie versunken war, waren banal, schrecklich banal.
Jetzt muss das Städel einen neuen Direktor suchen. Dabei hätten sie kaum einen besseren als Nicholas finden können. Nicholas war der geeignete Mann für den Posten, das war von Anfang an klar. Zielstrebig und gutaussehend. Charmant, vor allem mit Frauen, aber nicht minder beinhart, wenn das zielführender war.
Sie selbst hatte er immer mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, ohne eine gewisse Distanz je abzulegen. Einmal hatte er behauptet, er wäre in sie verliebt, aber sie hatte gewusst, dass er mit solchen Gefühle nur kokettierte. Nicht nur wegen seiner Frau. Sondern weil er genaue Vorstellungen von seinem Leben hatte und jemand wie sie nicht in dieses Leben passte, zumindest nicht langfristig, höchstens mal für einen Café- oder Restaurantbesuch.
Ich wollte doch mit ihm ins „Oosten“ gehen, dachte sie plötzlich.
Das war ein Ausflugslokal auf dem Gelände der ehemaligen Ruhrorter Werft. Sie hatte gelesen, dass für das Interieur gebrauchte Materialien, die neu aufbereitet wurden - die Sessel auf der Terrasse waren aus altem Bootsholz aus Indonesien gebaut -, und als sie Nicholas davon erzählt hatte, war er genauso neugierig darauf gewesen wie sie. Jetzt, das wusste sie, würde sie sich wohl nie aufraffen, ins Oosten zu gehen, und sie war sich nicht sicher, wofür sie sich mehr schämte: Dass sie angesichts von Nicholas' Tod an etwas so Banales wie indonesische Bootsholzstühle dachte. Dass sie keine anderen Freunde hatten, die mit ihr Frankfurts Gastronomie erkundeten. Oder dass sie sich nicht aufraffen konnte, das allein zu tun.
„Wo waren Sie gestern Abend?“, fragte Kommissar Hartmann.
„Bin ich eine Tatverdächtige?“
„Sie haben zu diesem Museum doch jederzeit Zugang, oder? Ich schätze mal, dass es außerhalb der Öffnungszeiten abgeschlossen ist. Wer hat noch einen Schlüssel, wie viel Mitarbeiter gibt es?“
Wenn er das fragt, ging Clara durch den Kopf – sehr langsam, irgendwie zeitversetzt – dann gibt es keine Spuren eines gewaltsamen Einbruchs. Sie erinnerte sich, dass sie ihm einen Reserveschlüssel gegeben hatte, damit er später abschließen konnte.
„Pfarrer Berger ist der Kurator des Museums. Eigentlich ist er Pfarrer in der Gemeinde Sankt Andreas, deswegen hat er für das Museum kaum Zeit.“
Genau betrachtet ist er auch nicht oft in der Pfarrei, dachte sie.
„Frau Zielińska“, fuhr sie fort, „die kennen Sie schon, sie hat Nicholas ja gefunden. Und dann gibt es Frau Ried, sie arbeitet halbtags hier, das heißt, an den Tagen, an denen das Museum geöffnet sind. Ich kann Ihnen eine Liste mit allen Personen geben, die am Wochenende hier arbeiten – Frau Ried kümmert sich normalerweise darum. Sie ist außerdem für den Kartenverkauf und den Museumsladen zuständig. Manchmal springt sie bei den Führungen ein, wenn ich schon eine Gruppe habe.“
„Sie haben mir noch nicht gesagt, wo Sie gestern Abend waren.“
„Ich war bei meiner Schwägerin.“
Meiner Ex–Schwägerin, fügte sie im Stillen hinzu.
„Den ganzen Abend, bis etwa 23.00 Uhr“, fuhr sie fort. „Sie und ihr Mann werden das gerne bestätigen. Was genau ist denn nun mit ihm passiert? Kann ich ... kann ich ihn sehen?“
„Das geht während der Ermittlungen nicht. Außerdem würde ich mir das an Ihrer Stelle nicht antun, ist 'ne echte Schweinerei“, meinte Hartmann. Es klang gleichgültig, eher wie ein vorschriftsmäßiges „Betreten auf eigene Gefahr!“.
„Ich muss ihn sehen!“, wiederholte Clara nachdrücklich.
Hartmann zuckte die Schultern, ehe er die Männer der Spurensicherung empfing, die die Treppe hoch stürmte.
„Na endlich“, brummte er. „Noch schön ausgeschlafen vor Dienstbeginn? Wird Zeit, dass ihr endlich loslegt.“
Einer der Männer war im Türrahmen der Kaffeeküche stehen geblieben, sein Blick schweifte durch den Raum und blieb bei Hartmanns Kaffeetasse hängen. „Na großartig“, knurrte er. „Das nenne ich, sich am Tatort gemütlich machen. Du weißt aber schon, dass überall Spuren ...“
„Der Tatort ist nebenan, nicht hier“, unterbrach Hartmann ihn unbeeindruckt. „Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sich der Mörder hier erst 'nen Drink zubereitet hat, bevor er losschlug und dabei ein paar Fingerabdrücke hinterließ? Und außerdem ...“
Clara hörte nicht mehr auf seine Worte. Unauffällig war sie an Hartmann vorbeigeschlüpft, den Männern von der Spurensicherung einfach gefolgt.
Sie sah, wie der erste von ihnen langsam den Türknauf von ihrem Büro niederdrückte, auf der Schwelle kurz innehielt, den Raum schließlich betrat. Die anderen folgten, ohne auf Clara zu achten.
Sie atmete kräftig aus. Beim Ausatmen fühlt man weniger Schmerz, hieß es. Vielleicht hatte man beim Ausatmen auch weniger Angst. Sie wusste nicht, ob es half, ob es einen nennenswerten Unterschied gab, ob beim Einatmen dieses Unbehagen noch größer gewesen wäre – das Unbehagen bis zur Türschwelle vorzutreten, zu sehen, was sich dahinter verbarg. Es fühlte sich so an wie damals als Kind, als sie Urlaub bei den Großeltern machte und es eine Mutprobe war, in den finsteren Keller zu steigen, an dessen Decke eine flackernde Glühbirne baumelte und wirre Schatten warf. Überall standen Kisten mit verschrumpelten Äpfeln und Kartoffeln oder waren Regale mit grünlich–bräunlichen Plastikvorhängen verhängt. Obwohl ihre Großmutter gesagt hatte, dass dahinter Einmachgläser, Gemüse und Obst lagerten, hatte sie immer gedacht, dass dort tote oder, was noch schlimmer war, noch lebende Ratten lauerten.
Sie starrte auf ihren Schreibtisch, auf den Kalender, der dort stand, er hatte keinen einzigen Eintrag, ihre wenigen Termine merkte sie sich auswendig.
Wieder atmete sie langsam aus. Ihr Blick glitt weiter zum Drehsessel, auf den man einen Haufen geknüllter Kleidungsstücke geworfen hatte. Die Jacken der Polizisten, dachte sie, doch dann sah sie genauer hin und stellte fest, dass es Nicholas' Kleidung war: seine Jeans, sein weißes Hemd, seine schwarze Anzugjacke. Als sie gestern Kaffee getrunken hatte, hatte er sie abgelegt.
Warum haben die Beamten ihn denn ausgezogen?, dachte sie. Erst später, viel später, ging ihr auf, dass das nicht die Polizisten getan hatten, sondern der Mörder.
Ihr Blick glitt tiefer, sie presste die Augen zusammen, sodass sie alles nur durch einen schmalen Spalt sah. Irgendetwas Großes lag dort auf dem Fußboden, neben dem Schreibtisch, sie hätte einen Schritt vortreten müssen, um es genauer zu sehen, doch sie stand wie festverwurzelt.
Die Leiche, wahrscheinlich war es die Leiche. In ihrem Magen breitete sich ein merkwürdiges Kitzeln aus.
Einer der Männer erhob sich, gab den Blick auf etwas anderes frei, was auch auf dem dunkelbraunen Laminat–Fußboden lag. Dieses Ding war kleiner als die Leiche, und Clara riss unwillkürlich die Augen auf, um es besser zu erkennen. Wenn es so klein war, konnte sein Anblick doch nicht so schlimm sein.
Es war eine Hand.
Nicholas’ linke Hand.
Der Verlobungsring befand sich noch dran. Die Hand war zwischen Handgelenk und Ellenbogen abgetrennt, blutete nicht, zumindest jetzt nicht mehr; die Lake, in der sie lag, glich einem schwarzen, zähen Schleim. Clara durchstöberte ihr medizinisches Grundwissen, glaubte sich vage zu erinnern, dass solche Mengen an Blut ein Zeichen dafür waren, dass man das Gliedmaß schon vor dem Tod abgetrennt hatte.
Sie schluckte, und es schmeckte metallisch in ihrem Mund, obwohl sie das vertrocknete Blut doch nur sah, nicht roch. Es war nicht nur auf den Boden geflossen. Ihr Blick fiel auf die vormals noch weiße Wand, über die die roten Blutspritzer fast lächerlich akkurat einen halben Kreis zogen, als der Mörder Nicholas die Hand abgeschlagen hatte. Rasch starrte sie wieder auf diese Hand, als wäre ein Anblick erträglicher als der andere, obwohl beides ihre Übelkeit wachsen ließ.
Die Finger waren etwas verkrümmt, so, als würde Nicholas Klavierspielen, und die Kuppen waren bläulich verfärbt. Ansonsten sah die Hand nicht tot aus, sondern irgendwie noch ... warm.
Das Kitzeln in Claras Bauch verstärkte sich, ließ dann kurz nach, kam schließlich in Form eines Würgreflex wieder. Dennoch konnte sie nicht aufhören, auf die Hand zu starren, machte sogar noch einen Schritt nach vorne, um sie besser sehen zu können. Der Schnitt, mit dem sie abgetrennt worden war, war nicht glatt. Die Haut, diese bleiche, fast ins bläuliche gehende Haut sah wie ein abgerissener Stofffetzen aus. Sie konnte noch die Spuren von Adern sehen, die gerunzelten, im Sonnenlicht vertrockneten Würmern glichen. Etwas Weißes blitzte an der Schnittfläche hervor, vielleicht ein Knorpel, vielleicht der Knochen.
Jetzt wich Clara endlich zurück, betrachtete – ohne es zu wollen – auch den Leichnam, erkannte, was der Mörder mit diesem getan hatte. Dann erst drehte sich um, fühlte, dass es zu weit bis zu den Toiletten war und beugte sich über den weißen Abfalleimer, der im Gang stand.
Während sie würgte, fühlte sie Hartmanns Blick auf sich ruhen, abschätzig und irgendwie genervt. Er war ihr gefolgt, ohne dass sie es merkte, hatte jedoch nicht zu verhindern versucht, dass sie den Toten sah.
Noch peinlicher als vor ihm zu kotzen, war, kotzen zu wollen, aber es nicht zu können. Ihre letzte Mahlzeit – irgendein Tandoorigericht mit Linsen, das ihre Schwägerin ... Ex–Schwägerin Dora nicht selber gemacht, sondern beim Inder bestellt hatte – lag länger als zwölf Stunden zurück. Nur Speichel floss aus ihrem Mund, zäher, bitterer Speichel, und dann, als ihr die Kehle unendlich weh tat, eine bräunliche Masse.
Hartmann trat neben sie.
„'ne echte Schweinerei“, murmelte er und ließ offen, auf was er anspielte.
„Herrgott, Hartmann!“, rief der Mann von der Spurensicherung genervt. „Das ist ein Tatort, kein Scheißhaus! Schaff sie raus!“
Clara wusste nicht, ob er sie oder die Leiche meinte.
4.
Simon klopfte an die Schlafzimmertür. „Bist du wach?“
Die Antwort war ein unverständliches Murmeln. Er zögerte einzutreten, hielt die Türklinke eine Weile ratlos umklammert, ehe er sie niederdrückte.
Dora lag im Bett, mit einer Schlafmaske im Gesicht, die langen roten Haare um sich ausgebreitet. Die beige Satinbettwäsche bedeckte ihre Beine, der Oberkörper in einem dünnen Spitzenhemdchen lag frei.
Simon trat einen Schritt näher, er kam sich wie ein Eindringling vor.
„Dora ... bist du wach?“
„Was?“
Sie schreckte hoch, zog sich die Schlafmaske vom Gesicht, ihre Wimpern waren farblos, die Haut besonders um die Augen zerknittert. Er sah sie fast nie ungeschminkt, schon gar nicht mit ungetuschten Wimpern.
„Ich brauche das Auto, kannst du mit der Bahn fahren?“





























