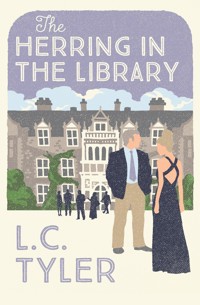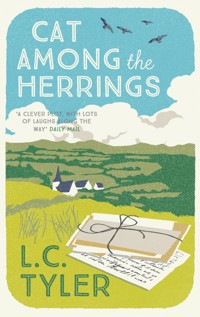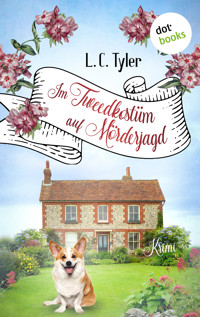
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ethelred Tressider
- Sprache: Deutsch
Er will seine Ruhe, sie will Pfundnoten sehen: der humorvolle Krimi »Im Tweedkostüm auf Mörderjagd« von L. C. Tyler jetzt als eBook bei dotbooks. Literaturagentin Elsie Thirkettle hat kaum noch Geduld für diesen Klienten: Der verschnarchte Autor Ethelred Tressider schreibt eher mittelmäßige Krimis, steckt in einer Midlife-Crisis – und leidet angeblich entsetzlich unter Elsies Ansprüchen. Doch die findige Literaturagentin lässt sich nicht lumpen: Wenn sie ihre Zeit schon für so einen Nichtsnutz aufopfert, statt entspannt am Kamin zu sitzen und heiße Schokolade zu schlürfen, soll er ihr nun endlich einen Erfolgsroman schreiben! Als Ethelreds Exfrau auf einmal spurlos verschwindet, kann Elsie ihr Glück kaum fassen: Das ist die perfekte Aufwärmübung für diese Schlafmütze von einem Autor – und sollte Ethelred dann plötzlich einem echten Killer gegenüberstehen, ist das ja nicht ihr Problem … Ein Cosy-Krimi für alle, die Mord, Schokolade und britischen Humor lieben! Jetzt als eBook kaufen und genießen: der humorvolle England-Krimi »Im Tweedkostüm auf Mörderjagd« von L. C. Tyler. Als hätten die Bestsellerautorinnen M. C. Beaton und Agatha Christie voller Vergnügen gemeinsam einen Krimi geschrieben. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Literaturagentin Elsie Thirkettle hat kaum noch Geduld für diesen Klienten: Der verschnarchte Autor Ethelred Tressider schreibt eher mittelmäßige Krimis, steckt in einer Midlife-Crisis – und leidet angeblich entsetzlich unter Elsies Ansprüchen. Doch die findige Literaturagentin lässt sich nicht lumpen: Wenn sie ihre Zeit schon für so einen Nichtsnutz aufopfert, statt entspannt am Kamin zu sitzen und heiße Schokolade zu schlürfen, soll er ihr nun endlich einen Erfolgsroman schreiben! Als Ethelreds Exfrau auf einmal spurlos verschwindet, kann Elsie ihr Glück kaum fassen: Das ist die perfekte Aufwärmübung für diese Schlafmütze von einem Autor – und sollte Ethelred dann plötzlich einem echten Killer gegenüberstehen, ist das ja nicht ihr Problem …
Ein Cosy-Krimi für alle, die Mord, Schokolade und britischen Humor lieben!
Über den Autor:
L. C. Tyler ist in Essex aufgewachsen und hat Geographie und Systemanalyse studiert. Als Angestellter des British Council reiste er nach Malaysia, Thailand, Dänemark und in den Sudan, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sein Krimi »Im Tweedkostüm auf Mörderjagd« war für den Edgar-Allan-Poe-Award nominiert. Heute lebt er mit seiner Familie in West Sussex.
Die Website des Autors: https://lctyler99.wixsite.com/mysite
***
eBook-Neuausgabe April 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »The Herring Seller’s Apprentice« bei Pan Macmillan, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2007 by L. C. Tyler
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Jackie Matthews / Savo Ilic / Jin Ah Kim / Anna Vershynina / javarman © pixabay / DarkmoonArt_de / AnnaliseArt
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-572-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Tweedkostüm auf Mörderjagd« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
L. C. Tyler
Im Tweedkostüm auf Mörderjagd
Krimi
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt
dotbooks.
Für Ann, Tom und Catrin
Mais il faux choisir: vivre or raconter.
J. P. Sartre
Anmerkung des Autors
Im wahren Leben kann man tatsächlich Schokolade (und viele andere nützliche Ding) bei Karen in der Findon Newsagency erstehen, und Peckham’s Spezialwürstchen (Celebration Sausages) gibt es beim Schlachter Tony zu kaufen. Von Catrin ist bekannt, dass sie Thistle gelegentlich im Nepote Green ausführt. Alle anderen Figuren des Buches sind frei erfunden.
Postskriptum
Sie haben das sicher auch schon erlebt: Gerade, wenn Ihnen das perfekte Verbrechen gelungen zu sein scheint, wendet sich gemeinerweise alles gegen Sie.
Mitten in der Nacht bereitete das Unheil verkündende Klingeln des Telefons der Stille von West Sussex und meiner Nachtruhe ein abruptes Ende. Ich nahm schnell ab und lauschte einer vertrauten Stimme, die sich um Ironie bemühte – was um ein Uhr nachts ebenso schwierig wie witzlos ist. Es handelte sich dabei auch nur um das Vorspiel zum eigentlichen Anlass des Anrufs. »Jetzt hast du dich endlich verraten. Ich weiß genau, was du da treibst, du Schwachkopf.«
»Das bezweifle ich«, gab ich zur Antwort. Ich blieb ziemlich gelassen. Kann sein, dass ich sogar gegähnt habe. Aber gelassen war ich auf alle Fälle.
»Ich weiß, mit wem du dich treffen willst.«
»Ach ja?«, erwiderte ich. »Wohl kaum.«
»Und ob. Ich verstehe nur nicht, wie du so lange davonkommen konntest.«
»Unverschämtes Glück«, gab ich zu. »Und die Tatsache, dass ich Schriftsteller bin und Kriminalromane schreibe. Das spielte eine große Rolle, vermute ich mal.«
Am anderen Ende war ein verächtliches Schnauben zu vernehmen, wodurch ich zu dem Schluss kam, dass ich diese Tatsache wahrhaftig zu meinem Vorteil nutzen könnte.
Denn so viele Ausweichmanöver und Halbwahrheiten es in den vergangenen Monaten – den langen Monaten zwischen meiner Rückkehr aus Frankreich und diesem überflüssigen nächtlichen Anruf – auch gegeben hatte, so hatte ich doch gerade eine unumstößliche Wahrheit geäußert: Ich war Schriftsteller.
Daran jedenfalls gab es keinerlei Zweifel.
Eins
Ich bin auch schon immer Schriftsteller gewesen.
Meinen ersten Roman verfasste ich mit sechs Jahren. Er war siebeneinhalb Seiten lang und handelte von einem Pinguin, der zufälligerweise meinen Namen trug, und einem weiblichen Igel, welcher zufälligerweise den Namen meiner Lehrerin trug. Nachdem die beiden einige kleinere Schwierigkeiten und Missverständnisse überwunden hatten, wurden sie Freunde und lebten glücklich bis an ihr Lebensende; naheliegenderweise war ihre Beziehung allerdings rein platonisch. In meinem damaligen Alter erschien mir die Liaison zwischen einem Pinguin und einer Igelfrau eine spannendere Handlung abzugeben als eine Liebesgeschichte zwischen Junge und Mädchen.
Daran hat sich über die Jahre wenig geändert. Heute bin ich drei Schriftsteller zugleich, ohne dass einer von uns dreien imstande wäre, über Sex zu schreiben.
Vielleicht liegt darin auch der Grund, dass keiner von uns dreien sonderlich erfolgreich ist. Zusammen erwirtschaften wir unseren Lebensunterhalt, aber wir schaffen es nicht auf die Bestsellerlisten der Sunday Times. Wir werden nicht zu Lesungen ins Bücherdorf Hay-on-Wye eingeladen. Das British Council schickt uns nicht auf Reisen in die südliche Sahara oder als Gastdozenten an die Universität Odense. Und wir bekommen keine renommierten Buchpreise.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen von uns dreien überhaupt gut leiden kann, aber als Peter Fielding habe ich mich jedenfalls immer am wohlsten gefühlt. Peter Fielding schreibt Kriminalromane, in denen der gefürchtete Sergeant Fairfax von der Kriminalpolizei Buckfordshire die Hauptrolle spielt. Fairfax ist Ende fünfzig und äußerst erbittert darüber, dass er nicht befördert wird und dass ich außerstande bin, ihm in irgendeiner Weise Sex zu erfinden. Als ich ihn vor sechzehn Jahren erschaffen habe, war er achtundfünfzig und gerade drauf und dran, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Er ist jetzt achtundfünfzigeinhalb und hat in diesem halben Jahr zwölf knifflige Fälle gelöst. Und er ist vermutlich im Recht, wenn er glaubt, dass man ihn unfairerweise übergangen hat.
Ferner schreibe ich unter dem Pseudonym J. R. Elliot historische Kriminalromane. Über das Geschlecht von J. R. Elliot bin ich mir nicht im Klaren, komme aber zusehends zu der Überzeugung, dass ich wohl eine Frau bin. Diese Romane spielen samt und sonders in der Zeit von Richard dem Zweiten, weil mir der Sinn nicht danach steht, weitere Epochen zu recherchieren. Dass zwischen 1377 und 1399 niemand Sex hatte, ist eine historisch unbezweifelbare Tatsache.
Als Amanda Collins fabriziere ich im Turnus von circa acht Monaten 150 Seiten starke, leicht lesbare Liebesromane. Stil und Handlungsschema sind jeweils vom Verlag vorgegeben. Miss Collins ist sehr beliebt bei Damen mit beschränkter Fantasie und beschränktem Horizont. Bei einer kurzen Recherche des Genres hatte ich festgestellt, dass die Helden der meisten Liebesromane Ärzte sind – meistenteils Hausärzte oder Herzchirurgen. Daher beschloss ich, meiner Hauptfigur das relativ unbekannte Fachgebiet der Mund-und-Kiefer-Chirurgie zuzuweisen. Mund-und-Kiefer-Chirurgen haben sehr häufig Sex, gelegentlich auch mit ihren Ehefrauen, wobei sich das jeweils sehr diskret abspielt. Diese Art Sex bevorzugen meine Leserinnen, und dasselbe kann ich von mir behaupten.
Wir drei Schriftsteller haben dieselbe Agentin: Ms. Elsie Thirkettle. Sie ist die einzige mir bekannte Frau unter siebzig, die den Vornamen Elsie trägt. Da dieser Name zweifellos sehr verstaubt klingt und Elsie ihn auch nicht sonderlich zu schätzen scheint, fragte ich sie einmal, wieso sie nicht ihren zweiten Vornamen benutze.
Daraufhin hatte sie mich angesehen, als wäre ich ein schwachsinniger Junge, zu dessen Betreuung sie von niederträchtigen Nachbarn überlistet worden wäre. »Sehe ich etwa aus wie eine verblödete Yvette?«
»Aber warum haben deine Eltern dich Elsie genannt, Elsie?«
»Sie konnten mich nicht leiden. Dämliche Volltrottel, alle beide.«
Meine Eltern konnten mich offenbar auch nicht leiden. Sie gaben mir den Namen Ethelred. Die Beteuerung meines Vaters, dass sie mich nach König Ethelred dem Ersten (866-871) und nicht nach Ethelred dem Unfertigen (978-1016) benannt hatten, war wenig tröstlich für einen Siebenjährigen, der von seinen Freunden nur »Ethel« gerufen wurde. Eine Weile unternahm ich den Versuch, mich als »Red« vorzustellen, doch aus irgendeinem Grund konnte sich dieses Kürzel bei meinen Bekannten nicht durchsetzen. Ach ja, und mein zweiter Vorname lautet »Hengist«, falls Sie sich vielleicht gerade danach erkundigen wollten. Ethelred Hengist Tressider. Niemand hat sich je darüber gewundert, dass ich es vorziehe, Amanda Collins zu sein.
Es ist durchaus möglich, dass Agenten ihre Autoren generell verachten, so wie Schulfinanzverwalter Rektoren verachten, wie Köche Oberkellner und wie Verkäufer ihre Kunden. Allerdings verachten nur wenige Agenten ihre Autoren so unverhohlen wie Elsie.
»Autoren? Die kriegen doch nicht mal einen Furz zustande, ohne dass ihre Agenten ihnen zeigen, wo ihr Arsch sitzt.«
Derartigen Bemerkungen pflege ich nur selten zu widersprechen. In Anbetracht der anderen Autoren von Elsie sind solche Äußerungen auch nicht von der Hand zu weisen. Die meisten von denen würden selbigen Furz wohl nicht mal mit dieser wohlmeinenden Hilfestellung zustande bringen.
Elsie vertritt tatsächlich außer uns dreien noch eine erkleckliche Anzahl anderer Autoren. Gelegentlich fragen wir uns, warum wir uns auf diese laute, dralle, exzentrisch gekleidete kleine Frau eingelassen haben, die behauptet, weder an Literatur noch an Schriftstellern Gefallen zu finden. Hat sie diesen Haufen besonders charakterschwacher Individuen, denen es weder gelingt, ihr Kontra zu geben, noch sich von ihr zu trennen, womöglich vorsätzlich um sich geschart? Oder genießen wir es insgeheim alle, wie sie unsere Arbeit und unsere Figuren misshandelt? Es gibt keine überzeugende Antwort auf diese Frage. Denn der wirkliche Grund ist höchst unangenehm, liegt aber auf der Hand: Keiner von uns ist sonderlich gut, aber Elsie verkauft unsere Manuskripte erfolgreich. Ferner ist sie sehr aufrichtig in ihrer Beurteilung unserer Arbeit:
»Das ist Scheiße.«
»Könntest du das vielleicht präzisieren?«
»Es ist Hundescheiße.«
»Ah ja.« Ich befingerte das Manuskript, das zwischen uns auf dem Tisch lag. Es war nur die erste Fassung der ersten Kapitel, aber ich hatte mich der Hoffnung hingegeben, dass es weltweit als Meisterwerk gefeiert würde.
»Überlass den literarischen Kriminalroman der verblödeten Barbara Vine. Du kannst so was nicht schreiben. Sie schon. Oder, anders ausgedrückt: Sie kann es und du nicht. Ist dir das präzise genug, oder soll ich’s dir mit Kreuzstich auf eine Teehaube sticken?«
»Ich habe schon ziemlich viel Arbeit reingesteckt in dieses Manuskript.«
»Nein, hast du nicht, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte«, entgegnete Elsie liebenswürdig.
»Aber ich war grade drei Wochen in Frankreich und hab für das verdammte Ding recherchiert.«
»Ist ja nichts verloren. Dann schick eben Fairfax nach Frankreich. Das arme Schwein hat wirklich mal Urlaub verdient. Wobei sich natürlich die Frage stellt, ob Frankreich der richtige Ort für ihn wäre. Er scheint ja wenig Interessen zu haben außer seinen Ermittlungen, anglonormannischen Taufbecken und Regionalgeschichte.«
»Er ist cracksüchtig, Transvestit und hat ’66 in der Fußball-WM für Deutschland gespielt. Das ahnen meine werten Leser noch nicht, aber das wird alles im nächsten Buch enthüllt.«
»Das lässt du lieber bleiben. Deine werten Leser nehmen diesen abgeratzten Fairfax bitterernst und haben nichts übrig für Ironie. Mit Sergeant Fairfax verdienst du deine Brötchen, und zwölfeinhalb Prozent von diesen Brötchen gehören mir. Wenn Fairfax jetzt neuerdings scharf auf Netzstrümpfe ist, dann schick ihn zu mir, ich rück ihm den Kopf schon zurecht.«
Auch das entsprach der Wahrheit. In dieser Hinsicht kannte Elsie keine Gnade. Einmal war ich auf die Idee gekommen, dass Fairfax die Musik von Berlioz schätzen könnte (da hatte ich wohl gerade zu viel Colin Dexter gelesen). Mit dem Ergebnis, dass Elsie schon mit dem Rotstift durch gewesen war, bevor man »Morse« sagen konnte. »Mach dir nicht die Mühe, die Figur auszuarbeiten«, hatte sie gesagt. »Deine Leser haben kein Interesse an persönlichen Details. Sie interessieren sich nicht für Atmosphäre. Und von geistreichen literarischen Anspielungen wollen sie nichts wissen. Was Metaphern angeht, wissen sie nicht, ob sie die in Butter braten oder auf ihre Hämorrhoiden schmieren sollen. Sie wollen nur kurz vor der letzten Seite selbst auf die Idee kommen, wer der Täter ist. Und gib ihnen nicht mehr als zehn Verdächtige, sonst müssen sie ihre Schuhe ausziehen, um sie zu zählen.«
Vielleicht sollte ich auch erwähnen, dass Elsie nur eines noch mehr verachtet als ihre Autoren: und zwar die Leute, die bescheuert genug sind, unsere Bücher zu kaufen. Doch auch in diesem Punkt könnte ich ihr nicht mit Überzeugung widersprechen.
Um ehrlich zu sein: Zurzeit widerspreche ich Elsie ohnehin nur äußerst selten. Deshalb wusste ich auch an jenem Abend vor vielen Monaten, als wir in meiner Wohnung beisammensaßen, dass diese erste Fassung des Buchs auch genau das bleiben würde: eine erste Fassung. Aber einen Versuch wollte ich doch noch unternehmen.
»Du könntest das Manuskript mit nach London nehmen und in Ruhe lesen«, schlug ich vor.
»Das Problem liegt nicht in meiner Art zu lesen«, erwiderte sie bissig, »und mein Papierkorb in London ist bereits voll, schönen Dank auch. Weißt du, wie viele Scheißromane es da draußen gibt?«
»Nein«, antwortete ich kleinlaut, da ich sie nie gezählt hatte.
»Zu viele«, bemerkte Elsie, die über die genaue Anzahl auch nicht im Bilde war, aber ihre Meinung wie immer vehementer zu vertreten vermochte als ich. »Und, wie war die Frankreich-Reise?«
Ich seufzte. »Unter literarischen Gesichtspunkten offenbar vollkommen überflüssig, ansonsten aber sehr erfreulich. Ich habe in einem charmanten kleinen Hotel gewohnt. Ich habe an der Loire gesessen und den einheimischen Wein getrunken – vor allem Chinon, aber auch Bourgeuil. Habe ungemein authentische Atmosphäre erlebt. Die Sonne schien, und die Vögel haben gezwitschert. Und ich habe niemanden getroffen, der meine Bücher kannte. Es war paradiesisch.«
»Nützliche Recherche.«
Ich hörte die Ironie heraus – was nicht schwerfällt, da Elsie und Subtilität so gar nicht zusammenpassen wollen. »Meine Figuren sollten ziemlich viel Zeit damit zubringen, an der Loire zu sitzen und Wein zu trinken«, sagte ich. »Ich lege großen Wert auf präzise Beschreibungen. Ich musste das intensiv recherchieren.«
»Humbug. Hattest du Sex mit jemandem?«
»Nee.«
»Ich dachte, die Franzosen vögeln alles, was nicht rechtzeitig auf den Bäumen ist.«
»Nicht in Châteauneuf-sur-Loire. Die Laster in all ihren Spielarten werden wohl in Plessis-les-Tours oder in Amboise praktiziert, aber da war ich nicht.«
»Dann begib dich doch bitte beim nächsten Mal nach Amboise. Amüsier dich. Lass dich verführen. Und beschreib das in deinem nächsten Buch.«
»Das geht nicht. Wie du weißt, schreibe ich keine Sexszenen. Außerdem bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass ich mich jemals wirklich amüsiert habe.«
»Hat deine Frau dich deshalb verlassen?«
»Meine Exfrau«, erwiderte ich. »Um ganz präzise zu sein, meine Exfrau. Geraldine und ich verstanden uns in einigen Punkten nicht sehr gut.«
»Vor allem in dem Punkt, dass sie mit deinem besten Freund gevögelt hat.«
»Exbester Freund«, sagte ich. »Er ist mein exbester Freund.«
»Und dann hat die Kuh dich verlassen.«
»Das hört sich aus deinem Mund so lieblos und abrupt an. Sie ist immerhin noch lange genug dageblieben, um mir eine ergreifende Nachricht zu schreiben.«
»Na gut, sie ist eine halbwegs gebildete Kuh«, räumte Elsie großzügig ein. Manchmal kann sie gerecht sein, wenn auch eher selten. »Ist sie immer noch mit dem temperamentlosen Schönling zusammen?«
»Rupert? Nee, den hat sie schon vor einer Weile verlassen.«
Elsie verengte die Augen. »Du scheinst deutlich besser informiert zu sein, als du das sein solltest, Tressider. Nun sag mir bloß nicht, dass du zu der alten Schlampe immer noch Kontakt hast.«
»Das muss ich von irgendwem gehört haben. Wieso sollte ich noch Kontakt zu ihr halten?«
»Weil du ein Idiot bist, deshalb. Ich hätte angenommen, dass du wenigstens so viel Verstand besitzt, einen weiten Bogen um sie zu machen. Normale Leute in deiner Lage – wobei ich es bei meinem Beruf tatsächlich mit wenig normalen Leuten zu tun habe – kappen sämtliche Bande zu ihren Expartnern. Eine Wachspuppe herstellen und Nadeln reinstecken soll auch äußerst wirkungsvoll sein. Ich kann dir gerne ein bisschen Wachs besorgen. Auf dem Markt ist immer so ein Nigerianer, der verkauft auch gleich die Nadeln dazu.«
»Ich finde schon, dass man mit einem früheren Partner befreundet sein kann«, wandte ich ein. »Irgendetwas muss Geraldine und mich schließlich auch verbunden haben. Wir hatten einige glückliche Jahre miteinander – wobei ich einräumen muss, dass sie gleichzeitig auch glückliche Jahre mit einem anderen hatte. Aber das Leben ist zu kurz, um nachtragend zu sein.«
»Okay, Ethelred, hör sofort auf, bevor mir das Kotzen kommt. Du kannst einfach nicht anständig hassen, das ist dein Problem. Hör auf, nett zu sein, und sag, du wünschst dir, dass sie in der Hölle schmort. Ich behaupte ja nicht, dass du das im Alleingang erledigen musst. Geraldine verfügt über ein außergewöhnliches Talent, sich Feinde zu machen, und es gibt bestimmt jede Menge Leute, die sich inständig wünschen, dass sie eines frühen und möglichst abscheulichen Todes sterben möge. Aber sollte sie jemals ermordet werden, dann denk dran, dass es dein gutes Recht ist, Hauptverdächtiger zu sein.«
»Das wird wohl eher nicht eintreten«, erwiderte ich.
Es klingelte an der Haustür.
Ein Polizist stand davor.
Er lächelte entschuldigend.
»Ich habe keine guten Nachrichten, Sir«, sagte er. »Es geht um Ihre Frau. Dürfte ich reinkommen?«
Zwei
Eigentlich mag ich Polizisten.
Ich bin keiner dieser Autoren, die über dusselige, unfähige Schnüffler schreiben, die Hilfe von aufgeweckten Amateurdetektiven in Anspruch nehmen müssen. Warum auch? Den Amateurdetektiv hat es nie gegeben. Ich bin noch in keinem einzigen realen Fall einer alten Jungfer begegnet, die in St. Mary Mead lebt und der Polizei auch nur im Geringsten nützlich sein konnte (und ich habe mich mit vielen beschäftigt). Echte Fälle aus dem wahren Leben werden nicht durch genialische Einfälle gelöst, sondern durch eine Vielzahl von Leuten, die eine ungeheure Menge Informationen sammeln und sichten. Verbrecher fängt man, indem man sich von Haus zu Haus durchfragt und stundenlang mühsam die Bilder von Überwachungskameras überprüft. Oder man hat Schwein, und ein wohlmeinender Komplize fängt an zu plaudern. Meiner Erfahrung nach machen sich Polizisten eher selten die Mühe, sämtliche Verdächtige im Wohnzimmer eines Landsitzes zu versammeln, um dann zu verkünden, wer der Täter war.
Doch es gibt freilich die altehrwürdige und äußerst englische Tradition des Gentleman-Detektivs (der auch eine Dame sein kann), von Sherlock Holmes über Lord Peter Wimsey und Miss Marple bis zu Bruder Cadfael. Ich mache nur ungern etwas schlecht, womit aufrechte Schriftsteller ihren Lebensunterhalt verdienen, aber ehrlich gesagt, ist das alles ein Haufen blödsinniger Unfug. In meinen Romanen werden Morde wie im wirklichen Leben von der Polizei aufgedeckt, und Privatleute übernehmen die Rolle, ermordet zu werden. An den Sergeant-Fairfax-Romanen kann man vielerlei auszusetzen haben, aber man kann ihnen nicht den Vorwurf machen, dass sie den Mythos des Amateurdetektivs am Leben erhielten.
Auf meiner Schwelle stand jetzt jedenfalls kein fiktiver Sergeant Fairfax aus Buckford. Sondern ein waschechter Polizist aus West Sussex.
»Kommen Sie doch rein«, sagte ich.
Die heikle Frage, ob Elsie Zeugin eines möglicherweise peinlichen Verhörs werden sollte, war schnell geklärt.
»Macht ihr beide nur, ich störe euch nicht«, verkündete sie und lehnte sich im Sessel zurück, die Arme trotzig verschränkt, damit auch keiner von uns beiden auf die Idee kommen konnte, sie auszuschließen. Ich schaute den Polizisten an, der Polizist schaute mich an. Wir identifizierten uns gegenseitig zutreffenderweise als Feiglinge und versuchten die Sache so rasch wie möglich hinter uns zu bringen.
Der Polizist gab ein offizielles Hüsteln von sich, das auch Elsie galt, und sagte: »Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Frau verschwunden ist.«
»Meine Exfrau. Wir sind seit mehreren Jahren geschieden.«
»Ihre Exfrau, natürlich. Gegenwärtig ist sie nur als vermisst gemeldet. Ich bedaure, Ihnen das so unumwunden mitteilen zu müssen, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass sie Selbstmord begangen hat.«
Ich nahm das alles bemerkenswert gefasst auf.
»Das ist gewiss sehr tragisch«, sagte ich, »aber ich wüsste nicht, was das nach all den Jahren noch mit mir zu tun hätte.«
»Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen, Sir?«
»Meine Exfrau?«
»Ihre Exfrau, ja.«
»Das weiß ich nicht mehr genau.«
»Haben Sie sie innerhalb der letzten zwei Wochen gesehen?«
»Ich war drei Wochen in Frankreich, Officer, und bin erst vorgestern Abend zurückgekommen.«
Er vermerkte das in einem kleinen Notizbuch.
»Ich war in Châteauneuf-sur-Loire«, sagte ich. »Soll ich das für Sie buchstabieren?«
Er hob das Notizbuch etwas an, damit ich nicht sehen konnte, was er geschrieben hatte. »Das ist nicht nötig«, erwiderte er mit einer Spur Verachtung für das gemeine Volk, die Fairfax auf jeden Fall goutiert hätte. »Können Sie mir sagen, ob es einen Grund gab, der Ihre Frau dazu veranlasst haben könnte, Selbstmord zu begehen?«
»Mit Sicherheit kann ich nichts behaupten, aber einige triftige Gründe kommen mir schon in den Sinn. Sie hat chronische Geldprobleme: Ihre erste Firma ging etwa zu der Zeit bankrott, als wir uns getrennt haben. Danach hat sie mit ihrer Schwester eine weitere Firma gegründet, aber ich meine gehört zu haben, dass es auch um die nicht gut bestellt war. Und sie hat eine langjährige Beziehung beendet.«
»Der Partner war ...?«
»Rupert Mackinnon. Sie muss an die zehn Jahre mit ihm zusammen gewesen sein. Seine gegenwärtige Adresse kenne ich nicht.«
Er notierte diese Details kommentarlos.
»Tut mir leid«, schloss ich, »aber ich fürchte, das ist alles, womit ich dienen kann.« Ich erhob mich, um ihn hinauszubegleiten.
Er blieb jedoch sitzen.
»Wir hatten gehofft, dass Sie uns noch etwas mehr mitteilen könnten, Sir. Sehen Sie, Mrs. Tressider hat vor ihrem Verschwinden etwas in ihrem Auto hinterlassen, das wir als Abschiedsbrief deuten würden.«
Ich nickte. »Und?«
»Der Wagen war ganz in der Nähe abgestellt – in West Wittering am Strand.«
Ich setzte mich wieder. »Heiliger Strohsack.«
»Könnte man so sagen. Es ist eine ziemlich weite Strecke von North London aus, um hier Selbstmord zu begehen. Ich meine, es könnte natürlich ein Zufall sein, dass Sie in West Sussex leben und dass Ihre Exfrau diesen Abschiedsbrief in West Sussex hinterließ. Doch Sie werden gewiss verstehen, dass uns das zu denken gibt und absonderlich vorkommt, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Mir gab es ebenfalls zu denken, auch wenn mir die Vokabel »absonderlich« dabei nicht als Erstes eingefallen wäre.
»Sie hat nie hier in der Gegend gewohnt, nicht wahr?«, fuhr der Polizist fort, als wollte er mich auf einen interessanten Punkt hinsichtlich meiner Lebensverhältnisse hinweisen. Er verengte die Augen und ließ eine vage Anschuldigung in der Luft hängen, die mir durchaus nicht behagte.
»Nein, ich bin nach unserer Trennung allein hierher gezogen.«
»Das ist der Brief.«
Er zeigte mir die Kopie eines Blattes, bei dem es sich eindeutig um Briefpapier mit Briefkopf handelte. Der obere Rand war unsauber abgerissen worden, so dass ein paar Buchstaben der Adresse zurückgeblieben waren, darunter »NI«. Die restlichen Bruchstücke davor und danach konnte man nur entziffern, wenn man die Adresse kannte. Was auf mich zutraf.
»Ihre Frau wohnte im Postbezirk NI in London?« Er zog streng eine Augenbraue in die Höhe.
»Ja. In der Barnsbury Street in Islington.«
»Es scheint sich also um ihr eigenes Briefpapier zu handeln. Aber wir können uns nicht erklären, warum sie den Briefkopf auf diese Weise abgerissen hat. Und ihre Ausdrucksweise ist auch ziemlich merkwürdig.«
Mit zunehmender Beklommenheit nahm ich den Brief entgegen und las ihn. Er war in verschnörkelten Großbuchstaben geschrieben.
AN DEN FINDER DIESES BRIEFES.
SEHR GEEHRTER HERR ODER SEHR GEEHRTE DAME.
MIR REICHT ES. WENN SIE DIES LESEN,
BIN ICH SCHON AN EINEM BESSEREN ORT.
LEBE WOHL, SCHNÖDE WELT USW.
MIT HERZLICHEN GRÜSSEN
G. TRESSIDER (MRS.)
»Ich meine«, äußerte der Polizist, »niemand schreibt ›LEBE WOHL, SCHNÖDE WELT‹ in einem Abschiedsbrief, oder? So was kommt doch nicht mal in Kriminalromanen vor, um Himmels willen.« Er schniefte verächtlich.
Ich habe schon schlimmere Klischees in der Kriminalliteratur gelesen (und selbst geschrieben), aber vielleicht las er nur P. D. James und hatte einen höheren Anspruch als ich. »Tut mir leid, Officer«, sagte ich. »Nach dieser kurzen Lektüre fühle ich mich nicht befähigt, über die Wortwahl zu spekulieren. Dieser Brief lag in ihrem Wagen, sagen Sie?«
»Richtig. In einem roten Fiat.«
Ich muss wohl verblüfft ausgesehen haben, denn er fügte rasch hinzu: »Es war ein Mietwagen, nicht ihr eigener. Sie hatte ihn ein paar Tage, bevor er gefunden wurde, am Flughafen Gatwick gemietet. Für eine Woche, bezahlt mit ihrer Kreditkarte. Am selben Tag muss sie damit nach West Wittering gefahren sein, den Brief hinterlassen haben und dann ...« Er stockte. »Nun ja, wir wissen natürlich nicht, was dann passiert ist. Sie sind gewiss darüber im Bilde, dass man eine Gebühr bezahlen muss, wenn man seinen Wagen am Strand parkt. Um diese Jahreszeit werden die Zufahrten um halb neun Uhr mit einer Schranke verschlossen. Als der Wachmann am Dienstag seine letzte Runde drehte, fiel ihm der Wagen auf. Es stehen immer mal wieder Autos am Strand, wenn Leute einen Spaziergang gemacht und die Zeit vergessen haben. Wenn man nach halb neun noch rausgelassen werden möchte, muss man eine Strafe zahlen. Aber eigentlich sind die meisten spätestens bis Mitternacht verschwunden. Als der Wachmann am nächsten Abend seine Runde machte, war der Wagen immer noch da. Übrigens nagelneu, mit nur 500 Kilometern auf dem Zähler, nicht irgend so eine alte Schüssel, wie man sie hier ständig sieht. Deshalb hat er mal einen näheren Blick drauf geworfen und dabei diesen Brief auf dem Fahrersitz entdeckt. Sonst war nichts im Auto – nur der Brief und die Hertz-Papiere. Da hat er uns angerufen. Wir haben dann festgestellt, dass Ihre Frau seit einem Tag oder so nicht zu Hause gewesen war, aber ihre Nachbarn haben sich erinnert, dass Sie hier herunter gezogen sind, in die Nähe der Witterings.«
»Ich bin den Nachbarn ungemein dankbar«, erwiderte ich, »dass sie Ihnen diese wichtige Information geben konnten. Dennoch möchte ich Ihnen vor Augen halten, dass man nach West Wittering mindestens eine Dreiviertelstunde fährt, selbst wenn man nicht bei Arundel im Stau steht.«
»Verdammte Umgehungsstraße«, bestätigte er mit einem Nicken. Dann saugte er an einem Zahn und fügte schließlich hinzu: »Sie wissen auch nicht zufällig, wo sich das eigentliche Auto Ihrer Frau befinden könnte, Sir?«
»Nein. Keine Ahnung. Was für einen Wagen fährt sie denn inzwischen?«
»Ein Saab-Kabrio. Metallicschwarz mit Alufelgen. Schnittige Autos, diese Saabs. Gute Kurvenlage. Anständige Beschleunigung. Der ist eben auch verschwunden, wissen Sie. Taucht aber vielleicht wieder auf. Könnte auch in der Werkstatt sein. Vielleicht hat sie sich deshalb einen Mietwagen genommen.«
Er stellte mir noch ein paar Fragen, da er sich wohl verpflichtet fühlte, die Sache im Sinne der Steuerzahler von West Sussex gründlich zu untersuchen. Aber ich konnte ihm wenig Nützliches berichten außer der Tatsache, dass ich länger nichts von Geraldine gehört hatte und weder wusste, wo sie sich aufhielt, noch weshalb sie einen neuen Mietwagen an einem Strand in Sussex geparkt hatte und dann verschwunden war.
»Also«, sagte Elsie, nachdem der Polizist gegangen war, »was würde sich Fairfax wohl dabei denken, hm? Eine Frau verschwindet unweit vom Wohnort ihres Exgatten. In einem Auto, das sie offenbar nur zu diesem Zweck gemietet hat, hinterlässt sie einen kryptischen Abschiedsbrief, der in Großbuchstaben und nicht in ihrer normalen Handschrift geschrieben ist.«
»Am letzten Dienstag war ihr Exmann in Châteauneuf-sur-Loire damit beschäftigt, keinen Sex zu haben, sehr weit entfernt von dem Ort, an dem die Frau verschwunden ist.«
»Aber warum sollte sich jemand einen Mietwagen nehmen, um darin Selbstmord zu begehen?«, fragte Elsie mit dem typischen Blick des Literaturagenten für dramatischen Handlungsaufbau. »Das kann man auch in seinem eigenen Auto erledigen. Ist wesentlich billiger.«
»Du hast doch gehört, was der Polizist gesagt hat: Vielleicht war ihr eigener Wagen in der Werkstatt oder so.«
»Wieso soll man seinen Wagen in die Werkstatt bringen, wenn man vorhat sich umzubringen?«
Diese Frage lag nahe, und ich wünschte mir, Geraldine wäre zur Stelle, um sie zu beantworten. Ich war drauf und dran, mir eine Antwort aus den Fingern zu saugen, als Elsie beschloss, ihre Frage selbst zu beantworten.
»Ich habe drei Theorien«, sagte sie und zählte selbige an ihren dicken Fingern ab. »Theorie Nummer eins, ja? Sie hat sich tatsächlich selbst abgemurkst, und zwar in Sussex, um dir möglichst viel Stress zu machen. Damit wäre das verschwundene Auto nicht erklärt, darauf bin ich aber auch nicht sonderlich scharf. Deshalb hier also Theorie Nummer zwei: Sie hat sich nicht selbst abgemurkst, sondern hockt quicklebendig in irgendeinem Pub und lacht sich eins.«
»Warum sollte sie das tun?«
»Woher soll ich das wissen? Vielleicht hat sie den Selbstmord vorgetäuscht und ist abgehauen, um ihre Gläubiger loszuwerden. Oder vielleicht wollte sie sich mal so richtig schlapplachen.«
»Gut, sie hat sich umgebracht, oder sie hat sich nicht umgebracht«, merkte ich an. »Das sind trotzdem erst zwei Theorien.«
»Ich war noch nicht fertig«, erwiderte Elsie und schwenkte erhaben ihr fettes Händchen. »Gegenwärtig bin ich der Ermittler. Und du bist bestenfalls der Verdächtige.«
»Verzeihung«, sagte der Verdächtige.
»Theorie Nummer drei: Vielleicht hat sie jemand umgebracht und dafür gesorgt, dass es nach Selbstmord aussieht.«
»Das wäre möglich«, sagte ich mit einem kleinen, wohlkalkulierten Achselzucken.
»Nein, eben nicht – es handelt sich nur um Wunschdenken«, entgegnete Elsie mit einem tiefen Seufzer. »Diese ganzen kleinen Details und Kniffe sind Geraldine, wie sie im Buche steht. Nimm doch nur mal diesen verschwundenen Wagen mit seinen Alufelgen: Niemand außer Geraldine würde sich die Mühe machen, Autos auszutauschen. Und dann dieser Brief: ›Bin ich schon an einem besseren Ort.‹ Darauf möchte ich wetten. Sie ist abgehauen. Dass sie tot ist, glaube ich erst, wenn ich die Leiche sehe – und vermutlich nicht mal dann.«
»Kann sein, dass nie eine Leiche gefunden wird«, gab ich zu bedenken und führte die Debatte damit zurück zur Selbstmordtheorie. »Die Strömungen am Strand sind ziemlich stark. Vielleicht ist sie in den Kanal rausgezogen worden.«
»Nur wenn sie’s fertiggebracht hat, ins Wasser zu gehen«, sagte Elsie und starrte aus dem Fenster auf die Häuser im Zwielicht. »Und darauf weist im Augenblick gar nichts hin. Ich würde eine ziemlich fette Wette eingehen, dass sie immer noch irgendwo da draußen ist, im Warmen und Trockenen, und das Geld von jemand anderem ausgibt.« Sie schien dabei das Fleischergeschäft Peckham’s direkt gegenüber zu fixieren, aber dort konnte man nicht Geraldine sehen, wie sie von ihrer ergaunerten Beute entfesselt Koteletts und Peckham’s Spezialwürstchen einkaufte – sondern lediglich Tony, der tüchtig den Laden fegte und putzte, bevor er Feierabend machte.
Es war eine friedliche Szenerie: eine kleine Ortschaft in Sussex in der Abenddämmerung des Frühherbstes. Schieferhäuser mit anheimelnd bemoosten Dächern, ein Pub mehr als dringend notwendig, ein Postamt und ein indischer Imbiss; das alles eingebettet in die sanften Hänge der South Downs. Für die meisten Bewohner des Örtchens folgte nun auf einen ereignislosen Tag eine weitere friedliche Nacht. Der Verkehr nach Worthing auf der Umgehungsstraße machte sich hier nur mit einem fernen Brummen bemerkbar. Einige Vögel hatten durchaus zutreffend beschlossen, dass es Zeit war für ihren Abendgesang. Alles war so, wie es sein sollte. Dies war schließlich ein Ort, an den sich Rentiers aus London zurückzogen, um hier in Ruhe alt zu werden und eines Tages friedlich im Bett zu sterben – und kein Ort für bizarre Selbstmorde in nagelneuen roten Fiats.
»Hör zu«, sagte ich, »ich finde, wir sollten das der Polizei überlassen. Zum Glück ist es deren Job, meine Frau zu finden, tot oder lebendig. Ich bin zwar wie du der Meinung, dass Geraldine durchaus imstande wäre, aus reinem Spaß an der Freude einen Selbstmord vorzutäuschen. Aber ich möchte meine Frau der Polizei überlassen.«
»Deine Exfrau«, entgegnete Elsie.
»Meine Exfrau«, sagte ich.
Drei
Anfangs war Schreiben das reine Vergnügen. Es war Elsie, die mir dann im Handumdrehen beibrachte, dass es ebenso gut stumpfsinnige Mühsal sein kann.
Es war Elsie, die mir beibrachte, dass man für ein Manuskript von 300 Seiten für gewöhnlich mehr Honorar bekommt, auch wenn die Geschichte auf 200 Seiten überzeugender erzählt wäre. (»Du solltest 50 Prozent mehr Verdächtige haben«, riet sie mir.) Elsie bestand ferner darauf, dass ich in jedem Jahr einen neuen Fairfax-Roman abliefern sollte, und zwar so pünktlich, dass das Buch noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in die Läden käme. (Sie hing der Theorie an, dass die Leute meine Bücher nicht kauften, um sie selbst zu lesen, sondern allein, um sie zu verschenken.) Elsie legte mir auch nahe, dieselben Handlungselemente immer wieder zu benutzen, da das Gedächtnis der Leser im Allgemeinen so gut sei wie das einer Stechmücke mit Alzheimer. (In diesem Punkt hörte ich ausnahmsweise nicht auf sie.)
Mein erster Fairfax-Roman, An einem Sommertag, entstand, als ich tatsächlich noch sehr jung war – noch keine fünfundzwanzig – und als jüngster Beamter in Diensten des Finanzamts stand. Damals war Schreiben für mich – wie soll ich das in Worte fassen? – eine schimmernde Schachtel, angefüllt mit einer unerschöpflichen Vielfalt von Pralinés in allen nur erdenklichen Formen und Geschmacksnoten. Ich ließ mir jedes Wort auf der Zunge zergehen, bemühte mich um Vollkommenheit, die ich damals noch für möglich hielt und die ich, wie ich meine, in meinem ersten Roman auch beinahe erreicht habe. Die Handlung muss mir in einer Art genialischem Moment eingefallen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, dass ich viel daran verändert hätte, während ich das Buch schrieb.
Fairfax, der ein schweres Alkoholproblem hat und von seinen Kollegen kaum mehr geduldet wird, steht kurz vor der vorgezogenen Pensionierung. Die Ermittlungen in einem Mordfall werden ohne Verhaftung oder greifbares Ergebnis ad acta gelegt. Fairfax als nutzlosestes Mitglied des Ermittlerteams muss den Papierkrieg erledigen, während die anderen sich vielversprechenderen Fällen zuwenden. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Aufgabe schnell zu bewältigen – im Gegenteil, Fairfax’ Kollegen beten darum, dass er damit beschäftigt sein möge, bis er sich in den Ruhestand verabschiedet. Und auf eine sonderbare Weise sagt diese Lösung auch Fairfax zu, der nie gerne im Team gearbeitet hat und sich zunehmend wohl fühlt mit seiner einsamen Aufgabe und seinen Trinkattacken. Ist er allerdings nüchtern, sichtet er methodisch die Beweislage, eine Kippe im Mundwinkel.
Meine Geschichte beginnt am 6. Juli, einem drückend heißen Tag, an dem sich das Verbrechen jährt. Fairfax’ Hirn arbeitet seit geraumer Zeit nicht mehr auf Hochtouren, aber etwas an diesem Fall hat ihm von Anfang an keine Ruhe gelassen: das Gefühl, dass etwas Offensichtliches übersehen wurde. Als er nach einem stärkenden flüssigen Mittagsimbiss im White Hart auf seine Rechnung schaut, fällt ihm plötzlich auf, dass 6/7 auf einer Quittung sowohl 6. Juli als auch 7. Juni bedeuten kann, je nachdem, ob man den Tag oder den Monat zuerst vermerkt. Heutzutage ist das vielleicht gebräuchlicher – aber damals schrieben nur die Amerikaner das Datum rückwärts. Fairfax lässt sein drittes Bier fast unberührt stehen und kehrt an seinen Schreibtisch zurück. Und in der Tat beruht eine zentrale Vermutung in diesem Fall auf einem einzigen kleinen Beweisstück: einer Rechnung, auf der nicht 6. Juli, sondern 6/7 steht. Mit zitternden, nikotinverfärbten Fingern blättert Fairfax zurück und liest die Aussagen aufs Neue, diesmal ohne Berücksichtigung dieses Beweisstücks. Und alles verhält sich wie bei einem Kreuzworträtsel, bei dem man zu Anfang ein falsches Wort eingefügt hat, was dann zu weiteren Irrtümern führt.