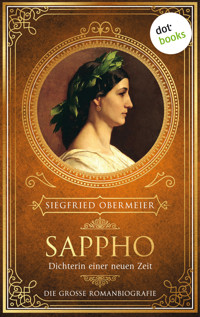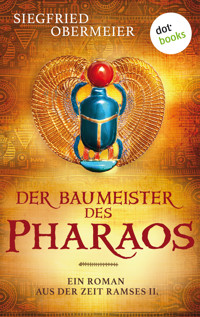4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankreich zu Beginn des 15. Jahrhunderts: Nach fast hundertjährigem Krieg gegen England weckt Johanna von Orléans noch einmal alle Kräfte des Landes; an ihrer Seite stürmt der Schwarze Ritter Gilles die Mauern der Stadt an der Loire. Um diese janusköpfige Gestalt und ihr farbenprächtiges Gefolge hat Siegfried Obermeier einen großen historischen Roman geschrieben, der die ebenso überragende wie böse Figur des Schwarzen Ritters authentisch porträtiert und sie zum Kristallisationspunkt für eine geheimnisvolle Epoche macht. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Siegfried Obermeier
Im Zeichen der Lilie
Der Roman über Leben und Zeit des dämonischen Ritters Gilles de Rais, Kampfgefährte der Johanna von Orléans
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei Fischer Digital
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-560287-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Nachwort
Zeittafel
[Karte]
Prolog
Perrinet fand das Leben schön. Er hätte die ganze Welt umarmen können, auch wenn ihm zur Zeit einiges zuwiderlief. Aber das würde sich finden, für alles gab es eine Lösung. Daran glaubte er fest – so fest wie an Gott, seine Heiligen und die Jungfrau Maria.
Er saß allein in der Werkstatt; der Meister war in Geschäften unterwegs, und der Gehilfe trug Ware aus. Die Arbeit ging ihm heute von der Hand wie nichts, und sein höllenscharfes Sattlermesser glitt durch das Leder, als schneide es Butter. Am Beginn seiner Lehrzeit war es ihm öfter ausgerutscht und hatte an seinen Händen tiefe Narben hinterlassen. Als Sohn von Maître Briand, dem Täschnermeister, hätte er dem Herkommen nach das Handwerk des Vaters erlernen müssen, aber dem stand einiges entgegen. Einmal war da noch der ältere Bruder, und wenn er am Leben blieb, so würde er der nächste Täschnermeister in Vaters Werkstatt sein. Ein Zweitgeborener ist immer übel dran, das weiß alle Welt. Doch Maître Briand stammte aus einer angesehenen altansässigen Familie, und so kam es, daß Perrinet – gerade sechzehn geworden – schon seit zwei Jahren verlobt war mit Marguerite, der Tochter von Maître Aubin, dem Sattlermeister. Keines ihrer Geschwister hatte die Kindheit überlebt, und so gab es keinen Sohn, der Maitre Aubin hätte nachfolgen können. Aber da war die Tochter, und so mußte Perrinet bei ihm das Sattlerhandwerk erlernen, um später mit Marguerite als Ehefrau der Nachfolger seines Schwiegervaters zu werden. Die besten Aussichten, nicht wahr, die ganze Stadt beneidete diesen Burschen, der sich – obwohl Zweitgeborener – einfach ins gemachte Nest setzen durfte. Andernfalls wäre es sein Schicksal gewesen, als ewiger Handwerksbursche einem Meister zu dienen; und wenn dies der eigene Bruder war – um so schlimmer.
Um ein Haar hätte er das kostbare Rindsleder für das vom Marschall de Rais bestellte Zaumzeug verschnitten. Er beugte sich über den Werktisch. Das ging ja gerade noch! Maître Aubin hätte getobt und ihm – wie es nicht selten geschah – ein paar schallende Maulschellen verpaßt. Perrinet atmete ein paarmal tief aus und ein und nahm sich das Halfter vor.
Mit seinen Berufsaussichten konnte er also zufrieden sein, und daß er nicht Täschner, sondern Sattler geworden war, störte ihn wenig. Ob er nun Zaumzeug, Sättel und Lederkoller fertigte oder den Bezug für Stühle, Möbel und Türen zurechtschnitt und daneben Taschen, Beutel und Reisekoffer herstellte, blieb sich gleich.
Was stört dich daran, Perrinet Briand, du Glückskind? Er stellte sich selbst diese Frage, und die Antwort war einfach: Marguerite paßte nicht so ganz in sein Zukunftsbild von einem glücklichen Leben. Denn Perrinet liebte Isabelle, und nun war er mit der Sattlerstochter verlobt – vor Zeugen! Ein Notar hatte alles fein säuberlich aufgenommen; das lag nun in einer eisernen Truhe, und nur Gott allein besaß die Macht, es ungeschehen zu machen. Ein alter, entfernt verwandter Domherr von St. Pierre hatte sich gnädig als Zeuge zur Verfügung gestellt. So wie er irgendwann sterben mußte, so sicher stand die Ehe mit Marguerite in seinem Schicksalsbuch. Doch niemand konnte zur Ehe gezwungen werden, schließlich mußten beide Brautleute ihr Ja vor dem Altar sprechen. Und wenn er sich nun weigerte? Dann wäre es freilich aus gewesen mit der künftigen Meisterwürde, denn eines hing am anderen. Ohne Marguerite kein Sattlermeister. Marguerite, die Betschwester. Marguerite, das brave, etwas dickliche Mädchen mit den wasserblauen Augen, dem fahlen Blondhaar und der flachen Brust. Nun, sie war erst vierzehn, da konnte schon noch etwas hinwachsen.
Perrinet besaß einen munteren, lebhaften Geist, Phantasie, Witz und einen schnellen Verstand. Trotz alledem gelang es ihm nicht, sich vorzustellen, er ginge mit Marguerite ins Bett. In die Kirche – ja, auf die Loirewiesen vor der Stadtmauer am Abend nach der Arbeit – gewiß, oder zum Festabend bei der alljährlichen Zunftfeier –, das alles konnte er sich vorstellen, nicht aber mit Marguerite verheiratet zu sein. Das jedoch stand ihm bevor, und es war der dunkle Punkt in seinem Leben.
Mit Isabelle war es genau umgekehrt. Sie konnte er sich nicht an seiner Seite vorstellen bei der Zunftfeier oder beim Kirchgang, auch nicht beim Abendspaziergang auf den Loirewiesen. Ein Sattlergeselle ging nicht Seite an Seite mit der Tochter einer Wäscherin. Die Mutter war eine ehrliche Haut, gewiß, im Viertel als zuverlässige laveuse geschätzt, aber sie war nie verheiratet gewesen, und so nannte man Isabelle einen Bankert. Das war nicht böse gemeint – schließlich gab es in Nantes viele Dutzende davon –, aber es wies ihr den Platz im Leben zu. Wenn sich nicht irgendein geiler Witwer ihrer erbarmte, blieb nur lebenslange Fron, das Hurenhaus oder ein Kloster. Mit Isabelle war Perrinet ins Bett gestiegen, besser gesagt ins Heu, und das war so vergnüglich gewesen, daß er jedesmal einen Steifen bekam, wenn er nur daran dachte. Isabelle war schon siebzehn oder achtzehn, so genau wußte sie es nicht, und was sie an Erfahrung besaß, gab sie an Perrinet weiter. Und das war nicht wenig!
Perrinet preßte die Knie zusammen, weil allein die Vorstellung von einer nackten Isabelle ihm das Blut ins Gesicht und in die Lenden trieb. Das Leben war schön, gewiß, aber da lag ein häßlicher Stolperstein auf der breiten, sicheren Straße in die Zukunft, und er wußte nicht, was er tun sollte. Isabelle aufgeben? Nein – um Himmels willen, nein! Er brauchte sie wie Essen, Trinken und den Schlaf. Marguerite aufgeben? Gerne, aber wie? Das hieß, den Beruf aufgeben, und das lag außerhalb seiner Vorstellungskraft. Mit Marguerite konnte und wollte er nicht über dieses Problem reden, während Isabelle nur fröhlich in den Tag hineinlebte und sich um die Zukunft keinen Deut scherte. Da lachte sie nur und rief:
«Mon Dieu – du hast vielleicht Sorgen! Wir leben doch jetzt und nicht in einem Monat oder in einem Jahr. Nur Gott kennt die Zukunft, du kannst morgen tot sein und ich schon heute abend. Wir lieben uns, chéri, jetzt und heute, und nur das zählt.»
Perrinet lächelte, und Isabelles Gesicht stand ihm so deutlich vor Augen, als wäre sie gerade hier gewesen. Das zarte ovale Rund mit der braunen Samthaut, den schrägen dunklen Augen – und ihr Lachen erst – ihr Lachen! Wenn Isabelle lachte, dann lachte der ganze Körper, ihre Brüste hüpften, ihre Haare flogen, ihre Hände wirbelten wie kleine Vögel durch die Luft … Und was war das für ein Körper! Schlank wie eine Gerte mit kräftigen Schultern und Armen, die Brüste nicht zu groß und nicht zu klein, Schenkel wie aus Nußbaum gedrechselt mit einem samtigen Honigglanz – und, und … Er schüttelte kräftig seinen Kopf mit den kurzgeschnittenen, strohblonden Haaren. Wer eine Isabelle zur Geliebten hatte, der konnte nicht mit einer Marguerite ins Bett steigen. Wieder schüttelte er störrisch den Kopf. Und leise begann er zu singen, denn es mußte heraus aus ihm, weil er sonst zerbarst. Seit einem halben Jahr war der Stimmbruch überwunden, Perrinet gewann Freude am Gesang und konnte Dutzende der alten Troubadourweisen. Am besten gefielen ihm die Liebeslieder des Bernard de Ventadour.
Gar sanft mit lauter Süßigkeit
Wirkt diese Liebe auf mein Herz.
Tags sterb’ ich hundertmal vor Schmerz
Und lebe auf vor Fröhlichkeit.
Mein Weh ist eine süße Pein,
Mit der kein fremdes Glück sich mißt;
Und wenn mein Weh so süß schon ist,
Wie süß muß dann mein Glück erst sein!
Dann hob er die Stimme und wiederholte die letzten Worte ganz laut. Sollten es nur alle hören!
Wie süß muß dann mein Glück erst sein!
Es war Mai, beide Fenster standen weit offen, und von dort kam jetzt ein gedämpftes Klatschen.
«Bravo junger Mann, bravo! Habe schon lange keinen so schönen Gesang mehr gehört!»
Gegen das helle Licht sah Perrinet nur einen dunklen Schatten am Fenster, doch er kannte die Stimme des Mannes.
«Tretet ein, Seigneur, Ihr kommt wegen des Zaumzeugs?»
Der Besucher kam herein.
«Habe nur vorbeigeschaut, wenn ich schon mal in Nantes bin.»
«Leider ist es noch nicht fertig, Seigneur, es sollte ja erst nächste Woche geliefert werden.»
Der eher schmächtige Mann mit dem fahlen Haar und den harten Augen winkte lässig ab.
«Richtig, Perrinet, richtig! Ich will keineswegs drängen. Deine schöne Stimme war es, die mich angelockt hat. Weißt du, daß mein Vetter Gilles in Machecoul einen Knabenchor gegründet hat? Später will er noch eine Abtei stiften.»
«Ein frommer Herr …», murmelte Perrinet.
«Du solltest deine Stimme dort hören lassen, junger Mann. In dieser muffigen Werkstatt verkommt eine solche Gottesgabe. Was meinst du?»
«Ich weiß nicht recht, Seigneur de Sillé … Mein Vater würde es nicht erlauben.»
Der Seigneur trat ganz nahe an ihn heran, und Perrinet sah nun deutlich die Farbe der kalten Augen, und ihn schauderte vor diesem schmutzigen Gelb, das aussah wie Erbrochenes. Er wich etwas zurück.
«Ich werde mit deinem Vater reden, oder Seigneur de Rais wird es tun, wenn er das nächste Mal in sein Haus kommt.»
Etwas wie Trotz regte sich in Perrinet Briand, denn er war ein freier Bürger von Nantes und kein höriger Bauer. Er deutete auf seine Arbeit.
«Ich habe noch viel zu tun, Seigneur, und wie Ihr seht, bin ich dabei, Sattler zu werden und nicht Sänger.»
Sillé lachte, und es klang, als zerbräche ein irdener Topf.
«Aber eines schließt doch das andere nicht aus! Du hast ja schon eine Männerstimme, könntest leicht Chorführer und Solist werden. Fast alle anderen sind Kinder zwischen sechs und zwölf, das taugt nur für den Chorgesang. Seigneur de Rais ist sehr generös, da sitzen die Goldstücke locker. Ich würde es mir an deiner Stelle gut überlegen …»
Mit einem freundlichen Lächeln verabschiedete sich der Seigneur, und Perrinet atmete auf, weil ihm die schmutzig-gelben Augen nicht mehr so nahe waren.
Was gab es da zu überlegen? Bei der Zunft sah man einen Berufswechsel oder gar einen Abbruch der Lehr- oder Gesellenzeit gar nicht gerne. Da würde er später kaum noch Anschluß finden, ganz abgesehen von Vater. Maître Jean Briand würde in gar keinem Fall seine Erlaubnis geben, auch nicht einem Seigneur de Rais, der Dutzende von Burgen und Dörfern besaß und zu den reichsten Edelleuten in und um Nantes zählte. Der König hatte ihn zum Marschall von Frankreich ernannt, weil er im Herbst 1428 an der Seite der Jeanne d’Arc in Orléans die Engländer geschlagen und dann besiegt hatte. Einem solchen Mann etwas abzuschlagen, wäre schon sehr unbedacht gewesen. Seigneur de Rais konnte seine Sattlerarbeiten einem anderen übertragen, konnte Gerüchte in die Welt setzen, konnte Druck auf die Zunft ausüben – konnte so allerlei. Perrinet seufzte und griff nach seinem Messer. Vor einer halben Stunde war ihm das Leben so schön erschienen …
Isabelle, schoß es ihm durch den Kopf, ihr und mir kann es nur nützen. Wenn ich Sänger in Machecoul bin, dann kann ich Marguerite nicht heiraten. Seigneur de Rais wird es kaum zulassen, daß sein Chorleiter sich davonmacht wegen dieser dummen, bigotten und flachbrüstigen Gans. Perrinet, Perrinet, du malst dir eine Zukunft aus, die dir nicht bestimmt ist. Weiß Gott, was dieser Vetter des Herrn de Rais alles so daherredet.
Draußen war die strahlende Maisonne hinter den Häusern der Place du Puits-Salé verschwunden, und sanft breitete sich eine graue Dämmerung über die kleine Werkstatt mit ihren Geräten: dem Werktisch, den Hockern und den streng riechenden Lederstapeln.
Marguerite trat ein, kaum hörbar, wie es ihre Art war.
«Ist Vater noch nicht zurück?»
Perrinet blickte sich spöttisch um.
«Siehst du ihn irgendwo? Vielleicht ist er in die Truhe dort hinten gekrochen.»
«Warum mußt du nur immer spotten, Perrinet? Könntest deine Verlobte schon manierlicher behandeln.»
Sie sagte das nur so hin, ganz ohne Zorn oder Vorwurf, weil sie wußte, daß Perrinet ihr sicher war. Eine Verlobung vor dem Notar und mit einem Domherrn als Zeugen – das ist schon was! Das ist so gut wie verheiratet. Ihr gefiel dieser Perrinet, und seine Mucken würde sie ihm schon austreiben.
Bald erschien dann auch Maître Aubin, und er war sehr guter Laune.
«Jetzt haben wir endlich beim Herzog erreicht, daß Nantes keine neuen Lederhandwerker aufnehmen muß. Gibt sowieso schon genügend Pfuscher vor den Toren der Stadt, die für ein paar Groschen schlechtes Leder zusammennähen für Geizkragen, die glauben, damit etwas zu sparen. Und wenn das Halfter reißt oder die Trense bricht oder der Sattel nach einigen Monaten auseinanderfällt, dann heißt es, das Handwerk sei auch nicht mehr das, was es früher war. Und wer ist schuld daran? Na – wer schon? Schuld sind …»
So ging es den ganzen Abend fort, und Perrinet hörte gar nicht mehr hin, sondern verabschiedete sich bald. Er hätte üblicherweise bei seinem Lehrherrn wohnen müssen, aber das Haus seiner Eltern lag nur wenig entfernt, und so ging er von der Place du Puits-Salé über die Rue de la Juiverie in die Rue de la Baclerie, an deren Ende – schon fast bei der Place du Bouffay – das Elternhaus lag.
Er war so in Gedanken, daß er den Ruf attention! fast überhört hätte und noch einige Spritzer aus dem pot de chambre abbekam, den eine schnelle Hand aus einem der oberen Fenster geleert hatte. Der Stadtrat hatte zwar untersagt, die Nachtgeschirre auf die Straße zu entleeren, aber wer hielt sich schon daran? Vor allem die Bewohner der oberen Stockwerke scheuten den Gang zum Abtritt im Hinterhof, und für ältere Menschen mußte es sehr beschwerlich sein, mehrmals am Tag die steilen Treppen hinauf- und hinunterzusteigen.
«Hast du schon zu Abend gegessen?» fragte die Mutter.
«Ja, eine Suppe. Bin nicht hungrig, werde bald zu Bett gehen.»
Marie Briand betrachtete ihren Jüngsten zärtlich.
«Ißt du auch genug?»
«Falle ich vom Fleisch? Wo sind Vater und Etienne?»
«Noch immer in der Werkstatt, die beiden finden heute kein Ende.»
Etienne, der ältere Bruder, war fleißig, stets gehorsam, aber ein besonderes Talent für sein Handwerk besaß er nicht. Wie viele Lederstücke der verschnitten hatte, bis er endlich Geselle war! Aber Vater hatte niemals die Geduld verloren, und was Etienne an Geschick nicht besaß, ersetzte er durch Fleiß und Ausdauer.
Nun, da er mit seiner Mutter allein war, drängte es Perrinet, vom Besuch des Herrn de Sillé zu erzählen, und mehrmals tat er den Mund schon auf, aber etwas hielt ihn schließlich davon ab. Sonst hatte er vor seiner Mutter kaum Geheimnisse – sie wußte sogar von Isabelle –, aber diesmal beschloß er, abzuwarten, ob der Seigneur tatsächlich beim Vater anfragen würde. Er, Perrinet, glaubte ohnehin nicht daran, weil die adeligen Herren viel daherredeten, wenn der Tag lang ist. Sie hatten in Nantes wenig zu sagen; die Gerichtsbarkeit lag beim Bischof, der zugleich Kanzler des Herzogs der Bretagne war. Das stärkte den Bürgerstolz, und so mancher scheute sich nicht, einen der adeligen Herren – viele von ihnen besaßen hier ein feudales Stadthaus – zu verklagen; und häufig bekam der Bürger recht. Das waren die stolzen Ritter nicht gewohnt, denn draußen auf dem Land, auf ihren festen Burgen spielten sie bei ihren hörigen Bauern die Herren über Leben und Tod.
Seine Gnaden, Jean de Malestroit, Bischof von Nantes, Kanzler und Vertrauter des Herzogs Johann V. der Bretagne, schätzte die adelsstolzen Landjunker nicht, und wenn einer von ihnen – was nicht selten geschah – Schulden bei Händlern und Handwerkern hinterließ, dann wurde ihm sein Stadthaus ohne langes Fackeln unter dem Hintern weggepfändet. Diese gewerbefleißigen Leute nämlich füllten zuverlässig die Kassen des Herzogs, und ihm wie seinem Kanzler waren sie allemal lieber als die aufsässigen Ritter, die keine Abgaben bezahlten und nur Scherereien verursachten.
Man mochte sie hier nicht, und Maître Jean, Perrinets Vater, machte da keine Ausnahme. Aber er behielt diese Meinung für sich, denn ohne die Kunden vom Landadel wäre seine Werkstatt um etliches bescheidener gewesen.
In den nächsten Wochen geschah nichts, das Leben ging weiter wie bisher. Es wurde Juni, man feierte das Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus, dann begann der Juli mit glühendheißen Tagen, an denen einem das Schneidemesser aus den schweißigen Händen glitt.
Die Tage waren lang, und für Perrinet wurde es schwierig, seine Geliebte unbemerkt zu treffen. Ihr allein hatte er vom Besuch des Seigneur de Sillé erzählt, doch sie war wie Perrinet der Meinung, das sei nur so dahingesagt, und er könne es ruhig vergessen. Sie saßen am Ufer der Madelaine, einem Arm der Loire, außerhalb der Stadt, wo sie sich im dichten Ufergestrüpp ein geheimes Plätzchen geschaffen hatten. Sie hatten sich geliebt und wieder geliebt, und nun lag Perrinet da, seinen Kopf in Isabelles Schoß, und plauderte schläfrig vor sich hin. Wegen der Schnaken unterhielten sie ein kleines Feuer, und Isabelle legte von Zeit zu Zeit eines der gesammelten Holzstücke nach.
«Vielleicht gäbe es dann für uns doch noch so etwas wie eine gemeinsame Zukunft, an die du ja nicht glaubst», sagte Perrinet.
Zärtlich strich sie über sein kurzgeschnittenes Haar.
«Weil ich vernünftig denke und weiß, was möglich ist und was nicht.»
«Die Heirat müßte jedenfalls verschoben werden. Wenn ich dem Seigneur de Rais zusage, kann ich ihn ja bitten …»
Isabelle legte ihm ihre schmale kräftige Hand auf den Mund.
«Schluß jetzt mit dem Gefasel! Der Herr de Rais weiß vermutlich nicht einmal, daß es dich gibt.»
Perrinet richtete sich auf.
«Das weiß er wohl. Ich habe ihm schon Ware in sein Stadthaus La Suze geliefert und von ihm selbst das Geld bekommen. Er hat mich angelächelt, auf eine Weise – auf eine Weise …»
«Na, wie denn?»
«Wie man eben einen Jungen nicht anlächelt.»
«Hirngespinste!»
Sie lachte, und ihre Hand stahl sich unter sein kurzes Hemd – mehr hatte er nicht an – und huschte dort herum wie ein Wiesel. Er atmete schneller.
«Du bist eine Hexe!»
«Muß ich wohl sein, denn wie sonst würde es mir gelingen, eine tote Schlange zum Leben zu erwecken. Da! Sie regt sich schon, ich fühle es deutlich, richtet sich auf – bedroht mich!»
In gespieltem Schrecken fuhr sie zurück, Perrinet packte ihre beiden Arme, und ein süßer lustvoller Ringkampf begann, der damit endete, daß Isabelle mit gespreizten Schenkeln auf seinen Hüften saß, um, wie sie sagte, die Schlange zu zähmen.
Später kam sie auf den Seigneur de Rais zurück.
«Ich weiß, warum er dich angelächelt hat.»
Er schaute sie fragend an.
«Weil du ein hübscher Junge bist mit deinem Blondhaar, den grünen Augen und einem Mund wie eine frische Frucht.»
Er blinzelte. «Was?»
«Ja, dein Mund ist wie eine frische Frucht. Deine Geliebte darf das doch sagen, oder?»
«Du schon, aber nicht er – ein Mann!»
«Es gibt Männer, die haben ihren Spaß an jungen Burschen.»
«Davon will ich nichts wissen.»
Isabelle lachte hell auf, ihre Haare flogen, die Brüste wippten.
«Ich schon, weil ich den gleichen Geschmack habe.»
«Du bist eine Frau.»
Wieder lachte sie.
«Zum Glück! Ein Mann möchte ich nicht sein – nie und nimmer!»
«Was ist da so schlimm dran?»
«Ich möchte zum Beispiel kein Krieger sein, weil ich niemanden töten könnte; ich möchte kein Richter sein, weil ich keinen Menschen verurteilen könnte – ich möchte kein Henker sein, kein Metzger, kein Jäger …»
Perrinet schaute sie zärtlich an. Er wollte nicht darüber diskutieren.
«Du bist Isabelle – meine Isabelle und das genügt.»
Ein paar Tage später kam Perrinet abends nach Haus, froh einen schweren Arbeitstag hinter sich zu haben. Maître Jean, sein Vater, empfing ihn mit einem grimmigen Gesicht.
«Komm mit in die Werkstatt!»
Das klang böse und schroff. Der Vater ging voraus, Perrinet schloß die Tür. Das Abendlicht lag warm und freundlich auf den von Kindheit an vertrauten Gegenständen, dem Schneidetisch, dem Holzbrett und den daran hängenden Messern, Ahlen, Zangen und Schleifsteinen, dem gestapelten Leder, dazu der vertraute Geruch. Er hätte sich hier blind zurechtgefunden. Maître Jean wandte sich um, und ehe Perrinet es sich versah, empfing er zwei schallende Maulschellen – eine links, eine rechts. Verwirrt rieb er sich die Wangen.
«Aber Vater … was habe ich … was ist …»
«Du weißt genau, was ist!» rief Maître Jean, «du hast mich hintergangen, mein Vertrauen mißbraucht. Solange du nicht erwachsen bist, verlange ich von dir Rechenschaft über alle wichtigen Dinge deines Lebens – hast du verstanden?»
Perrinet erschrak. Hatte der Vater etwas von Isabelle erfahren? Sollte er sich dummstellen oder alles zugeben? Doch da sprach der Vater schon weiter.
«Da erscheint heute früh Seigneur de Rais mit seinen Knechten, erteilt mir einen großen Auftrag und fragt so nebenbei nach deinen Sangeskünsten. Ich muß ihn ziemlich dumm angeschaut haben, denn er sagte, ob ich denn nichts davon wisse, daß sein Vetter Sillé dich besucht und die Möglichkeit erwogen habe, dich in seinen Chor zu holen. Das verschweigst du mir, und ich stehe da wie ein dummer Ochse, der von hü und hott nichts weiß.»
«Aber Herr Vater, ich hielt das nicht für so wichtig. Ich sang gerade ein Liedchen, als Seigneur de Sillé dazukam, meine Stimme lobte und meinte, sie sei durchaus für den Chor seines Vetters geeignet.»
Maître Jeans Zorn hatte sich abgekühlt, und er sagte jetzt mit ruhigerer Stimme:
«Du hättest es mir trotzdem sagen müssen. Ich wandte dann ein, daß dein Wunsch, Meister zu werden, größer sei, als den Gesang zum Beruf zu machen, doch Seigneur de Rais wischte den Einwand beiseite. Niemand hindere dich daran, in Machecoul als Sattlerlehrling weiterzuarbeiten, und du könntest dort in Ruhe an deinem Gesellenstück arbeiten, da habe die Zunft gewiß nichts dagegen. Im übrigen müsse er ja ohnehin erst deine Stimme hören, und dann könne man immer noch über das Weitere reden.»
«Was habt Ihr ihm darauf geantwortet, Herr Vater?»
«Daß ich einverstanden bin, wenn du selber es willst.»
Perrinet dachte an die drohende Hochzeit mit Marguerite und sagte ohne zu zögern:
«Warum nicht? Seigneur de Rais ist einer unserer besten Kunden, bei Euch wie bei Maître Aubin. Wir sollten ihn nicht verdrießen.»
Da lächelte Maître Jean und klopfte seinem Sohn auf die Schulter.
«Ich sehe, wir verstehen uns. Aber die Maulschellen hast du trotzdem verdient.»
Am Sonntag darauf erschien Perrinet im Stadtpalais des Seigneur de Rais, mit frisch geschnittenen Haaren und in seinen besten Kleidern. Trotz der Julihitze brannte im großen Saal ein Kaminfeuer, und ein seltsamer, schwer zu definierender Geruch hing im Raum. Perrinet erschrak. Etwas wie Unheil lag über dem düsteren Gemach, doch er schalt sich einen Hasenfuß und setzte ein erwartungsvolles Lächeln auf.
Seigneur Gilles de Rais erhob sich, als der Besucher eintrat. Mit seiner großen schlanken Gestalt und der einfachen, aber sehr feinen Kleidung füllte er den Raum auf eine Art, als gäbe es hier nur ihn. Sein schönes, etwas fahles Gesicht rahmte ein schwarzer kurzgeschnittener Bart, seine dunklen Augen schienen leicht zu flackern, als er Perrinet musterte – sehr eindringlich musterte.
«Bei unserem letzten Treffen warst du noch ein Kind, Perrinet – jetzt bist du ein junger Mann.»
Etwas wie Bedauern lag in dieser Feststellung.
«Ich habe ja gesagt, er könnte dir zu alt sein», warf Seigneur de Sillé ein.
Ach, den gibt es auch noch, dachte Perrinet.
«Spielst du ein Musikinstrument?»
«Nein, Herr.»
«Sillé, hol eine Laute.»
Der Vetter verschwand. Perrinet blickte verstohlen zum Kamin und rümpfte die Nase. Der Seigneur bemerkte es sofort.
«Stinkt hier ein wenig, nicht wahr? Mein alter Majordomus hat Rattengift verstreut, und wir haben die toten Viecher verbrannt. Ratten, Mäuse und eine Katze, die auch draufgegangen ist.»
Perrinet sah schwärzliche Klumpen im Feuer liegen, aber er schaute nicht genauer hin.
«Wie alt bist du, mein Junge?»
«Gerade sechzehn geworden.»
«Aha – da hast du sicher schon eine Freundin?»
Nichts von Isabelle, dachte Perrinet, nicht jetzt.
«Ich bin schon verlobt, Seigneur, mit Marguerite, der Tochter meines Lehrherrn.»
«Dann ist ja alles im Lot», sagte Seigneur Gilles und griff nach der Laute, die Sillé ihm reichte.
«Was spielen wir, was singen wir? Vielleicht etwas Religiöses, das dir aus der Kirche vertraut ist? Oder lieber den Schlachtgesang des ungestümen Bertrand de Born?»
«Den kenne ich!»
«Also gut.»
Gilles de Rais schlug die Laute an, und Perrinet sang.
Be m play lo douz temps de pascor,
Que fai fuelhas e flors venir …
Der holde Lenz gefällt mir schon,
Der Blüten treibt und Blätter;
Mich freut auch mit dem süßen Ton
Der Vögel froh Geschmetter.
Mehr aber freut es mich, zu sehn
Vom Anger die Standarte wehn,
Zum Kampfe wehn den Rittern …
Seigneur de Rais spielte noch einige Akkorde und stellte die Laute weg.
«Ein wildes Lied, nicht wahr, von Kampf und Sieg und Tod. Gefällt es dir?»
«Weniger der Inhalt als die schönen Reime.»
Er stand auf.
«Hast recht, Krieg ist nichts Schönes, auch wenn die Dichter ihn verherrlichen. Er ist nur manchmal notwendig. Deine Stimme gefällt mir, Perrinet, mein Vetter hat da nicht übertrieben. Wir könnten es mit dir versuchen – wenn du willst.»
«Ich will», sagte Perrinet fest, «ja, ich will!»
Maître Aubin legte sich zuerst quer, als sein Lehrling und künftiger Schwiegersohn so mir nichts dir nichts verschwinden sollte, doch auch er wurde mit Aufträgen und guten Worten beschwichtigt. Im übrigen könne er, der Meister, gelegentlich Perrinets Arbeiten überprüfen. Er sei auf Machecoul, das ja nur einen Tagesritt von Nantes entfernt läge, jederzeit als Gast willkommen, doch wenn er die Reise scheue, würden die Knechte des Marschalls ihm von Zeit zu Zeit Perrinets Arbeiten zur Besichtigung vorlegen. Maître Aubin wunderte sich über das Gewese um seinen Lehrjungen, nur weil der recht gefällig ein Liedchen zu trällern verstand. Marguerite sagte nichts dazu. Es fragte sie auch keiner.
Das prächtige hochaufragende Schloß lag am Rande der Ortschaft Machecoul auf flachem Land, von weiten Feldern umgeben, hinter dichten Busch- und Baumgruppen verborgen. Um die Burg verstreut, standen die niedrigen Hütten der Dienstleute, und wie Perrinet bald sah, waren es sehr viele Menschen, die für den Seigneur arbeiteten – Gärtner, Reitknechte, Handwerker, Wäscherinnen, während die im Rang Höherstehenden, die Kammerdiener, Küchenmeister und Mundschenken in den Seitenflügeln und Anbauten der Schloßburg lebten.
Perrinet Briand wurde dort einquartiert, sein Nachbar war ein junger Schulmeister, der viel von Musik verstand und mit den Knaben die lateinischen Choräle einübte. Die meisten der Jungen kamen aus Machecoul und wohnten bei ihren Eltern, ein paar von ihnen lebten als Pagen im Schloß.
Perrinets Stimme gefiel, wurde geschult, und bald durfte er – auf ausdrücklichen Wunsch des Marschalls – als Vorsänger und gelegentlicher Chorleiter auftreten. Der Schulmeister begegnete ihm mit Zurückhaltung, aber er brachte ihm bei, was er als Chorführer wissen mußte, vor allem die Notenschrift, und bald wußte Perrinet eine Maxima von einer Longa, eine Fusa von einer Minima zu unterscheiden und konnte die oft sehr ähnlichen Pausenzeichen auseinanderhalten.
Marschall de Rais war in diesem Frühjahr oft unterwegs, denn seine zahlreichen Besitzungen lagen zum Teil weit auseinander, und – so munkelte man – der Seigneur müsse wegen seiner großen Ausgaben einen Teil davon verkaufen.
Im Juni kam er für länger zurück, und mit ihm setzte ein aufwendiges feudales Hofleben ein. Es wurde geschlachtet und gebacken, gebraten und gesoffen, gejagt und geritten, musiziert und getanzt. Ganze Scharen von Händlern, Gauklern und Bettlern belagerten Tag und Nacht das Tor zum Schloß – und sie taten es nicht umsonst. Die Gaukler durften auftreten, die Händler breiteten ihre Schätze an Juwelen, Prachtkleidern, Schnitzereien, illustrierten Büchern und Raritäten aus fernen Ländern vor dem Marschall aus, und er kaufte, kaufte, kaufte. Die Bettelkinder wurden mit den Resten der Festmähler gefüttert, und einige von ihnen – weißhäutige, blondgelockte, grün- oder blauäugige Buben zwischen acht und zehn Jahren – wurden ins Schloß geholt, gewaschen, gekämmt, gekleidet, getränkt und gefüttert, herausgeputzt wie kleine drollige Pagen. Irgendwie verschwanden sie dann wieder, und der kundige Seigneur de Sillé holte für seinen kinderlieben Vetter neue heran, häufig begleitet von Roger de Bricqueville, einem anderen Freund und Verwandten des Marschalls.
An der Tafel spielten die Musikanten lustige Weisen, und Perrinet sang Lieder von Machaut, Deschamps und Froissart. Da saß der Marschall dann im Kreise von Freunden, umsorgt von seinen Lieblingsdienern Poitou und Henriet, aß und trank, lauschte der Musik – trank vor allem, Becher um Becher, nötigte auch andere zum Trinken. Da durfte Perrinet sich eines trunkenen Abends neben ihn setzen, der Seigneur legte einen Arm um seine Schulter und lallte ihm ins Ohr: «Ge-gefällt’s dir bei mir, Per-Perrinet? Ein lu-lustiges Leben – oder? Zieh – zieh dich aus – los! Ist do-doch warm genug …»
Seigneur de Sillé betrachtete Perrinet mit seinen schmutzig-gelben Augen wie die Schlange das Kaninchen, und als der Junge zögerte, zischte er ihn an:
«Hast du nicht gehört, was der Marschall gesagt hat?»
Was soll’s, dachte Perrinet, auch schon etwas betrunken, was kann schon passieren? Er schlüpfte aus den Kleidern, behielt nur den Lendenschurz an. Der Seigneur lachte auf seine harte, freudlose Art.
«Schau – schau, Sillé, was für einen schönen Hintern unser Chorknabe hat.»
Er strich kurz mit der Hand darüber, seine Finger schlüpften unter den Lendenschurz, fanden das Glied, streichelten es, preßten und bogen es, daß Perrinet leise aufschrie. Gilles de Rais lachte.
«Der Kleine ist empfindlich? Los – troll dich, bi-bist mir zu – zu alt.»
Er sagte es nicht unfreundlich, und als sich Perrinet wieder angezogen hatte, küßte de Rais ihn auf den Mund.
«Ge-gehörst trotzdem zu meinen Lie-Lieblingen …»
Perrinet fürchtete, in dieser schwülen, von Wein und Schweiß geschwängerten Luft zu ersticken, und bat, sich entfernen zu dürfen.
«Aber freilich», rief der Marschall, «kannst gehen und kommen wie du – wie du willst.»
Seigneur de Sillé lächelte spöttisch dazu.
«Wir sind alle eine große Familie.»
Perrinet taumelte hinaus, atmete tief die klare kühle Frühsommerluft, ging über den Schloßhof zur Zugbrücke – die Wachen kannten ihn und rührten sich nicht –, lief auf die große Wiese und warf sich ins taufeuchte Gras. Er war nicht allein – ringsum nächtigten unter dürftigen Planen, Decken und Strohbündeln die Gaukler und Bettler. Etwas zupfte ihn am Arm, und er setzte sich auf. Da stand ein etwa zehnjähriges Mädchen, und das fahle Mondlicht schimmerte auf ihrem verfilzten Haar.
«Herr, Ihr seid doch einer von da drinnen?»
Er nickte.
«Ich habe einen Bruder, François, der ist vor drei Tagen ins Schloß geholt worden und nicht mehr wiedergekommen. Er ist kleiner als ich, blond, hat ein rundes Gesicht …»
«Ich glaube, ich habe ihn gesehen», sagte Perrinet leichthin. «Sicher geht es ihm gut, und er wird bald wiederkommen.»
Dann schlief er ein und wachte weit nach Mitternacht mit steifen Gliedern wieder auf. Er fühlte sich munter und ausgeruht, hatte keine Lust, ins Bett zu gehen. An den schlafenden Wachen vorbei ging er ins Schloß zurück, hatte plötzlich Lust auf frisches Obst, das in einem Keller unter dem Nordturm lagerte.
Da hörte er einen Schrei, schrill, grausig und nicht enden wollend. Perrinet fröstelte. Das klang wie von einem Kind. Was soll’s, dachte er, ein Kind hat im Schlaf geschrien. Doch dann schüttelte er den Kopf. So schreit man nicht im Schlaf. Die Lust auf Obst war ihm vergangen, aber es ließ ihm keine Ruhe, er nahm eine brennende Kerze vom Sims, stieg eine steile Steintreppe hinab, und da öffnete sich ein schmaler Gang, der vor einer schweren Holztür endete. Sie war aus unregelmäßigen Bohlen gezimmert, durch deren Ritzen funkelte flackerndes Licht.
Wie im Traum ging Perrinet auf die Tür zu, löschte die Kerze, preßte sein Gesicht gegen das rauhe Holz und spähte durch eine der Ritzen. Da stand der Marschall mit dem Rücken zur Tür, ihm schräg gegenüber sein Vetter Sillé, während Poitou, der Leibdiener, gebückt etwas vom Boden aufwischte. Plötzlich drehte der Seigneur de Rais sich zur Seite, hob etwas hoch und ließ ein schreckliches, den Raum füllendes Lachen hören.
Als Perrinet sah, was der Seigneur in der Hand hielt, fuhr er zurück, als hätte ihn ein Schlag getroffen. Kalter Schweiß brach ihm aus den Poren, sein Magen krümmte sich, die halbverdauten Speisen und der Wein schossen in den Mund. Ächzend und würgend lief er die Treppe hinauf, das Erbrochene floß ihm über die Lippen, er stolperte, lief weiter, würgte, erbrach sich, lief, lief und sank neben dem Brunnen im Schloßhof zu Boden.
Das muß ein Alptraum gewesen sein, dachte Perrinet. Er zog den Eimer herauf und goß sich das eiskalte Wasser über den Kopf. Er träumte nicht, er war wach. Langsam schwand die Übelkeit, und seine Gedanken ordneten sich.
Dann fiel ihm plötzlich und scheinbar ohne Zusammenhang der seltsame Geruch im Stadthaus des Marschalls ein. Auch hier hatte er von Zeit zu Zeit diesen Geruch wahrgenommen, aus dem Garten hinter dem Schloß, wo Poitou und Henriet manchmal etwas verbrannten und dabei sehr geheimnisvoll taten. Einmal hatte Perrinet nachgesehen und einige verkohlte Knochen gefunden. Da atmete er auf. Sie verbrennen Küchenabfälle, weil man sich der Hunde nicht mehr erwehren konnte, ließ man die abgenagten Knochen einfach liegen.
Waren es tatsächlich Abfälle gewesen, damals in Nantes – Ratten, Mäuse und eine tote Katze?
Sein Verstand weigerte sich, Zusammenhänge herzustellen. Er schüttelte immer wieder seinen Kopf. Er war vor Schrecken wie betäubt und verkroch sich in sein Zimmer.
1
Jean de Malestroit, Schatzmeister, Generalsteuerpächter und Kanzler des Herzogs der Bretagne, dazu Bischof von Nantes, entstammte zwar einer Adelsfamilie, doch das änderte seine Einstellung nicht im geringsten. Er mochte sie nicht, diese kleinen und großen Feudalherren, die zu nichts nütze waren und deren endlose Streitereien sein fürstlicher Freund, Herzog Johann, zu schlichten hatte, wenn er diese Aufgabe auch meist seinem Kanzler übertrug. Sie waren Lehensmänner, diese Herren, und hätten im Konfliktfall Waffendienst leisten müssen, aber wenn man sie wirklich brauchte, hagelte es Ausreden. Von Abgaben jeglicher Art waren sie selbstredend befreit, und so saßen sie wie kleine Herrgötter auf ihren festen Burgen und lachten sich ins Fäustchen.
Er war mit den Jahren ein wenig dick und behäbig geworden, der Bischof von Nantes, auch sein schönes volles Haar hatte sich gelichtet – besser gesagt, es war so gut wie nicht mehr vorhanden, doch bei einem Würdenträger wie Malestroit fiel das kaum ins Gewicht, weil sein Rang es ihm erlaubte, das Haupt stets bedeckt zu halten. Sein fünfzigster Geburtstag lag schon eine Weile zurück, aber der Kanzler fühlte sich so jung und frisch wie ein Dreißigjähriger, und wenn er daran dachte, welche Aufgaben seiner harrten, so barst er vor Tatkraft.
Er hatte es sich zum Ziel gesetzt – und der Herzog gab ihm dazu freie Hand –, die Feudalherren in der Bretagne zu stutzen, ihren Besitz und ihre Macht zu schmälern, mit der Stimme des Volkes gesagt: sie kleinzukriegen. Beim Herzog mochten dabei staatspolitische Motive den Vorrang haben, beim Bischof aber war es ein ehrgeiziges Prinzip, wenn auch nicht ohne Selbstsucht, denn er achtete durchaus darauf, daß dabei für ihn etwas abfiel.
Nun arbeitete er daran, Seigneur Gilles de Rais, den Marschall von Frankreich, kleinzukriegen, und er ging dabei so geschickt zu Werke, daß der mit anderen Dingen befaßte Seigneur es nicht einmal merkte – noch nicht.
Jean de Malestroit nahm ein Blatt zur Hand und ließ – zum weiß Gott wievielten Mal – seine Augen über die Aufstellung des weithin verstreuten Besitzes von Seigneur de Rais gleiten. Schlösser, Burgen, Edelsitze, Güter, Dörfer, Märkte, Weinberge – das ganze Blatt war mit Namen beschrieben. Champtocé und Ingrandes an der Loire, durch Schiffszölle immens reiche Besitzungen, dann Machecoul, Pornic, Bourgneuf, Vue, Princé, Prigny, St. Etienne, Légé und La Bénate im Pays de Rais, der Gegend, die seinen Namen trug und die noch zur Bretagne gehörte. Seine Frau Catherine hatte dem Seigneur die reichen Herrschaften Tiffauges und Pouzauges eingebracht, doch die lagen in der Grafschaft Poitou, außerhalb des Gerichtsbereichs der Bretagne wie auch die Besitzungen in Maine und im Anjou.
Malestroit rieb sich die Hände. Einiges davon, nämlich Prigny, Vue und ein paar andere Ländereien hatte er schon an sich gebracht – für einen Pappenstiel! Der Seigneur war in ständiger Geldnot, sein vielköpfiger Hofstaat kostete ihn Unsummen, und er brauchte es immer schnell und sofort, dieses Geld, und so sandte der Bischof seine Agenten, die es bar auf den Tisch legten. Für Prigny etwa hatte er nur ein Fünftel des tatsächlichen Wertes bezahlt. Herzog Johann wußte davon und hieß es stillschweigend gut, denn sein Kanzler verpachtete die Güter an Nichtadelige, und die mußten reichlich Abgaben an die herzogliche Kasse zahlen. Außerdem hatte Seine Hoheit schon begehrliche Blicke auf Ingrandes und Champtocé geworfen und die Bemerkung fallenlassen, wenn es an der Zeit sei, wolle er vielleicht diese schönen Besitzungen für seinen Sohn erwerben.
Ich werde dich nicht mehr aus den Augen lassen, Gilles de Rais, und mir wird erst wohl sein, wenn man dich als Bettler aus dem Land jagt. Doch dazu wird es vielleicht gar nicht kommen.
Malestroit holte ein anderes Blatt aus seinem großen vieltürigen Schreibschrank und ging damit zum Fenster. Sein Sekretär hatte vor kurzem die Klagen zusammengefaßt, die seit Monaten eintrafen aus Nantes, aus den Ortschaften der engeren und weiteren Umgebung. Und immer ging es darum, daß der Seigneur oder seine Vettern Sillé und Bricqueville, häufig auch seine Diener Henriet und Poitou, bei Eltern, Verwandten und Lehrherren Knaben angeworben hatten für den Kirchenchor, als Pagen oder Schloßdiener, und diese Leute waren stolz, daß die Kinder bei so einem großen Herrn lernen und arbeiten durften. So weit, so gut. Doch dann, als die wenigsten von ihnen zurückkehrten, keimten Argwohn und Mißtrauen auf. Anfragen in Machecoul, in Tiffauges oder Champtocé – in diesen drei Burgen hielt der Seigneur sich am häufigsten auf – wurden entweder gar nicht beantwortet oder nur mit Ausflüchten. War der Junge nach Machecoul gegangen, so hieß es, er befinde sich nun in Tiffauges; fragte man dort an, so verwies man auf Champtocé, und war er nicht da, so befand er sich auf der Reise von einem Ort zum anderen. Wer sich damit nicht abspeisen ließ, wie Perrine Loessart, die Mutter eines zehnjährigen Jungen, dem wurde trauervoll mitgeteilt, der kleine Page sei bei der Überquerung eines Flusses vom Pferd gestürzt, ertrunken und weggeschwemmt worden. Und das wiederholte sich, wieder und wieder: vom Pferd gestürzt, beim Apfelpflücken verunglückt, von einer Leiter gefallen, ertrunken, vom Pferd getreten, vom Jagdhund gebissen, von durchziehenden Gauklern geraubt – immer waren die Knaben tot oder verschwunden.
Malestroit schüttelte den Kopf. Er griff nach der Handglocke.
«Laß Maître Petit kommen!»
René Petit war ein junger, ehrgeiziger und talentvoller Jurist, Malestroits Privatsekretär und rechte Hand. Er stammte aus Tours, war der Sohn eines Notars, hatte in Paris die Rechte studiert und dort seine Magisterprüfung abgelegt. Als Malestroit einen tüchtigen Sekretär suchte, war ihm Petit von einem früheren Studienfreund, der jetzt in Paris Kirchenrecht lehrte, ausdrücklich empfohlen worden.
Der Magister trat ein, wie immer einfach, aber untadelig gekleidet, sein schmales gescheites Gesicht gesammelt und aufmerksam. Malestroit mochte diesen Menschen, weil er seine Arbeit ernst nahm, beherrscht, unbestechlich und loyal war.
«Monseigneur?»
«Setzt Euch zu mir, Petit, mir geht diese Sache da nicht aus dem Kopf.»
Er schob seinem Sekretär das Blatt über den Tisch. Der lächelte kurz.
«Das kenne ich, Monseigneur, ich habe es ja selber abgefaßt.»
«Ich kann’s einfach nicht glauben! Vielleicht haben einige dieser Eltern ihre Kinder versteckt, um aus Seigneur de Rais Geld zu pressen. Wo sollen sie denn sein, Dutzende von Knaben zwischen sechs und sechzehn Jahren? Sie können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben oder vom Seigneur zum Abendmahl verspeist worden sein? So etwas gibt es doch nicht! Was haltet Ihr davon, Magister?»
«Jedenfalls glaube ich nicht, daß so viele Eltern quasi zur gleichen Zeit auf den Gedanken kommen, Seigneur de Rais zu erpressen – ganz davon abgesehen, daß niemand es wagen würde. Ich halte aber etwas anderes für möglich: Der Marschall hat die Kinder verkauft.»
Malestroit riß die Augen auf und fuhr sich nervös über die Stirn.
«Verkauft? Wohin, an wen? Wer kauft schon Kinder?»
«So abwegig ist das nicht, Monseigneur. Frankreich ist durch den jahrzehntelangen Krieg mit England ausgeblutet, Pest und Hungersnöte haben ein übriges getan, um ganze Landstriche zu entvölkern. Nun geht es wieder aufwärts, aber wer etwas schaffen will, braucht dazu Menschen. Den Besitzern und Betreibern von Erzgruben, Salinen, Weinbergen und Obstgärten fehlen die Hände, um zu graben, zu schöpfen, zu schneiden und zu pflücken. Fällt Euch nicht auf, daß die meisten der Jungen im Alter zwischen zehn und vierzehn waren, gesund, kräftig? Keine schwachen und hungrigen Bettelkinder. Ich bin mir fast sicher, daß diese Burschen in einem anderen Teil von Frankreich als Arbeitssklaven und Leibeigene ein elendes Dasein führen. Wie ich Herrn de Rais einschätze, wird er alles tun, um sein aufwendiges Prasserleben so lange wie möglich weiterführen zu können. Er hat die Jungen verkauft, das halte ich für die wahrscheinlichste Möglichkeit.»
Malestroit nahm die Kappe ab und strich über seinen kahlen Schädel.
«So einleuchtend es auch klingt, Petit, mir will es nicht so recht in den Kopf. Aber ich gebe es gerne zu, daß mir auch nichts Besseres einfällt. Nur dürfen wir die Klagen dieser Eltern und Angehörigen nicht einfach in den Wind schlagen. Was Seigneur de Rais mit diesen Kindern auch immer getan hat – wir müssen es herausfinden. Und wenn es etwas Übles war, dann gnade ihm Gott!»
«Eines muß noch bedacht sein, Monseigneur. Die hier aufgeführten Klagen von Eltern, Verwandten und Lehrherren dürften nur ein Bruchteil dessen betreffen, was tatsächlich geschehen ist. Kein höriger Bauer aus Champtocé, Machecoul oder Tiffauges würde es wagen, seinen Feudalherrn zu verdächtigen oder ihn gar anzuklagen, ganz abgesehen von den zahlreichen Bettelkindern, die von Burg zu Burg, von Dorf zu Dorf ziehen. Selbst wenn die im Dutzend verschwinden, wird es keinen kümmern.»
Malestroit lächelte hintergründig.
«Jetzt habe ich Euch bei einem Denkfehler ertappt, Magister! Ihr selber habt vorhin gesagt, daß für einen Verkauf nur gesunde und kräftige Kinder in Frage kommen. Was also soll er mit schwachen, grindigen, nicht selten sogar verkrüppelten Bettlern?»
Petit sah den Bischof ruhig an.
«Ich bin ein wenig auf Spurensuche gegangen. Es sind sowohl Bauern- wie Bettelkinder verschwunden, dafür gibt es Zeugen und Beweise.»
Malestroit drohte mit dem Finger.
«Schau, schau, der Herr geht eigene Wege. Aber im Ernst: Ihr habt gut daran getan, Euch umzusehen, und ich möchte unsere Untersuchung erweitern und auf eine solide Basis stellen. Das denke ich mir so: Ich gebe Euch Geld und die nötigen Papiere – sie werden Euch zum Kommissar ernennen und das Siegel seiner Hoheit des Herzogs tragen – mit dem Auftrag, geheime Untersuchungen anzustellen, natürlich nur auf dem Hoheitsgebiet der Bretagne. Für die Besitzungen im Poitou und im Anjou werde ich eine andere Lösung finden. Aber achtet mir darauf, daß zunächst niemand erfährt, wonach Ihr forscht und in wessen Namen! Ihr sollt Euch umhören, unauffällig, mit Bedacht, quasi nebenbei, als ginge es um eine Bagatelle, etwa eine Steuersache. Sprecht mit den Leuten, deren Namen wir bis jetzt kennen, vielleicht trefft ihr auf Fälle, wo die Kinder wiedergefunden wurden – wer weiß? Seid freundlich, und wo es sein muß» – der Bischof rieb Daumen und Zeigefinger aneinander – «seid auch großzügig, aber denkt daran: nur kleine Münze. Ein höriger Bauer käme sofort in Verdacht, wenn er ein Goldstück wechseln ließe. Und, Magister, hört Euch alle an! Ganz gleich, ob es ein altes geschwätziges Weib ist, ein lallender Betrunkener oder die paar Worte eines verstockten Kindes. Versucht vor allem auch jene zum Sprechen zu bringen, die aus Angst vor dem Grundherrn sprachlos sind: die Bauern, Taglöhner, Schäfer, Winzer, Landarbeiter. Und bleibt um Gottes willen innerhalb der Grenzen des Herzogtums, aber das brauche ich Euch als Jurist ja nicht zu sagen. Dabei haben wir Glück, denn die meisten Klagen kommen aus dem Dreieck Nantes, Bourgneuf und Machecoul. Wir lassen uns Zeit, Magister, und die Zeit arbeitet für uns.»
Petit verneigte sich leicht, sein schmales gescheites Gesicht blieb unbewegt.
«Ich werde tun, was Ihr befehlt. Es wird etwas hinderlich sein, daß wir unsere Ermittlungen nicht auf Champtocé im Herzogtum Anjou und auf Tiffauges in der Grafschaft Poitou ausdehnen können, da einige Spuren auch dorthin führen. Aber ich sehe dennoch eine Möglichkeit.»
Malestroit beugte sich neugierig vor.
«Und die wäre?»
«Der Marschall hat sich vor kurzem einen Alchimisten aus Italien kommen lassen. Es geht das Gerücht, er wolle Gold machen und habe den Teufel beschworen.»
Malestroit schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Handglocke umfiel.
«Petit, ich könnte Euch umarmen! Wenn das stimmt, müßte die Inquisition zugezogen werden.»
Petit nickte.
«Und die ist an keinerlei Grenzen gebunden, eingesetzt vom Papst, allein der Kirche verantwortlich und nicht dem Landesfürsten, der sich ihr unterwerfen und sie unterstützen muß.»
«Der Landesfürst darf dann das Urteil verkünden und die weltliche Strafe vollstrecken.»
Malestroit sagte es her wie einen Gesetzestext.
«Ja, so steht es im ‹Manuel des Inquisiteurs‹ von dreizehnhundertsechsundsiebzig. Wir müßten uns also an Jean Blouyn, den Inquisitor für die Diözese Nantes wenden.»
«Das weiß ich selber», sagte der Bischof unwillig, doch er schien an etwas anderes zu denken. «Habt Ihr Euch schon Gedanken darüber gemacht, daß der Marschall de Rais allein durch seine weltlichen Vergehen – was immer er mit den Kindern gemacht haben mag – kaum zu fassen sein wird? Seine Kumpane werden beschwören, daß die kleinen Pagen beim Dienst verunglückt sind, und ihre Eltern werden ein paar écus Abfindung bekommen und sich daranmachen, neue Kinder zu zeugen. Das Delikt Sodomie wäre schon besser, aber die kleinen Zeugen sind verschwunden, und seine Diener werden schweigen. Auf diese Weise ist der Seigneur schwerlich zu fassen und kann bestenfalls zu einer Geldbuße verurteilt werden. Die zahlt er dann – wenn er sie überhaupt bezahlt – mit der linken Hand. Aber Teufelsbeschwörung …»
Der Bischof sah sehr zufrieden aus und fuhr fort:
«Übrigens, Petit, da seht Ihr wieder, was Ihr als Priester erreichen könnt. Als weltlicher Jurist habt ihr es schwerer, so tüchtig Ihr auch seid. Laßt Euch wenigstens zum Diakon weihen, tragt in der Öffentlichkeit ein geistliches Gewand und lebt weiter wie bisher. Ich meine es nur gut mit Euch. Schaut doch mich an! Glaubt Ihr, ich hätte es als sechster Sohn eines kleinen Landedelmannes zu mehr gebracht als zum Hauptmann der herzoglichen Truppe? Aber das geistliche Gewand öffnet alle Türen.»
«Monseigneur, da muß ich Euch mit allem Respekt vorwerfen, daß Ihr untertreibt. Nicht das geistliche Gewand hat Euch im Leben vorwärts gebracht, sondern ein scharfer Verstand, Loyalität, politisches Talent und ein kühler Kopf. Ihr hättet auch ohne die Tonsur Karriere gemacht.»
Malestroit lachte schallend, und Petit sah, daß es ihm schmeichelte.
«Von der Tonsur sieht man inzwischen nicht mehr viel. Aber in einem habt Ihr unrecht: Bischof von Nantes wäre ich nicht geworden. Ich sehe schon, Ihr hört auf diesem Ohr schlecht. Was stört Euch denn am geistlichen Stand?»
«Ich möchte später eine Familie gründen.»
«Das könnt Ihr auch so. Die meisten geistlichen Herren haben Frauen und Kinder – zur linken Hand. Läßliche Sünden, die man beichten kann.»
«Mir liegt so etwas nicht, Monseigneur, ich möchte lieber gerade Wege gehen.»
«Wie Ihr wollt, Magister.» Das klang ziemlich kühl.
Noch am selben Tag sandte der Bischof einen Boten in das Dominikanerkloster, wo der Inquisitor Jean Blouyn lebte und wirkte. Der ernannte den jungen Pater Robert Lesné zum Kommissar im Fall des Seigneurs de Rais und sandte ihn nach Nantes. Wenig später machte Bischof Malestroit die beiden Kommissare miteinander bekannt.
«Ihr, Magister Petit, seid der weltliche Arm der Gerechtigkeit und Ihr, Bruder Robert, der geistliche. Ihr sollt Hand in Hand zusammenarbeiten, euch von Zeit zu Zeit absprechen, die Ermittlungen koordinieren, mir gemeinsam Bericht erstatten, aber niemals gemeinsam auftreten.»
Die blauen Augen des jungen Paters strahlten vor Eifer. Sein sommersprossiges Gesicht rötete sich leicht.
«An mir soll es nicht liegen! Ich fürchte weder Tod noch Teufel und habe Gott gelobt, das Böse auszurotten, und als gehorsames Werkzeug der Heiligen Inquisition werde ich mich nicht schonen.»
Malestroit verkniff sich ein Lächeln und zwinkerte seinem Sekretär unauffällig zu.
«Nun, Magister Petit, was habt Ihr dem entgegenzusetzen?»
«Nichts, Monseigneur, als meinen weltlichen Eifer, die Verbrechen des Seigneur de Rais – falls er welche begangen hat – nach besten Kräften aufzudecken, um ihn seiner Strafe zuzuführen.»
«Gut, meine Herren. Ihr, Pater Lesné, seid hiermit entlassen. Geht zur Kasse und laßt Euch zwanzig écus d’or auszahlen. Das dürfte für die ersten Monate genügen.»
Als Lesné verschwunden war, sagte Jean Petit:
«Mir habt Ihr dreißig geben lassen; warum wird der Pater benachteiligt?»
«Ihr seid ein rechter Quälgeist, Petit, und wollt immer alles genau wissen. Pater Robert kann bei seinen Ermittlungen in Klöstern übernachten und wird dort auch verpflegt, während Ihr auf Herbergen und Gasthäuser angewiesen seid.»
«Dann ist es gerecht.»
«Eben. Ehe Ihr Euch auf den Weg macht, wünsche ich ein curriculum vitae unseres Verdächtigen, so ausführlich wie möglich. Was Ihr nicht wißt, könnt Ihr später im Laufe der Ermittlungen ergänzen. Wir müssen diesen Herrn von Grund auf kennenlernen – er muß für uns im Sinne des Wortes ‹faßbar› sein. Verstehen wir uns, Magister?»
«Absolut, Monseigneur, Ihr könnt Euch auf mich verlassen. Aber eines muß ich noch wissen. Wo soll mein Bericht beginnen? Bei den Eltern? Bei den Großeltern?»
«Gilles’ Eltern starben früh, er wurde vom Großvater erzogen. Ich kannte diesen Jean de Craon – ein finsterer, habgieriger und gewalttätiger Mann. Alle Welt fürchtete ihn, und er genoß es. Er war ein Verbrecher, schlau, tückisch und zu allem bereit. Vielleicht hat er sein böses Blut an den Enkel weitervererbt? Nun, Magister, macht Euch an die Arbeit.»
Der Bischof mußte nicht lange auf den Bericht warten, und dieser begann vor etwa dreißig Jahren mit Gilles’ Großvater, dem finsteren und habgierigen Seigneur de Craon.
2
Jean de Craon galt – nächst dem Herzog – als der reichste Lehensmann im Anjou. Meist residierte er in seiner festen Burg Champtocé, die auf einem Höhenrücken über der Loire thronte und von deren hochragendem schlanken Südturm ein Wächter Tag und Nacht den Fluß kontrollierte. Craon erhob Zölle von den Schiffen, doch er tat dies in der Art eines Freibeuters – gewalttätig, wucherisch, die Landesgesetze mißachtend.
Aus der Grafschaft Anjou war 1380 ein Herzogtum geworden, und in der Residenz des Herzogs Ludwig in Angers häuften sich die Klagen über den räuberischen Lehensmann. Doch es geschah nicht viel, weil der Herzog sich schon seit Jahren bemühte, die Königskrone von Neapel an sich zu bringen und sich nur selten in seinem Stammland aufhielt.
In dieser windigen, von Regenschauern durchpeitschten Herbstnacht des Jahres 1404 hatte Jean de Craon andere Sorgen, als auf die Loireschiffer zu achten. Seine Tochter Marie lag seit Stunden in den Wehen, und Seigneur Jean tat, was er lange nicht mehr getan hatte: Er kniete in der Burgkapelle vor einer Statue der Schmerzhaften Gottesmutter und versuchte zu beten, aber ihm fiel nur das Vaterunser ein. Und so murmelte er die alten heiligen Worte, ohne ihren Sinn zu erfassen, ohne seine Seele Gott zu öffnen.
Alles, was von ihm bisher geplant und in die Wege geleitet worden war, hatte sich in seinem Sinn weiterentwickelt. Als er im Februar seine einzige Tochter mit Guy de Laval verheiratete, war dieser Hochzeit ein Meisterstück an Lug und Betrug vorausgegangen. Der Bräutigam hatte nach langem Hin und Her seine Verwandte, die kinderlose Jeanne de Chabot beerbt, deren umfangreicher Besitz im Pays de Rais südlich von Nantes lag und deren Bedingung es war, daß der Erbe Siegel und Titel der Herren von Rais führte. Kurz vor ihrem Tod überlegte es sich die Edeldame anders und hinterließ ihren Besitz der Familie de Craon. Guy de Laval drohte mit Prozessen. Schließlich einigte man sich auf die einfachste Lösung: Ein Laval heiratet eine Craon, und das Ehepaar wird Namen, Titel und Siegel der Herren von Rais führen.
Und du, mein ungeborener Enkel, wirst dies alles erben, und ich werde, solange ich lebe, dafür sorgen, daß es mehr wird – mehr – mehr – mehr! Das klang nun nicht mehr nach einem Gebet. Jean de Craon erhob sich, schlug ein Kreuz und neigte seinen kantigen Schädel mit der arrogant vorspringenden Nase. Er ging hinüber zum Palast, hörte die Schreie der Gebärenden und nickte zufrieden. Der künftige Herr von Rais will ans Licht! Daß es ein Mädchen sein könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Er blickte zum Himmel. Die Sonne hatte sich hinter Wolkenbergen verkrochen, aber ein heller Schein verriet ihren ungefähren Stand. Das war wichtig, weil Jean de Craon einen Astrologen konsultieren wollte, wie es unter den besseren Leuten allgemein üblich war. Taufe und Horoskop, das gehörte zusammen, und niemand fand etwas dabei. Er beschleunigte seinen Schritt, nahm zwei Stufen auf einmal und traf vor der Tür des Gebärzimmers seinen Schwiegersohn. «Nun?»
«Es muß jeden Augenblick dasein.»
«Wenn du ihr keinen Sohn gemacht hast, drehe ich dir den Hals um!»
Guy de Rais ging nicht darauf ein, weil er wußte, daß der Alte nur darauf aus war, einen Streit vom Zaun zu brechen – auch hier vor der Tür seiner gebärenden Tochter. Guy war in allem der Gegensatz zu seinem Schwiegervater: großzügig, nicht nachtragend, belesen und von einer stillen Frömmigkeit, die sich nicht aufdrängte.
«Du bist ein Schlappschwanz!» hatte er oft von dem Alten zu hören bekommen. Doch da zuckte er nur die Achseln und sagte: «Dafür haben wir dich in der Familie, einen Ritter ohne Furcht und Tadel.» Craon entging die Ironie, und er nahm eine solche Bemerkung als bare Münze, so schlau er sonst auch war.
Hinter der Tür der Wochenstube war es still geworden. Dann setzte ein schrilles dünnes Greinen ein, und die beiden Männer traten zurück. Eine Ewigkeit verging, bis die Tür sich öffnete.
«Ihr habt einen Sohn, Seigneur de Rais!»
Die Amme trat zurück und öffnete weit die Tür. Trotz der Mittagsstunde war der Raum nur schwach erleuchtet, denn draußen jagten schwere Regenwolken über das Tal der Loire, und aus dem Süden klang schwaches Donnergrollen.
Die Dame de Rais lag bleich und erschöpft in ihren Kissen, das schweißverklebte Haar hatte die Zofe notdürftig gekämmt, und es umgab ihr schmales Gesicht wie einen dunklen Rahmen. In ihrem rechten Arm ruhte der Sohn.
Seigneur Guy beugte sich über seine Gemahlin und küßte sie sanft auf die Stirn – eine zarte, fast schüchterne Geste, die Jean de Craon abstieß wie alles, was mit Güte, Rücksichtsnahme und Zärtlichkeit zu tun hatte. Schroff wandte er sich ab und sagte zur Amme, die bei der Tür stand:
«Auswickeln! Ich möchte sehen, ob es seine Richtigkeit hat.»
Guy de Rais wollte etwas sagen, doch seine Frau legte schnell einen Finger über ihren Mund.
«Kommt nur, Vater, seht Euch den Enkel an.»
Die Amme wickelte das Kind behutsam aus, und da lag es nun, nackt und bloß wie eine geschälte Frucht, und der Alte ergriff mit zwei Fingern den Penis. Er lachte laut und grob.
«Schon ganz schön was dran! Wenn der so weitermacht, vergewaltigt er mit fünf Jahren seine Amme.» Stolz blickte er sich um, aber da niemand etwas sagte, stapfte er wortlos hinaus. Dabei murmelte er grimmig: «Ich werde schon dafür sorgen, daß mein Enkel nicht so ein frömmelnder Jammerlappen wird wie sein Vater …»
Marie de Rais liebte ihren Vater trotz alledem, verzieh ihm vieles, war ihm ähnlicher, als sie selber wußte. Für sie war er ein strenger mächtiger Patriarch, der schützend seine starke Hand über die ganze Familie hielt. In die Zweckehe mit Guy de Laval hatte sie sich gehorsam gefügt, und sie dankte Gott, daß ihr Gemahl rücksichtsvoll, ritterlich und zärtlich war. Es bedeutete für sie ein neues Erlebnis, da sie ihr Bild vom Mann nur nach dem Vater ausgerichtet hatte.
Jean de Craon ließ den Schreiber kommen und diktierte ihm eine lange Liste von Verwandten und Nachbarn, die er zur Taufe laden wollte. Sein eigener Sohn Amaury diente am Herzoghof in Nantes als Page, aber seit der Geburt seines Enkels stolzierte der Alte herum, als habe er das Kind gezeugt, als vertrete er Vaterstelle an dem kleinen Gilles.
Zur Taufe in der Dorfkirche von Champtocé kamen sie alle, von nah und fern, die Träger der Namen Laval, La Suze, Montmorency, Craon, Sillé, Hunaudaye, Thouars und andere. Fast alle waren sie mit Gilles de Rais – aber auch untereinander – verwandt, und nicht wenige waren verfeindet, manche schon seit Generationen. Immer ging es dabei um Besitz, um Erbschaftsansprüche, um einen Kuchen, der nicht größer wurde, von dem aber jede Familie sich die größten Stücke absäbeln wollte und dabei keine Tücke, keine Gewalttat scheute.
Jetzt zogen sie ganz manierlich hinter- und nebeneinander in die niedrig hingeduckte Dorfkirche und stellten sich dort, jeder mit einer brennenden Kerze in der Hand, um den Altar auf.
«Von dem, was der einmal erben wird, möchte ich nur ein kleines Stück», flüsterte ein junger Edelmann seinem Vater zu. Der zuckte die Schultern.
«Von drei Kindern erleben zwei ihr drittes Jahr nicht. Schon so mancher stolze Erbe ist in die Grube gefallen, noch ehe er der Ammenbrust entwöhnt war.»
Doch der kleine Gilles wuchs gesund heran, war ein eher stilles, folgsames Kind, das keinem in der Familie Sorgen bereitete, ausgenommen dem Großvater, dem ein rauher, störrischer und weniger gehorsamer Junge lieber gewesen wäre. Er hatte einen Boten an Magister Bernardus gesandt, einen angesehenen Astrologen in Nantes, der insgeheim sogar den Herzog beriet. Freilich, die Kirche stellte sich seit Jahrhunderten gegen die Astrologie, denn Gottes Wille und nicht der Lauf der Sterne bestimmte das Schicksal des Menschen. Dem begegnete Bernardus mit dem Einwand, Gott sei es, der die Gestirne bewege und sie als eines seiner Instrumente benutze, um auf die Menschen einzuwirken, wie er dies auch durch Blitz, Sturm, Erdbeben und Wasserfluten tue, die ihm als Strafmittel dienten. Dem war kaum etwas entgegenzusetzen, um so mehr, als Magister Bernardus ein streng christliches Leben führte, keinen Kirchgang, keine Osterbeichte versäumte, die Fastenzeiten einhielt und seiner Pfarrei namhafte Beträge zur Armenpflege spendete.
Bernardus also stellte seine Berechnungen an, um die Nativität des am 22. November 1404 geborenen Gilles de Rais zu berechnen. Er beschäftigte einen jungen Eleven, der die Routine-Arbeiten erledigte – die langwierigen Berechnungen der Häuser und Planetenstände –, während der Meister selber das Horoskop zeichnete und alle Daten eintrug. Jedenfalls verstand der Eleve genug vom Metier, um eine bedenkliche Miene aufzusetzen.
«Der arme Bursche ist aber schlecht dran. Um diese Nativität braucht ihn keiner zu beneiden.»
Magister Bernardus, der die Namen seiner Kunden auch vor dem Eleven geheimhielt, sah mit einem Blick, daß es sich da in der Tat um etwas Außergewöhnliches handelte.
«Du darfst heimgehen, es wird ohnehin schon bald dunkel. Ich mache alleine weiter.»