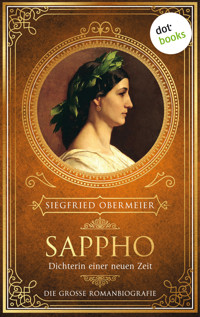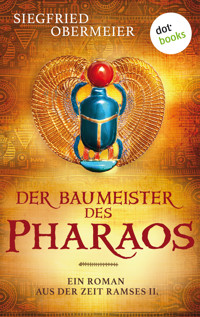4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender historischer Roman über Spanien und Portugal zur Zeit Don Juans ›Don Juan‹ entführt seine Leser in die faszinierende Welt des mittelalterlichen Sevilla, Granada, Coimbra und Santarém. In eindrucksvollen Bildern lässt Siegfried Obermeier eine bewegte und grausame Epoche lebendig werden, in der die Lebensgeschichte des Don Juan de Tenorio spielt. Er ist ein von der Macht Verführter, ein Verlorener, der die ewige Liebe sucht und doch unfähig ist zu lieben. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 937
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Siegfried Obermeier
Don Juan
Der Mann, den die Frauen liebten
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei Fischer Digital
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-560288-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dieses Buch ist all [...]
Buch I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Buch II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Danksagung
Dieses Buch ist all jenen Leserinnen gewidmet, die Don Juan für das Urbild des rücksichtslosen und immer siegreichen Verführers halten.
Genau betrachtet aber war er der ewige Verlierer.
Buch I
Der Hochmut leiht dir böser Pläne Glauben:
die Reisenden der Schätze zu berauben,
die Fraun, selbst Ehefraun, zu nehmen mit Gewalt,
und Jungfern gar und Nonnen, jung und alt.
Durch Hochmut fiel ein ganzes Menschenheer.
Die Engel selbst – vereint mit Luzifer,
dem undankbaren Wesen so zuwider –,
sie fielen tief aus Himmelshöhn hernieder.
Sehr viele, deren Sein der Wohlstand würzt,
durch Hochmut werden sie gestürzt;
wie viele könnte ich auf tausend Blättern nennen,
die so in ihr Verhängnis rennen.
Wie viele Kriege, Schlachten, Metzelein,
grässlicher Zank, blutige Streiterein
besteht der Mensch, weil du sie stiftest
und so die ganze Welt vergiftest.
Juan Ruiz (ca. 1283–1350)
aus «El libro de buen amor»
1
Das Zwillingspärchen Maria und Juan hatte seine Geburt weniger einem Akt der Liebe als der Tatsache zu verdanken, dass Jofré Tenorio, almirante eines Teiles der kastilischen Armada, in jenen friedlichen Tagen zur Untätigkeit verdammt war. Es hatte auch damit zu tun, dass König Alfonso aus seiner Residenz Burgos ins ferne Sevilla gezogen war, weil er dort Granada, dem letzten maurischen Königreich auf der iberischen Halbinsel, näher war und den ihm ohnehin schon tributpflichtigen Sultan Mohamed besser im Auge behalten konnte. Bis jetzt hatte Don Jofré vergeblich auf einen Ruf seines Königs gehofft und das hatte ihn unleidlich und ungeduldig werden lassen.
Die Ehe des almirante war bereits mit zwei kräftigen Söhnen gesegnet – nicht gerechnet die drei anderen, schon im Säuglingsalter verstorbenen Kinder. Die beiden jungen Männer standen – das verstand sich von selbst – im Sold des Königs und hatten bei Truppe und Armada ihren Dienst – dort unten, weit im Süden …
Don Jofré seufzte. Er rannte im Zimmer auf und ab und jedes Mal, wenn er Doña Ana, seiner Gemahlin – sie saß im Erker und stickte – näher kam, stieß er empörte Bemerkungen aus, um dann, keine Gegenrede erwartend, sich schnell umzudrehen und wieder in Richtung Tür zu rennen.
«Weiß der König überhaupt, dass es mich noch gibt? Ha? Dass im Hafen von Caronium ein Teil seiner Flotte liegt? Ha?»
Doña Ana schaute kurz auf und versuchte ihren Blick verständig und zustimmend zu machen, nicht teilnehmend oder mitleidig – o nein, das hätte sofort seinen Zorn erregt.
Doña Ana, klein, rundlich und von sanftem, aber auch beharrlichem Wesen, hatte den so genannten Freuden des Ehebettes nie sehr viel abgewinnen können und war – wenn sie es auch nicht zeigte – doch recht erleichtert gewesen, als ihr Gemahl sie seit einigen Jahren unbehelligt ließ. Sie näherte sich dem vierzigsten Jahr und war alles in allem genommen mit ihrem Leben auf dem Landgut bei Sobrado – einige Meilen südlich von Caronium gelegen – recht zufrieden.
Zu tun gab es genug. Einige kleinere Dörfer mit Pachtbauern gehörten zu dem Anwesen, auch eine größere Olivenpflanzung und ein etwas unergiebiger Weinberg, den Don Jofré eigensinnig hegte und pflegte und dessen Säuerling er seinen Gästen als einen guten Tropfen – ja, so nannte er ihn tatsächlich – kredenzen ließ. So sehr er dies alles schätzte, seine Familie hochhielt und seine Zeit an Land nur hier verbrachte – sein Herz hing doch mit aller Inbrunst an der ihm anvertrauten Flotte und wenn die Schiffe monatelang nur im Hafen dümpelten, dann geriet Don Jofré in den vorhin genannten Zustand.
Um diese Zeit hatte sich der Frühling nun mit aller Macht durchgesetzt. Die düsteren Regentage waren seltener geworden und wenn es am Morgen eine Stunde goss, dann schien wieder die Sonne und ihr heißer Atem sog die Nässe weg, ehe man sich dreimal umdrehte.
«Ich muss irgendetwas unternehmen!», rief Don Jofré und raufte sich den schon seit Tagen nicht mehr gepflegten Seemannsbart, der sonst kurz geschnitten sein breites, etwas bäurisches Gesicht rahmte. Eigentlich war es Siestazeit und er hätte sich etwas ausruhen müssen, umso mehr, als ihm die üppigen Speisen und der etwas reichlich genossene Wein schwer in den Gliedern lagen.
Er blieb vor seiner Frau stehen und räusperte sich. «Es wird etwas warm, die Sonne hat schon eine ziemliche Kraft – ich glaube … ich glaube, wir sollten uns etwas hinlegen – was meinst du?»
Doña Ana stand gehorsam auf. «Haben wir das nicht immer um diese Zeit getan?»
Er blickte sie verwirrt an. «Ja – gewiss …»
Er hätte Mühe gehabt, seine Gefühle zu erklären, aber von solchen heiklen Dingen war zwischen den Eheleuten ohnehin nie die Rede gewesen. Gerade heute hatten sich verschiedene Ereignisse zusammengefunden, die in Jofré Tenorio etwas entfachten, das er längst für überwunden glaubte, nämlich die Lust mit seiner angetrauten Gemahlin geschlechtlichen Umgang zu pflegen. Wenn er von Zeit zu Zeit im Hafenviertel von Caronium in ein Hurenhaus ging, dann nannte er es in der Männerrunde seiner Seekapitäne «eine aufs Kreuz legen» oder «wieder einmal anständig vögeln», aber was er und die anderen mit ihren Frauen machten, wurde weder beredet noch kommentiert, und selbst wenn – wie jetzt – Don Jofré daran dachte, dann formulierten sich nur schickliche Worte in seinem Kopf.
Seit eh und je hatten sie ihre Siesta in unterschiedlichen Räumen verbracht – sie im ehelichen Schlafgemach, er in seinem kleinen Arbeitsraum auf dem schmalen Feldbett.
Don Jofré fasste seine Frau an der Hand. «Ich werde dich begleiten, querida …»
Doña Ana blickte auf, erschrak fast über das ungewohnte Kosewort, errötete leicht und senkte dann ihr zierliches Haupt, dessen Haare schon da und dort silbrig glänzten.
Er machte dann nicht an der Türe zur alcoba kehrt, um in sein eigenes Zimmer zu gehen, sondern betrat mit ihr den kühlen dämmrigen Raum, wo er die zuerst Sprachlose auszukleiden begann – so ungeschickt und fahrig, dass sie ihm zur Hand ging.
«Aber Jofré – nein – ich weiß nicht recht … das gehört sich doch nicht … so mitten am Tag …»
Er schwieg, führte sie zum Bett, breitete die fast Willenlose hin wie ein Kleidungsstück, doch dann – als erinnere sie sich ihrer Pflichten als christliche Ehefrau – spreizte sie ihre recht üppigen Schenkel, drehte den Kopf zur Seite, schloss die Augen und betete in Gedanken ein Ave Maria.
Was sich heute in Don Jofré angestaut hatte, die frühsommerliche Hitze, die gewürzten Speisen, der schwere Wein, dazu Bitterkeit und Ungeduld über das Schweigen des Königs und die erzwungene Untätigkeit, dies alles bündelte sich nun in seinem Bauch und machte sein Geschlecht jenem Besenkraut gleich, dessen Fruchtkapseln – wenn sie ausgereift sind – bei der kleinsten Berührung platzen und ihre Samen weithin verstreuen. Nicht anders erging es Don Jofré, dessen Erguss so mächtig war, dass – als Doña Ana später aufstand – ein Rest davon aus dem übervollen Schoß lief und auf ihrem Schenkel eine silbrige Spur zeichnete.
Von da an gab sich der almirante ruhig und gelassen.
Doña Anas leise Befürchtung, der Liebestrieb ihres Gatten sei wieder so stark erwacht wie in den Jahren ihrer jungen Ehe, erwies sich als grundlos. Don Jofré tat, als sei nichts gewesen, und verbrachte seine Siesta wieder in dem mit Seekarten, Bordbüchern und nautischen Messgeräten voll gestopften Arbeitszimmer.
Als zwei Wochen später ein Bote mit der Nachricht erschien, dass sich Piratenschiffe des Königs von Marokko im Golf von Biscaya gezeigt hätten, nahm er diese Botschaft hin, als habe er sie längst erwartet.
Auf diese Nachricht hin ritt Don Jofré sofort nach Caronium und befahl die Kapitäne seiner Flotte in das am Hafen gelegene Haus der Admiralität. Die Piratenflotte hatte – so viel wusste man bis jetzt – auf der Höhe von Bilbao zwei Handelsschiffe aufgebracht, beraubt und versenkt und sei jetzt wieder auf dem Weg nach Westen, vielleicht auf der Höhe zwischen Santander und Gijon.
«Wie viele unserer Schiffe sind zum Auslaufen bereit?»
Auf diese Frage ihres Admirals duckten sich einige Köpfe, denn die lange Untätigkeit und die Abwesenheit des Befehlshabers hatten Zustände einreißen lassen, die einer kastilischen Armada schlecht anstanden.
So begann gleich am nächsten Tag ein heftiges Sägen, Hämmern und Klopfen, das den Hafen mit Lärm, auch mit Unruhe erfüllte, weil die vielen Zimmerleute, Segelmacher, Nagelschmiede, Seiler und deren Hilfskräfte überall herumwimmelten.
Sie hätten sich gar nicht so beeilen müssen, denn die maurische Flotte ließ sich Zeit, kreuzte im Golf herum, um dann und wann bei kleineren unbefestigten Ortschaften anzulegen, um sie auszurauben. Freilich, für die Bevölkerung war Zeit genug, ins Hinterland zu fliehen, aber was nicht niet- und nagelfest war, nahmen die Piraten mit und setzten dann zum Abschied noch den roten Hahn aufs Dach.
Als sie dann – gegen Ende Juni – doch auf der Höhe von Caronium auftauchten, schien es offensichtlich, dass sie nicht daran dachten, diesen für sie gefährlichen Kriegshafen anzusteuern.
Wenige Tage zuvor hatte Jofré Tenorio aus einem Schreiben seiner Frau erfahren, dass sie guter Hoffnung sei. So stiftete der almirante für seine Kapitäne und Steuerleute ein Fass guten Weines aus Campados, um seine werdende Vaterschaft zu feiern.
Schon etwas trunken rief er: «Da weiß man wenigstens, wofür man kämpft!»
«Kämpft?», fragte es mehrfach erstaunt zurück.
Don Jofré erhob sich. «Ja, glaubt ihr denn, meine Herren, dass wir dieses maurische Räubergesindel ungestraft mit seiner Beute abziehen lassen?»
Viele hatten es geglaubt, denn nach allem, was man erfahren hatte, waren es an die dreißig Schiffe, während die kleine Armada im Hafen von Caronium es höchstens auf ein Dutzend brachte. Das waren leichte schnelle Schiffe, zwar geeignet, auch schwere große Kriegsgaleonen mit Brandpfeilen zu beunruhigen, ohne sich der Gefahr auszusetzen, verfolgt und angegriffen zu werden, untauglich jedoch für eine wirkliche Seeschlacht.
Don Jofré Tenorio hatte den tollkühnen Plan gefasst, die feindliche Flotte mit seinen schnellen Schiffen zu umkreisen und sie dabei mit Brandpfeilen unter Dauerfeuer zu setzen. Deshalb besetzte er jedes seiner Schiffe mit ausgesucht guten Bogen- und Armbrustschützen und belud sie mit einem großen Vorrat an Pfeilen und Brandpech.
Am frühen Morgen des nächsten Tages kam die feindliche Flotte in Sicht, aber noch ehe die Kapitäne den Plan des almirante durchführen und die großen Schiffe einkreisen konnten, hatte man dort die schweren arcubalistas am Heck verankert, und dann kamen die großen Brandpfeile geflogen. Diese Wurfmaschinen waren einer Armbrust nachgebildet, hatten aber die Größe eines Pferdegespanns und mussten von zwei Mann bedient werden. Doch sie schossen fünfmal weiter, als Bogen- oder Armbrustschützen es vermochten, und zwar Pfeile von der Länge einer Lanze.
Es dauerte nicht lange, dann brannte die gesamte kastilische Flotte lichterloh, und die Männer waren so sehr mit dem Löschen beschäftigt, dass sie zu spät das Nahen von sechs der mittelschweren feindlichen Galeonen wahrnahmen. Diese fuhren mit ihren bronzeverstärkten Bugen in die kleinen Schiffe wie Messer in einen Brotlaib. Als die Moros zwei Stunden später ihre Fahrt wieder aufnahmen, hinterließen sie von der kastilischen Armada nur rauchendes verkohltes Kleinholz und die dazwischen treibenden Leichen halb verbrannter Männer.
Der almirante Don Jofré Tenorio kam um, als ihn eine herabfallende Segelstange bewusstlos schlug und er ins Meer stürzte. Das kalte Wasser brachte ihn noch kurz zum Bewusstsein, doch er konnte – wie fast alle Seeleute – nicht schwimmen.
«Gott segne mein ungeborenes Kind …» Mit diesen geflüsterten Worten versank Don Jofré im salzigen Wasser des Atlantik. Von ferne war gerade noch die gewaltige Granitmasse des Cabo Finisterre zu erkennen, das einer der jungen schwimmkundigen Seeleute nach mehreren Stunden zu Tode erschöpft erreichte. Als einziger Überlebender und Unglücksbote erschien er wenig später in Caronium und überbrachte die schreckliche Nachricht.
Als Doña Ana vernahm, dass sie nun Witwe sei und ihr Kind – das sie für November erwartete – seinen Vater niemals kennen lernen würde, begann sie mit Gott zu hadern.
Da sie einige Sonntage weder zur Messe noch zur Beichte erschienen war, kletterte Don Silvio, der alte Stadtpfarrer von Sobrado, auf seinen alten Maulesel und beide – Tier wie Mensch – legten den steinigen Weg von einigen millas unter Ächzen und Stöhnen zurück, während eine feurige Augustsonne das karge hügelige Land erbarmungslos durchglühte.
«Wenn ich Euch meine Tochter nenne, Doña Ana, dann nicht nur aus meiner priesterlichen Autorität, sondern weil ich schon fast siebzig bin und tatsächlich Euer Vater sein könnte. Nennt mir also den Grund, warum Ihr das Haus des Herrn seit einiger Zeit meidet.»
Sie blickte ihn mit ihren etwas hervorquellenden, vom vielen Weinen geröteten Augen an. Ihr rundes faltenloses Gesicht, das früher immer so gerne gelächelt hatte, war versteinert, der Mund schmerzlich nach unten gezogen.
«Könnt Ihr Euch das nicht denken, Don Silvio? Solange ich nicht weiß, warum mich der Herr so schwer gestraft hat, möchte ich sein Haus nicht betreten – vielleicht wäre es ihm auch gar nicht recht? Bin ich eine Sünderin, die Strafe verdient? Ich weiß es nicht …»
Der Priester räusperte sich, hob mit zittriger Hand den Weinbecher und tat geräuschvoll einige Züge. Als er das Gefäß langsam zurückstellte, benutzte er beide Hände und lächelte entschuldigend.
«Ihr seht, ich werde alt … Nun, Euer Gemahl war um einiges jünger und Ihr wollt wissen, warum der Herr ihn zu sich geholt hat. Ich weiß es nicht, denn Gottes Wille ist unerforschlich, aber mein armer Menschenverstand sagt mir, dass er es nicht ohne Grund getan hat. Euer Gatte war ein kühner Krieger, und – wenn ich das sagen darf – außer mit Euch mit seiner geliebten See vermählt. Er hat sich entschlossen und mutig mit unterlegenen Kräften den Ungläubigen entgegengeworfen, und vielleicht hat ihn der Herr dafür mit einem schnellen Tod belohnt. Könnt Ihr Euch Don Jofré vorstellen, wie er hilflos ans Bett gefesselt dem Tod entgegendämmert? Ich nicht, meine Tochter – ich nicht! Und zudem hat Euch Gott nicht nur etwas genommen, sondern Euch auch das schönste und kostbarste Geschenk gemacht, das – neben der ewigen Seligkeit – uns Menschen zuteil werden kann: Er hat Euren Leib gesegnet und das in einem Alter, da Frauen kaum noch fruchtbar sind. Gott hat Euch auserwählt, meine Tochter, und Ihr meidet sein Haus! Denkt an die Geschichte von Elisabeth und Zacharias, wie sie uns der Evangelist Lukas erzählt. Beide waren sie schon betagt und dennoch gebar Elisabeth Johannes den Täufer, weil Gott es so wollte. So erkennt auch in Eurer naturwidrigen Schwangerschaft die Absicht Gottes, der Euch keineswegs strafen will, sondern Euch ein Geschenk macht, so dass Euer Gemahl nicht nur als Seele im Himmel, sondern auch im Blut seines Kindes fortleben wird.»
«Ich habe schon zwei Söhne, Don Silvio …»
Der alte Priester winkte ab. «Die gehören Euch nicht mehr, sie sind fern und leben ihr eigenes Leben. Euer Kind aber – glaubt mir, meine Tochter – wird Euch über alles hinwegtrösten, doch zuvor solltet Ihr Euch mit Gott versöhnen.»
Der kluge Don Silvio hatte den richtigen Ton angeschlagen und er sah ihr an, dass er sie schon halbwegs gewonnen hatte.
«Aber muss ich mich nicht schämen vor den anderen Witwen? Diese Frauen besuchen nach der Messe die Gräber ihrer Gatten, beten dort, legen Blumen nieder …»
Ah – das ist es, dachte Don Silvio fast belustigt. Er berührte mit einer liebevollen Geste ihre rundliche Hand.
«Auch daran habe ich gedacht. Wir werden einen namhaften Künstler beauftragen, Eurem Gemahl ein Epitaph zu schaffen, das wir neben dem Altar in die Kirchenwand einfügen werden. Seine Verdienste sollen dort aufgezeichnet werden, und wenn Ihr mich dazu beauftragt, werden an seinem Namens- wie an seinem Todestag feierliche Messen gelesen.»
In diesem Augenblick fühlte Doña Ana, wie das Kind sich zum ersten Mal in ihrem Leib regte. Da brach sie in Tränen aus, kniete nieder und küsste Don Silvios runzelige Hand. Der zeigte sich gerührt, stand auf und half ihr wieder auf die Füße.
Von da an war Doña Anas ganzes Trachten auf die bevorstehende Geburt gerichtet. Sie machte sich bei den Pachtbauern kundig, wo eine gesunde junge Frau etwa um die gleiche Zeit gebären würde, hielt zugleich Ausschau nach einer tüchtigen ama, einem Kindermädchen, das Tag und Nacht um das Kleine sein würde. Da brauchte sie nicht lange zu suchen, denn die Witwe eines vor zwei Jahren verstorbenen Schafhirten lebte noch auf dem Gut, eine tüchtige Frau, die sich als Mädchen für alles nützlich – ja, fast unentbehrlich gemacht hatte. Ihr verstorbener Mann war zugleich ein Heilkundiger gewesen, der jedes Kraut zu benennen wusste und seine geheimen Kräfte kannte. Er verstand es, Glieder einzurenken, Wunden auszubrennen und hohes Fieber nach wenigen Tagen zu bannen. Magdalena hatte sich viel davon angeeignet, und wenn es nicht gerade um Leben oder Tod ging, zogen die Gutsherren es vor, sie zu den Kranken zu rufen – auch, anders als ihren Mann, zu den Gebärenden.
Als ihre Niederkunft – es war Ende Oktober – bald bevorstand, ließ Doña Ana die heilkundige Lena rufen.
An dieser Frau war nichts Liebedienerisches oder Geducktes. Erhobenen Hauptes trat sie ein, stämmig und ihre eher zierliche Herrin fast um Haupteslänge überragend. Ihr ovales, bräunliches Gesicht war von Blatternarben gezeichnet, aber keineswegs entstellt. Sie verliehen ihren Zügen etwas Herbes und Bestimmendes, was ihrem Verhalten den Kranken gegenüber entsprach. Wenn einer es wagte, den Kräutertrank nicht zu schlucken, die kalten Kompressen abzustreifen oder sich dem Brandeisen bei einer schwer heilenden Wunde zu entziehen, dann brach sie ihre Behandlung ab.
«Setz dich, Lena!»
Sie schüttelte den Kopf. «Das gehört sich nicht, dueña …»
Lena nannte Doña Ana nie beim Namen, sondern immer nur dueña – Herrin.
«Was sich gehört, bestimme in meinem Haus nur ich!»
So nahm Lena Platz auf der äußersten Stuhlkante, aufrecht und unbewegten Gesichts.
«Du weißt, dass ich bald mein Kind zur Welt bringe, und ich habe mich entschlossen, keine comadrona aus der Stadt zu rufen, sondern dir das Amt einer Hebamme anzuvertrauen.» Sie lächelte. «So neu ist das ja nicht für dich?»
«Nein, dueña, wenn ich bisher auch nur beim Gesinde …»
«Ach Gott, Lena, Frau ist Frau – beim Gebären sind wir doch alle gleich. Du sollst dich dann auch weiterhin um das Kleine kümmern, als ama, bis es eben den Kinderschuhen entwächst.»
Lena neigte leicht ihr Haupt. «Es ist eine Ehre für mich, dueña.»
«Die du dir redlich erworben hast!»
Von da an lebte die tüchtige Lena im Haus, und ihr kundiges Auge schätzte den Zeitpunkt der bevorstehenden Geburt ab. Was sie etwas verwirrte, war der gewaltige Bauch ihrer Herrin. Gut, die kleine Gestalt der Doña Ana ließ die Schwangerschaft besonders deutlich hervortreten, aber ihr Leib wölbte sich zuletzt so weit vor, dass sie nur noch ein paar Schritte tun konnte. Wenn sie draußen auf dem Hof etwas Luft schöpfen wollte, dann tat sie es am sorglich stützenden Arm von Lena, die bei sich dachte: Entweder wird es ein Riesenkind und deshalb keine leichte Geburt oder es werden Zwillinge.
Letzteres traf zu – Doña Ana gebar ein Zwillingspärchen und es wurde eine leichte und schnelle Geburt. Kaum war das Mädchen abgenabelt und hatte den ersten Schrei getan, erschien der mit dunklem Flaum bedeckte Kopf des Jungen. Und dies geschah am 8. November, dem Namenstag des seligen Don Jofré.
Ein Zeichen? Ein Zeichen! Alle flüsterten es, murmelten es, wisperten und tuschelten.
«Ein Zeichen!» Don Silvio sprach es laut aus, als er der Taufe wegen die Wöchnerin besuchte.
«Da habt Ihr es, Doña Ana, und deutlicher könnt Ihr es wohl nicht verlangen. Gott hat Euch am Namensfest Eures verstorbenen Gemahls mit zwei Kindern beschenkt – in Seiner übergroßen Gnade!»
«Ja, Don Silvio, und ich werde mich in jeder Weise dankbar zeigen.»
Es waren kleine, zierliche Kinder und Doña Ana, bestärkt von Lena, hielt es für richtig, einige Wochen zu warten, ehe sie in der Kirche von Sobrado feierlich getauft wurden – natürlich von Don Silvio. Sie hatte den Hinweis auf das Wunder der biblischen Elisabeth nicht vergessen, und so wählte sie für den Jungen den Namen Juan Bautista und für das Mädchen den der allerseligsten Jungfrau, zu der sie die letzten Wochen vor der Niederkunft innig gebetet hatte.
Zu dem feierlichen Ereignis trugen die Kinder ein spitzenbesetztes Taufhemdchen, das am Hals lose verschnürt war. Als Juans Taufpate hatte sich ein entfernter Verwandter des verstorbenen Don Jofré angeboten, nämlich der lange verwitwete Notar und Sekretär des alcalde von Sobrado, Don Diego Tenorio – ein hagerer, etwas steifer, schwarz gekleideter Herr in mittleren Jahren, der als wohlhabend und einflussreich galt und dem gewisse Verbindungen zum Hof des Königs nachgesagt wurden.
Er also hielt das Kind – recht ungeschickt übrigens – über das Taufbecken, während Don Silvio, zittrig und nicht weniger ungeschickt, den Ritus vollzog und schon bei der Salbung sich in das zierliche Bändchen des Taufkleides verhedderte, wobei es sich öffnete. Als Don Silvio die Worte sprach:
«Ego te baptista in nomine Patris et –», da traf ihn ein gelber Strahl aus dem winzigen Penis des Täuflings mitten ins Gesicht, wobei er so zornig schrie, dass sein Köpfchen rot anlief. Nur wenige nahmen es wahr, aber der Priester hielt verwirrt inne, wischte sich mit seiner breiten, von Altersflecken gesprenkelten Hand übers Gesicht und fuhr fort: «– et Filii, et Spiritus Sancti.»
Lena, die ama der Kinder, hatte den Zwischenfall sehr wohl bemerkt, und über ihr pockennarbiges Gesicht flog ein schadenfrohes Lächeln, gedankenschnell, so dass es nur jemandem aufgefallen wäre, der sie länger beobachtet hatte. Doch aller Augen waren zu diesem Zeitpunkt auf die heilige Handlung gerichtet.
Maria verschlief ihre Taufe und quäkte nur leise, als das Wasser sie dreimal netzte.
Zur Tauffeier begab sich die ganze Gesellschaft auf die Finca von Doña Ana, wo ein Festmahl gerichtet war. Noch ehe sie das Gut erreichten, prasselte ein eisiger Novemberregen herab, was Lena, die mit den beiden Wickelkindern unter einer Plane in der breiten Familienkutsche saß, zu der leisen Bemerkung veranlasste: «Das ist nun die wirkliche Taufe, die von oben kommt und nicht aus der Hand des Pfaffen.»
«Was hast du gesagt, Lena?», fragte die daneben sitzende Amme.
«Nichts, amiga, nichts, hab nur über das Sauwetter geschimpft.»
Mit Lenas christkatholischem Glauben stand es nicht zum Besten, sie hatte die meiste Zeit ihres Lebens draußen in der Natur verbracht, und wenn sie eine Kirche betrat, dann wurde es ihr eng ums Herz, sie schwitzte und ihre Hände begannen zu zittern.
2
Nach dem Taufmahl waren die Gäste wieder nach Hause gefahren, Don Diego Tenorio aber war geblieben, weil er aus verwandtschaftlicher Verbundenheit der Witwe in verschiedenen Dingen beizustehen beabsichtigte. Er hatte es ihr erklären müssen.
«Euer Gemahl, Doña Ana, der almirante Don Jofré Tenorio, ist als ein Held Kastiliens zu betrachten. Er hat sich in kühner Todesverachtung den Ungläubigen entgegengeworfen und dabei als wahrhaft christlicher Ritter den Tod gefunden, vergleichbar dem Cid Campeador, der sein Leben im Kampf gegen die Mauren aufopferte.
Nun, als Witwe dieses Helden habt Ihr begründeten Anspruch auf zwei Dinge, die Hand und Herz betreffen. Eure Hand soll Anteil haben an dem Eurem Gatten vom König bezahlten Sold, der Euch, wenn auch vermindert, weiterhin zusteht. Euer Herz aber sehnt sich nach der von Don Silvio versprochenen Gedenkstätte eines Epitaphs in der Kirche, aber soviel ich weiß, ist noch nichts zu ihrer Verwirklichung unternommen worden. Falls Ihr einverstanden seid, werde ich Euch als abogado vertreten, auch im Namen der vaterlosen Kinder, zu deren Vormund Ihr mich bestellen könnt. Die Familie Tenorio ist weit verzweigt und einige werden mit obskuren Erbansprüchen an Euch herantreten, denen Ihr nur wirksam begegnen könnt, wenn Euch die entsprechenden Gesetze geläufig sind.»
«Davon verstehe ich nichts, Don Diego.»
«Das habe ich auch nicht erwartet. Aber Ihr könnt mir vertrauen …»
Doña Ana blickte auf und schaute dem Vetter in die etwas verschwommen blickenden graublauen Augen. Die standen ruhig in seinem schmalen bleichen Gesicht und wichen ihrem Blick nicht aus. Doña Ana seufzte. Was konnte sie als schwache Frau, als Witwe mit zwei unmündigen Kindern schon bewirken? Natürlich war Don Jofrés Tod seinen beiden erwachsenen Söhnen angezeigt worden, doch es kam keine Antwort. Vermutlich waren die beiden an den Kämpfen im Süden von Andalusien beteiligt und für Nachrichten nicht erreichbar.
So wurde aus Diego Tenorio der «Mann im Haus», doch er vermied es, sich in Doña Anas Rechte und Pflichten einer Gutsherrin einzumischen. Er wirkte im Hintergrund, sah viel, wusste viel und machte da und dort seinen Einfluss geltend.
Etwa nach einem Jahr kam der Bescheid vom Schatzmeister des Königs mit einer Urkunde über den gnädig bewilligten Ehrensold für die Witwe des Seehelden. Des Weiteren hatte Don Diego angeregt, die ehemals dem almirante unterstellten Kapitäne mögen eine Sammlung veranstalten, und da Don Jofré bei ihnen recht beliebt gewesen war, erbrachte sie mehr, als für ein schönes Grabmal notwendig war. So wurde ein tüchtiger Steinmetz beauftragt, eine Grabplatte mit dem lebensgroßen Bild des almirante herzustellen. Zwei Jahre später wurde sie in einer Nische neben dem Altar feierlich enthüllt.
In dieser festlichen Stunde wurden Maria und Juan aus Lenas Obhut entlassen, und Doña Ana nahm ihre Kinder bei der Hand und führte sie vor das Grabmal von Don Jofré.
«Juan, Maria, seht euch dieses Bildwerk genau an – es ist euer Vater, der in einer Seeschlacht gegen die Mauren als christlicher Held gestorben ist und euch jetzt vom Himmel aus stolz und liebevoll betrachtet.»
Die beiden Dreijährigen verstanden nichts davon, außer dass dieser steinerne Mann ihr Vater sein sollte und dass er im Himmel war, denn davon hatte die Mutter schon oft gesprochen.
«Ein Held?», fragte Juan. «Was ist denn das?»
Maria belehrte ihn naseweis. «Ein Held ist, wenn man tot ist, aber vorher viel – viel gemacht hat.»
«Ihr werdet das später besser verstehen», sagte Doña Ana und übergab die Kinder ihrer ama.
Als sie in ihrer carreta heimwärts fuhren, fragte Juan: «Was ist ein – ein Held, Lena?»
Der Wagen holperte ratternd über den steinigen Feldweg und Lena hatte anstatt hero das Wort hereje verstanden. Sie schüttelte den Kopf. «Was weißt du schon von einem Ketzer? Wo hast du das aufgeschnappt? Das sind schlimme Leute, die ausgepeitscht werden und im Büßergewand vor der Kirche mit einer Kerze in der Hand sühnen müssen.»
Lena wusste auch nicht genau, was ein Ketzer ist, aber sie hatte solche Leute schon gesehen, wie sie allsonntäglich im härenen Kleid vor dem Kirchenportal büßen mussten. Wieder schüttelte sie ihren Kopf. Was dieser Junge so alles fragte!
Don Diego Tenorio, der Notar und frühere Sekretär des alcalde – diese Tätigkeit hatte er aufgegeben –, lebte auf Doña Anas Finca und es hatte sich, fast ohne sein Zutun, wie von selber ergeben, dass er in die Rolle des Gutsherrn hineingewachsen war.
Doña Ana hatte den Vetter immer mit verwandtschaftlichen Augen betrachtet und nicht als einen Mann, der vielleicht ihr neuer Lebensgefährte hätte werden können. Damit hatte sie nun endgültig abgeschlossen – mit heimlichem Stolz trug sie ihre Witwenschaft als die Gemahlin des volkstümlichen Seehelden und Mutter seiner Kinder.
Don Diego hatte immer deutlich erkennen lassen, dass Ana für ihn nur die Frau seines verstorbenen Vetters war und er ihr als abogado und Gutsverwalter beistand. Um dies noch zu betonen, hatte er die ihm von Zeit zu Zeit bezahlten Honorare nicht abgelehnt, sondern sie ordentlich gegen Quittung und mit einer Verbeugung entgegengenommen. Oft war er in Geschäften unterwegs – einmal sogar fast drei Monate, die er im Süden und meist in Sevilla verbrachte.
Als er um die Weihnachtszeit zurückkehrte, waren die Zwillinge gerade sechs Jahre alt geworden und er herzte die kleine Maria – die in eine Art duldsame Steifheit verfiel – wie die eigene Tochter, während er den kleinen Juan auf die Wange küsste, spaßhaft seine Schulter stupste und ihm einen zierlichen maurischen Dolch als Geschenk überreichte.
«Aber Don Diego!», wehrte die Mutter ab, «er ist noch zu klein dafür, kann sich verletzen …»
Über Diegos ernstes bleiches Gesicht flog ein Lächeln. «Daran habe ich natürlich gedacht. Ein Feinschmied hat die Klinge mit der Scheide so verbunden, dass es die Kraft eines Mannes braucht, sie zu ziehen. Sobald er dazu imstande ist, kann er sie lösen und dann wird er auch damit umzugehen wissen.»
Juan hatte mit großen Kinderaugen das Gespräch verfolgt. «Ich danke Euch für das Geschenk, Don Diego – und – und werde es in Ehren halten.»
Noch ehe der abogado etwas sagen konnte, quengelte Maria dazwischen. «Und ich? Was ist mit mir? Bekomme ich kein Geschenk?»
Don Diego schlug sich leicht an die Stirn. «Aber natürlich – fast hätte ich es vergessen!» Er entnahm seiner auf dem Tisch liegenden Satteltasche ein schön aus Binsen geflochtenes und mit Blumen bemaltes Körbchen, öffnete es und legte es Maria in den Schoß. «Da hast du den Reichtum unseres Landes auf einem Platz versammelt.»
In dem Körbchen lagen fein aneinander gereiht die Früchte der drei Jahreszeiten – in Honig kandiert.
Don Diego beugte sich nieder. «Schau, es beginnt im Frühling mit Kirschen und Aprikosen, dann folgen die Pflaumen, Mispeln und Feigen des Sommers und es endet mit den im Herbst geernteten Trauben, Mandeln und Nüssen.»
Maria, mit ihren vom Vater ererbten zartgrauen Augen, blickte auf. «Das ist so schön – so schön, dass ich es nicht anrühren werde. Es kann doch nicht faulen oder schimmeln?»
«Nein, aber ewig wird es nicht halten. Du solltest schon von Zeit zu Zeit davon naschen.»
«Und ich – kriege ich nichts davon?» Juans dunkle Augen glühten neidisch.
«Du hast doch den Dolch», versuchte die Mutter ihn zu besänftigen.
«Vielleicht lasse ich dich ein wenig kosten», sagte Maria und fügte mit einem schadenfrohen Lächeln hinzu: «Von deinem Dolch kannst du ja nicht abbeißen …»
Dann kam die ama und führte die Zwillinge hinaus.
Don Diego sagte mit gedämpfter Stimme: «Ich bitte Euch, mir nach dem Essen noch eine Stunde zu schenken.»
«Gerne – aber worum geht es?»
«Um – um die Familie … Das lässt sich nicht in wenigen Worten sagen, aber ich werde zur rechten Zeit …»
«Ist gut, Don Diego, ich werde meine Neugier zähmen.»
Er verneigte sich und ging hinaus, etwas steif und linkisch, wie es seine Art war.
Was wird er mir sagen wollen, überlegte Doña Ana, während sie nach alter Gewohnheit der Köchin ein wenig zur Hand ging. Sie vermutete, dass Don Diego, nachdem er alles zu ihrer Zufriedenheit geregelt hatte, sich zurückziehen und – vielleicht? – eine neue Ehe eingehen wolle. Nun, sie würde seine unaufdringliche Gegenwart, seine stets bereite Hilfe schon vermissen, aber es musste auch ohne ihn gehen und schließlich war er in Caronium nur eine Tagesreise von hier entfernt.
«Au!» Sie hatte sich beim Säubern der Bohnen in den Finger geschnitten. Die Köchin schüttelte entrüstet ihren Kopf, wobei ihr stattliches Doppelkinn wackelte wie ihr legendäres Fruchtgelee.
«Doña Ana, ich habe Euch schon tausendmal gesagt, dass diese Küchenarbeit Euch nicht ansteht! Es genügt, dass Ihr Eure Wünsche äußert, und wir werden bemüht sein, sie zu erfüllen.»
Doña Ana stand auf. «Du hast ja Recht, aber es macht mir einfach Spaß, da und dort ein wenig hinzugreifen.»
Die cena zog sich hin, und am Ende hatte sie Don Diegos Wunsch vergessen. Nach dem Dankgebet sah er sie fragend an. Sie stutzte und nickte dann.
Die Nacht hatte sich draußen über die kahlen spätherbstlichen Felder gebreitet, und Doña Ana befahl der Dienstmagd im Kaminzimmer ein paar Buchenscheite nachzulegen.
«Wie früh es jetzt schon dunkel wird …» Sie hüllte sich fester in ihren mit Fransen besetzten Wollschal. «Und von Tag zu Tag wird es kühler.»
Er nickte, rückte ihr den Sessel zurecht und wartete, bis sie sich gesetzt hatte. Dann schob er mit dem Fuß ein aus der Glut ragendes Holzscheit ins Feuer und nahm ihr gegenüber Platz.
«Ich bitte Euch jetzt, mir einfach nur zuzuhören, und danach können wir meine Vorschläge bereden. So wie ich es sehe, gibt es für mich drei Möglichkeiten: Ich kann mich wieder in meine alte Notarstube in Caronium verkriechen, aber das wird meinen Sohn nicht freuen, der dort schon seit Jahren das Geschäft übernommen hat. Ich könnte mich aber auch aus der Welt zurückziehen, mich in ein Stift einkaufen, um dort, bis Gott mich abruft, gelehrte Studien zu treiben. Doch dazu – das sage ich Euch offen – fühle ich mich nicht alt genug. Die dritte Möglichkeit wäre, Euch zu heiraten, damit die Kinder – besonders der Junge – wieder einen Vater haben und die Finca einen Herrn, denn ich fürchte, die Lage bleibt nicht so ruhig, wie sie in den letzten Jahren war. Unser König ist zwar noch nicht alt, aber er lebt ein sehr gefährliches Leben, setzt sich beim Kampf gerne an die Spitze und konnte schon mehrmals nur mit großer Mühe aus gefährlicher Lage gerettet werden. Gott möge ihn schützen, aber es ist fast abzusehen, dass unser kühner matamoro, unser Maurentöter, eines Tages auf dem Schlachtfeld bleiben wird. Dann steht es schlecht um die Monarchie. Pedro, sein einziger legitimer Sohn, ist noch ein Kind, um das sich der König ebenso wenig kümmert wie um Maria de Portugal, seine rechtmäßige Gemahlin. Nun – alle Welt weiß, wer das Herz unseres Königs gefangen hält: Leonor de Guzman, Mutter von sechs Kindern, die er hegt und pflegt und hütet und hätschelt. Stirbt der König, wird es Unruhen und Umbrüche geben und so mancher Besitz wird den Herrn – oder die Herrin wechseln.»
Doña Ana wollte etwas sagen, doch der abogado hob die Hand.
«Ich bin gleich fertig, meine Freundin. Eure beiden erwachsenen Söhne werden Ansprüche stellen und sich mit den Zwillingen um den Besitz streiten. Da tauchen schwierige Rechtsfragen auf und es wäre besser, wenn ich Euch dann nicht nur als abogado beraten, sondern als Euer angetrauter Ehemann handeln könnte.»
Doña Ana sagte zunächst nichts, starrte ins Feuer und schnippte einen angeflogenen Funken von ihrem Hausgewand. Dann wandte sie sich ihm zu und ihre sonst eher fröhlichen dunklen Augen blickten ernst, ihre glatte Stirn war leicht gerunzelt.
«Ich nehme Eure Argumente nicht auf die leichte Schulter, sie sind zweifellos gewichtig und wollen bedacht sein. Eben darum bitte ich Euch um Bedenkzeit bis morgen Abend. Ich werde beten und Gott oder die Jungfrau Maria um ein Zeichen bitten. Seid Ihr damit einverstanden?»
Er war es, stand auf und verbeugte sich schweigend.
Tat sie etwas Unsinniges, als sie gleich danach ins Zimmer der Kinder ging? Die Kleinen konnten ihr doch nicht weiterhelfen. Was verstanden Sechsjährige von Heirat, Besitz und Erbstreitigkeiten?
Dennoch tat sie es und schickte die ama weg. Aufrechten Hauptes ging Lena hinaus, ihr pockennarbiges Gesicht blieb unbewegt. Die Kinder hatten vor der Nachtruhe noch gespielt; nun standen sie da und blickten die Mutter erwartungsvoll an. Sie kniete nieder, presste die Kleinen an sich und küsste sie auf Mund und Wangen. Maria begegnete den ungewohnten Liebkosungen mit Zurückhaltung, während Juan sich ihnen entgegenwarf und sie mit feuchten täppischen Küssen erwiderte. Die Mutter konnte sich ihm nur mit Mühe entwinden.
«Nun, nun, Juan, warum gleich so stürmisch? Schließlich bin ich nur deine Mutter und nicht dein – dein Liebchen …»
Sogleich ließ er sie los. «Was ist das, ein Liebchen?»
«Das ist eine Freundin, die du dir als junger Mann zulegen wirst.»
«Da brauche ich nicht zu warten – du bist meine Freundin!»
«Meine auch!», mischte Maria sich ein und blickte den Bruder grimmig an.
Die Mutter erhob sich. «Ihr beide seid meine Kinder und meine Freunde und ich liebe Juan nicht weniger als Maria und dich –», sie stupste das Mädchen in den Bauch – «nicht weniger als Juan. So hätte es auch euer Vater getan und nun ergibt sich die Möglichkeit, dass ihr wieder einen bekommt.»
«Einen Vater?», fragten sie wie aus einem Mund.
Juans Gesicht leuchtete auf. «Ist er denn zurückgekommen? War er gar nicht tot?»
«Hat ihn der liebe Gott aus dem Himmel entlassen?», erwog Maria.
«Nein, nein, nichts davon. Euer Onkel Diego will mich heiraten, um euch einen neuen Vater zu geben.»
Juan runzelte die Stirn. «Geht denn das? Dann hätten wir ja zwei Väter – einen im Himmel und einen im Haus.»
«Das ist in vielen Familien so, wenn sich Witwen einen neuen Mann nehmen, damit ihre Kinder nicht vaterlos aufwachsen.»
«Dann wird aus dem Onkel Diego ein Papa …», meinte Maria nachdenklich.
«Wenn ihr einverstanden seid?»
«Wenn es sein muss …»
«Es muss nicht sein, Juan, aber für uns alle wäre es besser, wenn die Finca wieder einen Herrn hätte.»
«Müssen wir dann Papa zu ihm sagen?»
«Ja, besser wäre es schon.»
«Ich tue es nicht!», trotzte Juan. «Ein Onkel bleibt ein Onkel – sein Leben lang, so wie ein Mädchen ein Mädchen bleibt. Man kann doch aus Maria keinen Jungen machen – oder?»
Doña Ana blieb geduldig. «Nein, das nicht, aber aus Don Diego wird schließlich keine Frau, sondern euer – euer Stiefvater, denn in einem gebe ich euch Recht: euer echter Vater kann er nicht werden.»
Juan nickte. «Gut, dann werde ich ihn Stiefvater nennen.»
Die Mutter seufzte. «Das ist er zwar, aber so dürft ihr ihn nicht nennen, denn das wäre eine Beleidigung. Und es klingt auch seltsam: padrastro. Nennt ihn doch einfach Papa, er hat viel für uns getan und verdient es.»
«Na gut …», murrte Juan.
«Warum nicht?», sagte Maria schulterzuckend.
Ohne lange nachzudenken, sagte Doña Ana zu der draußen wartenden ama: «Lena, ich habe mich entschlossen, Don Diego zu heiraten – die Finca braucht wieder einen Herrn.»
Wenn sie überrascht war, so zeigte sie es nicht. «Meinen Glückwunsch, dueña! Es wird wohl für uns alle das Beste sein.»
«Ja, das glaube ich auch.»
Hatte Don Diego mit ihrem Einverständnis gerechnet? Ja und nein. Ja, weil er auf ihre Vernunft vertraute und hoffte, dass die Sorge um die Zukunft ihrer Kinder letztlich ihre Entscheidung bestimmte. Nein, weil er verstehen konnte, dass sie keinen Mann mehr im Bett haben wollte, dass sie sich längst mit ihrer Witwenschaft abgefunden hatte. Don Diego war ein frommer, auf Gott vertrauender Mensch und hoffte, dass der Herr ihr zur richtigen Entscheidung verhalf.
Als Don Silvio sie in der Pfarrkirche traute, war er so wackelig und auch vergesslich geworden, dass sein Kaplan ihn stützen und ihm den Text gelegentlich vorsagen musste.
Einige Wochen nach der Trauung war überraschend capitan Alfonso Tenorio erschienen, Doña Anas ältester Sohn. Er kam mit der Trauerbotschaft, dass sein Bruder in einer der Seeschlachten gegen die Moros gefallen war und so das Schicksal seines Vaters geteilt hatte.
«Du hast dich lange nicht sehen lassen …» Alfonsos etwas mürrisches bärtiges Gesicht verzog sich zu einem spöttischen Lächeln.
«Es ist ja auch viel geschehen inzwischen … Mein jüngerer Bruder ist tot, dafür habe ich einen neuen bekommen und eine Schwester dazu und jetzt auch noch einen Stiefvater. Da bin ich eigentlich überflüssig – oder?»
«So sollst du nicht reden, Alfonso!»
«Warum nicht? Ein Soldat ist immer geradeheraus! Mein König, denke ich, braucht mich nötiger als du, liebe Mutter, da du ja jetzt wieder Mann und Kinder hast.»
Don Diego mischte sich da nicht hinein, aber als Alfonso ihn alleine sprechen wollte, ahnte er schon, worum es gehen würde. Am Ende, so dachte er, geht es immer darum, wenn Menschen über etwas verhandeln.
Alfonso kam gleich zur Sache. «Ich will mein Erbteil ausbezahlt haben, Don Diego.»
«Das ist Euer gutes Recht.» Er brachte es nicht über sich, den Stiefsohn zu duzen, holte das Buch mit den Zahlen über die Einnahmen und Ausgaben. «Bargeld ist nicht viel da, das könnt Ihr Euch ja denken. Es gab in den letzten Jahren ein paar schlechte Ernten hintereinander und wir mussten den Pächtern einiges an Abgaben erlassen. Wir könnten etwas Land verkaufen …»
Alfonso lächelte düster. «Ihr seid Euch schon darüber im Klaren, dass ich als Erstgeborener ein Erbrecht auf die Finca habe und ich es bin, der meine Geschwister auszuzahlen habe?»
Nun ging Don Diego aufs Ganze. «Aber ja – wer bestreitet das? So schlage ich Euch vor, Ihr übernehmt die Verwaltung des Gutes und wir – das heißt Eure Mutter, ich und die Kinder – ziehen nach Caronium, wo mein geräumiges Haus ohnehin leer steht. Aber zuvor müsst Ihr Doña Ana und die Geschwister auszahlen; ich schätze, das wird Euch an die dreißigtausend Doblas kosten.»
Alfonsos Unterkiefer sank herab, und er sah aus, als hätte ihn sein König vom capitan zum gemeinen Soldaten degradiert. «Aber – aber, wie soll ich – woher werde ich –»
«Nun, das ist Eure Sache, capitan. Übrigens werdet Ihr sechs bis acht Jahre brauchen, um eine Finca Gewinn bringend zu verwalten, und es wird nicht gehen, ohne viel Lehrgeld zu bezahlen.»
Der capitan begann zu schwitzen. «Aber könnt Ihr – könnt Ihr mir denn meinen Anteil auszahlen?»
«Vielleicht ein Drittel davon in barem Geld, der Rest wird als Besitztitel stehen bleiben. Zuvor aber müsst Ihr auf Euren Erbanspruch als Erstgeborener verzichten – zugunsten Juans.»
Der capitan Alfonso Tenorio war ein Krieger mit Leib und Seele und es graute ihm davor, ein Gut verwalten zu müssen. Er wollte seinem König und der Truppe nahe sein und plante, sich in Sevilla ein Haus zu kaufen.
Sie einigten sich schließlich, der capitan verschwand wieder und hinterließ keine Lücke.
3
Als der capitan Alfonso Tenorio im Sevilla ankam, herrschte einige Aufregung. Nach langen Feldzügen war der König in seine Hauptstadt zurückgekehrt und residierte wieder im Alcazar. Da jetzt mit den Moros eine Art Waffenstillstand herrschte, hatte der Monarch einen Teil seiner Truppen entlassen, meist junge Söldner aus Bauern- oder Handwerkerfamilien, die jetzt wieder in ihre Heimatorte zurückkehrten.
Der capitan Alfonso aber war ein Berufssoldat und meldete sich bei seinem Truppenführer.
«Ihr seid der Leibtruppe des Königs zugeteilt – meldet Euch sofort im Alcazar!»
Dieser Dienst war nicht beliebt, weil dort immer eine gewisse Spannung herrschte zwischen der kleinen, aber bescheidenen Hofhaltung der rechtmäßigen Königin Maria und der aufwändigen von Leonor de Guzman, der Geliebten des Königs. Solange er abwesend war, konnte Doña Maria sich freier bewegen, wobei sie den Teil des weitläufigen Alcazars mied, den Leonor mit ihrer Dienerschaft bewohnte. Diese wiederum blieb in ihren Räumen, wenn ihr gemeldet wurde, die Königin sei unterwegs. Wenn sich aber der König in seiner Residenz aufhielt, so bestand er darauf, dass Doña Maria in ihren Gemächern blieb, während er mit Leonor und seinen zahlreichen Kindern den größten Teil des Alcazars besetzt hielt.
Der Oberst der Palastwache war ein gemütlicher älterer Herr aus einer alten, hoch angesehenen, aber schon etwas dünnblütig gewordenen Familie. Er ging jedem Ärger tunlichst aus dem Weg und weil er wusste, wie wenig beliebt der Dienst im Wohnbereich der Königin war, und er nicht wegen Vetternwirtschaft ins Gerede kommen wollte, verloste er unter den Hauptleuten die Dienstbereiche. Diesmal traf es den capitan Alfonso Tenorio und er begab sich in jenen abgelegenen Teil des Palastes – die Mauren hatten ihn damals als Dienerwohnungen benützt –, wo Doña Maria de Portugal sich mit ihrem Sohn Pedro und einigen Leibdienern eingerichtet hatte. Sie empfing ihn sofort, und er beugte das Knie.
«Ich bin zu Euer Gnaden Wachdienst mit meinen Leuten eingeteilt und möchte fragen, ob Euer Gnaden besondere Befehle für mich haben?»
Doña Maria war eine noch junge, groß gewachsene Frau mit dunkelblondem Haar, einer schmalen langen Nase und einem ausgeprägten Kinn. Mochte man sie nach landläufigem Geschmack auch nicht als Schönheit bezeichnen, so war sie doch eine ansehnliche wohlgestaltete Frau, deren hohe Abstammung – sie war eine Schwester des Königs von Portugal – nicht zu übersehen war, ebenso wenig wie der bittere Zug um ihren Mund und ihre melancholisch verschatteten Augen.
«Besondere Befehle? Nein, die habe ich nicht – das heißt, ich hätte sie schon, aber man würde sie kaum erfüllen. So tut denn Eure Pflicht, Don Alfonso, und freut Euch auf die Ablösung …»
Der capitan war kein Höfling und nicht wortgewandt genug, um schmeichlerisch zu antworten. «Es ist mir eine Ehre, Euer Gnaden zu dienen.»
Sie winkte ab. «Ich weiß, was in euren Köpfen vorgeht. Ihr könnt mich übrigens Doña Maria nennen – spart Euch die servile Anrede für die andere, die Edelhure, die Gebärmaschine in königlichen Diensten.»
Er verneigte sich nur stumm und wartete auf ein Wort der Entlassung, als die Tür aufflog und ein etwa siebenjähriger Junge hereinstürzte.
«Warum darf ich meine Brüder nicht besuchen, nicht mit ihnen spielen? Papa hat sie doch wieder alle mitgebracht – Enrique, Fadrique und den kleinen Sancho! Niemand kann mir verbieten –»
Maria schlug ihren Sohn leicht, wie spielerisch auf die Wange. «Ich kann es! Die du deine Brüder nennst, sind nur Halbbrüder, illegitime Bastarde und kein Umgang für dich, den Kronprinzen und Thronfolger. Da ist es mir lieber, du spielst mit den Kindern der Torwächter, Stallmeister und Kammerherren als mit dieser anmaßenden Brut.»
Pedro – der seiner Mutter auffällig glich – rieb sich die Wange. «Deshalb hättest du mich nicht zu schlagen brauchen!»
«Dann merkst du es dir besser.»
Der capitan räusperte sich. «Doña Maria, darf ich mich –?»
«Ach, Ihr seid auch noch da? Pedro, das ist Don Alfonso Tenorio, capitan unserer Bewacher.»
«Aber Doña Maria …»
«Ihr braucht nicht beleidigt zu sein – die Beleidigte in diesem Trauerspiel bin nur ich – ich allein.»
Pedros rundes Kindergesicht wurde ernst, fast hart. «Aber wir brauchen doch nur abzuwarten, Mama! Wenn ich einmal König bin, dann ist es aus mit den Bastarden, aus mit Leonor – und vielleicht auch mit Euch, Don Alfonso. Dann zählt nur noch, wer zu uns, zu mir und Mama, gehalten hat!» Atemlos hatte der Kleine die Drohung herausgestoßen, seine Augen blitzten, sein Gesicht hatte sich gerötet.
«Don Pedro, ich werde immer treu dem König dienen, mag er Don Alfonso, mag er Don Pedro heißen. Auf der Seite von Bastarden werdet Ihr mich niemals finden.»
Pedro lächelte gnädig. «Möge Gott Euch dabei helfen, Don Alfonso.»
Er spricht wie ein Erwachsener, dachte der capitan, dieser arme Junge ist vermutlich niemals ein Kind gewesen – hat es nie sein dürfen.
Während er in seine Wachstube zurückging, fiel ihm ein, dass der Kronprinz zuerst mit seinen Halbbrüdern hatte spielen wollen, um gleich darauf mit ihrer Auslöschung zu drohen. Nun ja, dachte der capitan, schließlich ist er noch ein Kind – die sagen mal dies, mal das.
Später kam er noch häufiger mit der Königin in Berührung und musste sich fast widerwillig eingestehen, wie korrekt und höflich sie mit ihm umging und dass sie weder Launen noch Willkür zeigte. Don Pedro behandelte ihn manchmal von oben herab, als säße ihm schon die Krone auf dem Kopf, dann wieder burschikos, wie einen Spielkameraden.
Als der capitan einmal von seinem Bruder Juan sprach, horchte er auf.
«Wie alt ist er?»
«Genauso alt wie Ihr, Don Pedro.»
«Dann könnte er ja mein Zwilling sein …»
«Er hat eine Zwillingsschwester.»
«Eine Schwester ist nichts! Mädchen sind ganz anders. Enrique hat einen Zwillingsbruder – Fadrique, aber mit denen darf ich ja nicht spielen, weil sie Bastarde sind. Da wäre mir Euer Bruder schon lieber.»
Don Alfonso stieß sich nicht daran, dass Pedro ihn abwechselnd duzte und dann wieder in der Höflichkeitsform ansprach. Seine gerade soldatische Art schien allmählich Doña Marias Misstrauen zu zerstreuen und auf Pedro – mit seiner Mutter eng verbunden – färbte dies ab. Immer wieder kam die Rede auf Juan, und es gehörte schon zum Spiel ihrer seltsamen Unterhaltungen, dass der Thronfolger scherzhaft darum bat – ja, ihm befahl, endlich diesen Zwilling herbeizuschaffen.
«Wollt Ihr das wirklich, Don Pedro?»
Der Junge verzog sein Gesicht. «Du unternimmst ja doch nichts, missachtest meine Befehle – ich werde dich in die Torre del Oro sperren lassen!»
Alfonso fiel auf die Knie. «Gnade, edler Prinz, Gnade! Dort schmachten Hoch- und Landesverräter, erspart mir das und ich will tun, was Ihr wollt.»
Pedro lächelte gnädig. «Also gut, noch einmal sei dir verziehen, aber du musst versprechen, dass du deinem Bruder – meinem Zwilling – schreibst.»
Mit dem Schreiben sah es beim capitan schlecht aus, so richtig hatte er es nie gelernt. Aus Loyalität fragte er die Königin, die zwar den Kopf schüttelte, aber doch zustimmte.
«Warum nicht? Die Tenorios sind fidalgos und etliche von ihnen stehen seit Generationen in königlichen Diensten. Euer Bruder könnte später hier am Hof Page werden – später! Die Dinge müssen erst wieder ins Lot kommen, aber das kann ja schon bald sein …»
Don Alfonso Tenorio diktierte dem Sekretär der Königin ein Schreiben, in dem er andeutete, dass Juan die Möglichkeit hätte, am Königshof in Sevilla als Page zu dienen.
Als Don Diego seiner Gemahlin Doña Ana das Schreiben vorlas, begann sie ihren Kopf zu schütteln, und das tat sie immer noch, als er den Brief auf den Tisch legte.
«Sehr ehrenvoll und gewiss eine Überlegung wert, aber ich gebe den Jungen nicht her – nicht solange er noch so klein ist, nicht ehe er etwas gelernt hat. Wir haben ja kürzlich erwogen, ihn bei den Zisterziensern in die Schule zu geben und dabei, so meine ich, soll es bleiben. Schließlich haben wir das Kloster quasi vor der Haustür.»
Der abogado hob die Hand. «Halt, meine Liebe! Von einer Schule dort kann keine Rede sein, dieser Orden kümmert sich seiner Tradition nach vor allem um Ackerbau und Viehzucht …»
Ihr rundes gutmütiges Gesicht mühte sich vergeblich um Strenge. «Ich habe nachgeforscht; es gibt dort einige Mönche, die auch Unterricht erteilen. Padre Mateo tut dies sogar in einigen Fächern und zwar Latein, Geschichte, Geographie und natürlich Religion.»
«Sieh an, du hast dich also hinter meinem Rücken erkundigt …»
Sie errötete und wollte etwas sagen, doch er wehrte ab.
«Nein, nein, es ist ja dein Fleisch und Blut, und du hast mir einige Mühe erspart. Ich werde in den nächsten Tagen hinüberreiten und mir diese Lehrer einmal ansehen.»
Als abogado und früherer Gemeindesekretär von Sobrado war Don Diego schon öfters dienstlich dort gewesen und hatte jedes Mal gestaunt, wie weitläufig sich dieser Klosterkomplex in die Landschaft erstreckte. Durch Stiftungen, Vermächtnisse und das stete Wohlwollen der Könige von Kastilien war diese strengere Form des Benediktinerordens sehr wohlhabend geworden und Sobrado dos Monxes, wie die gallegos es nannten, gehörte zu den reichsten Klöstern im Land. Über der Eingangspforte prangte das Wappen der Zisterzienser mit den goldenen Lilien auf blauem Grund, die an seinen französischen Stifter erinnerten, den Benediktinerabt Robert von der Champagne.
Es dauerte eine Weile, bis der abogado in die Zelle des Padre Mateo geführt wurde, der sich erhob und ihm Platz anbot.
«Zwar kenne ich Euch nicht persönlich, abogado, aber ich habe schon öfter von Euch gehört.»
Don Diego verneigte sich leicht. «Nur Gutes, hoffe ich. Auch Ihr seid mir dem Namen nach bekannt, Padre, und zwar als bemühter und gewissenhafter Lehrer, der einige unserer Heranwachsenden in verschiedenen Fächern ausbildet. Nun sind meine Gemahlin und ich zu der Auffassung gelangt, dass Juan, mein siebenjähriger Stiefsohn, nicht als grober unwissender Klotz in die Welt hinausziehen soll, sondern als ein Mann, der nicht seinen Sekretär rufen muss, wenn er ein Schreiben erhält oder eines verfassen soll, und der nicht verschämt den Mund halten muss, wenn von der Geschichte unseres Landes die Rede ist.»
Padre Mateo war nicht das, was das Volk respektlos einen feisten Pfaffen nennt, doch seine stämmige Gestalt und seine vollen Wangen verrieten, dass er sich nichts abgehen ließ und leiblichen Genüssen durchaus zugetan war. Seine Stimme klang etwas hoch und immer leicht belegt, mit einem satten behaglichen Ton, als hätte er gerade eine vielgängige Mahlzeit hinter sich.
«Eines habt Ihr bei Eurer Aufzählung vergessen, Don Diego: die Religion! Sie liegt mir naturgemäß besonders am Herzen und soll jedes meiner Fächer begleiten, wie sie uns Christen leitet von der Geburt bis zum Tod.»
«Amen! Da sprecht Ihr mir ganz aus dem Herzen, Padre!»
Noch etwas war zu klären: Ein Juan Tenorio, Sohn eines wohlhabenden fidalgo, konnte nicht allein zum Kloster reiten, auch wenn der Weg nur ganz kurz war.
«Juan braucht einen Diener, einen Burschen, der etwas älter als er ist und ein Auge auf ihn hat, wenn er draußen ist.»
Doña Ana pflichtete ihrem Gemahl bei, und sie überlegten, wem diese Aufgabe zu übertragen sei. Da kamen einige in Frage, doch Juan entschied es selber.
«Miguel soll es sein! Er ist schon lange mein Freund und …» Dann folgte eine Aufzählung gemeinsamer Unternehmungen, die sich Don Diego zerstreut anhörte.
«Wir sollten uns den Burschen einmal ansehen.»
Miguel war jetzt zwölf Jahre alt und Lenas einziges überlebendes Kind. Sie machte nicht viel von ihm her, doch sie behielt ihn im Auge. Der wendige Bursche hatte schon einen Teil ihrer früheren Aufgaben übernommen, war für vieles zu gebrauchen, aber wenn er etwas nicht konnte oder wollte, dann sagte er es und keiner brachte ihn dazu, es zu tun. Auf Miguels Kopf wuchs ein ungebärdiger Schopf rotbrauner Haare, die Wangen und seine Stupsnase waren mit pecas gesprenkelt, die im Winter verblassten, aber im Sommer so aussahen, als hätte man ihn mit braunem Lehm bespritzt.
Juan erkannte ihn als Einzigen vom ganzen Haus- und Hofgesinde als seinesgleichen an. Schon früh hatte Miguel seinen ganz eigenen Kopf gezeigt und weder gutes Zureden noch Prügel hatten ihn ändern können.
Nun stand er im Salon seiner Herrschaft – er hatte ihn noch niemals von innen gesehen – und hielt seine fleckige Lederkappe in der Hand. Don Diego musterte ihn zuerst schweigend von Kopf bis Fuß.
«Also – Miguel, wir haben für dich eine neue Aufgabe, die dein bisheriges Leben ändern wird. Unser Juan wird vom nächsten Montag an im Kloster Unterricht nehmen, und du sollst ihn dorthin begleiten und wieder abholen. Ihr seid ja ohnehin so etwas wie Freunde geworden und gut miteinander vertraut.»
Miguel rieb sich verlegen die braun gesprenkelte Stupsnase und trat von einem Bein auf das andere. «Was soll ich dazu sagen, Herr …»
«Nichts, solange du nicht gefragt wirst», wies ihn Don Diego freundlich zurecht.
«Deine Kleidung wird sich ändern müssen», meinte Doña Ana, «außerdem möchte ich, dass du künftig Schuhe trägst.»
«Ändern, Doña Ana …?»
«Aber schau dich doch an! Weste und Hose sind vielfach geflickt und gehören längst ins Feuer. Wir werden dich einfach, aber anständig kleiden, und du wirst künftig mehr auf Sauberkeit achten. Du bist der Ältere und sollst Juan ein gutes Beispiel geben.»
Miguel verstand sehr wohl, dass diese neue Aufgabe so etwas wie ein Aufstieg in der hierarchischen Ordnung der Finca war. Als Leibdiener des jungen Herrn konnte er anders auftreten als der herumgescheuchte Handlanger für alles und jeden.
Auch seine Mutter, die ama Magdalena, empfand einigen Stolz, doch sie zeigte es nicht. Juan würde bald seinen achten Geburtstag feiern und brauchte kein Kindermädchen mehr. Doch bei den fidalgos war das geachtete Amt einer ama quasi eine Lebensstellung und nicht selten wandten sich erwachsene Männer und junge Ehefrauen an ihr altes Kindermädchen, wenn sie einen Rat brauchten.
Maria, Juans Zwillingsschwester, nahm die neue Lage nicht so ohne weiteres hin. «Und was ist mit mir? Darf ich nichts lernen? Soll ich zu Hause versauern?»
Doña Ana verwies ihrer Tochter die freche Rede. «Danke Gott, dass du ein solches Zuhause hast! Es ist weder üblich noch notwendig, dass Mädchen Schreiben und Lesen oder gar Latein lernen. Es genügt, dass du dich in allem kundig machst, was die Leitung eines großen Haushalts betrifft, denn das wird von dir verlangt, wenn du einmal unter die Haube kommst. Diese durchaus nützlichen Dinge kannst und wirst du lernen, wenn du mich von nun an beim täglichen Tageslauf begleitest.»
Maria wollte noch etwas sagen, doch die Mutter schnitt ihr das Wort ab. «Schluss – aus und Amen! Und versuche ja nicht, bei deinem Vater etwas anderes zu erreichen! Er ist derselben Meinung wie ich und wird dich gar nicht anhören.»
Darin hatte sie sich aber getäuscht. Don Diego Tenorio hatte im Laufe der Jahre zu seiner Stieftochter ein weitaus besseres Verhältnis gefunden als zu Juan, der sich nicht selten sperrig und eigensinnig verhielt, ihn Onkel Diego nannte und ihn nicht vergessen ließ, dass sein wirklicher Vater als Seeheld in Stein am Altar der Pfarrkirche zu bewundern war.
Bei Maria war das anders. Sie liebte ihren Zwillingsbruder von Herzen, war stolz darauf, dass sie ihn hatte, und sie hielten gegen die Welt der Erwachsenen fest zusammen. Niemals hätte Maria ihn verraten und Juan, der manchmal bockig, ja tückisch sein konnte, hätte für Maria ohne mit der Wimper zu zucken das Blaue vom Himmel herunter gelogen.
Dass sie nicht von derselben Art waren, entdeckte Maria als Dreijährige. Juan hatte etwas Unrechtes gegessen und ihn plagte tagelang ein Durchfall, so dass die ama ihn ständig säubern musste. Da war es Maria erstmals aufgefallen, dass bei ihrem Bruder etwas zwischen den Schenkeln baumelte, das sie nicht hatte. Um ganz sicher zu sein, schaute sie nach – nein, da war nichts. Sie fragte die ama. Lena schmunzelte.
«Das ist eben der Unterschied zwischen euch: Du bist ein Mädchen und er ist ein Junge. Später, wenn ihr groß seid, ist er ein Mann und du bist eine Frau – wie ich.»
Das genügte vorerst, doch Maria wünschte sich ein Junge zu sein, damit sie gemeinsam zur Schule gehen durften.
«Du musst dich damit abfinden, dass du ein Mädchen bist, versuchte die ama sie zu trösten. «Das hat auch Vorteile, weißt du.»
«So – und welche?»
«Na, schau dir einmal deinen richtigen Vater an, der musste mit seinen Schiffen hinaus, als vor unserer Küste die Moros erschienen, musste kämpfen, verlor und ist mit all seinen Männern ertrunken, bis auf einen. Nicht anders erging es einem deiner beiden erwachsenen Brüder, den du nie gesehen hast – er starb in der Schlacht. So etwas kann uns Frauen nicht geschehen, wir sitzen friedlich zu Hause und wenn unser Ehemann draußen irgendwo umkommt, dann heiraten wir eben noch einmal – so, wie es deine Mutter getan hat.»
«Du aber nicht …»
«Nein, denn ich habe ja euch, da kann ich mich nicht auch noch um einen Mann kümmern.»
Am ersten Schultag ritt Juan auf seinem braven graubraunen Maulesel hinüber zum Kloster, und der rotschopfige Miguel begleitete ihn auf einem bockigen Esel, der manchmal ohne Grund stehen blieb und herzerweichend schrie.
Der Unterricht wurde in der Sakristei der Klosterkirche erteilt, ein Raum, der nach der Frühmesse leer stand und dem Lehrer mit seinen fünf Schülern genügend Platz bot.
Feixend betrachteten die vier anderen ihren neuen Mitschüler, nur Pablo, der Jüngste, blieb ernst. Das war ein lieber pausbäckiger Junge von vielleicht sechs Jahren, während sich die anderen im Alter zwischen acht und zwölf bewegten. Pablito, wie ihn alle nannten, war einige Wochen vor Juan in die Schule gekommen, und nun ging es bei ihnen darum, zuerst und vor allem Schreiben und Lesen zu lernen.
«Deshalb», so erklärte Padre Mateo, «werdet ihr künftig eine Stunde vor den anderen hier erscheinen, und in dieser Stunde werden wir nichts anderes tun, als uns um Wort und Schrift zu bemühen.»
Als der Padre dies erklärte, blickte er nur Pablito an, dessen liebes pausbäckiges Kindergesicht in gesammelter Aufmerksamkeit erstarrte.
Warum schaut er mich nicht an, überlegte Juan. Vielleicht mag er mich nicht …?
Juan vergaß es schnell wieder, weil ihn in den darauf folgenden Tagen und Wochen andere Absonderlichkeiten beschäftigten.
Neben der Sakristei gab es einen kleinen Raum für Dinge, die nur selten gebraucht wurden, wie Tragestangen für die bei Prozessionen benützten Baldachine, schadhafte Kerzenleuchter, zur Wiederherstellung vorgesehene Heiligenfiguren, die ergänzt oder neu gefasst werden mussten – und vieles mehr. Auch ein paar wackelige und zerschlissene Hocker standen an der Wand, und einen davon benützte Padre Mateo, um seine Schüler zu bestrafen. Das tue er nur deshalb hier in der Abgeschlossenheit, um den anderen keinen Grund zur Schadenfreude zu liefern.