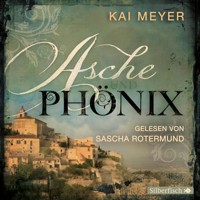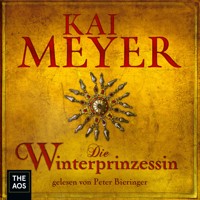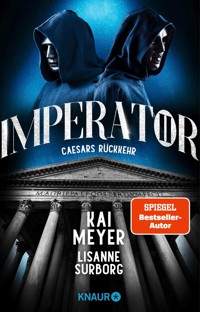
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Imperator
- Sprache: Deutsch
Band 2 des Fantasythrillers im Rom der Swinging Sixties – Okkulte Logen, politische Intrigen, Mörder mit schwarzen Handschuhen und ein Krieg der Geheimdienste um Europa Während die wiedergeborenen Kaiser ihre Macht in den höchsten Kreisen verankern, stößt Anna Savarese bei der Suche nach dem Mörder ihrer Mutter auf neue Mysterien. Ist General Laudeo tatsächlich der auferstandene Julius Caesar? Welche Rolle spielt die skrupellose Contessa Amarante? Und warum kennt ein antiker Schachautomat alle Antworten? Zugleich muss sich Gennaro Palladino – Privatdetektiv und Auftragskiller – nicht nur Mafiosi und Fremdenlegionären stellen, sondern seiner eigenen Vergangenheit. Vor Jahrzehnten kämpfte er als Partisan in den Alpen gegen die Faschisten und traf auf einen Mann, der heute mit seiner Grausamkeit ganz Rom im Griff hält. In Band 2 des phantastischen Thrillers entführen uns Erfolgsautor Kai Meyer und Newcomer-Talent Lisanne Surborg in die düsteren Machenschaften im Rom der 1960er Jahre, eine Stadt voller politischer Intrigen, mächtiger Feinde, gekaufter Mörder und unheimlicher Erscheinungen. Tauche ein ins Rom der Swinging Sixties und in die Welt der wiedergeborenen römischen Kaiser: - Imperator - Imperator II. Caesars Rückkehr - Imperator III. Messalinas Feuer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kai Meyer / Lisanne Surborg
Imperator II
Caesars Rückkehr
RomanBasierend auf einer Hörspielserie von Kai Meyer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Band 2 des Fantasythrillers im Rom in den Swinging Sixties – okkulte Logen, politische Intrigen, Mörder mit schwarzen Handschuhen und ein Krieg der Geheimdienste um Europa
Während die wiedergeborenen Kaiser ihre Macht in den höchsten Kreisen verankern, stößt Anna Savarese bei der Suche nach dem Mörder ihrer Mutter auf neue Mysterien. Ist General Laudeo tatsächlich der auferstandene Julius Caesar? Welche Rolle spielt die skrupellose Contessa Amarante? Und warum kennt ein antiker Schachautomat alle Antworten?
Zugleich muss sich Gennaro Palladino – Privatdetektiv und Auftragskiller – nicht nur Mafiosi und Fremdenlegionären stellen, sondern seiner eigenen Vergangenheit. Vor Jahrzehnten kämpfte er als Partisan in den Alpen gegen die Faschisten und traf auf einen Mann, der heute mit seiner Grausamkeit ganz Rom im Griff hält.
In Band 2 des phantastischen Thrillers entführen uns Erfolgsautor Kai Meyer und Newcomer-Talent Lisanne Surborg in die düsteren Machenschaften im Rom der 1960er Jahre, eine Stadt voller politischer Intrigen, mächtiger Feinde, gekaufter Mörder und unheimlicher Erscheinungen.
Tauche ein ins Rom der Swinging Sixties und in die Welt der wiedergeborenen römischen Kaiser:
Inhaltsübersicht
Was bisher geschah
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
Epilog
Was bisher geschah
Rom in den Swinging Sixties – eine Stadt zwischen Dolce Vita und politischen Intrigen, in der Paparazzi den Filmstars und Adeligen auflauern, um von den Ausschweifungen und Eskapaden der High Society zu profitieren.
Nach Einbruch der Dunkelheit zieht Anna Savarese mit ihrem Onkel Bruno und einer Gruppe Paparazzi über die berüchtigte Via Veneto, doch statt Skandalen sucht sie den Mörder ihrer Mutter Valeria, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. In einem Nachtclub fotografiert sie die mysteriöse Barbelo, deren Tanz das Publikum auf unheimliche Weise in seinen Bann zieht. Nach dem Besuch einer Schwarzen Messe gewinnt Anna den Paparazzo Spartaco als Verbündeten.
Dessen Stiefmutter, die Contessa Silvia Amarante, engagiert den Privatdetektiv und Ex-Polizisten Gennaro Palladino, um den Mord an dem Maler Fausto zu untersuchen. Palladino nimmt den Auftrag an, obwohl er selbst es war, der Fausto im Auftrag eines Mafia-Clans getötet hat. Dabei begegnet er Ugo, einem alten Freund aus Partisanentagen.
Anna und Spartaco brechen nachts in das Haus von Annas Großmutter ein und entdecken eine Tasche mit Dokumenten und Tonbandaufnahmen aus dem Clara-Wunderwald-Institut, in dem ihre Mutter früher als Pflegerin gearbeitet hat. Die Informationen hat Valeria für den Journalisten Gallo gestohlen, der ein rätselhaftes Phänomen aufklären wollte: Kurz nach Kriegsende war in der Klinik eine Abteilung für junge Patienten eingerichtet worden, die sich von einem Tag auf den anderen für wiedergeborene römische Kaiser hielten – die Imperatoren. Anna und Spartaco hören sich die Tonbandaufnahmen der Therapiesitzungen an, die der Arzt ProfessorCresta mit seinen Patienten geführt hat. Spartaco erkennt die Stimme seiner Stiefmutter und die der exzentrischen Martino-Zwillinge, an die er seine Ex-Freundin Halinka verloren hat.
Über Benedetto, einen früheren Kollegen bei der Polizei, stößt auch Palladino auf die Patienten des Clara-Wunderwald-Instituts, die mittlerweile allesamt hohe gesellschaftliche Positionen innehaben. Je tiefer er sich in das Geflecht aus Lügen und Intrigen verstrickt, desto öfter suchen ihn Erscheinungen des bizarren Bühnenzauberers Fratelli und eines riesenhaften Pavians heim. Seine Frau Laura hilft ihm zu erkennen, dass Fratelli eine Erinnerung aus seiner Kindheit ist. In seinen Visionen aber gibt sich Fratelli als Stimme des Chaos zu erkennen und beruft ihn zum Diener im Kampf gegen die Ordnung.
Palladino folgt der Spur der Contessa über den skrupellosen Baron De Luna zum Mafiaboss Ascolese und findet heraus, dass dieser im Auftrag der Contessa und der übrigen Imperatoren einen Anschlag in Rom plant, um die öffentliche Ordnung zu zerstören.
In einem Zeitungsarchiv stoßen Anna und Spartaco auf ein Foto des Regisseurs Villanova und des Schauspielers PaulCampbell, das die Männer mit Valeria verbindet. Campbell gibt Anna gegenüber zu, eine Affäre mit ihrer Mutter gehabt zu haben; aber natürlich habe er sie nicht ermordet.
In einer Villa am Strand von Ostia beobachten Anna und Spartaco eine geheime Zusammenkunft der Imperatoren. Spartaco identifiziert etliche Mitglieder der High Society sowie den alten Leibarzt seiner Familie, Bellofiore. Ein geheimnisvoller schwarzer Hund, den Anna aus ihrer Kindheit wiederzuerkennen glaubt, bewahrt die beiden davor, von den Imperatoren entdeckt zu werden. Am Rande der Versammlung stellen sie den ehemaligen Reporter Gallo, der ebenfalls auf der Lauer liegt und ein Buch schreiben will, in dem er die Verschwörung der Imperatoren aufdeckt und ihre Namen preisgibt. Von ihm erfahren sie, dass Annas Mutter im Institut vergewaltigt wurde. Demnach könnte einer der Imperatoren Annas leiblicher Vater sein.
Während Palladino im letzten Moment den Anschlag am Forum Romanum vereitelt, begreift Spartaco, dass der Leibarzt Bellofiore und der Institutsleiter Cresta ein und dieselbe Person sind. Der Arzt erschießt sich in Spartacos Beisein, damit die Schuld an seinem Tod auf Spartaco fällt, doch der kann um Haaresbreite entkommen.
Zeitgleich konfrontiert Anna ihren Onkel Bruno mit Fotos, die er am Tatort vom Leichnam ihrer Mutter gemacht hat, und erfährt, dass er von Valeria besessen war. Es kommt zum Kampf. Bruno kommt dabei ums Leben, bestreitet aber bis zuletzt, Valerias Mörder zu sein. Trotzdem belügt Anna die Polizei und behauptet, Bruno habe die Tat gestanden.
Mit Spartacos Unterstützung lässt sie ihren Vater Tigano, der nach einem Selbstmordversuch im Koma liegt, in eine Privatklinik in Rom überführen.
Und als die Contessa sich gerade ihre Niederlage beim Anschlag auf das Forum Romanum eingestehen muss, stattet ihr ein fremder Mann einen Besuch ab. Sein Name ist Aristide Laudeo, einstmals bekannt als Gaius Julius Caesar.
1
Um Palladino tobte das Chaos des Krieges. Maschinengewehre hämmerten in der Ferne. Geschosse gruben sich in Fleisch und Knochen. Hinter den Bäumen brüllte jemand Befehle, die im Geschrei der panischen Soldaten untergingen.
Palladino roch das Blut der Sterbenden und seinen eigenen Schweiß. Unter seinen Füßen vibrierte der Boden. Ohne Orientierung rannte er los, schlug sich durchs Buschwerk und kletterte den Berg hinauf, schlitternd über loses Gestein.
Ein Blick zurück. Der Panzer hatte die Senke fast erreicht. Mit schweren Ketten arbeitete er sich zu den verbliebenen Partisanen vor.
Palladino wandte sich kein weiteres Mal um, erklomm den Hang und hielt auf eine kleine Kirche zu, sehr alt und weiß verputzt. Seine Hände fanden einen rostigen Eisenring und zogen das Portal auf. Es fiel hinter ihm ins Schloss, während er im Halbdunkel über die Steinfliesen rannte.
Der Lärm aus der Senke drang nur noch gedämpft zu ihm durch, dafür rasselte der Atem in seinen Ohren. Dann hörte er noch etwas.
»Gennaro Palladino.«
Das Flüstern war scharf und zischelnd.
»Du wirst heute dem Teufel begegnen.«
Die Stimme ließ sich nicht orten, schien gleichzeitig aus allen Wänden der Kirche zu dringen. Palladino hatte sie schon früher gehört.
»Er wird lächeln, und dein Leben wird nicht mehr sein, wie es war. Und irgendwann, in vielen Jahren, wirst du ihm erneut gegenüberstehen.«
Ein irres Kichern, das ihm die Nackenhaare aufstellte.
In seinem Rücken flog das Portal auf. Das Scheppern der Tür ging in ohrenbetäubendem Kampflärm unter, der in die Kirche flutete. Die Panzerketten donnerten jetzt ganz in der Nähe, und jemand schrie einen Schießbefehl.
Palladino erwachte schweißgebadet, sein Herzschlag raste wie ein Echo der Maschinenpistolen. Mit fahrigen Bewegungen tastete er nach dem Päckchen auf dem Nachttisch und warf dabei fast das Wasserglas um. Er schüttelte eine Zigarette heraus, zündete sie an und hustete beim ersten Zug. Beim zweiten beruhigte sich sein Blutdruck allmählich.
Mit einem leisen Fluch stand er auf, trat an das Fenster seines Schlafzimmers und entriegelte es. Eine einzelne Vespa knatterte vorbei, sonst war es ruhig auf der nächtlichen Straße. Erleichtert zog er an der Zigarette, blies den Rauch aus und sog die kühle Nachtluft ein.
Viel zu klar, der Rauch war ihm lieber.
Schlecht gelaunt schloss er das Fenster, machte für einen Moment die Augen zu und versuchte, nicht an den Qualm vergangener Schlachtfelder zu denken, nicht an das Zischen brennender Leichen und den Ölgestank der Panzer.
Im Herbst 1944, als er im Piemont aufseiten der Partisanen gegen die Faschisten gekämpft hatte, hätten manche von ihnen für ein Päckchen Zigaretten gemordet. Damals hatte auch er das Töten gelernt.
Er ging zur Kommode unter der Dachschräge und entkorkte eine Whiskyflasche. Seine Hand zitterte leicht, als er sich großzügig einschenkte. Schon der erste Schluck wärmte ihn auf.
Einundzwanzig Jahre waren seit jenem Herbst vergangen. Einundzwanzig Jahre, in denen er vom Partisanen zum Polizisten geworden war und vom Polizisten zum … ja, was war er heute? Im Jahr 1965 klang der Begriff Privatdetektivwie etwas aus einem alten Film mit vergessenen amerikanischen Schauspielern. Und von denen hatten sie in Rom derzeit mehr als genug.
Ein drittklassiger Detektiv, der sich als Auftragsmörder ein Zubrot verdiente. Palladino kam sich vor wie ein Relikt, ein Klischee aus den gelben Taschenbüchern mit Kriminalromanen, die überall an den Kiosken verkauft wurden. Mit einer gewissen Melancholie erwartete er jeden Morgen, dass sein Gesicht im Badezimmerspiegel schwarz-weiß geworden war.
Ein beschissener Held bin ich, dachte er, griff nach der offenen Flasche und füllte das Glas erneut. Ein verkackter Schmalspurheld.
Die Zeitungen hatten schmeichelhaftere Worte gefunden, nachdem er den Bombenanschlag auf dem Forum Romanum vereitelt hatte. Drei Wochen war das jetzt her. Bei der Explosion hatte er mehr als nur sein linkes Ohr verloren: womöglich auch das, was von seinem Verstand übrig geblieben war, nach der Sache mit dem Zylinder des Fabelhaften Fratelli, dem weißen Kaninchen und der fremden Stimme in seinem Schädel. In schwachen Momenten – und davon gab es eine Menge in seinem Leben – klangen die Worte des Bühnenzauberers noch immer in ihm nach:
Das Leben, das du dir wünschst, hast du nie gelebt. Du kannst dir nichts zurückholen, das nicht existiert hat. Aber wir können dem Leben, das du hast, einen Sinn verleihen. Eine Aufgabe.
Verpiss dich, dachte er und knallte das leere Glas auf die Kommode.
Du weißt, zu was du geworden bist. Zu einem Mörder. Einem Ungeheuer. Du willst das nicht wahrhaben, aber Laura … sie weiß es.
Laura. Seine Hand fand zurück zum Flaschenhals. Er verachtete sich für sein Selbstmitleid. Sein Elend zu ertränken, war gewiss keine nachhaltige Lösung, aber im Augenblick erschien sie ihm reizvoll genug.
Ein schabendes Geräusch aus dem Flur ließ ihn versteinern. Er hielt den Atem an. Jemand machte sich am Schloss seiner Wohnungstür zu schaffen.
Palladino stellte die Flasche ab. Aus der obersten Kommodenschublade nahm er seine Pistole und war mit drei Schritten am Nachttisch mit dem Telefon. Ohne die Waffe aus der Hand zu legen, klemmte er sich den Hörer zwischen Ohr und Schulter und wählte.
Er konnte seinen Pulsschlag hören, während das Freizeichen ertönte. »Nun geh schon ran«, murmelte er.
Ein Scheppern, als am anderen Ende abgehoben wurde, dann ein Schnaufen. »Was?« Wenn Ugo schlechte Laune hatte, klang seine Stimme noch tiefer als gewöhnlich.
»Sie sind hier, draußen an der Tür!«, flüsterte Palladino, während er gleichzeitig darauf horchte, was am Eingang zur Wohnung vor sich ging. Nicht sehr erfolgreich, mit nur einem Ohr.
Ugo stöhnte. »Schon wieder?«
»Diesmal wirklich. Ich kann sie hören.«
»Wie bei den letzten vier Malen.«
»Scheiße, Ugo. Ich weiß nicht, ob’s nur einer ist oder mehrere.«
»Ja, schön«, sagte Ugo nach kurzem Zögern, »ich komm dann mal wieder rüber.«
»Bring diesmal das Gewehr mit!«
»Ich lauf doch nicht mit ’nem Sturmgewehr durch die Stadt.«
»Herrgott, dann pack’s halt irgendwo rein.«
»In meinen Geigenkoffer?«
Palladino lief der Schweiß in die Augen. Solange er telefonierte, konnte er sich keinen Überblick über die Lage verschaffen. »Die sind gleich drinnen!«
Ugo seufzte. »Baller nur ja nicht durch die Tür, hörst du? Das kann Gott weiß wer sein … Wenn’s überhaupt wer ist.«
Im Flur klickte das Schloss. Gleich darauf stieß das Türblatt gegen eine Vielzahl von Riegeln, die Palladino in der vergangenen Woche angebracht hatte.
Er senkte die Stimme. »Sie haben das Schloss aufbekommen. Meine Sicherungen halten noch, aber ich weiß nicht –«
»Bin schon unterwegs!«, unterbrach ihn Ugo. »Halt die Ohren steif! Oder das eine.«
2
Augenblicke später stürmte Ugo halb angezogen und mit dem Gewehr in der Hand aus seinem Schlafzimmer. Die Wohnung, die er sich mit seiner alten Mutter teilte, war nur wenige Ecken von Palladinos Apartment entfernt. Wenn er sich beeilte, konnte er in ein paar Minuten dort sein. Eine der Katzen huschte vorbei und blickte erwartungsvoll an der Tür hinauf, hinter der sich Ugos Mutter in ihrem Bett regte.
»Ugo-Schatz? … Kleiner, bist du das?«
Er schlüpfte in seine Schuhe und fluchte lautstark, als sich die Schnürsenkel verhedderten. »Schlaf weiter, Mama! Ich bin gleich wieder da!«
»Du musst doch noch gar nicht zur Schule.«
»Bleib einfach liegen, ja? Ich komm gleich zurück.«
»Ich hab Angst ganz allein. … Ugo? … Kleiner?«
Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie in zwei Minuten vergessen haben würde, dass sie ihn auf dem Flur gehört hatte. Hoffentlich vergaß sie auch ihre Angst.
Er blickte sich nach einer Tarnung für das Gewehr um. Schließlich griff er nach dem hohen Tonkrug, den seine Mutter seit Jahrzehnten als Schirmständer benutzte. Die Waffe verursachte einen hohlen Laut, als er sie hineinsteckte. Der Lauf ragte zwischen den Regenschirmen hervor.
Mit dem Gefäß im Arm stürmte er aus der Wohnung und hinaus in die Nacht.
3
Fast sanft rüttelte es an Palladinos Wohnungstür. Erneut wurde das Holz gegen die Riegel gedrückt.
Palladino hatte sich eine Hose übergezogen. Barfuß und mit freiem Oberkörper stand er am Ende des langen Flurs und zielte mit der Pistole beidhändig auf die hohe Tür.
»Verpisst euch! Ich knall euch durch die Tür ab, wenn ihr nicht abhaut.«
Wer immer im Hausflur stand, hielt schlagartig inne. Die Stille dehnte sich.
Dann schlugen zwei Kugeln durchs Türblatt.
Instinktiv sprang Palladino zur Seite und warf sich ins Schlafzimmer. Mit einem Ächzen prallte er gegen die Kommode, die Whiskyflasche fiel um und zerbrach am Boden.
»Okay, ihr wollt das so.« Aus seiner Deckung hinter dem Türrahmen beugte er sich in den Flur, um das Feuer zu erwidern – und sah, dass der Eingang offen stand. Alle Riegel waren aus ihren Verankerungen gebrochen.
Jenseits davon war das Treppenhaus leer. Derjenige, der die Tür aufgestemmt hatte, musste sich bereits im Inneren der Wohnung befinden, in einem der Räume im vorderen Teil, in der Küche oder im Wohnzimmer.
»Wer hat euch geschickt? Der Ascolese-Clan? Oder die Etruskische Front?«
Beide hatten ihre Gründe, sich an ihm zu rächen. Die Ascoleses glaubten, dass Palladino ihren Anführer Carmine Ascolese getötet hatte. Und die Altfaschisten von der Etruskischen Front nahmen ihm übel, dass er ihre Anschlagspläne auf dem Forum Romanum durchkreuzt hatte und dafür von den Zeitungen gefeiert worden war – gegen seinen Willen, denn nun kannten alle sein Gesicht, die Mafia ebenso wie die Nationalisten.
Er musste herausfinden, in welchem Zimmer der andere sich aufhielt. Aber der gab keinen Ton von sich.
»Hallo?« Zur Ablenkung versuchte er es auf die versöhnliche Tour: »Vielleicht können wir uns einigen.«
Auf der gegenüberliegenden Seite des Korridors befand sich die geschlossene Tür zum Badezimmer. Durch dessen Fenster konnte er auf das Dach des Nebenhauses gelangen. Vorausgesetzt, er schaffte es über den Flur, ohne sich eine Kugel einzufangen. Er horchte über seinen eigenen Atem hinweg. Der andere gab keinen Ton von sich.
»Du tust das hier doch für Geld, oder? Ist es das wirklich wert? Vielleicht blas ich dir das Hirn weg, bevor du mich erwischst.« Mit viel Glück konnte er Zeit schinden, bis Ugo auftauchte. Dann würden sie den Kerl von zwei Seiten in die Zange nehmen. »Was zahlen sie dir dafür, mich abzuknallen?«
Vergebens lauschte er auf verräterische Laute. Die Mafia ließ ihre Drecksarbeit gern von halbstarken Jungs erledigen. Dagegen sprach die Ruhe des Eindringlings. Das da draußen war jemand, der so etwas nicht zum ersten Mal machte. Irgendwer hatte einen verfluchten Profikiller auf ihn angesetzt, wahrscheinlich die Etruskische Front – oder gar die Contessa Amarante, falls sie herausgefunden hatte, dass er ihren alten Freund Fausto auf dem Gewissen hatte.
Schritte. Blitzschnell und fast unhörbar.
Der Angreifer befand sich im Zimmer neben ihm.
Erneut liebäugelte Palladino mit der Tür zum Badezimmer und dem Fenster zum Dach. Zwei Schritte über den Flur, nur ganz kurz die Deckung verlassen. Aber er hatte nicht den Partisanenkrieg in den Bergen überlebt und danach fast zwanzig Jahre bei der Polizei, um heute einen so groben Fehler zu begehen.
Er seufzte. »Hör zu. Kommst du zu mir ins Zimmer, niete ich dich um. Geh ich raus auf den Gang, verpasst du mir ’ne Kugel. Unentschieden, wenn du mich fragst. Nur dass ich vorhin die Polizei gerufen hab, die jeden Moment auftauchen dürfte. Wie wär’s also, wenn du dich einfach aus dem Staub machst?«
Ein Fehler, und er wusste es im selben Augenblick. Hätte er wirklich die Polizei gerufen, wären jetzt schon Sirenen zu hören. Und in seiner Lage log man nur aus Verzweiflung.
Ach, scheiß drauf, dachte er. Kurz entschlossen sprang er aus dem Zimmer über den Gang zur Badezimmertür.
Zwei Kugeln jagten schallgedämpft an ihm vorüber.
Palladino feuerte einmal zurück, nur auf gut Glück, weil er den anderen auf die Schnelle nicht sehen konnte. Dann krachte er schon mit der Schulter gegen die Tür und stieß sie nach innen. Ob der Schmerz eine Folge des Zusammenstoßes war oder ob ihn eine Kugel getroffen hatte, konnte er im ersten Moment nicht sagen.
An der Wanne vorbei stürmte er zum Fenster und riss es auf.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er hinter sich eine Bewegung in der Tür. Er wandte sich um und schoss zweimal. Die Antwort schlug knapp neben seiner Brust in die Wand ein.
Breitbeinig stand er im Bad und wagte kein zweites Mal, der offenen Tür den Rücken zu kehren, um aus dem Fenster zu klettern. Der Angreifer war draußen im Korridor, ganz nah, aber nun ließ er sich nicht mehr blicken.
Palladino bemühte sich um Konzentration und rang nach Atem.
Ganz langsam machte er einen Schritt rückwärts, bis er gegen die Wand stieß. Die Fensterbank befand sich auf Höhe seiner Schulterblätter. Er würde sich mit beiden Händen hochstemmen müssen, um hinauszuklettern. Keine Chance, ohne dass der Kerl ihn erwischte.
Stattdessen stieg er in die leere Badewanne und schlich darin zurück zur Tür. Jetzt befand sich nur die gekachelte Wand zum Flur zwischen ihm und seinem Gegner.
»Und was jetzt? Irgendwelche Vorschläge?«
Er war nicht sicher, was für eine Waffe der andere benutzte, aber der Schalldämpfer verriet, dass es kein großes Kaliber war. Die Mauer würden die Kugeln nicht durchschlagen.
Zu seiner Überraschung gab der Mann ihm diesmal eine Antwort. »Du kommst hier nicht lebend raus, Palladino.«
»Oder du, mein Freund, oder du.«
»Wenn ich dich nicht töte, tut es ein anderer.« Der Fremde sprach schnell und flüsternd, seltsam tonlos.
»Und das sollte mich dazu bewegen, einfach aufzugeben?« Als der andere nichts erwiderte, horchte Palladino auf seinen Atem. »Hey! Noch jemand da?«
Er stand seitlich an der Wand, mit einem Knie auf dem Wannenrand, die Waffe auf die Tür neben sich gerichtet, kaum eine Armlänge entfernt. Sobald dort nur eine Nasenspitze auftauchte, würde er schießen.
In der Ferne ertönte eine Polizeisirene.
»Wir könnten ja noch Stunden weiterplaudern – nur dass irgendwer die Schüsse gehört hat und die Polizei jetzt wirklich unterwegs ist.«
Auf der anderen Seite der Wand erklangen mechanische Geräusche, die Palladino sofort zuordnen konnte. Der Angreifer hatte eine zweite Waffe mitgebracht. Und die war bedeutend schwerer.
»Ach komm. Das ist verdammt noch mal nicht fair …« Instinktiv ließ er sich fallen, flach in die Wanne hinein, als über ihm die Wand explodierte. Schützend riss er die Arme über den Kopf und verlor dabei seine Pistole. Mauerbrocken und Fliesensplitter prasselten auf ihn nieder.
Der Fremde lud abermals durch. Der zweite Schuss zielte tiefer, und Palladino rettete nur der gusseiserne Wannenrand.
Er rollte sich auf den Gesteinstrümmern herum und suchte vergeblich nach seiner Pistole. In der Mauer zum Flur klaffte ein gezacktes, fenstergroßes Loch. Vage erkannte er in den grauen Staubschwaden einen Umriss. Der Mann ließ die Schrotflinte fallen und schob die schallgedämpfte Pistole durch die Öffnung. Die Mündung zielte auf Palladinos Brust.
Palladino sah in das fahle, kalte Gesicht. »Leck mich am Arsch«, flüsterte er.
Ein Schuss peitschte.
Der Mann im Flur stieß einen gedämpften Schrei aus.
Im Schock tastete Palladino über seinen Oberkörper, suchte nach einer Wunde. Als er wieder aufsah, war die Silhouette aus der Öffnung verschwunden.
Ein weiterer Schuss erklang, dann schwere Schritte.
»Verflucht sei dein Anus, Gennaro! Hier ist eine Scheißsauerei in deinem Flur.«
Der Schock fiel von ihm ab, er spürte das Adrenalin in seinen Adern. »Ugo …?«
»Nein, der Schornsteinfeger«, sagte Ugo mürrisch.
Während Palladino sich am Wannenrand hochstemmte und Schutt von seinem Körper klopfte, wurden draußen die Polizeisirenen lauter. »Du musst verschwinden!«
Ugo schnaubte. »Gern geschehen. Ich bin auch froh, dass ich dein Scheißleben gerettet hab. Und wo ist eigentlich dein Schutzengel … dieser Affe?«
»Die Bullen sind gleich hier!« Fliesensplitter schnitten in Palladinos nackte Fußsohlen, als er über die Trümmer auf den Flur trat.
»Keine Sorge.« Ugos schwarzes Haar war noch wirrer als sonst, und seine mächtigen Schultern schienen den ganzen Korridor auszufüllen. »Ich hab das Gewehr in Mamas Schirmständer versteckt.«
»In ihrem –« Er sah den schweren Tonkrug direkt neben der offenen Wohnungstür. Sogar die Schirme steckten noch darin. »Okay, danke … Aber hau jetzt lieber ab. Lauf durch den Keller und nimm die Hintertür.«
»Jaja.« Ugo platzierte sein Sturmgewehr zwischen den Regenschirmen wie eine Rose im Bouquet, dann hob er das schwere Tongefäß hoch und presste es in einer Umarmung an seine breite Brust.
»Beeil dich!«, rief Palladino. »Und lass doch die Scheißvase stehen!«
»Schirmständer. Den braucht sie noch.«
Draußen kamen die Sirenen näher. Vermutlich bog gerade eine kleine Flotte von Polizeiautos in die Straße ein.
Mit dem Krug im Arm lief Ugo los. Die Treppe knirschte unter seinem Gewicht.
Einen Moment lang starrte Palladino seinem Freund nach, dann drehte er sich zur Leiche des Attentäters um. Ugo hatte dem Mann erst in die Seite, dann ins Gesicht geschossen. Und er hatte recht – es war eine Riesensauerei.
Palladino ging in die Hocke und betrachtete eine Tätowierung am Hals des Toten. Er musste Blut wegwischen, um das vollständige Zeichen zu erkennen: sieben geschlängelte Flammen über einer runden Schale. Darunter drei Buchstaben: L – P – N.
Unten vor dem Haus wurden mehrere Wagentüren zugeschlagen. Palladino hörte Stimmen, aber er achtete nicht auf das, was sie sagten.
Er kannte das Symbol, und er wusste, was die Initialen bedeuteten.
Legio Patria Nostra.
Die Fremdenlegion.
4
In derselben Nacht brachen Anna und Spartaco in eines der alten Stadthäuser am Tiberufer ein.
Sie standen im Hinterhof, über sich ein Netz aus Wäscheleinen. In der Dunkelheit konnte Anna nicht so recht erkennen, was genau Spartaco tat, nachdem er vor der Tür in die Hocke gegangen war. Aber nach ein paar Augenblicken sprang sie auf und gab den Weg ins Treppenhaus frei. Anna folgte ihm hinein und lehnte die Tür hinter sich an.
»Leise!« Spartaco sprach mit gesenkter Stimme.
»Ich dachte, hier steht alles leer.«
»Ja. Wahrscheinlich.«
»Wir brechen in ein wahrscheinlichleeres Haus ein?«
»Du wolltest hier rein.« Er warf ihr ein kurzes Lächeln zu. »Also, weiter.«
Anna schlich hinter ihm die knarrende Holztreppe hinauf. Sie trug eine seiner schwarzen Jacken, die viel zu langen Ärmel hatte sie hochgekrempelt.
Im zweiten Stock befand sich die Pension Ilaria, einst ein verschwiegenes Etablissement, in dessen Zimmern sich die Mitglieder der besseren Gesellschaft zu geheimen Rendezvous getroffen hatten.
Vor dreizehn Monaten war Annas Mutter in Zimmer 7 mit einem Messer ermordet worden. Seitdem war die Pension geschlossen.
Von der Treppe aus konnte sie einen Blick auf eine Tür erhaschen. Sie war aufgebrochen. »Im Erdgeschoss wohnt jedenfalls keiner mehr.«
Spartaco nickte. »Mein Kontakt bei der Polizei sagt, die dritte und vierte Etage sind auch leer. Seit die Pension zu ist, tut sich hier gar nichts mehr. Der frühere Besitzer hat das Haus verkauft, weil nach der ganzen Sache nichts mehr zu holen war.«
»Und der neue scheint es nicht eilig zu haben, irgendwas mit dem Kasten anzustellen.« Anna löste ihre Hand von dem wackeligen Geländer, als sie den zweiten Stock erreichten.
Sie versuchte, sich an Spartaco vorbeizuschieben, aber er schien den Weg absichtlich zu blockieren. Zögerlich drehte er sich zu ihr um. »Du bist wirklich sicher, dass du dir das ansehen willst?«
Sie legte genug Empörung in ihren Tonfall, um sich selbst zu überzeugen. »Ich überleg mir so was doch nicht auf den letzten paar Metern anders.«
»Was, wenn alles noch so ist wie … wie es eben war?«
Der Gedanke war ihr selbst schon viele Male gekommen. Was, wenn in Zimmer 7 noch das Blut ihrer Mutter klebte, schwarz verkrustet nach über einem Jahr? Wenn der Raum tatsächlich aussah wie am Tag nach dem Mord?
Um Spartacos fragendem Blick auszuweichen, horchte sie einen Moment lang hinauf ins stille Treppenhaus. Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Ich war ein Jahr lang in meiner Vorstellung jeden Tag an diesem Ort, jede Stunde, jede Minute. Wenigstens einmal muss ich das Zimmer mit eigenen Augen sehen.«
»Okay.« Er setzte sich wieder in Bewegung. »Gehen wir rein.«
Im Gegensatz zu den anderen Türen war die der Pension Ilaria mit einer Kette gesichert. Spartaco zog eine schwere Zange aus seinem Rucksack und machte sich an die Arbeit. Bei ihrem Aufbruch in Trastevere hatte sie fast ein schlechtes Gewissen gehabt, ihn zu dieser Sache angestiftet zu haben. Als sie nun jedoch sah, was er alles im Rucksack verstaut hatte – neben der Zange waren da ein Brecheisen, eine Eisensäge und ein Glasschneider –, beruhigte sie sich mit der Gewissheit, dass Spartaco als kommunistischer Aktivist wahrscheinlich mehr Gesetze gebrochen hatte, als sie aufzählen konnte. Ganz abgesehen von seiner Verwicklung in den Tod von Professor Cresta, auch wenn die Polizei ihn bis heute nicht damit in Verbindung brachte.
Die Kette fiel rasselnd zu Boden. Spartaco schob sie mit dem Fuß zur Seite, setzte das Brecheisen an und stemmte routiniert die Tür auf. »Voilà!«
»Mein Held.«
»Schick mir eine Feile ins Gefängnis.«
»Du willst nicht, dass ich dir einen Kuchen backe.«
Die Tür quietschte, als Spartaco sie aufstieß. Anna atmete tief ein und betrat die Diele der Pension.
Vor zwanzig Jahren war ihre Mutter vergewaltigt worden, in einer psychiatrischen Klinik in den Abruzzen, in der man achtzehn außergewöhnliche Patienten eingesperrt hatte. Achtzehn Männer und Frauen, die sich selbst für die Reinkarnationen römischer Kaiser hielten. Im Januar ’45 war einer dieser Männer in einer dunklen Kammer über die Nachtschwester Valeria Savarese hergefallen, und neun Monate später war Anna zur Welt gekommen. Sie hatte keine Gewissheit, dass der unbekannte Vergewaltiger ihr leiblicher Vater war – ihre Mutter hatte es abgestritten –, aber Anna konnte gar nicht anders, als die Möglichkeit in Betracht zu ziehen.
Vor gut einem Jahr hatte Valeria ihren Mann Tigano verlassen, war nach Rom zurückgekehrt und hatte womöglich versucht, einen oder mehrere der ehemaligen Patienten mit ihrem Wissen über die Klinik zu erpressen. Die meisten von ihnen befanden sich heute in hohen gesellschaftlichen oder politischen Positionen. Hatte einer von ihnen Valeria in der Pension zum Schweigen gebracht? Oder war doch Tigano Savarese der Täter, der Mann, den Anna ihr Leben lang für ihren Vater gehalten hatte und der seit einem Selbstmordversuch vor drei Wochen im Koma lag?
Und schließlich kam auch noch ihr Onkel Bruno als Täter in Betracht, weil er Valeria mit krankhafter Besessenheit geliebt und doch an seinen Bruder Tigano verloren hatte. Seit Anna ihn in Notwehr getötet hatte, war zumindest die Staatsanwaltschaft von seiner Schuld überzeugt. In seiner Dunkelkammer waren Fotos von Valerias Leiche gefunden worden – Fotos, die er unmittelbar nach ihrer Ermordung hier am Tatort gemacht hatte. Niemand zweifelte daran, dass er in der Mordnacht in der Pension gewesen war.
Anna setzte ihren Rucksack ab und zog zwei Taschenlampen hervor. Nachdem Spartaco das Werkzeug verstaut hatte, reichte sie ihm eine davon. Er leuchtete den Gang hinunter.
»Zimmer 7 müsste auf der linken Seite sein, ganz am Ende des Korridors.« Wieder drehte er sich mit diesem besorgten Blick zu ihr um. »Sag mir, wenn du hier rauswillst. Dann hauen wir auf der Stelle ab.«
»Okay.« Sie ließ den Lichtkegel ihrer Lampe über die Wände wandern und bekam eine Gänsehaut. Ihre Mutter hatte einst genau hier gestanden.
Langsam bewegten sie sich vorwärts, vorbei an der kleinen Rezeption, hinter der alle acht Zimmerschlüssel an ihren Haken hingen. Keiner brauchte sie mehr, denn die Türen standen weit offen. Jemand musste die Vorhänge zugezogen haben, selbst aus den Räumen an der Vorderseite fiel kein Licht der Straßenlaternen.
»Wonach riecht’s hier?«, fragte Spartaco.
Über dem Geruch von Staub, alten Textilien und ungelüfteten Räumen lag etwas seltsam Schweres, das sie an einen anderen Ort erinnerte.
Anna schluckte. »Ich weiß, was das ist.«
Der Schein ihrer Lampen fiel in die verlassenen Zimmer, auf abgezogene Betten und offen stehende Schränke. Die Einrichtung war unerwartet schlicht für eine Pension, die vor allem Schwerreichen einen Unterschlupf für ihre Stelldicheins geboten hatte. Anna hatte roten Samt und goldene Himmelbetten erwartet, doch die Zimmer waren bestenfalls zweckmäßig eingerichtet. Hierher war man nicht gekommen, um die Möbel zu bewundern.
»Der Geruch … das sind verwelkte Blumen. Genauso hat’s nach ein paar Tagen an ihrem Grab gerochen, bevor die Kränze und Gestecke weggeräumt wurden.«
Im Licht der Taschenlampe runzelte Spartaco die Stirn. »Seltsam, oder?«
Sie passierten nur offene Türen – bis sie das Ende des dunklen Korridors erreichten. Die Tür von Zimmer 7 war geschlossen. Der süßliche Geruch raubte Anna fast den Atem.
»Die Polizei war nie wieder hier, oder?«, fragte sie.
»Nachdem die Spurensicherung durch war?« Spartaco hob die Schultern. »Ich wüsste nicht, warum.«
Mit einer leisen Vorahnung dessen, was sie hinter der Tür erwartete, legte sie eine Hand auf die kühle Messingklinke, wechselte einen Blick mit Spartaco und drückte sie nach unten.
Der Gestank flutete heraus auf den Flur. Sie hörte das leise Summen von Insekten, noch ehe das Licht der Taschenlampen ihnen das Innere von Zimmer 7 offenbarte.
Das Doppelbett war unter einem Berg aus verwelkten Blumensträußen begraben, der Anna bis zur Hüfte reichte. Jemand hatte über Monate hinweg immer wieder neue Blumen auf die alten gelegt, bis sich das Bett kaum von einer frischen Grabstätte unterschied. Dabei waren die unteren Schichten zu einer dunklen, verschlungenen Masse kompostiert.
Auch der Boden war bedeckt mit vertrockneten Pflanzen und üppigen Gestecken. Von den meisten Blumen waren nur noch die Stiele übrig, Blüten und Blätter waren zu braunem Staub zerfallen. Jemand hatte Kränze an alle Wände genagelt und daran zahllose Sträuße befestigt. Der Kleiderschrank stand offen, auch er war mit toten Blumen gefüllt. Das gesamte Zimmer sah aus, als wäre es von einer bizarren Vegetation überwuchert worden, die nach und nach abgestorben war.
»Was für ’ne Scheiße.« Anna presste sich den Ärmel vors Gesicht und betrat das Zimmer.
»Irgendwer war ein großer Verehrer«, sagte Spartaco.
»Das ist krank.«
Er ließ das Licht flüchtig über das Bett gleiten. »Sieht nach Bruno aus, oder?«
»Wahrscheinlich.« Anna wusste nicht recht, was sie fühlte, wenn sie an Bruno dachte. So viel war passiert, seit er sie vor etwa einem Monat am Roma Termini abgeholt hatte. Sie hatte in seine Abgründe geblickt, und dieser Blumenfriedhof war bei Weitem nicht der tiefste. »Aber wer hat dann die Kette an der Tür im Treppenhaus angebracht? Wenn’s der neue Besitzer war, hätte er das hier doch ausräumen lassen.
»Vielleicht Bruno selbst. Falls sonst niemand hergekommen ist, wäre die Kette gar keinem aufgefallen.«
»Aber wer kauft ein Haus, ohne sich alle Räume anzusehen?«
»Investoren. Die warten, bis die Preise steigen, und verkaufen die Bude dann mit Gewinn weiter.« Er machte Anstalten, den Raum zu verlassen.
Aber Anna war noch nicht so weit. Mit bebender Hand ließ sie den Lichtkegel der Stablampe über die Wände und den welken Blumenhügel wandern. Überall wimmelte es von Fliegen und Spinnen.
»Wir gehen besser«, sagte Spartaco leise. »Oder willst du das hier durchsuchen?«
Es dauerte einen Moment, ehe seine Worte zu ihr durchdrangen. »Nein, du hast recht, lass uns abhauen.«
Anna bewegte sich einen Schritt rückwärts, dann einen zweiten. Je weiter sie den Flur hinabgingen, desto freier konnte sie atmen. Der moderige Geruch blieb in der Pension zurück wie ein Gespenst, das an diesen Ort gebunden war.
Spartaco zog die Etagentür zu, sodass der Einbruch nicht auf den ersten Blick auffallen würde. Er lehnte sich über das Geländer und warf einen Blick nach oben. »Willst du auch die anderen Stockwerke sehen?«
Anna schüttelte den Kopf. Sie war nicht sicher, ob sie noch mehr leere Räume, mehr Staubgeruch und Spinnweben ertragen konnte. Schon jetzt glaubte sie, dass sie nie wieder Blumen riechen wollte, frische oder verwelkte, ganz egal.
Schweigend verließen sie das Haus und durchquerten den Hinterhof. Am Tor prüfte Spartaco kurz die Lage draußen auf der Straße, dann gingen sie zügig den Bürgersteig hinab. Ein paar Vespas und eine Handvoll Autos fuhren vorbei. Am anderen Ufer des Tibers spazierte ein Paar, ansonsten war niemand zu sehen.
»Wann triffst du dich morgen mit Venturi?«, fragte er unvermittelt.
»Du willst mich nur von dem Irrsinn da oben ablenken.«
Er lächelte. »Schon möglich.«
Domenico Venturi war der neue Chefredakteur des Espresso. Mit Spartacos Hilfe hatte Anna in der letzten Woche eine Reihe aufsehenerregender Fotos in den Nachtclubs und Bars an der Via Veneto geschossen. Venturi hatte ihr über die Bildredaktion ausrichten lassen, dass er sie zu sprechen wünschte. Vielleicht wollte er ihr einen festen Job anbieten, doch wahrscheinlicher erschien ihr, dass er neugierig war auf die einzige Frau unter Roms Paparazzi.
Nach den Ereignissen um Brunos Tod hatte sie sich tagelang in ihrer neuen Wohnung verkrochen, war nur mit dem Hund vor die Tür gegangen oder um ihren Vater in der Klinik zu besuchen. Dann hatte sie beschlossen, dass es so nicht weitergehen konnte, und Spartaco gebeten, sie abends wieder in die Lokale an der Veneto einzuschleusen. Sie hatte sich in ihre Arbeit fallen lassen, und ein paar Tage lang war es ihr gelungen, die Imperatoren und die Ungewissheit über den Tod ihrer Mutter auszublenden.
Bis heute. Am Morgen hatte sie gewusst, dass endlich der Tag gekommen war, an dem sie die Pension Ilaria von innen sehen wollte. Nun aber wusste sie nicht mehr, ob sie froh war über diese Entscheidung.
»Um zehn soll ich in der Redaktion sein. Willst du mitkommen?«
»Damit alle wissen, wer dich an den Türstehern vorbeibringt?« Er warf ihr einen zweifelnden Seitenblick zu. »Auf keinen Fall. Du machst die Fotos, ich schleuse dich rein. Das war die Absprache.«
»Das war die Absprache, als ich dich noch erpresst habe«, sagte sie lächelnd.
Er zuckte die Achseln. »Ich hab auch so genug zu tun.«
»Neue Umsturzpläne?«
»Irgendwer muss meine Stiefmutter aufhalten.« Zwischen seinen Augenbrauen erschien eine steile Falte, wie so häufig, wenn er über die Contessa Amarante sprach.
»Wir waren uns doch einig, dass wir das zusammen machen.«
»Es ist besser, wenn Silvia gar nicht erst auf dich aufmerksam wird. Nach der Bombe auf dem Forum Romanum wissen wir, wie weit sie geht, und ich will nicht, dass sie dir –«
»Spartaco.« Anna blieb stehen und sprach erst weiter, als er sich zu ihr umgedreht hatte. »Ich weiß, dass es gefährlich ist. Und es ist mir egal. Was wir brauchen, sind Beweise gegen deine Stiefmutter und die anderen. Die paar Artikel von Tulio Gallo über die Klinik beweisen gar nichts. Und solange Gallo nicht mit der ganzen Wahrheit rausrückt und alle so tun, als hätte es bei dem Anschlag keine Hintermänner gegeben …« Sie hielt kurz inne. »Wir können nur abwarten, was Silvia als Nächstes tut.«
Er hatte wieder diesen verbissenen Blick. Erst wenn seine Augen ganz schmal und ernst wurden, schienen sie wirklich in dieses schmale, ernste Gesicht zu passen. In Momenten wie diesem wurde offensichtlich, was ihn wirklich antrieb: der Schatten seines toten Vaters und die Furcht davor, dass etwas vom Conte Amarante auch in ihm steckte. Spartaco war der Sohn eines fanatischen Faschisten, und er redete sich Schuldgefühle ein, weil er diesen Mann trotz allem einmal gerngehabt hatte. So kam es ihm gelegen, dass er all seinen Zorn auf die Frau projizieren konnte, die das Erbe des Conte angetreten hatte. Und die Contessa machte es ihm leicht, sie zu hassen.
»Silvia soll wissen, dass ihr jemand auf der Spur ist«, sagte er. »Ich will, dass sie Angst hat.«
»Weil du sie nicht ausstehen kannst.«
Er schüttelte den Kopf. »Weil sie dann vielleicht Fehler macht. Und wenn das passiert, dann werd ich da sein und dafür sorgen, dass alle Welt davon erfährt.«
5
Als Palladino am Vormittag die Kapuzinerkirche an der Via Veneto betrat, hallte Orgelspiel durch das Gemäuer.
»Guten Morgen, Pater Rosario.«
Der braun gelockte Geistliche, der ihm im Mittelgang entgegenkam und die leeren Bankreihen auf zurückgelassene Gegenstände kontrollierte, schenkte ihm ein Lächeln. »Ciao, Gennaro. Du hast draußen nicht zufällig einen Hund auf der Treppe gesehen?«
»Was für einen Hund?«
»Er kommt immer um diese Zeit vorbei, kackt einen fetten Haufen auf die unterste Stufe und verschwindet wieder. Aber niemand sieht ihn.«
»Und Sie glauben, der Teufel hat dabei seine Hand im Spiel?«
»Gewiss nicht die Hand, mein Sohn.«
»Warum lauern Sie ihm nicht auf?«
»Um dann festzustellen, dass es nur ein Tier ist mit einem Besitzer, der sich buchstäblich einen Scheiß um die Unbeflecktheit unseres Gotteshauses schert?« Lächelnd schlug er ein Kreuzzeichen. »Ich verrat dir ein Geheimnis, Gennaro. Wir von der Kirche sind froh, dass der Teufel uns niemals von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Wir wären nur enttäuscht über seine ordinäre Boshaftigkeit. Lieber bewahren wir uns das Bild des satanischen Versuchers, der nie in Erscheinung tritt.«
»So wie der scheißende Hund auf der Treppe?«
»Der wahre Glaube lebt von der Kraft seiner Metaphern.« Mit einer Geste lud Rosario ihn ein, mit ihm den Mittelgang hinab Richtung Altar zu gehen. In der vordersten Reihe nahm er Platz und zog die braune Kutte glatt. »Es ist keiner hier außer unserem tauben Orgelspieler.«
Palladino setzte sich neben ihn. Über Musik wusste er wenig. Die einzigen Konzerte, die er je freiwillig besucht hatte, waren Lauras gewesen. Aber selbst mit seinem verbliebenen, ungeschulten Ohr hörte er, dass die Orgel über dem Kirchenportal äußerst kunstfertig bedient wurde. »Der da oben ist taub?«
Pater Rosario lächelte hinauf zur Kirchendecke. »Wenn du damit den Orgelspieler meinst, ja. Jedenfalls behauptet er das. Aber er wäre nicht der Erste, der es in einer Kirche mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt.« Er seufzte und wandte Palladino das Gesicht zu. »Du siehst heute noch schlechter aus als sonst.«
»Ich hab nicht viel geschlafen. Jemand hat versucht, mich umzubringen.«
»Vielleicht sollten wir in den Beichtstuhl gehen?«
»Ich hab ihn nicht getötet.«
»Aber jemand hat es getan.« Rosario faltete die Hände in seinem Schoß. Er sprach keinen Tadel aus, es war lediglich eine Feststellung.
»Der Polizei hab ich erzählt, dass ich es war. Für die war das Notwehr. Der Kerl hat meine halbe Wohnung in Schutt und Asche gelegt. Ein früherer Kollege, der heute bei der Anti-Mafia-Einheit ist –«
»Dieser Benedetto?«
Palladino stutzte. »Ich hab ihn nie erwähnt, oder?«
»Er war mit dir in der Zeitung. Nach der Geschichte auf dem Forum Romanum.«
Palladinos Miene verdüsterte sich. Er hatte darüber nachgedacht, seine Wohnung zu wechseln, vielleicht sogar seinen Namen. Aber inzwischen war es dafür wohl zu spät. »Benedetto weiß, dass der Bombenanschlag von Handlangern des Ascolese-Clans durchgeführt wurde. Für ihn ist deshalb klar, dass der Killer heute Nacht von denen kam.«
»Aber du glaubst das nicht?«
»Der Kerl hatte eine Tätowierung, die sich ehemalige Fremdenlegionäre stechen lassen. Das ist nicht die Art von Leuten, die einem die Mafia auf den Hals hetzt. Die haben ihre eigenen … Spezialisten für so was.«
Ein Ausdruck von leisem Erstaunen trat auf Rosarios Gesicht. »Du glaubst, der Mann war ein Söldner?«
»So was in der Art, ja.«
»Nun, du hast gewusst, dass die Etruskische Front es auf dich abgesehen hat.«
»Bisher haben die ihre Drecksarbeit von Carmine Ascoleses Leuten erledigen lassen. Der ehrenwerte Don Carmine ist hinüber, aber da ist sicher schon ein anderer nachgerückt. Außerdem hat die Etruskische Front gute Gründe, den Ball möglichst flach zu halten. Würden die also jemanden schicken, der gleich das halbe Haus abreißt? Wohl kaum.«
Der Priester richtete den Blick auf den prunkvollen Altar. »Ich rede gern mit dir über deine Sorgen. Aber was die Feinheiten der Gewaltausübung betrifft, bin ich nicht mehr am Puls der Zeit. All das liegt lange hinter mir.«
Pater Rosario lebte im Kapuzinerkloster an der Via Veneto und predigte dort in der Kirche Santa Maria Immacolata, nur einen Steinwurf entfernt von der amerikanischen Botschaft und den berühmten Cafés und Bars. Während des Krieges hatte er genau wie Palladino in den Bergen des Piemont gekämpft – damals hatten sie auf unterschiedlichen Seiten gestanden. Während Palladino Anschläge auf Eisenbahnbrücken und die Militärkonvois der deutschen und italienischen Faschisten verübt hatte, war Rosario überzeugter Anhänger Mussolinis gewesen und hatte als Gebirgsjäger Jagd auf Partisanen gemacht. Vor zwanzig Jahren hätten sie einander ohne mit der Wimper zu zucken über den Haufen geschossen. Heute aber hatte Palladino seine revolutionären Ideale an den Nagel gehängt, und Rosario bedauerte seinen Kampf für den Duce so sehr, dass ihn die Schuld ins Kloster getrieben hatte.
»Wenn ich Pech habe«, sagte Palladino, »hat es nicht nur die Mafia und die Etruskische Front auf mich abgesehen, sondern noch wer anders.«
»Die Contessa?»
»Hätte ich Ihnen lieber nicht von ihr erzählen sollen?«
»Ich und mein tauber Orgelspieler werden dein Geheimnis mit zum Herrn nehmen, Gennaro.«
»Sie wissen noch nicht alles über die Contessa. Sie gehört zu einer Gruppe von Männern und Frauen, die alle mal Patienten in einer Irrenanstalt in den Bergen waren. Vier Jahre lang hat man sie dort weggesperrt. Offenbar hatte es eine Art Massenpsychose gegeben, die dazu führte, dass alle diese Leute sich von heute auf morgen für wiedergeborene römische Kaiser hielten.«
»Arme, kranke Seelen.«
Palladino nickte, obgleich sich sein Mitgefühl in Grenzen hielt. »Nur dass diese armen, kranken Seelen zwanzig Jahre später – also heute – hohe Posten in Politik und Wirtschaft innehaben. Oder, wie die Contessa, einfach nur stinkreich geworden sind. Sie hat den Chef der Etruskischen Front geheiratet, und praktischerweise ist der Conte Amarante eines Nachts friedlich verschieden und hat ihr sein gesamtes Vermögen vermacht.«
»Der Herr hat es offenbar gut mit ihr gemeint.« Pater Rosario sah mit großem Ernst zum Altar. Ob er gelegentlich fürchtete, dass ihn sein Sarkasmus ins Fegefeuer führte? Möglich auch, dass er mit diesem Ausgang der Dinge längst seinen Frieden gemacht hatte.
»Ich kenne nicht die Namen aller achtzehn Patienten«, sagte Palladino, »aber ich weiß, dass einige von ihnen – wenn nicht sogar alle – heute bestens vernetzt sind. Es mag ja vorkommen, dass sich Eliteschüler nach zwanzig Jahren allesamt in solchen Positionen wiederfinden. Aber ein Haufen Psychiatriepatienten?«
Rosarios Blick verweilte noch einen Augenblick auf dem Altar, dann – als wären die Worte gerade erst zu ihm durchgedrungen – wandte er sich Palladino zu. »Warum erzählst du mir das alles?«
»Weil ich versuche, so was wie einen roten Faden zu finden, der von der Contessa Amarante über Bastarde wie Carmine Ascolese bis zu einem Killer führt, der mir Löcher in die Wände schießt.«
»Das ist nicht der wahre Grund.«
Palladino nahm sich Zeit, ehe er zögernd zu einer Erwiderung ansetzte. »Ich brauch mal wieder Ihren Rat, Pater. Ich hab Angst. Nicht um mich – um Laura.«
»Es ehrt dich, dass du dir trotz eurer Trennung Sorgen um sie machst.«
»Diese Leute wissen Bescheid über Laura. Und ich glaube, denen ist auch klar, dass sie mich … dass sie mich treffen können, wenn sie ihr was antun.«
»Dann bring sie in Sicherheit«, sagte Rosario.
»Sie lebt draußen vor der Stadt in einem Bauernhaus, das mal meinen Eltern gehört hat. Selbst nach der Sache mit der Bombe weigert sie sich strikt, in meine Nähe zu ziehen. Ich hab wirklich alles versucht.«
»Du meinst, sie wäre sicherer in der Nähe von jemandem, der von Fremdenlegionären gejagt wird?«
»Ich kann sie beschützen. Ich könnte –«
»Du kannst nicht mal auf dich selbst aufpassen.« Die Strenge in der Stimme des Paters überraschte Palladino. »Um was geht’s dir also wirklich?«
»Sie … sie darf niemals erfahren, was ich getan hab. Was ich bin. Oder war.«
»Ganz im Gegenteil«, erwiderte Rosario. »Sie sollte es von dir erfahren statt von einem anderen.«
Palladino schüttelte den Kopf. Er fühlte sich schwer an, als wollte er ihn mit der Stirn voran auf die steinernen Stufen des Altars ziehen. »Sie würde mir das nie verzeihen.«
»Weil du’s dir selbst nicht verzeihen kannst?«
»Ich komm schon damit klar.«
»Tauchst du deshalb so oft in meiner Kirche auf? Weil du so gut damit klarkommst, einer von den Bösen zu sein? Gott ist die Rettung für jedermann.«
»Ich glaube nicht an Gott, Pater. Und das wissen Sie auch.«
»Du denkst, er kann dir nicht helfen. Aber Reden hilft dir. Und auch das ist Gottes Werk.« Sein rechter Mundwinkel zuckte. »Wir schreien das nur nicht ganz so laut in die Welt hinaus wie die Auferstehung Jesu. Wegen irgendwas müssen die Leute ja noch zu uns kommen.«
Palladino dachte an die Contessa Amarante, an den Baron De Luna und an den toten Fausto am Kreuz in seinem Atelier. »Eine ganze Menge Leute scheinen plötzlich an Auferstehung zu glauben.«
Pater Rosario ging darüber hinweg. »Was Laura angeht: Es würde ihr helfen, wenn sie wüsste, was dir zu schaffen macht. Sie ist nicht dein Problem, Gennaro – sie ist die Lösung.«
»Sie würde mich hassen.«
»Du bist wie der Hund da draußen auf der Treppe. Du kommst alle paar Tage vorbei, lädst deinen Unrat ab und verschwindest in der Hoffnung, dass dich keiner gesehen hat. Irgendwann wirst du zu dem stehen müssen, was du bist. Und was du sein willst.«
»Was ich ganz sicher nie sein wollte, ist ein Scheißheld. Der Kerl da in den Zeitungen, der die Leute vor der Bombe gerettet hat, der bin ich nicht. So einer werd ich auch nie sein.«
»Vielleicht solltest du Laura danach fragen. Zumindest den anständigen Teil von dir kennt sie besser als irgendwer sonst. Zeig ihr, wer du mal warst und was mit dir geschehen ist. Dann wird sie dir verraten, wen sie heute in dir sieht. Eine bessere Antwort als sie wird dir keiner geben – und damit wirst du dann leben müssen, so oder so.«
So oder so. Palladino wusste nicht, was er sich von Pater Rosario erhofft hatte. An Wunder glaubte er nicht, an eine göttliche Macht schon gar nicht. Und doch hatte er in den letzten Wochen Dinge erlebt, die völlig unmöglich waren.
»Kann ich hier rauchen?«
Rosario warf ihm einen tadelnden Blick zu. »Draußen auf –«
»Auf der Treppe. Ich weiß schon.« Er stand auf. Sein Kopf fühlte sich noch immer schwer an, aber die Gedanken darin schossen nicht mehr kreuz und quer. »Danke, Pater.«
»Alles in allem bin ich doch ganz froh, dass ich dich in den Bergen nicht umbringen musste.«
An einem anderen Tag hätte Palladino vielleicht gelacht. Nach der Nacht, die hinter ihm lag, reichte es nur für ein träges Grinsen, während er zwischen den Kirchenbänken zurück zum Portal ging. Seine Hand glitt in die Jackentasche und förderte sein Feuerzeug und eine Zigarette zutage. Auf halbem Weg zur Eingangstür zündete er sie an und nahm einen ersten, tiefen Zug.
Hoch über ihm erklang ein schriller Schrei.
Palladino erstarrte und schaute hinauf ins Kirchengewölbe. Aus dem Augenwinkel bemerkte er einen Schemen, der über eine Stuckleiste huschte, doch schon im nächsten Moment war dort nichts mehr zu sehen.
Als er zurück zu Pater Rosario blickte, bedachte der ihn wegen der Zigarette nur mit einem Kopfschütteln. Er schien den Laut nicht gehört zu haben, wandte sich mit resigniertem Schulterzucken von Palladino ab und entfernte sich in Richtung Altar.
Ein zweiter Schrei.
Palladinos Magen krampfte sich zusammen. Diesmal war er sich sicher, dass der Laut aus der Kehle eines Pavians stammte. Insgeheim hatte er sich schon gefragt, wann er Faustos Affen wieder begegnen würde. Ihm graute davor, zu erfahren, warum er hier war.
Er ließ die Zigarette fallen und trat sie aus. Dann stürmte er los, zwischen den Bankreihen hindurch, am Portal vorbei nach rechts. Durch eine offene Seitentür gelangte er in ein Treppenhaus und rannte enge Steinstufen hinauf.
Das Seitenstechen setzte ein, noch bevor er die schmale Holztür erreichte. Er stieß sie auf, die Scharniere knirschten, und er kniff die Augen zusammen.
Vor ihm lag der halbdunkle Dachboden der Kirche, ein Gitter aus Balken und Stegen, unter denen die Oberseite der Gewölbedecke zu sehen war. Das wenige Licht fiel in langen Bahnen durch Fenster in den steilen Dachschrägen, keines größer als eine Schießscharte.
Der Pavian schrie erneut und schnatterte aufregt. Diesmal ganz nah.
Palladinos Atem raste, als er den Hauptsteg in der Mitte des Dachbodens betrat. Unter seinen Sohlen ächzte das Holz.
Ein breiter Umriss schälte sich aus dem Zwielicht.
Der mannsgroße Pavian erwartete ihn am Ende des Stegs. Obwohl er ihm mit jedem Schritt näher kam, konnte Palladino das Tier nur undeutlich erkennen. Es wirkte seltsam substanzlos, fast durchscheinend. Bei ihren früheren Begegnungen war das anders gewesen. Zweimal schon hatte ihm das kreischende Biest das Leben gerettet, die Handlanger Carmine Ascoleses getötet und schließlich den Mafiaboss selbst zerfleischt. Ascolese war wimmernd auf den Stufen seiner Villa gestorben, und nur Palladino und Ugo wussten, wer für seinen Tod verantwortlich war.
Die Geräusche, die der Pavian von sich gab, klangen nicht länger nach Gefahr, sondern kläglich und schwach. Das massige Tier wimmerte.
Eine zweite Gestalt trat aus den Schatten an die Seite des verblassenden Affen, ein spindeldürrer Mann in einer altmodischen Uniform, wie ein Zirkusdirektor.
»Gennaro Palladino.«
»Fratelli«, entgegnete er kühl.
Der Fabelhafte Fratelli trug seinen schwarzen Zylinder und weiße Handschuhe. Seine Arme und Beine waren zu lang für seinen Körper, und einmal mehr musste Palladino bei seinem Anblick an ein Insekt denken, eine Heuschrecke in einem Gehrock aus Schwarz und Gold.
Neben ihm begann der Affe zu zittern wie ein Fieberkranker.
»Was ist los mit ihm?«, fragte Palladino.
Fratellis Blick war stechend. »Er wird dir in Zukunft nicht mehr beistehen. Er war das Spielzeug Neros. Als du Nero getötet hast –«
»Ich hab einen verdammten Maler getötet, und nicht mal einen guten.« Palladino blieb in der Mitte des Stegs stehen, oberhalb des Kirchengewölbes.
»Du weißt, wer Fausto wirklich war«, sagte Fratelli, als spräche er mit einem uneinsichtigen Kind. »Nero hat in ihm weitergelebt, und du hast ihn getötet. Der Affe war unsere Verbindung zu ihm. Doch mit Nero sind auch seine Erinnerungen gestorben. Der Affe war immer nur der Nachhall von etwas, das längst vergangen ist. Künftig wirst du ohne seinen Schutz auskommen müssen.«
»Bin ich schon. Lief alles super.«
»Du bist heute Nacht fast gestorben!«
»Ich bin hier. Ich lebe noch. Das genügt.«
»Wir haben dir eine Aufgabe gegeben. Es wird Zeit, dass du sie erfüllst.«
Palladino schüttelte entschieden den Kopf. »Ich will niemanden mehr töten.«
»Wegen der Frau?« Fratelli verzog abfällig das Gesicht. »Denkst du wirklich, sie wird dir all deine Verbrechen nachsehen, nur weil du jetzt ein besserer Mensch werden willst?«
Für einen Moment, vorhin im Gespräch mit Rosario, hatte Palladino das tatsächlich geglaubt. Es war genau der Funke Hoffnung gewesen, der nötig gewesen war, um so etwas wie Zuversicht in ihm zu entfachen. Aber Fratelli hatte natürlich recht: Laura würde ihm niemals verzeihen. Manches hatte sie geahnt, ein paar Dinge wohl auch gewusst, aber nichts über die Morde.
Fratelli lehnte sich vor und reckte Palladino das spitze Kinn entgegen wie ein hässlicher Kistenclown. »Vernichte die Diener der Ordnung! Es sind mehr als nur die achtzehn aus dem Institut. Es gibt andere, die ihr Geheimnis all die Jahre über bewahrt haben. Imperatoren, die vom Volk als Götter verehrt wurden.«
»Sind sie das denn – Götter?«
»Nein. Sie dienen der Ordnung, so wie ich dem Chaos diene. Sie sehnen sich danach, zu führen und Stärke zu zeigen. Den Menschen Regeln aufzuerlegen, die sie selbst niemals einhalten würden. Und sie sind schon früher gescheitert. Du wirst dafür sorgen, dass ihre Pläne erneut zerschlagen werden. Du und noch andere.«
Palladino runzelte die Stirn. »Welche anderen?« Vielleicht konnten die den Auftrag allein erledigen. Vielleicht gab es einen Ausweg.
»Es ist nicht nötig, dass ihr einander begegnet. Jeder kämpft für sich allein.«
Palladino richtete seine Aufmerksamkeit auf das Tier. Der Pavian war jetzt kaum noch zu sehen. Ein einzelner Lichtstrahl fiel durch seinen Umriss wie durch Glas. Noch während Palladino hinsah, löste er sich vollständig auf.
Dann stand nur noch Fratellis Silhouette am Ende des Stegs, ein Albtraum aus Palladinos Kindheit, eine groteske Strichfigur, wie von einem Fünfjährigen mit Kohle gezeichnet. »Die Pik-Dame ist nicht mehr der gefährlichste Trumpf des Feindes. Ein neuer Gegner ist aufgetreten. Jemand, der viel mächtiger ist als sie. Er war es, der versucht hat, dich heute Nacht töten zu lassen.«
»Erst sie, dann ein anderer …« Palladino schüttelte den Kopf. »Das ist dein großer Plan? Jetzt weiß ich, was du mit Chaos meinst.«
»Du wirst tun, was wir dir auftragen.« Etwas an Fratellis Stimme hatte sich verändert. Er klang, als würde starker Wind seine Worte in eine andere Richtung treiben. »Und jetzt geh, Palladino!«
»Was, wenn ich es nicht tue?« Palladino trat einen Schritt vor, dann noch einen. »Ich brauche darauf eine Antwort!«
Fratellis Stimme drang an sein Ohr wie durch eine schlechte Telefonleitung. »Was du brauchst, sind keine Antworten, sondern Gründe. Wir können dir Gründe geben.«
»Warte! Was für Gründe?« Er blieb erst stehen, als er das Ende des Stegs erreicht hatte.
Fratelli war nirgends mehr zu sehen.
Palladino hielt den Atem an und horchte. Aber da war nur noch der Klang der Orgel.
6
D