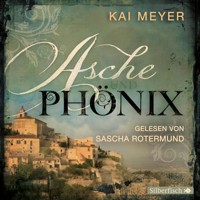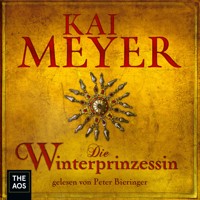9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Phantastisch, abenteuerlich!
Dezember 1812. Wie ein Flüchtiger reist der vor Moskau geschlagene Napoleon durch Europa. In tiefer Nacht macht er in Weimar Station und sucht Goethe mit einem dringenden Anliegen auf … Wenige Tage später reisen die Brüder Grimm an den Hof zu Karlsruhe – mit einer Empfehlung Goethes. Der Herzog sucht einen Lehrer für sein neugeborenes Kind. Doch in Karlsruhe stoßen sie bald auf schaurige Warnungen. Wer drängt sie, von ihrem Auftrag abzulassen? Was hat es mit dem herzoglichen Sohn auf sich? Als die Brüder der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, geraten sie selbst in tödliche Gefahr ...
„Kai Meyer ist ein Zauberweltenerfinder.“ Focus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Januar 1813. Am badischen Hof in Karlsruhe geraten die Brüder Grimm in eine bizarre Intrige. Eine Prinzessin aus Indien macht Jagd auf den neugeborenen Sohn des Herzogs – und die Grimms werden Zeugen von Mord und Erpressung.
Dezember 1812. Wie ein Flüchtiger reist der vor Moskau geschlagene Napoleon durch Europa. In tiefer Nacht macht er in Weimar Station und sucht Goethe mit einem dringenden Anliegen auf …
Wenige Tage später reisen die Brüder Grimm an den Hof zu Karlsruhe – mit einer Empfehlung Goethes in der Tasche. Der Herzog sucht einen Lehrer für sein neugeborenes Kind. Doch in Karlsruhe stoßen sie bald auf schaurige Warnungen. Wer drängt sie, von ihrem Auftrag abzulassen? Was hat es mit dem herzoglichen Sohn auf sich? Als die Brüder der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, geraten sie selbst in tödliche Gefahr.
Kai Meyer ist ein »Zauberweltenerfinder« FOCUS
Kai Meyer
Die Winterprinzessin
Ein unheimlicher Romanum die Brüder Grimm
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Epilog
Nachwort des Autors
Über Kai Meyer
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Findet, so werdet ihr suchen
Eintrag im Gästebuch der Brüder Grimm,3. Januar 1808
Fünf Große Fragen gibt es. Wann ist die jüngste, denn jung ist unser Maß der Zeit. Kaum älter ist auch Wo, gefolgt bald von der Frage Wer, mit ihr begriff der Mensch sich selbst. Altehrwürdig dagegen Wie, sie hinterfragt den Lauf der Dinge. Die älteste, die klügste ist Warum, denn sie steht am Beginn des Denkens. Fünf Große Fragen. Sie beherrschen die Sprachen, sie regieren die Welt.
Und da sind fünf, die es ihnen gleichtun wollen. Sie gaben sich selbst einen Namen:
Quinternio der Großen Fragen.
Prolog
Weimar, im Dezember 1812
»Warum?« fragte die Dienstmagd Dorothea, als der Kaiser auf ihre Schwelle trat, denn sie wußte nicht, daß er der Kaiser war, und hätte sie es gewußt – nun, er war Franzose. Davon gab es zu jener Zeit in Weimar viele, und sie mochte keinen einzigen von ihnen, ganz gleich ob Bettler oder Söldner oder Kaiser oder Gott (denn hieß es nicht: »Essen wie Gott in Frankreich« oder »Gott ißt in Frankreich« oder »Gott ist in Frankreich«?).
Die Frage schien ihr angemessen, denn es war tiefste Winternacht. Tief waren Dunkelheit und Schnee und sicher auch der Schlaf des Herrn, den der Besuch zu sprechen wünschte. Der Herr Geheimrat brauchte Ruhe, er war nicht mehr der Jüngste. Die Uhr hatte längst Mitternacht geschlagen, als er die letzte Kerze löschte; und nun ging es schon bald auf vier – am Morgen, wohlgemerkt.
Der kleine Gast – er reichte kaum zu Dorotheens Schulter – bedachte sie mit einem Wortschwall. Die Kälte in seinem Blick übertraf dabei selbst jene, die vom Frauenplan herein ihr Nachtgewand durchwehte. Der Schnee lag kniehoch und würde noch viel höher steigen, wenn der Flocken dichter Fall so anhielt wie bisher.
Schnee lag auf der Mütze des Franzosen, Schnee lag auf seinen Schultern und auf dem schlichten Pferdeschlitten, der draußen vor dem Haus hielt. Der Schlittenlenker saß in Felle gehüllt auf seinem Bock, die Zügel der schnaubenden Pferde locker in der Hand. Ob in der Kabine des Schlittens weitere Fahrgäste saßen, vermochte Dorothea nicht zu erkennen. Der Vorhang des Einstiegs war zugezogen. Wohl fiel durch Ritzen sanftes Licht, ein gelbes, zartes Lampenflackern.
Sie dachte nicht daran, den Fremden einzulassen. Er hatte sich nicht vorgestellt, machte auch keine Anstalten, dergleichen nachzuholen. Als kennte sie jeden Franzosen auf der Welt! Sollte der dreiste Zwerg doch im Kalten stehen, bis ihm die Ohren klirrten!
Da sprach die Stimme des Herrn in ihrem Rücken: »Den Gruß des Unbekannten ehre, Dorothea. Der erste Gruß ist viele tausend wert, drum grüße freundlich jeden der begrüßt.« Ein humoriger Klang schwang in seinen Worten, wie oft, wenn er sich selbst zitierte.
Goethes Hände ergriffen sie von hinten an den Schultern und schoben sie beiseite. Verwirrt, wenngleich mit Reden solcher Art nur allzu vertraut, machte Dorothea Platz und musterte verwundert ihren Herrn. Er trug nur ein Nachthemd, hielt seine Schlafmütze in der linken, einen Kerzenleuchter in der rechten Hand. Er hatte den nächtlichen Gast wohl längst erkannt, denn nun drückte er Mütze und Kandelaber in Dorotheens Hände, ergriff die behandschuhte Rechte des Kleinen und schüttelte sie aufs herzlichste. »Tretet ein«, bat er.
Dies tat der Gast und strafte Dorothea mit Mißachtung. Ihr sollte es recht sein. Der Flegel war ihr längst zuwider. Wollte wohl durch schlechtes Benehmen wichtig tun, der Gnom.
Der Herr bat den Franzosen, ihm hinauf ins Haus zu folgen. Dorothea ging in gehörigem Abstand hinterher. Nicht einmal den Schnee hatte der Fremde von seinen Stiefeln geklopft. Bei jedem Schritt hinterließ er eine Pfütze, selbst der Salve-Schriftzug am oberen Treppenabsatz grüßte alsbald durch Wasser und Eis.
Die beiden schlugen den Weg zum Arbeitszimmer ein. Nur einmal blieb Goethe stehen, wandte sich zu Dorothea um und gestattete ihr, wieder zu Bett zu gehen. Sie fragte noch, ob er den Dienst des Kammerdieners nötig habe; der Herr aber gedachte keineswegs, sich anzukleiden. Der Besuch mußte wahrlich wichtig sein, wenn er ihn gar die Regeln des Anstands vergessen ließ. Nun, es war nicht ihr Besuch. Nicht ihre Sorge.
Sie machte sich auf zu ihrer Kammer, doch wie so oft ließ ihr die Neugier keine Ruhe. Sie schlich zurück, so leise sie konnte, preßte ihr Ohr an die Tür des Arbeitszimmers. Zu ihrer Enttäuschung unterhielten sich die beiden Männer in der Sprache des Besuchers. Nur Bruchstücke waren es, die Dorothea verstehen konnte.
Es ging wohl um ein Kind, gerade erst geboren, irgendwo im Badischen. Das Leben des Kleinen schien bedroht, von fremden Mächten war die Rede, von – Gott bewahre! – Götzendienern. Der Besucher mußte der Großvater des Kindes sein, und ihm schien viel an seinem Sproß zu liegen. So war es wohl solch zarte Zuneigung, die ihn bewog, Ungeheueres zu verlangen. Dorothea traute ihren Ohren kaum und war geneigt, das Gehörte auf ihr mangelndes Französisch zu schieben – bat doch der kleine Mann den großen Dichter, er möge sich der Erziehung des Kindes annehmen! Ihr Herr Goethe eine Amme!
Unverfroren war der Fremde, in der Tat, fraglos ein Nichtsnutz, von Größenwahn getrieben. Um so mehr erstaunte sie, wie ruhig und höflich der Herr Geheimrat blieb. Er lehnte ab, natürlich, doch er tat es mit den freundlichsten, den sanftesten Worten, als begreife er das Anliegen seines Gastes durchaus und könne es gar nachvollziehen. Trotzdem, er sagte nein, und dabei blieb es.
So nahm man Abschied voneinander, und Dorothea beeilte sich, davonzulaufen. Dabei rutschte sie in einer der Eispfützen aus, setzte sich im Nachtgewand ins Nasse und hatte alle Mühe, zu verschwinden, ehe man sie bemerken mochte. Holla, sie würde einiges zu erzählen haben, wenn sie sich am nächsten Tag mit dem Bauer Rosenberg zum Stelldichein traf!
Vom Fenster aus beobachtete sie, wie der Franzose durch den Schnee zum Schlitten stapfte. Goethe schloß die Tür. Dann hörte sie, wie ihr Herr die Treppe hochstieg und abermals ins Arbeitszimmer trat. Niemand sonst schien die Störung bemerkt zu haben, weder der Kammerdiener noch Goethes junge Frau Christiane. Nach Minuten endlich herrschte Ruhe.
Der Schlitten wartete immer noch vorm Haus. Der kleine Franzose stand unterhalb des Kutschbocks und redete auf den vermummten Lenker ein. Da, plötzlich, blickten sich die beiden um, gleichsam erschrocken, ängstlich gar. Der Franzose sprang gehetzt ins Innere der Kabine, der Lenker gab seinen Rössern die Peitsche. Eilig glitt der Schlitten davon, so geschwind, als ginge es um Leben und Tod.
Und während sich Dorothea noch über den hastigen Aufbruch wunderte, preschten sechs Pferde auf der Spur des Schlittens dahin, darauf sechs schwarze Reiter. Gefolgsleute oder Verfolger? Ihre weiten Mäntel flatterten. Der dampfende Atem ihrer Pferde ließ sie dahinschweben wie auf einer Nebelwolke, die sie mit jedem Schritt umwogte. Nur dem Schnee war es zu danken, daß nicht ganz Weimar vom Trampeln der Hufe erwachte.
Irgend etwas stimmte nicht mit den Gesichtern der Reiter. Dorothea preßte Handflächen und Nase an die Scheibe. Durch das Netz der Frostkristalle erhaschte sie einen letzten Blick, nunmehr von hinten. Das waren doch keine Mützen auf ihren Hinterköpfen, auch kein Haar. Waren es … Federn?
Nein, dachte sie, es war die Nacht, die sie täuschte. Die Nacht, ihre Aufregung und die Kälte auf den Scheiben. Schlitten und Reiter verschwanden im Dunkel. Bald schon würde der Schnee ihre Spuren zudecken; alle, bis auf die Pfützen im Haus.
Lange noch stand Dorothea am Fenster und starrte zitternd hinaus in die Nacht. Doch alles, was sie sah, waren Eisblumen, die ihr Atem zu funkelndem Tau zerschmolz.
Erster Teil
Barfuß durchs Feuer – Träume von Blumen und Haarausfall – Ein totes Kind, das lebt? – Fünf Fragen, fünf Teufel und eine Prinzessin – Vogelmenschen im Schmetterlingshaus – Leichenregen – Der Feind wünscht guten Abend
1
In der Wirtsstube roch es beißend nach Zwiebeln und Schweiß – und noch etwas anderem, seltsam Exotischem, das weder Jacob noch ich zu benennen wußten. Die beiden Fenster standen offen, trotz der Januarkälte, doch die frische Luft blieb ohnmächtig angesichts der Wirtshausschwaden. Über den Wipfeln des Hardtwalds herrschte düsteres Grau und brachte Kunde von mehr und noch mehr Schnee, der die Wege verstopfen und die Ödnis der Wälder noch einsamer, noch finsterer gestalten würde. Wollten wir vor Anbruch der Nacht und neuerlichen Schneemassen von hier fort sein, schien es ratsam, dies so schnell als möglich zu tun. Unsere Kutsche lag ein Stück weiter nördlich am Wegrand, ein Vorderrad geborsten, und dies Gasthaus schien der einzige Ort in der Wildnis, an dem wir auf Hilfe hoffen durften. Zwei Wagen standen vor dem Haus bereit zur Abfahrt, und unser Streben war es, in einem davon zwei Plätze zu ergattern, wenigstens bis zur nächsten größeren Stadt. Der eine war eine Postkutsche, und sie war es, die uns besonders geeignet erschien.
Wir schrieben den ersten Tag des neuen Jahres 1813. An mehrere Tischen lärmten Holzfäller nach einer durchzechten Nacht und einem durchfeierten ersten Januar. Als wir den Schankraum betraten, stimmten sie gerade ein Lied an. Einer forderte uns mit erhobenem Bierkrug auf, uns den frohen Gesängen anzuschließen – was freilich weder an diesem noch an jedem anderen Tag unseren Neigungen entsprochen hätte. So traten wir einfach an ihnen vorüber, nicht ganz ohne Unbehagen, wie ich gestehen muß, und näherten uns der Theke, wo der Postillion beim Essen saß. Außer ihm und den Holzfällern gab es zwei weitere Gäste, wohl die Reisenden aus der zweiten Kutsche, die an einem Ecktisch saßen und Eintopf in die Schatten ihrer hochgeschlagenen Kapuzen löffelten. Ihre Gesichter lagen völlig im Dunkeln.
Der Postillion trug einen Mantel mit Fellbesatz, ganz ähnlich wie Jacob und ich. Sein zackiges Vogelgesicht musterte uns mißtrauisch, als wir an seine Seite traten und ihn grüßten.
»Wohl bekomm’s«, sagte ich mit Blick auf den zähen Zwiebeleintopf in seiner Schale, der einzigen Speise, die der Wirt seinen Gästen anbot. Auch die Holzfäller hatten einen großen Topf davon auf einem ihrer Tische stehen. Einer kippte gerade sein Bier hinein. Seine Kameraden begrüßten es mit lautem Gejohle und rangen miteinander um Nachschlag.
Der Postkutscher brummte etwas und warf einen Blick auf das halbe Dutzend Postsäcke, die er neben sich an die Theke gelehnt hatte. Offenbar fürchtete er, Jacob könne sich daran zu schaffen machen, während ich ihn ablenkte.
Nun, wir wollten nur mit ihm nach Süden fahren, nicht seine Freunde werden. Ich beeilte mich, unser Anliegen vorzubringen, und nachdem wir einen viel zu hohen Preis geboten hatten, erklärte er sich bereit, uns mitzunehmen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!