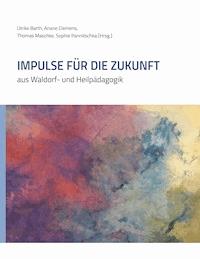
Impulse für die Zukunft E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die leitende Grundfrage eines in der Aus- und Weiterbildung von Pädagog*innen tätigen Instituts bezieht sich auf das dort inhärente Verständnis von Studium und damit einer zeitgemäßen Erwachsenenbildung. Zum einen gilt es, Inhalte zu vermitteln, und zum anderen persönliche Entwicklungsprozesse anzustoßen, sowie sich auch als Lehrende in der Begegnung weiterzuentwickeln. Fragen wollen immer wieder neu gestellt und beleuchtet, Antworten angepasst werden. Wie gestalten sich Bildungsprozesse für Menschen, die sich selbstverantwortlich in diese stellen, um sich umfassend vorzubereiten auf eine spätere berufliche Tätigkeit, welche dann die persönliche (Weiter-)Veränderung genuin in sich trägt? Pädagog*innen gestalten Zukunft - in Verantwortung und immer neu. MIT BEITRÄGEN VON: Christiane Adam, Ulrike Barth, Matthias Bunge, Ariane Clemens, Christiane Drechsler, Gisela Erdin, Johannes Kühl, Thomas Maschke, Sophie Pannitschka, Albert Schmelzer, Peter Schnell, Ha Vinh Tho, Johannes Wagemann, Götz W. Werner, Angelika Wiehl, Dirk Wollenhaupt und Studierenden
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Einleitung der Herausgeber*innen
Lebendige Anthropologie als Grundlage der Waldorfpädagogik
Albert Schmelzer
Erziehung oder Freiheit?
Die Entwicklung des Kindes im Spiegel unterschiedlicher Entwicklungstheorien
Gisela Erdin
Goetheanismus und Physik
In welchem Sinne ergänzen sich Goetheanismus und konventionelle Naturwissenschaft?
Johannes Kühl
Bewusstseinsphänomenologische Bemerkungen zum Rhythmusmotiv in Rudolf Steiners Allgemeiner Menschenkunde
Johannes Wagemann
Erziehungskunst als Soziale Plastik
Matthias Bunge
Freiheit und Verantwortung – zum Berufsbild von Klassenlehrer*innen an Waldorfschulen
Ariane Clemens und Thomas Maschke
Motiv Entwicklung: Persönlichkeitsentfaltung für den Lehrer*innenberuf
Sophie Pannitschka
Lernen, ein künstlerischer Prozess?!
Ein Essay
Dirk Wollenhaupt
Träumen – Denken – Wollen – Tun
Über die Notwendigkeit einer Debatte über die Zukunft unseres Zusammenlebens. Ein Essay
Götz W. Werner
Wir brauchen eine neue Aufmerksamkeitskultur
Angelika Wiehl im Gespräch mit Ha Vinh Tho, März 2018
„Ich denke tiefgehender und gleichzeitig freier“
Ergebnisse einer qualitativen Studierenden-Befragung
Studierende von Akademie und Institut
Interkulturelle Bildung: Waldorfpädagogik in der Migrationsgesellschaft
Christiane Adam und Albert Schmelzer
Motivation und Widerstand – Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Ein Zwischenruf
Christiane Drechsler
Pädagogik aktiv und positiv gestalten: Individualität in Gemeinschaft – ohne Diskriminierungen
Ulrike Barth und Thomas Maschke
„Wir brauchen immer neue Ideen und Entwicklungen“
Interview mit Peter Schnell
Autoren*innen
Einleitung der Herausgeber*innen
Die Konzeptionierung und Herausgabe eines Buches, welches die Vielfalt der Themen und damit Arbeitsbereiche und Arbeitsfrüchte eines im pädagogischen Spektrum tätigen Instituts abbilden möchte, steht vor einer umfassenden Aufgabenstellung und vielen Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen.
Die alles leitende Grundfrage bezieht sich auf das dort inhärente Verständnis von Studium und damit einer zeitgemäßen Erwachsenenbildung. Zum einen gilt es, Inhalte zu vermitteln, und zum anderen persönliche Entwicklungsprozesse anzustoßen sowie sich auch als Lehrende in der Begegnung weiterzuentwickeln. Fragen wollen immer wieder neu gestellt und beleuchtet, Antworten angepasst werden. Wie gestalten sich Bildungsprozesse für Menschen, die sich selbstverantwortlich in diese stellen, um sich umfassend vorzubereiten auf eine spätere berufliche Tätigkeit, welche dann die persönliche (Weiter-)Veränderung genuin in sich trägt?
Hier ist die Ebene der Persönlichkeitsentwicklung im Sozialen ebenso berührt, wie die Frage nach bildenden Inhalten und adäquaten Lehrmethoden. Einige Kolleginnen und Kollegen sowie Freunde der Akademie für Waldorfpädagogik und des Instituts für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität der Alanus Hochschule machen sich in ihren Beiträgen darüber Gedanken, wie sie sich zu Inhalten und Methoden, Fragen und Wegen im Themenkomplex einer Ausbildungsstätte von Heil- und Waldorfpädagogik stellen.
Fragen, als „Vorboten von Antworten“ (Maschke) stehen neben Beobachtungen und Überzeugungen, Möglichkeiten und Ideen. Tätige Menschen geben einen Einblick in ihr „inneres Atelier“ (das hier über einen Satz aus dem jeweiligen Beitrag repräsentiert wird):
„Und wie können wir Kompetenzen für etwas entwickeln, was wir noch nicht kennen“ (Wollenhaupt)? „Kann man sich auf eine solche Aufgabe [als Klassenlehrer*in] überhaupt ‚gut genug‘ vorbereiten – und wenn ja, wie“ (Clemens/Maschke)? „Die gute Nachricht dabei ist: Dadurch, dass wir sie [die Systeme unserer Gesellschaft] in jedem Augenblick unseres Lebens mitgestalten, können wir sie auch ändern“ (Ha Vinh Tho). „Diese Kinder haben gelernt, dass Verschiedenheit etwas Gutes ist. Mit Glück werden sie ihr Leben entsprechend gestalten“ (Drechsler).
„Wie und warum funktioniert Waldorfpädagogik? Lässt sich dieses Funktionieren von den als rätselhaft oder auch als Zumutung empfundenen Anschauungen Rudolf Steiners ablösen“ (Wagemann)? „Damit wird die Frage nach der Freiheit zu einer nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Geht man dieser Frage nach, so stößt man auf zwei Faktoren: Wahrnehmung und Denken“ (Schmelzer). „Anliegen dieses Beitrags ist es zu beschreiben, wie zum einen der Goetheanismus das Verständnis der konventionellen Physik vertiefen kann, aber auch umgekehrt Kenntnisse aus der Physik goetheanistische Gesichtspunkte beleuchten können“ (Kühl). „Wie Künstler*innen, so sind auch Pädagog*innen auf die notwendige Einbildungskraft als produktives Erkenntnis- und Darstellungsvermögen angewiesen“ (Bunge).
Aber, „wie gelingt es unser Zusammenleben so zu gestalten, dass jede*r erlebt, dass es auf ihn und sie ankommt – egal wie der soziale Status ist“ (Werner)? „Entwicklungstheorien versuchen, die Entwicklung des Kindes zu erklären. Wie ist es möglich, dass das Kind etwas Neues aus sich hervorbringt“ (Erdin)? „Daher ist es bei Lehrenden ein „Entwicklungswille“ [der zu entwickeln ist], der diesbezüglich ein Leitstern für den eigenen Habitus und das Rollenverständnis ist“ (Pannitschka).
„Ich denke tiefgehender und gleichzeitig freier“ (Studierendenbefragung). „Also muss man sich um die junge Generation kümmern, nicht um zu indoktrinieren, sondern um den vollen Entfaltungswillen der nachwachsenden Generation zu fördern“ (Schnell).
Am 26. und 27. Oktober 2018 feiern die Akademie für Waldorfpädagogik und das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität der Alanus Hochschule, dass seit 40 Jahren in Mannheim Waldorflehrer*innen und Heilpädagog*innen ausgebildet werden. Wir haben aus diesem Anlass Freund*innen und Kolleg*innen um Beiträge gebeten, die das inhaltliche Spektrum unserer Forschungs- und Lehrtätigkeit repräsentieren und im vorliegenden Band erscheinen – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Wir möchten an dieser Stelle all jenen, die zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben, von Herzen danken. Neben den Autor*innen gilt unser Dank Heike Fangrat, Ute Wieckhorst und Valerie Zoth: Sie haben dem Buch sein Aussehen und seine Gestalt verliehen. Ein besonderer Dank geht an Michael Schröder: Er gibt uns immer das Gefühl, frei arbeiten zu können, – und schafft durch seinen Einsatz die Bedingungen, die unsere Arbeit ermöglichen.
Mannheim im Oktober 2018
Ulrike Barth, Ariane Clemens, Thomas Maschke, Sophie Pannitschka
Albert Schmelzer
Lebendige Anthropologie als Grundlage der Waldorfpädagogik
„Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage der Erziehung und des Unterrichts sein. Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen“ (Steiner, 1919/1961, S. 37).
Diese Sätze, die Rudolf Steiner im Sommer 1919, wenige Wochen vor der Begründung der ersten Waldorfschule, geschrieben hat, deuten in programmatischer Schärfe auf eine „wahrhaftige Anthropologie“ als Quelle der Waldorfpädagogik hin. Was ist mit dieser Formulierung gemeint? Steiner hat sich, angefangen von seinen frühen philosophischen Werken bis hin zu den späten medizinischen Schriften und Vorträgen, während seines ganzen Lebens intensiv um eine Erkenntnis des Menschen bemüht; die von ihm entwickelte Anthroposophie möchte dem Menschen ein „Bewusstsein seines Menschentums“ (Steiner, 1923/1974, S. 76) geben. Die Entfaltung einer Anthropologie, genauer: einer anthroposophisch orientierten Anthropologie, steht somit im Zentrum von Steiners Werk. Damit stellt sich die Frage, wie sich eine solche Menschenkunde zur wissenschaftlichen Anthropologie verhält. Diese Frage ist bis heute für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs über die Waldorfpädagogik von erheblicher Bedeutung. Denn während die Praxis der Waldorfpädagogik im Allgemeinen anerkannt wird, stehen zahlreiche Erziehungswissenschaftler ihrer theoretischen Grundlage skeptisch gegenüber; sie sei als vorwissenschaftlich, mythisch, anachronistisch, kurz: als fragwürdige Ideologie zu betrachten (Prange, 1985; Ullrich, 2015; Skiera, 2010).
In diesem Kontext wird wenig beachtet, dass Rudolf Steiner 1917 in seinem Buch „Von Seelenrätseln“ die nach normalen wissenschaftlichen Standards arbeitende Anthropologie und die Anthroposophie miteinander verglichen hat (S. 11-33). Dabei weist er darauf hin, dass die Anthropologie aufgrund ihrer Orientierung an der Naturwissenschaft auf der Grundlage empirisch erhobener Daten arbeite, während der anthroposophische Zugang innere, seelische Beobachtungen einbeziehe. Beide Erkenntniswege seien unverzichtbar, der eine könne den anderen nicht ersetzen. Doch seien sie widerspruchslos miteinander kompatibel und könnten sich in einer vermittelnden „Philosophie über den Menschen“ miteinander verständigen und wechselseitig anregen. Steiner selbst hat eine Fülle von Ansätzen für eine solche „Philosophie über den Menschen“ entwickelt und dabei anatomische, physiologische, psychologische, philosophische und theologische Aspekte ineinander verwoben. Einige dieser Ansätze, die als theoretische Grundlage der Waldorfpädagogik angesehen werden können, seien im Folgenden vorgestellt; sie sind – wie jede andere pädagogische Anthropologie auch – den Beurteilungskriterien der modernen Erziehungswissenschaft zugänglich. Allerdings ist zu beachten, dass Steiner vielfach mit lebendigen, offenen, lebensweltlichen Begriffen arbeitet; er zieht das Charakterisieren dem Definieren vor und scheut sich auch nicht, künstlerische Ausdrucksmittel wie Metaphern und imaginative Bilder zu verwenden (Kiersch, 1990).
1 Die Freiheitsfähigkeit des Menschen
Als eine erste Facette der angedeuteten „Philosophie über den Menschen“ ist zweifellos seine Freiheitsfähigkeit zu betrachten, sie wird in Steiners frühen Schriften Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (Steiner, 1886/2003) und Die Philosophie der Freiheit (Steiner, 1894/1995) begründet. Freiheit – so der Ausgangspunkt der Argumentation – bedeutet, die Gründe für das eigene Handeln durchschauen zu können. Damit wird die Frage nach der Freiheit zu einer nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Geht man dieser Frage nach, so stößt man auf zwei Faktoren: Wahrnehmung und Denken.
Wir sind unentwegt mit einer Fülle von Sinneseindrücken konfrontiert, deren Zusammenhang wir denkend herzustellen haben. Dabei drängt die Wahrnehmung sich auf, das Denken haben wir aktiv hervorzubringen. Beobachten wir nun das Denken, so werden wir bemerken, dass die Begriffe, mit denen es geschieht, in gesetzmäßige Zusammenhänge hineinführen: Der Begriff der Ursache steht mit dem der Wirkung, der Begriff des Organismus mit denen eines gesetzmäßigen Wachstums und des Einklangs der Teile mit dem Ganzen in innerer Verbindung. Das Denken erweist sich als besondere Erfahrung in der Erfahrung: Während die Wahrnehmungswelt als ein Aggregat zusammenhangloser Einzelheiten erscheint, finden wir im Denken den Zusammenhang, der uns über die Welt aufklären kann. Im Erkenntnisprozess fügen wir beide Elemente, Wahrnehmen und Denken, zusammen; in der Wissenschaft verbindet der Mensch die Sinnen- und Gedankenwelt zu einer ungetrennten Einheit.
Damit ist deutlich: Die Wirklichkeit ist nicht einfach gegeben, sondern wird vom erkennenden Menschen tätig hervorgebracht. Das geschieht allerdings nicht in willkürlicher Weise; vielmehr hat der urteilende Mensch Einsicht in die Gründe, warum er in einem Wahrnehmungsurteil einen bestimmten Sinneseindruck mit einem Begriff verbindet, warum er in einem Begriffsurteil zwei Begriffe ineinander fließen lässt. Diese Erfahrung der Einsichtsfähigkeit ist die Quelle menschlicher Freiheit: Wir machen die seelische Beobachtung, dass wir als Erkennende nicht von außen gezwungen, sondern durch innere, nachvollziehbare Gründe bewegt werden.
Das gilt auch für das menschliche Handeln. Frei werden wir in dem Maße, in dem es uns gelingt, die Motive und Antriebe unseres Tuns nicht von außen bestimmen zu lassen, sondern angesichts einer konkreten Situation durch moralische Intuition zu ergreifen:
„Ich erkenne kein äußeres Prinzip meines Handelns an, weil ich in mir selbst den Grund des Handelns, die Liebe zur Handlung gefunden habe. Ich prüfe nicht verstandesmäßig, ob meine Handlung gut oder böse ist; ich vollziehe sie, weil ich sie liebe. Sie wird ‚gut’, wenn meine in Liebe getauchte Intuition in der rechten Art in dem intuitiv zu erlebenden Weltzusammenhang drinnen steht; ‚böse’, wenn das nicht der Fall ist“ (Steiner, 1894/1995, S. 162).
Stellt man Steiners Freiheitsphilosophie in den Kontext der philosophischen Positionen, so mag deutlich geworden sein, dass er – ähnlich wie Kant und Fichte – den naiven Realismus überwindet und die Rolle des Subjekts im Erkenntnisprozess betont. Aber im Unterschied zu Kant und Fichte bleibt das Subjekt nicht in seinen eigenen Vorstellungen gefangen, ohne zum „Ding an sich“ durchzustoßen zu können. Vielmehr sieht Steiner im Anschluss an Goethe die Möglichkeit, das sich an eine sorgfältige Wahrnehmung anschließende Denken so zu schulen, dass in ihm die gleichen Kräfte und Gesetze wirken wie in der Natur. Diese Fähigkeit, die Goethe die „anschauende Urteilskraft“ nennt, schlägt die Brücke vom Subjekt zum Objekt und stellt seinen Weltbezug her.
Im Jahre 1911 hat Steiner bei einem Vortrag auf einem philosophischen Kongress in Bologna diese Position noch schärfer umrissen. Er weist darauf hin, dass das Subjekt den gesetzmäßigen Zusammenhang der mathematischen Formeln innerhalb des eigenen Bewusstseins gewinnt. Dennoch ließen sich diese in reiner Innerlichkeit gewonnenen Gesetze in der äußeren Welt physikalisch anwenden. Das aber bedeute, dass das Ich geistig in den Weltgesetzen lebe und der Leib nur ein Spiegel sei, der „das außer dem Leibe liegende Weben des Ich“ (Steiner, 1911/1965, S. 139) bewusst mache. Eine solche Sicht, zunächst hypothetisch als erkenntnistheoretisch denkbar genommen, würde die Subjekt-Objekt-Spaltung überwinden. Zwei Jahre später, in seinem Buch Rätsel der Philosophie, hat Rudolf Steiner diese Auffassung eines „peripheren Ich“ weiter präzisiert: Es lebe nicht nur in den Gesetzen der Welt, sondern auch in den Sinneserscheinungen:
„Wenn ich eine Farbe sehe, wenn ich einen Ton höre, so erlebe ich die Farbe, den Ton nicht als ein Ergebnis des Leibes, sondern ich bin als selbstbewusstes Ich mit der Farbe, mit dem Ton außerhalb des Leibes verbunden. Der Leib hat die Aufgabe, so zu wirken, dass man ihn mit einem Spiegel vergleichen kann“ (Steiner, 1914/1968, S. 606).
Erst in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist durch die Entdeckung des Systems der Spiegelneuronen im Gehirn eine solche Ansicht in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses getreten. Ausgangspunkt war die Entdeckung eines italienischen Forscher*innenteams um den Neurophysiologen Giacomo Rizzolatti an der Universität Parma, dass bestimmte Neurone im Gehirn von Menschenaffen nicht nur dann „feuerten“, wenn der Affe selbst nach einer Nuss griff, sondern auch schon dann, wenn ein*e Forscher*in nach der Nuss griff und der Affe diese Handlung nur beobachtete. In der Folge zeigte sich schnell, dass solche Neurone auch im menschlichen Gehirn vorhanden sind und dass sie nicht nur Handlungen, die sich in unserem Umkreis abspielen, sondern auch Gefühle spiegeln. In Deutschland wurden die Entdeckungen durch den Neurologen Joachim Bauer von der Universitätsklinik Freiburg in einem Buch mit dem bezeichnenden Titel: „Warum ich fühle, was du fühlst“ (Bauer, 2005) verbreitet.
Auch die anthropologische Forschung, die dem phänomenologischen Ansatz des Brentano-Schülers Edmund Husserl folgt, nähert sich dem Ansatz eines sphärischen Ich an. In seinem im Jahr 2000 erschienenen grundlegenden Werk „Leib-Raum-Person“ stellt der Mediziner und Philosoph Thomas Fuchs fest:
„Gerade im leiblich-sinnlichen Erleben besteht ursprünglich keine Gegensätzlichkeit von Subjekt und Objekt, sondern ein partizipierendes Welt- und Naturverhältnis. […] Das seelische Erleben – unsere Empfindungen, Triebregungen, Gefühle, Wahrnehmungen etc. – ist als solches nicht irgendwo im Raum unseres Körpers lokalisierbar, auch nicht im Gehirn. Es ist überhaupt nicht nur etwas in uns. Seelisch sind wir bei den Dingen und Menschen, die wir wahrnehmen […]“ (Fuchs, 2000, S. 20f.).
In dem beginnenden Gespräch über ein „Umkreis-Ich“ liegt ein Beispiel vor, wie – ganz im Sinne von Steiners Differenzierung in „Von Seelenrätseln“ – „anthropologische“ und „anthroposophische“ Forschung einander befruchten können. Wir halten fest: In Kontinuität zu Steiners Frühschriften erscheint in Steiners pädagogischer Anthropologie das tätige, erkennende Ich als Zentrum des Menschen und Quelle seiner Freiheit.
Für die Waldorfpädagogik ist der Ich-Begriff in seiner Spannung von Subjektorientierung und Weltteilhabe von fundamentaler Bedeutung. Denn zum einen wird schon das Kind als eigentätiges Subjekt gesehen, das die Anregungen der Erzieher*innen und Lehrer*innen individuell aufgreift und verarbeitet: „Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes“ (Steiner, 1923/1989, S. 131). Im Lernprozess wacht der junge Mensch sukzessive zu den eigenen Interessen auf, die sich idealerweise gegen Ende der Schulzeit zu individuellen Lebensmotiven verdichten. Zum anderen ist die Waldorfpädagogik so angelegt, dass sich dieser Prozess der Selbstfindung in einer intensiven Weltbegegnung vollzieht. Im Handarbeits-und Werkunterricht, im musikalischen Üben und plastischen Gestalten, in der Eurythmie und im Sport setzen sich die Heranwachsenden tätig mit den Materialien, Farben, Tönen und Formen der Welt sowie den Gesetzen der eigenen Leiblichkeit und des Raumes auseinander; in den gedanklichen Fächern ereignet sich Weltteilhabe durch innere Erfahrungen. So lässt sich die Waldorfpädagogik als eine Erziehung zur Freiheit in einem doppelten Sinn verstehen: als Anregung zur Selbstfindung und als Weg der Fähigkeitsbildung für das Handeln in der Welt.
2 Die Lehre von den Wesensgliedern
Eine weitere anthropologisch-anthroposophische Grundlage der Waldorfpädagogik ist Steiners Auffassung von der Gliederung des Menschen nach Leib, Seele und Geist sowie deren weitere Differenzierung in verschiedene Schichten – in der Sekundärliteratur zumeist „Wesensglieder“ genannt –, wie sie in der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts etwa von Max Scheler und Helmuth Plessner vertreten worden ist (Pleger, S. 145-160). Rudolf Steiner hat diese Anschauung systematisch in seinen Büchern Theosophie (Steiner, 1904/2013) und Die Geheimwissenschaft im Umriss (Steiner, 1910/2013) entwickelt.
Unter Leib versteht Steiner die Körperlichkeit des Menschen, durch die er mit den Naturreichen verwandt ist; er ist dreifach gegliedert. Der physische Leib ist der mineralischen Welt verwandt; wie diese ist er von einer materiellen, Raum erfüllenden Stofflichkeit durchzogen. In die Lebensprozesse eingebunden ist der Mensch durch den Lebens- oder Ätherleib; er organisiert – wie bei den Pflanzen – Wachstum, Fortpflanzung und Formverwandlung und ist Träger der Rhythmen. Der Seelenleib oder Astralleib ermöglicht die Empfindungsfähigkeit des Leibes, der wie die Tiere über die Sinne Eindrücke der Außenwelt aufnehmen und – mit dem Nervensystem als leibliche Grundlage – innerlich verarbeiten kann.
Der Begriff Seele verweist auf die psychische Innerlichkeit des Menschen; in ihr kann das Ich in unterschiedlicher Weise wirken. Die Empfindungsseele entsteht, indem die durch den Seelenleib vermittelten Sinneseindrücke empfindend durchlebt und qualifiziert werden, wie das etwa beim Anhören eines Konzerts oder beim Betrachten eines Bildes geschehen kann. Demgegenüber ist die Verstandes- oder Gemütsseele darauf ausgerichtet, die Eindrücke gedanklich zu verarbeiten. Dabei dient die Verstandesseele der zweckrationalen Einrichtung des Lebens, während die Gemütsseele flüchtige Emotionen zu dauerhaften Gefühlen vertiefen kann. Die Bewusstseinsseele schließlich ist die Schicht des Seelischen, in der das Ich sich selbst ergreift und seiner Autonomie bewusst wird.
Die sich anschließenden geistigen Glieder des Menschen entstehen dadurch, dass das Ich durch Bildung und Selbstbildung die natürlich gegebenen Schichten umwandelt. Durch Bearbeitung von Lust und Unlust wachsen die Anteile des Geistselbst, durch die Verwandlung von Temperament und Charakter die des Lebensgeistes, durch die Auswirkungen des inneren Lebens auf die Stoffe und Kräfte des physischen Leibes der Geistesmensch.
Damit ist - in aller Kürze - die von Steiner in seiner theosophischen Phase zwischen 1904 und 1910 konzipierte neungliedrige Auffassung vom Menschen skizziert, wobei das „Ich“ ganz im Sinne Fichtes als geistiger Kern und als Aktivitätszentrum verstanden, in das Seelische und Geistige hervorbringend und gestaltend hineinwirkt. Obwohl Steiner teilweise in der Theosophie übliche Termini verwendet und zu manchen indischen Traditionen Bezüge hergestellt werden können (Schmitt, 2015, S. 25--36), ist doch deutlich, dass das Konzept eine originäre Leistung Steiners darstellt; das mit „Ich“ oder „Bewusstseinsseele“ Gemeinte hat in der indischen Philosophie eine völlig andere Konnotation. Viel eher lassen sich Parallelen zu abendländischen Traditionen aufzeigen: Die natürlichen Wesensglieder finden sich – wenn auch mit anderen Bezeichnungen – schon bei Aristoteles (Pleger, 2013, S. 137-144), den Ich-Begriff hat Steiner in entscheidenden Aspekten im Alter von 18 Jahren in Auseinandersetzung mit Johann Gottlieb Fichtes „Wissenschaftslehre“ gefasst (Lindenberg, 1997, S. 82); zu der Gliederung der Seele in Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele hat er sich durch Immanuel Hermann Fichte, den Sohn des bekannten Philosophen, anregen lassen (Teichmann, 1990, S. 25-34). Der Geistbegriff wiederum ist in der aristotelischen Tradition vielfältig ausgestaltet worden – auf Scheler und Plessner wurde schon hingewiesen.
Im Blick auf die pädagogische Relevanz dieser Anschauungen sei auf einen Aspekt aufmerksam gemacht: Der Begriff des Lebensleibes ist ein Schlüssel zum Verständnis des kindlichen Organismus und damit zu seiner Gesundheit. Steiner hat eindringlich betont, dass diese Dimension einer gesunden Entwicklung von der Pädagogik zu berücksichtigen ist; Ziel der Waldorfpädagogik sei es, „in der freiesten Weise das Physisch-Leibliche des Menschen zu entwickeln und dem Geistig-Seelischen gewissermaßen die Möglichkeit zu bieten, sich aus sich selbst heraus zu entfalten“ (Steiner 1922/1978, S. 215). Das Ideal sei, „den Menschen so in die Welt hineinzustellen, dass er seine individuelle Freiheit entfalten kann, dass er an der Entfaltung dieser individuellen Freiheit in seinem Leibe kein Hindernis hat“ (Steiner 1922/1978, S. 216). Aus diesem Anliegen ist die breite salutogenetische Ausrichtung der Waldorfpädagogik hervorgegangen. Sie umfasst Bereiche wie die ästhetische Gestaltung der Schularchitektur und der Klassenräume, die Vermeidung von Schulstress durch den Verzicht auf Prüfungen und Selektion in der Unter- und Mittelstufe, die Rhythmisierung des Tageslaufs durch den Wechsel zwischen kognitiven, künstlerischen und handwerklich-praktischen Fächern und gesundheitsfördernde Interventionen durch Rezitation und Singen sowie durch Sport und Eurythmie (Zdrazil, 2000, 2010; Marti, 2006).
3 Die Dreigliederung des Menschen
Der Begriff der physiologischen, psychologischen und pneumatologischen Dreigliederung des Menschen kann als Kernstück der Steiner‘schen Anthropologie betrachtet werden; er stellt nach Steiners eigener Aussage das Ergebnis eines 35 Jahre dauernden Forschungsprozesses dar und wurde von ihm erstmals 1917 im sechsten Anhang seines Buches „Von Seelenrätseln“ als Beitrag zu einer möglichen „Philosophie über den Menschen“ veröffentlicht (Steiner, 1917/1983; Kiersch, 2011, S. 442ff.; Zdrazil, 2017, S. 27-54). In diesem Text skizziert Steiner in gedrängter Kürze das Verhältnis von Leib, Seele und Geist im Menschen. Dabei ist ihm zufolge die Beziehung der Seele zum Leib dreifach differenziert. Die leibliche Grundlage der wachbewussten Prozesse des Seelenlebens, des Vorstellens und des Denkens ist das Nervensystem mit dem Gehirn als seinem Zentrum. Demgegenüber hat das wie im Traum sich abspielende Fühlen seine Stütze im Atemrhythmus und im Blutkreislauf, das wie im Schlaf verlaufende Wollen wird vom Stoffwechsel getragen. Wie sich die Seele so auf der einen Seite mit dem Leib in intensiver Interaktion befindet, steht sie auf der anderen Seite mit der geistigen Dimension des Menschen in Verbindung; diese Beziehung wird durch Imagination, Inspiration und Intuition erfahrbar.
Es ist deutlich, dass sich Steiner mit einer solchen Auffassung im Gegensatz zu der bis heute weit verbreiteten gehirnzentrischen Sicht des Menschen befindet und damit die Basis für eine Pädagogik gelegt hat, die nicht nur die kognitiven, sondern auch die emotionalen, sozialen und künstlerischen Fähigkeiten fördern möchte, sowie alles das, was sich auf den Willen und das Handeln bezieht. Eine der Anschauungen, welche sich aus dieser Auffassung, die Kopf, Herz und Hand gleichermaßen berücksichtigt, ergibt, ist der Entwurf einer Pädagogischen Psychologie, den Steiner im zweiten Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“ entwickelt (Steiner, 1919/1973; Schmelzer, 2016a, S. 171-178). Darin geht er von der Polarität von Kopf und Gliedern, von Vorstellen und Wille, aus. Dem entsprechen die Haltungen von Antipathie und Sympathie. Die Antipathie ist eine Kraft der Abgrenzung: Wir stellen uns der Welt gegenüber. Die Sympathie dagegen ist eine Kraft der Zuwendung: Wir verbinden uns mit der Welt. Aus dieser Gegenüberstellung ergeben sich zwei Reihen:
Die eine enthält die Elemente Vorstellen, Gedächtnis und Begriff. Alle drei, das Vorstellen als Produktion eines inneren Bildes, das man sich angesichts bestimmter Sinneseindrücke formt, das Gedächtnis, in das dieses Bild eingeprägt wird, der Begriff, der als inneres, von früher Kindheit an erworbenes Konzept der konkreten Vorstellung zugrunde liegt und die Form einer Definition annehmen kann, sind Ausdruck einer sich steigernden Antipathie: Der Mensch stellt sich erkennend der Welt gegenüber. Diese Haltung ist notwendig vergangenheitsbezogen – die betreffende Welterscheinung muss schon existieren, bevor sie Objekt der Erkenntnis wird.
In eine völlig andere Sphäre taucht man ein, wenn man sich nun der polaren Reihe zuwendet, welche auf der Sympathie beruht. Hier ist das erste Element der Wille. Der Wille hat Seinscharakter, wir identifizieren uns mit ihm, wir fließen mit ihm zusammen. Denn der Wille ist in seiner elementaren Form körperliche Tätigkeit – beim Holzhacken, Schnitzen, Tanzen oder Musizieren sind wir ganz mit diesem Tun verbunden. Wille in diesem Sinn ist nicht Bild, sondern Keim und damit zukunftsbezogen; jede Tätigkeit wirkt auf den Akteur zurück und bildet Fähigkeiten, die Wachstumspotenziale in sich schließen. Wird nun der Wille gesteigert, so entsteht die Phantasie. Besonders schön lässt sich der Übergang vom Willen zur Phantasie an spielenden Kindern beobachten: Sie sitzen am Strand und häufen Sand auf, flugs wird der Sandhaufen zu einer Burg, dann wird ein Burggraben angefügt, Muscheln werden zum Schmuck herangeholt, eine Fahne wird aufgesteckt, Deiche werden angelegt. Die Phantasie wächst aus der Tätigkeit; in keinem künstlerischen Prozess ist das Ergebnis im Voraus in der Vorstellung enthalten. Vielmehr ist es gerade umgekehrt: Aus dem Willensprozess entsteht Neues, Ungeahntes, Unvorhergesehenes. Wird nun die Willenstätigkeit der Phantasie weiter gesteigert und durchdringt die Sinne, dann entsteht das, was Steiner „gewöhnliche Imagination“ nennt: das intensive Leben in einer Sinnesempfindung, einer Farbe oder einem Klang, so dass diese Qualität den Menschen ganz erfüllt.
Somit bestehen zwei polare Ströme des seelischen Lebens: ein Strom des Erkennens, der auf der Antipathie, also der Distanzierung beruht, und ein Strom des Willens, der Tätigkeit, dieser Strom beruht auf der Sympathie, der Identifikation. Diese beiden Ströme sind nun für die Didaktik von fundamentaler Bedeutung. Denn es gilt, die Einseitigkeit eines nur kognitiven Unterrichts, der sich der Entwicklung des Vorstellens, des Gedächtnisses und der Begriffsbildung verschreibt, ebenso zu vermeiden wie die andere Einseitigkeit eines nur handlungsorientierten Unterrichts, der nicht zu Erkenntnissen vordringt. Vielmehr kommt es darauf an, die Pole ineinander zu verweben und das mittlere Element des Fühlens so zu seinem Recht kommen zu lassen, dass die Kinder und Jugendlichen zu einem Erleben der Weltphänomene geführt werden. Dieses Grundprinzip gilt es nun bis in die Einzelheiten des Unterrichts auszugestalten.
Dazu einige Beispiele: Im Rechenunterricht werden die Zahlenreihen so gelernt, dass sie von den Schüler*innen rhythmisch geklatscht, gestampft oder gesprungen werden. Haben sie sich auf diese Weise auch leiblich eingeprägt, kann es geschehen, dass beim Laufen eines Rhythmus eine Schülerin plötzlich ausruft: „Oh, das ist doch die Fünfer-Reihe!“ Der Begriff kann besser erfasst werden, wenn aus der Tätigkeit heraus das Erleben stark geworden ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Sprachunterricht. Ein Klassenlehrer lässt die Schüler*innen hüpfen, springen oder andere Tätigkeiten ausführen und sie benennen, so führt er das „Tu-Wort“ ein. Völlig anders ist die Qualität der Hauptwörter – die können vor-gestellt werden. Wir stehen auf einem Bauernhof, da sind viele Tiere: der Hund, die Katze, der Hahn etc. Mit den Tätigkeitswörtern identifizieren wir uns, die Hauptwörter haben wir innerlich vor uns, mit den Eigenschaftswörtern setzen wir uns mit den Dingen in Beziehung. Das wird zunächst zum Erleben gebracht, später kann es in die Helligkeit des Begriffs geführt werden. Damit ist eine generelle Tendenz der Didaktik und Methodik der Waldorfpädagogik angedeutet: In den unteren Klassen setzt der Unterricht beim nachahmenden Mittun an, während in der Oberstufe die begriffliche Welterschließung dominiert. Ein vermittelndes Element stellt – allerdings in altersgemäßer Akzentuierung – das bildhafte Erzählen dar.
Die geschilderten Ansätze sind inzwischen differenziert ausgearbeitet worden (Wiehl, 2015; Sommer, 2016); sie sind immer auch in ihrer Auswirkung auf die Leiblichkeit zu bedenken. Ein nur kognitiver Unterricht beansprucht die Nerventätigkeit in einseitiger Weise; er baut die Lebenskräfte ab und wirkt verhärtend (Zdrazil, 2010, S. 250). Demgegenüber würde eine Didaktik und Methodik, welche das Lernen durch körperliche Arbeit und Bewegung favorisiert, das Blut-Muskelsystem einseitig fordern und zu baldiger Ermüdung führen. Anzustreben ist ein in jeder Hinsicht „atmender“ Unterricht: ein Wechsel zwischen gedanklichen, künstlerischen und handwerklich-praktischen Fächern und Sport, und in jeder Unterrichtseinheit ein lebendiges Spiel zwischen kognitiven, gefühlsmäßigen und willenshaften Elementen.
4 Die Entwicklungspsychologie
Eng verbunden mit Steiners Anthropologie ist seine Entwicklungspsychologie. Einige ihrer Aspekte hat er erstmals 1907 in seiner Schrift „Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft“ (Steiner, 1907/1973) umrissen, in der Folge hat er diese Ansätze wesentlich differenziert und ausgestaltet (Loebell, 2016). Dabei greift er auf seine Lehre von den Wesensgliedern und der leiblich-seelischen Dreigliederung zurück. Die Entwicklung – so Steiner – vollzieht sich als sukzessive Entfaltung und Emanzipation dieser Wesensglieder, Steiner spricht in diesem Zusammenhang von verschiedenen „Geburten“.
In den ersten sieben Jahren wird zunächst die Körperlichkeit des Menschen durch den Lebensleib aus- und umgestaltet; Anzeichen dafür sind die für dieses Lebensalter charakteristischen Wachstumsprozesse. Dabei geht die Umgestaltung vom Nerven-Sinnessystem des Menschen aus; es vollzieht sich eine Differenzierung des Gehirns und eine Reifung der Sinnesorganisation. In dieser Zeit ist das Kind „ganz Sinnesorgan“, jeder Eindruck wird mit großer Sensibilität aufgenommen. Dieser großen Offenheit entspricht die religiöse Stimmung, in der das Kind lebt, es geht von der unbewussten Erwartung aus: „Die Welt ist gut“ und trägt daher die Bereitschaft zur Nachahmung und zur Hingabe an Vorbilder in sich. Auch das Gehen, Sprechen und Denken werden in dieser Phase erworben. Die diesem Alter angemessene Pädagogik ist die einer gestaltenden Erziehung. Der Erwachsene kann noch nicht gedanklich wirken, sondern prägt als Vorbild durch die „sinnvolle Gebärde“ das Kind bis in seine Leiblichkeit hinein. Von daher ist ein*e Erzieher*in für dieses Lebensalter so etwas wie ein*e „Plastiker*in“; es spielt aber in diese Haltung auch ein religiös-priesterliches Element hinein, indem das Kind in Ehrfurcht empfangen wird.
In der darauf folgenden zweiten Phase von wiederum etwa sieben Jahren wird vorzugsweise das seelische Element ausgebildet. Mit dem Zahnwechsel und dem Gestaltwandel ist die erste Zeit eines intensiven Aus- und Umbaus des Körpers abgeschlossen. Ein Teil der Gestalt-bildenden Kräfte des Lebensleibs wird nun frei und steht als Vorstellungs-, Gedächtnis- und Phantasiekraft zum Lernen zur Verfügung. Dabei ist zu beachten, dass sich der Schwerpunkt der Entwicklung auf das rhythmische System, das durch die Organe Lunge und Herz repräsentiert wird, verlagert. In der Mitte der Kindheit vollzieht sich die Atemreife, in der sich Atem und Puls tendenziell auf den Rhythmus von eins zu vier einschwingen. In dieser Phase ist das Kind in besonderer Weise disponiert, über das Fühlen die Weltbegegnung zu erfahren; hier entspringt sein Sinn für alles Musikalische und Plastisch-Bildnerische. Das Kind lebt in diesem Alter in der unbewussten Erwartung: „Die Welt ist schön“, und in diesem Sinn sucht das Kind nach einer geliebten Autorität, die ihm einen lebendig-ästhetischen Zugang zur Welt eröffnet. Die adäquate Pädagogik ist jetzt die einer belebenden Erziehung, die/der Lehrer*in wird idealerweise zur*m Künstler*in.
Das dritte Jahrsiebt steht unter dem Motiv der geistigen Entwicklung. Mit der Geschlechtsreife und dem Gestaltwandel vollzieht sich eine erneute Geburt: Der Seelenleib wird frei. Körperlich dominiert jetzt das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System; Symptome dafür sind die hormonellen Umstellungen und das Längenwachstum der Arme und Beine. Vom seelisch-geistigen Gesichtspunkt aus betrachtet werden nun zum einen die Kräfte des begrifflichabstrakten Denkens und der eigenständigen Urteilsbildung geboren. Zum anderen strebt der Jugendliche nach der eigenen Identität; orientierende Ideale sind auf diesem Wege von großer Bedeutung. Der Heranwachsende lebt in der Erwartung: „Die Welt ist wahr“; die pädagogische Beziehung ist durch die Worte Freiheit und Pflicht bezeichnet, wobei „Pflicht“ hier die selbst gewählte Aufgabe im Sinne des englischen „duty“ meint. Die Pädagogik dieser Altersstufe kann als „erweckende Erziehung“ beschrieben werden; ein*e Oberstufenlehrer*in ist fachlich versiert, aber muss auch geistige*r Anreger*in sein, in dem Sinn, dass der Erwachsene selbst als „Suchender“ wahrgenommen wird (Steiner, 1898/1966, S. 234). Die eigentliche Mündigkeit erreicht der Jugendliche zu Beginn des vierten Jahrsiebts mit der „Geburt des Ich“, der junge Erwachsene wird Selbstgestalter*in seines Lebens.
Diese idealtypisch skizzierten „normalen“ Entwicklungsphasen werden allerdings modifiziert durch einen gewissermaßen gegenläufig aus der Zukunft kommenden Strom der Individuation. Dieser zeigt sich im erwachenden Ich-Bewusstsein um das dritte Lebensjahr (Steiner, 1912/1983, S. 119ff.), er kommt auch in dem oft als „Rubikon“ bezeichneten Umschwung im Alter von neun, zehn Jahren (Steiner, 1919/1998, S. 47) mit dem ersten Zweifel an Autoritäten zum Ausdruck. Auch das Erwachen des kausalen Denkens um das zwölfte Lebensjahr kann in diesem Zusammenhang gesehen werden (Steiner 1923/1982, S. 109). Ebenfalls ist zu beachten – das ist für die pädagogische Handhabung von erheblicher Bedeutung –, dass es für die verschiedenen Phasen keine starren Altersgrenzen gibt; Rudolf Steiner war sich bewusst, dass vielfältige individuelle Entwicklungslinien möglich sind (Schmelzer, 2016b).
Von Kritikern*innen wie etwa Heiner Ullrich ist angeführt worden, Steiner habe mit seiner Entwicklungslehre auf das aus der Antike stammende „archaische Schema der Altersordnung“ (Ullrich, 2015, S. 132) zurückgegriffen; sie sei weder auf empirischer Basis entstanden, noch im Diskurs mit der zeitgenössischen Kinder- und Jugendpsychologie konzipiert worden. Demgegenüber ist festzuhalten, dass Steiner zwar kein akademischer Entwicklungspsychologe, aber doch ein pädagogischer Praktiker mit einem hohen Interesse an pädagogischen und psychologischen Fragen war. Schon in seiner Schul- und Studienzeit erteilte Steiner acht Jahre lang regelmäßig Privatunterricht für Schüler*innen und Studierende, zudem war er von 1884 bis 1890, also im Alter von 23 bis 29 Jahren, Hauslehrer bei der Wiener Familie Specht und hatte sich um die vier Söhne zu kümmern. Besondere Sorge bereitete der bei Steiners Ankunft zehnjährige Otto Specht, der an einer Hydrozephalie litt und im Lesen, Schreiben und Rechnen weit zurückgeblieben war. Steiner gelang es, den Jungen so zu fördern, dass er das Abitur ablegen, Medizin studieren und Arzt werden konnte; hier liegen die Wurzeln der anthroposophischen Heilpädagogik (Schmalenbach, 2011, S. 478ff.). Steiner konnte also, als er 1907 die kleine Schrift „Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft“ schrieb, auf pädagogische Erfahrungen mit Heranwachsenden zurückgreifen. Zudem verfolgte er aufmerksam die Anfänge der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie. Ende Juli, Anfang August 1907 schrieb er einen Nachruf auf den eben verstorbenen Wilhelm Preyer, dessen Buch „Die Seele des Kindes“ heute als Beginn der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie angesehen wird. Steiner lobt die eindringliche Beobachtungsgabe Preyers (Steiner, 1897/1989, S. 348), erkennt aber auch für manche Gebiete – etwa die Reaktionszeit von einer Sinnesempfindung zur Handlung – die relative Bedeutung der Experimentalpsychologie an (Steiner, 1901/1989, S. 467). In diesem Zusammenhang hebt er das von Wilhelm Wundt geführte Leipziger Laboratorium für Experimentalpsychologie hervor – es habe Weltgeltung erlangt und Wundts Schüler Carl Stumpf, Hermann Ebbinghaus, Ernst Mach und Hugo Münsterberg hätten Wertvolles geleistet (Steiner, 1901/1989, S. 467f.). Zudem hat sich Steiner auch in der Folgezeit nachweislich mit weiteren Forschern*innen der entstehenden Kinderpsychologie wie Wilhelm August Lay, William Stern und Wilhelm Ament beschäftigt, in dessen Buch „Die Seele des Kindes“ das Kind – ähnlich wie in Steiners ein Jahr später erschienenen „Erziehung des Kindes“ – als „Sinneswesen“ (Ament, 1906, S. 37) mit „Freude an der Nachahmung“ (a.a.O., S. 48) charakterisiert wird.1
Vor diesem Hintergrund ist die Kritik Heiner Ullrichs zu hinterfragen. Denn wissenschaftstheoretisch stellt sich Steiners Entwicklungspsychologie wissenschaftlicher Kritik, wissenschaftsgeschichtlich ist sie aus Steiners eigenen Beobachtungen und der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kinderpsychologie entstanden, inhaltlich weist sie Übereinstimmungen mit der modernen Entwicklungspsychologie auf. Denn die in den Lehrbüchern für Entwicklungspsychologie gängigen Altersgliederungen: frühe Kindheit bis zum siebten Lebensjahr, mittlere und späte Kindheit bis zum zwölften Lebensjahr und nachfolgende Jugendzeit stimmen im Wesentlichen mit der von Steiner vorgenommenen Gliederung überein (Schneider & Lindenberger, 2012, S. 5).
Besonders auffallend erscheint die Komplexität von Steiners entwicklungspsychologischem Konzept, das verschiedene Bereiche umfasst: das Denken (die Kognition), das Fühlen (die Emotion), das Wollen (die volitionalen Aspekte), die Leiblichkeit (die biologischen Aspekte). Im Blick auf diese Komplexität weist der Erziehungswissenschaftler Christian Rittelmeyer darauf hin, dass Steiners Konzept die Chance biete, die vier Strömungen moderner Entwicklungspsychologie, die sich im 20. Jahrhundert getrennt voneinander und damit einseitig entfaltet hätten, zu integrieren: die Kognitionstheorien, die psychoanalytischen Theorien, die behavioristischen Lerntheorien und die Reifungstheorien. Daher kommt Rittelmeyer zu folgendem Schluss:
„Der Versuch, eine organische und anthropologisch begründete Verbindung der kognitiven, emotionalen, volitionalen und leiblichen Fähigkeiten zu schaffen, die in den beschriebenen Theorien so einseitig und damit auch geistlos dargestellt wurden, ist aus meiner Sicht jedenfalls ein bisher einmaliger und zukunftsweisender entwicklungspsychologischer Impuls“ (Rittelmeyer, 2016, S. 208).
Für die Waldorfpädagogik sind die entwicklungspsychologischen Anschauungen Steiners von großer Bedeutung; sie bilden zum einen die Grundlage für ein altersgerechtes Lernen und eine entsprechende Lehrplangestaltung, zum anderen bieten sie den Lehrern*innen einen offenen, beweglichen Rahmen, den sie durch ihre eigenen Beobachtungen ausfüllen und gegebenenfalls auch modifizieren können.
5 Die Sinneslehre
Auch Steiners Sinneslehre ist ein wichtiger Baustein der Waldorfpädagogik; sie ist von ihm nach mehreren Anläufen (Lauer, 1953) im Jahre 1917, ebenfalls in seinem Buch Von Seelenrätseln, erstmals vollständig skizziert worden. Um auf diesem Feld zu klaren Begriffen zu kommen, gilt es zunächst einmal, sich zu vergegenwärtigen, was eigentlich ein Sinn ist. Im Leben spielen verschiedene Eindrücke ineinander: Wir sitzen behaglich im Garten in der Frühlingssonne, spüren ihre Wärme auf unserer Haut, hören dem Zirpen der Meisen zu und freuen uns an dem frischen Gelb der Osterglocken. Für einen wissenschaftlichen Zugang ist es nun notwendig, einzelne Sinnesempfindungen zu isolieren: Das Gelb erschließt sich uns durch den Sehsinn, das Zirpen durch den Hörsinn, der Eindruck der Wärme durch den Wärmesinn, das Behagen durch den Lebenssinn. Ein Sinn ist das, was eine Sinnesempfindung, eine Sinnesmodalität ermöglicht. Mit dieser Aussage ist auch deutlich, dass Wahrnehmung und Sinnesempfindung nicht das Gleiche sind: Dass das Gelb zu einer Narzisse gehört, ist schon das Ergebnis einer Urteilsbildung, die in der Kindheit geschehen ist und seither so unbewusst verläuft, dass wir sie nicht bemerken. Ebenfalls ist es nicht so, dass ein Sinn unbedingt einem Sinnesorgan entspricht. So weiß man vom Auge, dass in ihm verschiedene Sinne zusammenwirken: der Sehsinn für das Empfinden der Farben und des Hell und Dunkel, der Bewegungssinn für das Abtasten der Formen und der Gleichgewichtssinn für das Erfahren der Vertikalen und Horizontalen.
Insgesamt zählt Rudolf Steiner ein Spektrum von zwölf Sinnen auf, die er in drei Gruppen mit jeweils vier Sinnen unterteilt. Zur ersten Gruppe gehören der Tast-, Lebens-, Bewegungs- und Gleichgewichtssinn. Während wir über den Tastsinn die Grenzen unserer Leiblichkeit erfassen, vermittelt uns der Lebenssinn ein Bewusstsein davon, wie wir uns in unserem Leib erleben: frisch oder ermattet, hungrig oder gesättigt, behaglich oder unwohl. Durch den Lebenssinn „empfindet sich der Mensch als ein den Raum erfüllendes, leibliches Selbst“ (Steiner, 1910/2009, S. 31). Dieses Leiberleben wird durch den Bewegungssinn modifiziert, wir empfinden reflexhafte Bewegungen wie das Schließen der Augen beim Anflug einer Wespe ebenso wie gewohnheitsmäßige oder willkürlich ausgeführte Bewegungen. Der Gleichgewichtssinn schließlich vermittelt uns ein Bewusstsein für die Lage unseres Leibes im Raum: oben und unten, rechts und links, vorne und hinten werden durch ihn ebenso erfahrbar wie das Gewicht eines Gegenstandes, den wir tragen. Da alle vier Sinne mit dem Empfinden unserer Leiblichkeit zusammenhängen, können sie als Leibessinne bezeichnet werden; man kann sie auch Willenssinne nennen, weil sie von einer unbewussten Willenstätigkeit durchzogen sind (Steiner, 1919/1973, S. 128f).
Die zweite Gruppe besteht aus dem Geruchs-und Geschmackssinn, dem Sehsinn und dem Wärmesinn. Diese Sinne vermitteln eine Empfindung von der Außenwelt, genauer: von den Stoffeigenschaften äußerer Körper. Etwas überraschend taucht in dieser Gruppe der Wärmesinn auf, weil dieser zunächst – man denke an das Phänomen der kalten Füße – als nach innen hin gerichtet erlebt wird. Für Steiner ist allerdings der Gesichtspunkt ein anderer: Er macht darauf aufmerksam, dass der Wärmesinn eine intimere Bekanntschaft mit der Natur der Gegenstände ermöglicht als der Sehsinn, man denke etwa an die „Kälte“ eines Metalls, die vom Holz nicht erreicht werden kann. Da die mit der zweiten Sinnesgruppe verbundenen Empfindungen oft mit starken inneren Erlebnissen verknüpft sind – etwa bei wohlschmeckenden Speisen oder ekelerregenden Gerüchen – bezeichnet Steiner sie auch als „Gefühlssinne“ (Steiner, 1919/1973, S. 129).
Die dritte Gruppe umfasst den Hörsinn, den Sprach- oder Lautsinn, den Gedanken- oder Begriffssinn und den Ich-Sinn. Zwar hat der Hörsinn mit den Gefühlssinnen gemeinsam, dass man auch durch ihn Stoffeigenschaften erkennen kann. Dennoch kann er auch zur dritten Gruppe gerechnet werden, weil er einen Zugang öffnet zum Empfinden des sozialen Umkreises. Dieser erschließt sich in elementarer Weise durch den Sprach- oder Lautsinn: Im Schmerzlaut, im Sprachklang, aber auch durch das Mitempfinden von Mimik und Gestik dringt das Seelische des Mitmenschen in uns ein. Ebenso haben wir die Fähigkeit, die Äußerungen des Gegenüber, seien sie nun sprachlich oder gestisch, inhaltlich zu verstehen; möglich wird das durch den Gedanken- oder Begriffssinn, der uns die Bedeutungen der an uns herandringenden Botschaften aufschließt. Der Ich-Sinn schließlich schafft einen Zugang zum Mitmenschen, der uns sein ganz Individuelles erleben lässt; man könnte ihn daher auch als Du-Sinn bezeichnen. Die spezifische Sinnesempfindung ist, dass wir uns durch die Präsenz des anderen Ich, die sich etwa in seinem Blick äußert, getroffen fühlen. Es entsteht dann eine Art unbewusster Kampf zwischen dem Beeindruckt-Werden durch den Anderen und dem Bestreben, das eigene Ich aufrecht zu erhalten. In ähnlicher Weise wie durch Steiner ist der Ich-Sinn – allerdings mit anderen Bezeichnungen – durch Max Scheler (1923/ 1931, S. 273-307), Jean Paul Sartre (1943/2014, S. 457-538) und Martin Buber (1923/1997, S. 301-319) beschrieben worden. Zusätzlich zu dem Erfahren der eigenen Leiblichkeit und dem gefühlsmäßigen Empfinden der Eindrücke der Außenwelt verfügen wir also mit der dritten Gruppe der Sinne über ein Instrumentarium, das uns einen eher erkennenden Zugang zur sozialen Welt bahnt, sie können daher auch Erkenntnissinne genannt werden.





























