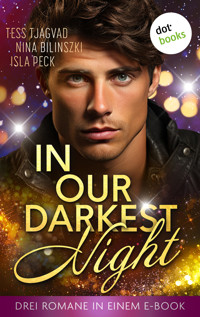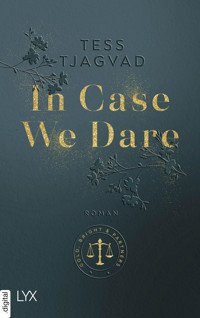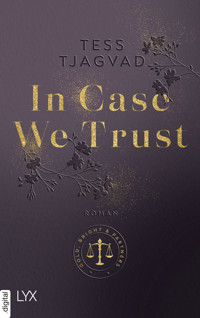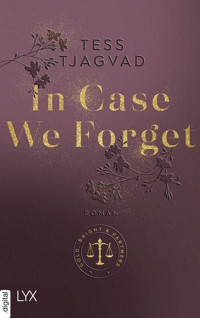
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gold, Bright & Partners
- Sprache: Deutsch
Ich habe nichts davon vergessen. Ich habe dich nicht vergessen
Als Neffe der Geschäftsführerin von GOLD, BRIGHT & PARTNERS steht Jude unter ständigem Druck, sich zu beweisen. In einem Scheidungsfall sieht er die letzte Chance, mit seinen ehrgeizigen Kolleg:innen mithalten zu können. Doch dann trifft er unerwartet auf seine Ex-Freundin Nora, die als Anwältin für die Gegenseite arbeitet. Nora, die Einzige, die jemals seine Schutzmauern überwunden hat - und ihm damals das Herz brach. Obwohl sie sich auf entgegengesetzten Seiten befinden, kommen die alten Gefühle wieder hoch, und schnell wird klar, dass keiner von beiden diese besondere Verbindung zwischen ihnen je vergessen hat ...
»IN CASE WE FORGET ist eine so ehrliche, einfühlsame und echte Geschichte über Selbstfindung, Heilung und zwei Herzen, die einander nie vergessen haben.« CHARLIE_BOOKS
Abschlussband der GOLD, BRIGHT & PARTNERS-Reihe von Tess Tjagvad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Motto
Playlist
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Epilog
Nachwort
Die Autorin
Die Bücher von Tess Tjagvad bei LYX
Impressum
TESS TJAGVAD
In Case We Forget
GOLD, BRIGHT & PARTNERS
Roman
Zu diesem Buch
Arroganter Schnösel, einsamer Wolf, Neffe der Geschäftsführerin – Jude Darling weiß genau, wie seine Kolleg:innen bei Gold, Bright & Partners ihn sehen. Doch hinter seiner Fassade steckt weit mehr, als andere ahnen. Nur eine Person konnte mühelos hinter seine Schutzmauern blicken: seine Ex- Freundin Nora, die einst Licht in sein Dunkel brachte, bis sie von heute auf morgen aus seinem Leben verschwand – und ihm das Herz brach. Als Jude durch Zufall die Möglichkeit erhält, einen Scheidungsfall zu übernehmen, sieht er darin seine letzte Chance, um im Kanzlei-Ranking aufzuholen und mit den anderen ehrgeizigen Anfänger:innen mitzuhalten. Dabei trifft er jedoch ausgerechnet auf Nora – die Anwältin der Gegenseite. Und mit einem Mal ist alles wieder da: die Erinnerungen, das Herzklopfen und diese ganz besondere Verbindung zwischen ihnen. Während sie nun auf entgegengesetzten Seiten stehen, gefährden ihre Gefühle nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Herzen – die nach wie vor nur füreinander schlagen.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Tess und euer LYX-Verlag
Für alle Gewitterköpfe.
Und für uns;
ich glaube, ich habe verstanden.
In case you ever foolishly forget;
I am never not thinking about you.
Virginia Woolf
Playlist
Hey Babe, I’m A Mess, I’m Sorry – JC Stewart
Slip Away – Luke Hemmings
Howling – Noah Kahan
The Roads – Jonah Kagen
exile – Taylor Swift, Bon Iver
Lovers To Strangers – Chance Peña
This’ll Only Hurt for a Minute – Emily James
doing my best – Hazlett
chance with you – mehro
Manly Man – Delacey, Emily Weisband
Stay – Gracie Abrams
Work Song – Hozier
Paper Moon – Hunter Metts
The Boy Who Cried Wolf – Passenger
The Kitchen – Tow’rs
Orpheus – Vincent Lima
Hero – David Kushner
I’ll Scream (All the Words) – Deyaz
This is what the drugs are for – Gracie Abrams
Place In Me – Luke Hemmings
Leave a Light On – Tom Walker
Muscle Memory – Chance Peña, Lydia Kaseta
Eurydice – Vincent Lima
The View Between Villages (Extended) – Noah Kahan
Sweet Heat Lightning – Gregory Alan Isakov
Nostalgia’s Lie – Sam Fender
Forever – Noah Kahan
1
Jude
Damals, zweieinhalb Jahre zuvor
Es gibt Worte, die haben solch spitze Fangzähne, dass sie dir mit nur einem Biss das Herz herausreißen. Sie lassen dich bluten, bohren sich so fest in deine Haut, dass du die Narben davon nie wieder vollständig loswirst. Egal, wie sehr du dich darum bemühst.
Du ziehst
mich
runter.
Eigentlich hatte ich die Erinnerung in den dunkelsten Tiefen meines Gedächtnisses versenkt. Doch wie Luftblasen, die aus einem schlammigen Moor emporsteigen, brachte dieser Ort sie wieder hervor. Er brachte alles hervor, das Gute wie das Schlechte – vor allem das Schlechte. Als würden diese tristen weißen Wände einen geradezu dazu auffordern wollen, sie mit Erinnerungsbildern vollzukleben, damit sie nicht mehr so nackt waren. Bilder aus meiner Kindheit, Bilder von meinen Eltern, meinem alten Zuhause in Schottland … und Bilder von ihr.
Du ziehst mich runter. Runter, runter, runter.
Gottverdammt, ich wünschte, ich könnte dieser Stimme in meinem Kopf ein für alle Mal das Maul stopfen. Stattdessen schien sie mit der Zeit nur noch lauter zu werden.
Wer sollte das denn auf Dauer aushalten können?
»Jude, sind Sie bei mir oder woanders?«
Mrs Jeffersons Frage kratzte an meinem Bewusstsein, ebenso wie der tickende Minutenzeiger der Uhr über ihrem Kopf, der sich nur langsam der Vier näherte, und somit meiner Erlösung. Ich konnte es kaum erwarten, hier rauszukommen. Nicht nur aus diesem Raum, sondern aus dieser gesamten Klinik, in die ich mich selbst eingeliefert hatte wie einen Schrottwagen in die Werkstatt, ohne zu wissen, ob er je wieder richtig laufen würde. Ich hasste diesen Ort. Aber noch mehr hasste ich es, dass ich ihn nicht einfach verlassen konnte. Zumindest nicht, wenn ich ehrlich zu mir war.
»Jude.«
Ich blinzelte, stellte die Szene vor mir träge wieder scharf. Dann räusperte ich mich und veränderte meine Sitzposition, um nicht länger nervös mit dem Fuß zu wippen. »Ich bin anwesend.«
Mrs Jefferson hob eine Augenbraue – ein Zeichen ihres Zweifelns. »Und dennoch haben Sie in der vergangenen halben Stunde kaum mehr als eine Handvoll Worte mit mir gewechselt.«
Das ist nicht ungewöhnlich, hätte ich gern geantwortet. Allerdings war mir klar, dass es nicht das war, was sie hören wollte. Also schwieg ich. Darin war ich mit den Jahren immer besser geworden. Wer schwieg, hatte nichts zu befürchten.
»Sie wissen, dass das nicht der Sinn dieser Stunden ist, oder?«, fragte sie. »Wollen Sie mich auch künftig die ganze Zeit über anschweigen?«
Wenn es sein muss.
Mrs Jefferson musterte mich einen Moment lang mit stoischer Miene, weshalb ich mir erlaubte, dasselbe bei ihr zu tun. Sie trug ihr kastanienbraunes Haar heute akkurat mit einer Klammer zurückgesteckt, dazu eine hellblaue Hemdbluse, die keine einzige Falte aufwies. Irgendetwas daran ließ mich denken, dass sie ein penibler Mensch war, der sein Leben bestens unter Kontrolle hatte – was es umso ironischer machte, dass sie sich in ihrem Job ausgerechnet mit denjenigen beschäftigte, die kläglich daran scheiterten. Wie ich.
»Mögen Sie mir wenigstens verraten, wie es Ihnen heute geht?«
Ich zuckte mit den Schultern. Die verringerte Dosis hatte sich längst bemerkbar gemacht. Ich schlief unruhig, obwohl ich durchgehend müde war, konnte meine zerstreuten Gedanken kaum noch auf einen Punkt fokussieren. Jede Bewegung kostete mich Kraft, jedes noch so kleine penetrante Geräusch einen Haufen Nerven. Ich war eine tickende Zeitbombe und eine Explosion unvermeidbar. Das wussten wir beide.
»In Ordnung, anderer Vorschlag: Wieso schreiben Sie es mir nicht auf?« Sie griff nach einem Block und einem Kugelschreiber und reichte mir beides.
Ich betrachtete das leere Papier einige nervöse Herzschläge lang, bevor ich aufsah. »Ich soll es einfach aufschreiben?«
Mrs Jefferson nickte. »Wie Sie sich fühlen, ja.«
Ohne groß nachzudenken, notierte ich, was mir als Erstes in den Sinn kam.
»Was steht da?«, fragte sie und lehnte sich neugierig vor.
Instinktiv schob ich meine Hand darüber, als befürchtete ich, sie könnte mir etwas wegnehmen wollen, auch wenn ich nicht ganz verstand, was das sein sollte. Einen Seelensplitter vielleicht.
»Da steht: schlecht.«
Wiederholtes Nicken. »Gut. Machen Sie weiter. Warum fühlen Sie sich schlecht?«
»Keine Ahnung«, murmelte ich.
»Dann schreiben Sie das auf.«
Ich schnaubte. »Das ist doch lächerlich.«
»Warum?«
»Weil es nichts aussagt.«
»Finden Sie?«
Erneut starrte ich auf das Blatt, fuhr kaum merklich mit meinem Finger über das kleine Eselsohr darin. Schließlich strich ich das schlecht durch und ersetzte es durch scheiße. Kritzelte keine Ahnung darunter und ersetzte es durch leer. Und dann dachte ich: Das ergibt keinen Sinn. Man kann nicht an einem Tag alles und am nächsten plötzlich nichts fühlen.
Weil sich Mrs Jeffersons aufmerksamer Blick zunehmend durch sämtliche meiner Hautschichten zu brennen schien, strich ich kurzerhand alles durch und hob den Kopf. »Ich kann das nicht, wenn Sie mir zusehen.«
»Das verstehe ich. Sie können sich gern vor die Tür setzen«, bot sie mit einem freundlichen Lächeln an. »Kommen Sie einfach wieder rein, wenn Sie fertig sind.«
Für eine Sekunde war ich versucht, sie zu fragen, warum sie davon ausging, dass ich nicht weglaufen würde. Aber wahrscheinlich war es das, was man von einem Vierundzwanzigjährigen, der sich freiwillig eingewiesen hatte, erwarten konnte. Weit wäre ich ohnehin nicht gekommen. Erst vorgestern war ich außerhalb des Geländes in einem angrenzenden Waldstück spazieren gegangen, ohne mich vorab bei jemandem abzumelden, und hatte dadurch ein Drama ausgelöst, das ich ungern wiederholen würde.
Mit einem Seufzen ließ ich mich im schmalen Flur auf das Sofa sinken und schaute mich um. Es gab kein Tageslicht, nur die surrende Schirmlampe auf dem Tisch neben mir. Je länger ich mich darauf konzentrierte, desto mehr verspannte sich mein Nacken, weshalb ich mir mit zwei Fingern über den Halswirbel rieb. Es verschaffte mir kurze Erleichterung, die jedoch nicht von Dauer war – wie auch sonst nichts auf der Welt. Widerwillig zog ich den Block hervor:
Ich hab keinen Plan, wie ich diesen Zustand, in dem ich mich befinde, beschreiben soll. Manchmal fühlt es sich an, als würde ich durch ein leer stehendes Haus laufen. Ich kenne dieses Haus, weiß, wie es einst dort ausgesehen hat. Dass es lange Zeit bewohnt war, die Sonne im Sommer ihr Lichtkonfetti auf das Parkett warf, im Winter im Kamin ein Feuer brannte und immer irgendwo der Geruch von frisch gebrühtem Früchtetee in der Luft lag. Jetzt sind da überall bloß noch Staub und Stille. Das Licht funktioniert nicht mehr, durchs undichte Dach tropft Wasser, und im Boden des Wohnzimmers prangt ein schwarzes Loch, genau dort, wo mal ein Teppich lag.
Dieses leere Geisterhaus, das bin ich, glaube ich. Und das schwarze Loch ist das Ding in meiner Brust, von dem ich nicht weiß, wie ich es füllen soll, weil es sich immer weiter ausdehnt. Ich kann noch so viel Zeug in mich reinstopfen – Essen, Pillen, ganz egal –, ich fühl mich trotzdem die meiste Zeit wie ausgehöhlt. Als wäre ich gefühlstaub. Dass mein Herz noch schlägt, weiß ich nur, weil ich meinen Puls spüren kann. Ist das normal?
Ohne mir die Worte noch einmal durchzulesen, weil ich sie sonst nur wieder durchgestrichen hätte, kehrte ich in das Therapiezimmer zurück. Mrs Jefferson legte sofort ihre Unterlagen beiseite und hob erwartungsvoll die Brauen.
»Und? Haben Sie etwas aufgeschrieben?«
Ich nickte und setzte mich. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass sie mir den Block abnehmen und den Text überfliegen würde. Stattdessen fragte sie: »Mögen Sie es mir vorlesen?« – was noch tausendmal schlimmer war.
Mir entfuhr ein Lachen. »Ganz sicher nicht.«
Sie neigte leicht den Kopf. Das tat sie oft, und aus irgendeinem Grund regte es mich auf. »Sie müssen keine Angst haben. Es gibt hierbei kein Richtig oder Falsch. Alles, was wir beide hier besprechen, bleibt in diesem Raum.«
Schön und gut, ich wollte aber, dass es in mir blieb. Alles andere machte es zu real – und somit schwerer zu verdrängen. Da sie mich jedoch so hoffnungsvoll ansah, gab ich mit einem Stöhnen nach. »Von mir aus.«
Noch während ich den zweiten Satz vorlas, spürte ich, wie sich die Wörter zunehmend an dem aufkommenden Knoten in meinem Hals stauten. Bis mir nach dem dritten kein weiteres mehr über die Lippen kam. »Ich kann das nicht.«
Mrs Jeffersons Gesicht blieb so unbewegt wie die Oberfläche eines Sees bei absoluter Windstille. Ich fragte mich, woher sie ihre innere Ruhe nahm, ob sie diese aus dem Boden unter ihren Füßen zog, und wieso mir nicht dasselbe gelang.
»Warum nicht?«, hakte sie nach. Warum, warum,dieses andauernde Warum ließ die Ader in meiner Schläfe jedes Mal ein wenig stärker pochen.
»Weil es …« Wieder knickte meine Stimme weg; wie mein Knie damals beim Basketballturnier in der Grundschule. Und sofort flammte eine weitere Erinnerung auf.
»Stell dich nicht so an, Jude! Steh auf und mach weiter!«
Ich kniff die Augen zusammen, versuchte, sie abzuschütteln, und sah dabei die bestürzte Miene meiner Mum vor mir.
»Er ist verletzt, Kent. Er kann nicht weiterspielen.«
Trotzdem hatte ich es getan. Bis zum bitteren Ende. Danach war ich am Meniskus operiert worden und zwei Wochen auf Krücken gelaufen. Es hätten vier sein sollen, aber ich hatte ihm und irgendwie auch mir selbst was beweisen wollen. Wenn ich mein Knie heute im Stehen etwas zu weit nach rechts drehte, schmerzte es immer noch.
»Nur Mut, Jude«, wisperte Mrs Jefferson sanft in die Stille hinein. Zu sanft, als wäre ich ein in Luftpolsterfolie gewickeltes Stück Porzellan.
Mit einem Mal peitschte mir eine alte, solch vertraute Wut ins Gesicht, dass sie mich buchstäblich vom Stuhl fegte. »Ich sagte, ich kann nicht! Wie oft noch? Fuck, das hier ist alles so lächerlich.« Ich riss das beschriftete Blatt vom Block, zerknüllte es in meiner Hand und schmiss es ihr vor die Füße. Scheiß drauf. Scheiß auf sie. Scheiß auf das alles.
»Jude, laufen Sie nicht weg!«, rief Mrs Jefferson, kaum dass ich mich zur Tür gewandt hatte. Aber ich blieb nicht stehen.
Im Anschluss an die Sitzung hatte ich mindestens fünf Zigaretten gebraucht, um mich wieder abzureagieren. Als ich am frühen Abend auf mein Zimmer zurückkehrte – Einzelzimmer natürlich, mein Vater hatte darauf bestanden –, lag ein leeres Notizbuch auf meinem Bett. Mir war sofort klar, dass es von Mrs Jefferson stammte, ebenso, was sie damit bezwecken wollte.
Netter Versuch.
Mit einem verächtlichen Schnauben warf ich es in den Papierkorb am anderen Ende des Raums, wo es eine ganze Zeit blieb, bis ich in der Nacht aufwachte und nicht mehr einschlafen konnte. Die Matratze hatte meinen Schweiß aufgesogen, alles war nass. Mein Kopf fühlte sich an wie mit Steinen befüllt, mein Mund war wüstentrocken. Mit einem Glas Wasser setzte ich mich auf die Bettkante und blickte in das leere Zimmer. Ein paar Streifen silbernes Mondlicht fielen durch die Jalousien. Wir hatten Vollmond, und ich hasste es, dass es mich an sie erinnerte. Genau wie der Papiermond, der an einem Lederband an meinem Bettpfosten hing. Ich hatte ihn aus meiner Wohnung mitgenommen. Tagsüber hielt ich ihn unter meinem Kopfkissen versteckt, aber vor dem Schlafengehen hängte ich ihn auf. Als würde ich wirklich daran glauben, dass dieses Ding etwas bewirken könnte.
»Der durchbricht hoffentlich auch die dunkelsten Träume«,hatte sie früher gesagt. Und eine Weile hatte er das auch getan. Bis ich mit ihrem Verschwinden begriffen hatte, dass nie der Mond, sondern sie dafür verantwortlich gewesen war.
Meine Augen blieben an dem Mülleimer kleben, aus dem eine Ecke des Notizbuchs ragte. Ich knipste meine Lampe an, holte es heraus und blätterte gedankenverloren darin herum. Keine Ahnung, wann und warum ich nach dem Kugelschreiber auf meinem Nachttisch griff.
Nora,
frag mich nicht, was das hier werden soll. Ich glaube, meine Therapeutin hofft, dass ich auf diese Weise anfange, über meine Gefühle zu reden. Du warst so ziemlich der einzige Mensch, mit dem ich das tun konnte. Warum ich trotzdem nur selten den Mund aufbekommen habe, weiß ich nicht. Eigentlich ist es auch egal, du hast sowieso nie bleiben wollen. Das will niemand, und ich versteh’s. Nein, echt. Wie Kafka einst mal so ähnlich sagte: »Kommst du zu mir, so springst du in die Tiefe.« Und ihr habt alle recht.
Manchmal kommt es mir vor, als würde ich auf mich selbst runterschauen, und scheiße, ich hasse alles an diesem Kerl. Wie er aussieht, wie er redet, was er tut. An anderen Tagen weiß ich, dass ich genau dieser Kerl bin.Und dann würde ich mir am liebsten die Haut vom Leib reißen, weil ich mich im Spiegel ansehe und selbst nicht ausstehen kann. Es ist so leicht, negative Menschen aus seinem Leben zu verbannen, wenn sie einen runterziehen. (Du musst es ja wissen.) Aber was, wenn du selbst dieser Mensch bist und mit ihm leben musst?
Im Ernst, was hast du mal an mir gemocht? Ich finde nichts Gutes und hab Schiss, dass dieses Gefühl für immer bleiben wird. Keine Ahnung, ob und wie lange ich das ertragen kann. Ob ich es ertragen will. Dieses ganze beschissene Leben betäubt mich, und ich bin so müde davon, jeden Tag denselben Tag zu leben. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag.
Ichwillnichtsterbenoderso,abermanchmaldenkeich,dassesgarnichtschlimmwäre,nichtmehrhierzusein.
– J
2
Jude
Heute
Geld regiert die Welt, sagt man. Und der Scheiß stimmte.
Zum ersten Mal hatte ich es mit sechzehn festgestellt, als ich zu meiner Überraschung nicht von der Highschool geflogen war, obwohl ich meine dritte Verwarnung missachtet hatte und beim Kiffen erwischt worden war.
Zum zweiten Mal mit siebzehn, als ich zum Studium in Yale zugelassen wurde, obwohl ich nichts geleistet hatte, um mir den Platz an einem Elite-College zu verdienen.
Zum dritten Mal mit fünfundzwanzig, als ich trotz meines grottigen Abschlusses in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien Bostons eingestellt wurde, nur weil meine Tante hier das Sagen hatte und sie meinem Vater einen Gefallen schuldig gewesen war.
Mit Geld kam man irgendwie immer durch. Und genau da lag das Problem; ich hatte es nie anders gelernt. Ich war schon als Kind damit aufgewachsen, war es gewohnt, dass der Wohlstand meiner Familie ein Sicherheitsnetz bildete, das mich im Notfall auffing. Damit, dass dieses Netz eines Tages mal reißen könnte, hatte ich nicht gerechnet. Aber allmählich musste ich mir eingestehen, dass der Riss im Maschengeflecht mit der Zeit immer größer geworden war – und ich drohte durchzurutschen.
»Ich verstehe das nicht, Jude. Wenn ich mir deine Arbeitszeiten anschaue, unterscheiden sie sich kaum von denen der anderen Associates, und trotzdem liegst du im Ranking zurück. Hast du bei irgendetwas Probleme? Wenn du nicht mit mir oder deinem Mentor redest, kann dir auch niemand helfen.«
Wenn du nicht redest, kann dir auch niemand helfen. Natalies Wortecho hallte dumpf in mir nach, genau wie das seltsame Gefühl von Scham und Frust, das damit verknüpft war.
»Ich brauche keine Hilfe«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ich will keine Hilfe. Ein einziges Mal in meinem Leben wollte ich meiner Tante und meinem Vater zeigen, dass ich etwas allein schaffen konnte. In dem Ranking, das von der Kanzlei eingeführt worden war, um die Leistungen der Associates im ersten Jahr zu bewerten, hatte ich meine Chance gesehen, genau das zu tun. Stattdessen hatte ich ihnen nur wieder bewiesen, was sie ohnehin schon gewusst hatten: dass ich zu nichts zu gebrauchen war. Dabei war es mir nie um die zehntausend Dollar Preisgeld gegangen, die dem Erstplatzierten winkten. Ich war auch nicht daran interessiert, zur Belohnung an Natalies Seite an einem großen Fall mitzuwirken. Alles, was ich wollte, war ein winziges bisschen Anerkennung. War das denn zu viel verlangt?
Verdammt, ich verfluchte dieses Ranking, eigentlich das gesamte Arbeitsumfeld hier. Es war durchzogen von Neid, Perfektionismus und Konkurrenzdenken, eine Schlacht, in der jeder nur für sich kämpfte. Es fing schon in der Schule an, wo man uns zu kleinen, missgünstigen Egomaninnen und Egomanen heranzog, die darauf trainiert wurden, einander zu übertrumpfen. Es ging nicht darum, gut zu sein, es ging darum, besser zu sein als die anderen. Noten waren nicht nur ein Maßstab für deine eigene Leistung, sie wurden zu einer Waffe, um andere auszustechen.
Jetzt, im Berufsleben, war es das Gleiche. Der Druck war geblieben, und wer ihm nicht standhielt und ausreichend auf sich achtgab, bezahlte mit seiner Gesundheit. Kein Wunder, dass so viele in diesem Job an mentalen Krankheiten litten oder am Rande eines Burn-outs standen. Und trotzdem machten sie diesen Wahnsinn mit. Ich machte ihn mit. Aber im Gegensatz zu manch anderem, der seine Augen davor verschloss, hatte ich ihn inzwischen wenigstens durchschaut.
Meine Tante strich sich mit einem Seufzen eine Strähne ihres schwarzen, mit grauen Fäden durchzogenen Haars aus dem Gesicht. Sie wirkte seit zwei Wochen ungewohnt müde, vielleicht sogar ein wenig dünner. Unter ihren Augen zeichneten sich Schatten ab, und der sonst so goldene Schimmer ihrer Haut war verblasst, als hätte sie wochenlang keinen Fuß in die Sonne gesetzt. Angesichts der Millionenklage gegen eine ihrer Mandantinnen hatte sie das vermutlich tatsächlich nicht.
»Ich wollte dich hiermit bloß daran erinnern, dass dir nur noch zwei Monate bleiben, um aufzuholen. Bei deinem bisherigen Tempo dürfte das schwierig werden.«
Dafür brauchte ich keine Erinnerung. Es wurde mir regelmäßig vor Augen geführt. Wenn nicht von ihr, dann von meinem Vater, meinen Kolleginnen und Kollegen oder der Punkteliste, die jeden Montag aktualisiert wurde und mir somit Woche für Woche meine Inkompetenz demonstrierte. Wahrscheinlich hätte ich schon längst viel weiter vorn liegen können, hätte ich mich nicht aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund dazu entschieden, die verfänglichen Geheimnisse der anderen Associates, die vergangenes Jahr mit mir hier angefangen hatten, für mich zu behalten, und ihre Schwächen nicht gegen sie zu verwenden.
Denn sie alle hatten eine.
Wenn es bei Gracie Cabot nicht ihre Familie war, dann ihre eigene Unsicherheit. Bei Laurel Bennett war es neben ihrer Impulsivität die Beziehung zu ihrem ehemaligen Mentor, Samuel Andersson hatte einen deutlichen Minderwertigkeitskomplex, bei Otis McCoy war es seine Blauäugigkeit, und Cassidy Lindt hatte neben der nervtötenden Angewohnheit, in jeder Diskussion das letzte Wort haben zu müssen, eine viel zu große Klappe. Der Einzige, der mit seiner Zurückhaltung nach wie vor ein Rätsel für mich darstellte, war Ira Briggs. Über ihn hatte ich damals kaum etwas herausgefunden, außer dass er ein Stipendium erhalten hatte und eine Art Wunderkind war. Aber ich war sicher, dass es hinter seiner stoischen Fassade noch mehr zu entdecken gab.
»Jude.«
Diesmal war ich derjenige, der seufzte. »Jaha. Ich weiß. Und was willst du mir damit sagen? Dass du überlegst, mich rauszuwerfen?« Es gab Tage, da konnte ich dem Gedanken, diesen Laden zu verlassen, überraschend viel abgewinnen. An anderen bereitete er mir eine Scheißangst. Was wäre meine Alternative?
Natalie feuerte einen verärgerten Blick auf mich ab. »Selbstverständlich nicht. Trotzdem wäre es schön, wenn du dich zur Abwechslung mal ein bisschen dankbar dafür zeigen würdest, dass ich dir hier eine so großartige Chance biete. Stattdessen hast du immerzu diese Null-Bock-Einstellung.«
Null-Bock-Einstellung. Natürlich. Ich wollte lachen. Dass es einem nicht gelang, die gleiche Leistung abzuliefern wie andere, wurde automatisch mit Bocklosigkeit gleichgesetzt. Immerhin waren sie ja das beste Beispiel dafür, dass es funktionieren konnte, wenn man sich nur genug anstrengte, hm? Getreu dem Motto: Du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst!
Am Arsch. Die Wahrheit konnte ich ihr allerdings auch nicht erzählen. Weder, warum ich ein Semester länger fürs Studium gebraucht hatte, noch dass ich nach wie vor unter Schlafstörungen litt und es mir extrem schwerfiel, mich über einen längeren Zeitraum auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Mein Vater hatte es mir verboten. »Besser, wir behalten das für uns«, hatte er gesagt. »Du bist ein Darling, Jude. Also benimm dich endlich auch mal so.«
In der Highschool war ich anders gewesen: ignorant, faul, rücksichtslos. Weil ich wusste, wie sehr es meinen Vater anpissen würde. Ich wollte ihm das Leben so schwer wie nur irgend möglich machen – wie er das meiner Mum. Aber mit zunehmendem Alter und dem wachsenden Druck seinerseits, etwas aus mir machen zu müssen, bevor es zu spät war und er mir den Geldhahn zudrehen würde, änderte sich das. Mit dem College änderte sich alles. Ich wurde endlich besser, wurde gut. Dann hatte die Law School begonnen, und gut war plötzlich nicht mehr gut genug gewesen.
»Jude, sag mal, hörst du mir überhaupt zu?«
Ich blinzelte mehrmals. »Hm? Ja. Sicher.«
Für einen Moment sah Natalie aus, als würde sie mir am liebsten ein »Wennichesmirrechtüberlege,wundertesmichdochnicht,warumdusoschlechtabschneidest«an den Kopf werfen. Vielleicht spielte sie auch mit dem Gedanken, ihn mir gleich ganz abzureißen. Ich konnte es ihr nicht verübeln. Wenn es eine Sache gab, die ich perfekt beherrschte, dann war es die, andere Menschen zur Weißglut zu treiben. Keine Ahnung, wie sie es schaffte, an ihrer Geduld festzuhalten und in ruhiger Tonlage weiterzusprechen.
»Hast du schon mal daran gedacht, dich umzuorientieren? Noch hast du die Möglichkeit, dir andere Bereiche anzusehen. Du weißt, dass wir das jedem von euch anbieten. Vielleicht ist Bank- und Finanzrecht doch nicht das Richtige für dich. Du könntest dir ein Beispiel an deiner Mutter nehmen und –«
»Was?«, grätschte ich dazwischen und blickte auf. »Ins Familienrecht gehen?« Nein, danke.
Diese Option hatte ich während meines Jurastudiums kurz in Erwägung gezogen, mich nach dem Abschluss allerdings bewusst für Bank- und Finanzrecht entschieden. Ich hatte angenommen, dass ich in diesem Bereich hauptsächlich mit Dokumenten arbeiten würde, nicht mit Menschen. Meistens traf das auch zu, weil ich mich oft mit Kreditvereinbarungen und ähnlichem Papierkram herumschlug. Zwar wurde ich hin und wieder für einen Auftrag mit anderen Associates in ein Team gesteckt, doch war mir eine halbherzige Zusammenarbeit mit ihnen immer noch lieber als eine intensive Auseinandersetzung mit den Leben einzelner Mandantinnen und Mandanten, wie es im Familienrecht der Fall gewesen wäre. Für diese Art von Interaktion war ich nicht einfühlsam genug. Ich wäre diesen Leuten in ihrer schweren Zeit keine gute Stütze, eher ein lästiger Klotz am Bein. So gesehen tat ich uns allen einen Gefallen.
»Zum Beispiel.« Natalie zuckte mit den Schultern. »Du wärst mit Sicherheit ein hervorragender Familienrechtsanwalt.«
Ich unterdrückte ein verächtliches Schnauben. Dass sie solche Dinge sagte, bewies nur, wie schlecht sie mich kannte. Auch das konnte ich ihr im Übrigen nicht übel nehmen, denn noch weniger als sie es tat, kannte ich mich selbst.
»Das bezweifele ich«, murmelte ich und verstärkte den Griff meiner Hände um die Armlehnen. »Sonst noch was? Ich hab gleich ein Meeting.«
Sie musterte mich einen Moment lang aus ihren dunklen Augen, als versuchte sie, zu mir durchzudringen. Ich wusste, dass es ihr nicht gelingen würde. Meine ehemalige Therapeutin hatte ewig dafür gebraucht, die Steine meiner Schutzmauer abzutragen.
»Nein, das war’s«, antwortete sie, nachdem sie – wie zu erwarten – gescheitert war. »Versprich mir nur, dass du darüber nachdenkst, okay? Du kannst jederzeit zu mir kommen.« Ein versöhnliches Lächeln zupfte an ihren Mundwinkeln. Mich ließ es kalt.
»Klar«, sagte ich gedehnt. Wenige Sekunden später schloss ich die Bürotür hinter mir und brachte Luft zwischen mich und diesen Raum. Dann straffte ich die Schultern, spachtelte die feinen Risse in meiner Fassade mit künstlicher Selbstsicherheit zu und machte weiter.
Das erwähnte Meeting zog sich wie eine endlose Fahrt im Stau. Es ging um die Planung und den Bau eines neuen Gebäudes für eine der größten Immobiliengesellschaften der Stadt direkt am Charles River. Nach einigem Blabla über Zinssätze und Tilgungsmodalitäten war es uns nach zwei Stunden endlich gelungen, eine vorläufige Einigung zu erzielen, mit der alle Parteien zufrieden waren. Im Anschluss daran beauftragte mein Mentor Jae Lee mich damit, die Dokumente für den kommenden Termin nächste Woche vorzubereiten.
»Wenn möglich, etwas zügiger als beim letzten Mal, damit ich noch Zeit habe, alles gründlich zu überprüfen.« Er sagte es mit einem lässigen Zwinkern, den Seitenhieb spürte ich dennoch wie eine Pfeilspitze zwischen meinen Rippen.
»Geb mein Bestes, Boss.« Es kam mir sarkastischer als beabsichtigt über die Lippen, aber Jae hatte sich sowieso längst wieder seinem Mandanten zugewandt. Jede Minute, in der er sich mit mir herumschlagen musste, bedeutete eine weniger, die er in sinnvolle Arbeit investieren konnte.
Ich beschloss, meine Mittagspause vorzuziehen und einen kurzen Abstecher in die Kantine zu machen, bevor ich mich um seinen Auftrag kümmerte. Auf meinem Weg dorthin durchquerte ich den langen Flur, dessen Seitengänge sich wie die Adern eines riesigen Blattes zu den verschiedenen Meeting- und Konferenzräumen verzweigten, und erreichte schließlich die Kolonnaden im Erdgeschoss. Goldenes Sonnenlicht fiel durch das gläserne Kuppeldach herein, und wie üblich roch es nach erwärmtem Holz und feuchter Pflanzenerde. Die Lobby bildete das Herzstück der Kanzlei und war wie eine dreistöckige Empore aufgebaut. Dicke gewundene Holzsäulen stützten die Laufflure der Kolonnaden in den oberen Geschossen, während sich grüne Philodendren an den Balustraden entlangwickelten und ihre Köpfe dem Licht entgegenstreckten. Zwei mit burgunderrotem Teppich ausgelegte Treppen führten ins erste Obergeschoss der Zivilrechtsabteilung. Von dort gelangte man über ein paar schmalere Treppen sowohl in die zweite als auch in die dritte Etage, die der deutlich kleineren Strafrechtsabteilung zugewiesen worden war.
Jedes Mal, wenn man hier stand, im Zentrum des Geschehens, konnte man sich einreden, dieser Ort wäre der Mittelpunkt, um den die Welt sich drehte. Es war leicht, sich selbst vorzutäuschen, etwas erreicht zu haben, wenn man durch diese Gänge schritt. Sich als Teil von etwas Großem zu fühlen und zu glauben, man trage etwas Wichtiges dazu bei, dass es von den anderen als solches begriffen wurde. Keine Überraschung also, dass sich viele etwas darauf einbildeten, bei Gold, Bright & Partners arbeiten zu dürfen.
Wahrscheinlich war es so schon zu Lebzeiten meines Großvaters gewesen. Meine Tante hatte die Kanzlei vor einigen Jahren von ihm übernommen (wenn er nicht irgendwann zu krank geworden wäre, hätte er seinen letzten Atemzug vermutlich in seinem Büro getan). Sie war sein ganzer Stolz gewesen, deshalb hatte er entschieden, sie der Familie in seinem Testament zu vermachen. Selbst mir hatte er ein nettes Sümmchen seines Erbes hinterlassen, obwohl wir kaum Kontakt zueinander gepflegt hatten. Er war sein ganzes Leben in Boston geblieben, während mein Vater nach seinem Studium und seiner Ausbildung bei der Polizei für meine Mum nach Schottland gezogen war.
Ich hatte damals schon geahnt, dass es meinen Vater eines Tages wieder in diese Stadt ziehen würde, daher war ich nicht überrascht gewesen, als er uns seinen Entschluss auf den Tisch geknallt hatte, nachdem ich gerade elf geworden war. Die Staaten böten schließlich »mehr Aufstiegschancen und Auswahlmöglichkeiten« in seinem Job. Schottland fühle sich außerdem »nicht heimisch« an.
Er hatte Schottland gesagt, aberMum gemeint. Unüberbrückbare Differenzen nannte man das in der juristischen Fachsprache. Ich nannte es Verrat. Verrat an unserer Familie, Verrat an ihr und allem, was sie bis dahin miteinander geteilt hatten.
Ich war nicht per se wütend darüber, dass er uns verlassen hatte – die beiden hatten sich ständig gestritten, und wir waren ohne ihn sowieso besser dran gewesen. Mich hatte eher wütend gemacht, wie er gegangen war. Wie ein Tornado, der auf seinem Weg nach draußen versucht hatte, alles, was nicht niet- und nagelfest war, an sich zu reißen. Letztlich war es ihm nicht gelungen, als alleiniger Gewinner aus der Sache hervorzugehen. Als Scheidungsanwältin hatte Mum genügend Leute gekannt, die Profis auf dem Gebiet waren. Geblieben war ihr am Ende trotzdem nicht viel. Nur ein gebrochenes Herz, dieser heimlich wachsende Tumor in ihrem Kopf – und ich. Beschissener hätte die Gleichung kaum aufgehen können.
Ich stieß die verglaste Flügeltür zur Kantine auf und schien gegen eine Wand aus stickiger Luft und lautem Stimmengewirr zu prallen, die mich glatt wieder daran erinnerte, warum ich für gewöhnlich nicht zur Hauptpausenzeit hier aufkreuzte. Mir sprang sofort der Tisch ins Auge, an dem die anderen Associates saßen. Es war jeden Tag derselbe, als hätten sie irgendein Anrecht darauf. Als wäre es irgendeine Art von Clubtisch, an dem nur ausgewählte Mitglieder sitzen durften – zu denen ich nicht zählte. Ab und zu zog es einen Teil von mir trotzdem in ihre Richtung. Der andere und deutlich vernünftigere wollte sie in sicherer Entfernung wissen.
Seit meinem Umzug aus Schottland hatte ich nirgendwo mehr dazugehört, kaum noch Freunde gehabt. Was hatte ich anderen denn auch zu bieten? Eine traurige Familiengeschichte? Eine gute Portion Zynismus? Einen Mund, der alles, was ich sagte, wie eine Beleidigung oder Sarkasmus klingen ließ? Die nervige Angewohnheit, so lange nicht auf Textnachrichten zu antworten, dass aus Stunden Wochen wurden? Großartig. Ein Wunder, dass die Leute noch nicht Schlange standen.
Es sollte mich nicht überraschen, dass die anderen aufgehört hatten, mich in ihre gemeinsamen Unternehmungen miteinzubeziehen. Und doch war es jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht. Für mich war es eine Sache, jemanden einzuladen, von dem man ahnte, dass er sowieso nicht auftauchen würde. Aber eine andere, jemanden von vornherein auszugrenzen. Im ersten Fall gab man dir das Gefühl, trotzdem willkommen zu sein. Im zweiten wusstest du, dass man lieber auf deine Anwesenheit verzichtete.
Glaubt mir,dachte ich, wenn ich könnte, würde ich mich auch ausschließen. Stattdessen war ich dazu verdammt, mit mir selbst auszukommen. Wer von uns hatte nun also das üblere Los gezogen?
Nachdem ich mir einen Überblick über das Essensangebot verschafft hatte, steuerte ich den Kühlschrank mit den Getränken an. Aufgrund der heutigen Temperatur und der defekten Klimaanlage schwebten kaum sichtbare Dunstwölkchen darüber. Sie stammten von der Kühlung, unter die ich beim Öffnen der Tür am liebsten meinen Kopf gehalten hätte. Ich verabscheute den Sommer. Viel zu hell und warm.
»Jude«, sagte da plötzlich jemand hinter mir.
Ich spähte über meine Schulter und schaffte es beim Anblick der vertrauten azurblauen Augen nicht, mein Seufzen zu unterdrücken. Meine Kollegin und ehemalige Kommilitonin Laurel war ein lästiges Überbleibsel meiner Vergangenheit, das mir wie Kaugummi unter der Schuhsohle klebte. Ganz gleich, wie oft ich ihn auch abstreifte, trat ich jedes Mal wieder hinein, wenn ich ihr in der Kanzlei begegnete.
»Was willst du, Bennett?«, fragte ich und griff in den Kühlschrank.
»Ich habe Nora heute gesehen. Sie ist in der Stadt.«
Es war Gewohnheit geworden, dass mein Körper kurz zusammenzuckte, wann immer mir jemand unvorbereitet ihren Namen an den Kopf warf. Diesmal steckte jedoch so viel Wucht dahinter, dass ich fast die Wasserflasche fallen ließ. Dumpf purzelten die Buchstaben zwischen uns auf den Boden. Und da lagen sie dann wie ein unfertiges Puzzle aus Gefühlen und Erinnerungen, das ich selbst blind wieder hätte zusammensetzen können: NORA.
Was hatte das zu bedeuten? Sie war hier, in Boston? Warum? Wo genau hatte Laurel sie getroffen? War sie sich sicher, dass es Nora gewesen war? Hatten sie miteinander gesprochen? Was hatte sie gesagt? Hatte sie sich nach mir erkundigt?
Dutzende Fragen wirbelten in meinen Gedanken umher, aber keine davon verirrte sich in meinen Mund. Das passierte nur in den seltensten Fällen. Ich wollte niemandem das Gefühl vermitteln, irgendetwas in mir ausgelöst zu haben. Und erst recht nicht wollte ich offenherzig sein. Ich ließ doch auch nicht meine Haustür offen stehen, wieso sollte ich es dann bei meinem Herzen tun? Es gab anderen zu viel Macht, und nicht jeder ging rücksichtsvoll damit um. Das hatte ich früh gelernt. Menschen wie mein Vater, Gefühlsvampire, nährten sich praktisch davon. Sie schlugen ihre Zähne in jede noch so flüchtige Emotion und vergifteten sie; vergifteten dein ganzes Denken; dein ganzes Sein. Das Problem daran, sich emotionslos zu geben, war nur, dass die Leute glaubten, sie könnten dir alles an den Kopf werfen, weil es dich sowieso nicht interessierte. Ich wünschte wirklich, es wäre so. Aber die Wahrheit war, dass das meiste davon, an manchen Tagen auch alles, scheißwehtat. Sagte ich ihnen das? Natürlich nicht.
Auch jetzt drehte ich mich zu Laurel um, schob den Buchstabensalat auf dem Boden nur achtlos beiseite und bemühte mich mit aller Kraft darum, meinen gleichgültigen Gesichtsausdruck beizubehalten. »Und?«
Laurel hob die Schultern. »Sie hat nicht viel gesagt.«
Ich schnaubte. »Nein, ich meinte eher: Und du denkst, das interessiert mich, weil …?«
Eine tiefe Falte grub sich zwischen ihre markanten Brauen. Meine Worte schienen sie zu irritieren. Vermutlich hatte sie damit gerechnet, dass ich ihr die Fragen stellen würde, die mir im Kopf herumspukten. Wenigstens eine. Doch das tat ich nicht. Weil es nichts geändert hätte.
»Keine Ahnung … Ich dachte, du wüsstest es vielleicht gern. Sie sagte, ihr Vater sei kürzlich verstorben.«
Ich benötigte ein paar Sekunden, um ihre Antwort zu verarbeiten. Cornelius war tot? Shit. Bedeutete das, sein Krebs war zurückgekehrt? Ich erinnerte mich, dass er früher schon einmal damit zu kämpfen gehabt hatte. Die Ärzte hatten behauptet, die Chancen auf eine vollständige Genesung nach seiner Operation seien gering, aber nicht ausgeschlossen. Mein Magen verkrampfte sich. Das erklärte, warum Nora in Boston war. Ihr Vater hatte ihr die Welt bedeutet. Shitshitshit. Wo war sie jetzt? War jemand bei ihr? War sie okay? Vielleicht sollte ich ihr schreiben oder sie anrufen? Andererseits … hatte sie sich ja auch nicht um mich geschert. Warum fing ich jetzt also damit an?
»Nicht mein Problem«, erwiderte ich etwas verspätet und schämte mich augenblicklich dafür. Es war mir bitter über die Lippen gekommen, und genauso schmeckte es auch. Eine beißende Mischung aus Frust, Wut und Verrat. Ganz schwach darunter etwas Süßeres, Weicheres: Sehnsucht.
Laurel schien verärgert über meine Reaktion und trat kopfschüttelnd einen Schritt zurück, als müsste sie dringend Distanz zwischen uns bringen. »Mein Fehler, du hast recht. Ich hab vergessen, dass du nichts für andere Menschen übrig hast.«
Mir war bewusst, dass Laurel abgesehen von Abstand nicht viel von mir hielt, seit sie mich in ihrem Kopf als zwielichtigen Drogendealer abgestempelt hatte. Und wahrscheinlich hatte unsere Unterhaltung auf der Preisverleihung vor ein paar Monaten, in der ich mich danebenbenommen hatte, auch nicht gerade dazu beigetragen, in ihrer Sympathieliste aufzusteigen. Dennoch glichen ihre Worte einem scharfen Messerschnitt in den Finger. Er war hauchdünn, aber brannte höllisch.
Mir rutschte ein kehliges Lachen heraus. Und dann passierte das, was immer passierte: Ich ging in die Defensive und schaltete auf emotionalen Durchzug. »Zugegeben, es sind nur wenige Menschen. Aber dafür wenigstens auch keine, die sich wortlos verpissen.« Denn genau das hatte Nora getan. Und dafür wollte ich sie hassen.
Ohne meine Kollegin eines weiteren Blickes zu würdigen, schob ich mich an ihr vorbei und verschwand nach dem Bezahlen des Wassers aus der Kantine. Das Stimmengewirr hinter mir verklang, ihre Worte dagegen verfolgten mich wie ein zweiter Schatten, den ich den gesamten Tag über nicht loswurde. Egal wie schnell ich rannte.
Ich flüchtete ins Archiv, an den einzigen Ort, der mir Ruhe bot, stöpselte mir meine Kopfhörer ins Ohr und versuchte, mich auf den Auftrag von Jae zu konzentrieren. Allerdings drifteten meine Gedanken alle paar Minuten ab und landeten wieder und wieder in dieser verdammten Einbahnstraße, die ihren Namen trug. Hatte die Beerdigung bereits stattgefunden? Wie lange würde sie in der Stadt bleiben? War irgendeine der Frauen auf der Straße, in denen ich sie kurz zu sehen geglaubt hatte, tatsächlich sie gewesen? Wo wohnte sie inzwischen?
Denkt sie noch an mich?
Der letzte Gedanke schwirrte täglich mindestens einmal in mein Bewusstsein, ungebeten und lästig wie eine Fliege. Und jedes Mal verfluchte ich mich dafür. Nicht nur, weil er so hartnäckig war und sich kaum vertreiben ließ, sondern weil ich die Antwort darauf längst kannte, wenn ich ehrlich zu mir war.
Ich wusste, die einzige Möglichkeit, diese nervtötenden Gedankenfliegen loszuwerden, war, ein Notfallfenster zu öffnen. In diesem Fall hieß das Fenster: Ablenkung. Und genau diese lernte ich nach Feierabend in einer Bar in Downtown kennen.
Maxine war drei Jahre jünger als ich, mit ihren Piercings und Tattoos auf verwegene Weise attraktiv und gerade frisch getrennt. Unser Treffen war kein Zufall gewesen. Ich nutzte Dating-Apps nicht, um Frauen kennenzulernen, sondern nur, um ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen und sie dann wieder zu vergessen. Um fair zu sein, machte ich auch keinen großen Hehl daraus. Immerhin gab es genügend Nutzerinnen, die ebenso wenig auf der Suche nach etwas Festem waren. Erst vor drei Wochen hatte ich mit einer Anwältin geschlafen, die mich zweimal versehentlich beim Namen ihres Ex-Mannes genannt und anschließend peinlich berührt darum gebeten hatte, ihn ihr ein für alle Mal aus dem Kopf zu vögeln.
Ich verstand das. Ich verstand das so gut.
Maxine war Amateur-Schauspielerin und wohnte in einer kleinen Einzimmerwohnung nahe der Haltestelle Broadway. Jeder Quadratzentimeter war mit Möbeln vollgestellt, neben ihrem Bett lagen Kleidungsstücke verstreut, die Türen ihres Schranks standen offen. In der Spüle der angrenzenden Küche stapelte sich Geschirr, und der Geruch von Bratfett lag in der Luft. In der ersten Sekunde wäre ich am liebsten rückwärts wieder aus der Haustür rausspaziert. Nur war mein Drang nach Ablenkung stärker gewesen.
»Hast du ein Kondom?«, fragte sie.
»In meiner Brieftasche.«
Ich fuhr mit der einen Hand über ihre nackten Brüste, ihre Hüften, ihren Bauch, fühlte ihre Haut und gleichzeitig nichts. Die andere ließ ich langsam in ihren Slip wandern, während ihre Atmung hörbar flacher wurde. Es dauerte keine drei Minuten, bis sie sich verkrampfte und kam. Eigentlich hatte ich daraufhin sofort dazu übergehen wollen, sie über ihren Schreibtisch zu beugen, allerdings schien sie andere Pläne zu haben. Mit geröteten Wangen drehte sie sich zu mir um und zerrte mir ungeduldig das Shirt über den Kopf. Dabei fiel ihr Blick unweigerlich auf die Unterseite meines linken Oberarms. Sie hielt inne, fuhr vorsichtig über all die kleinen runden Silberflecken, die meine Schwäche verrieten. Brandmale, Schandmale, zu viele Male, in denen ich die Kontrolle verloren hatte. Ich rechnete schon damit, dass sie nachfragen würde, aber alles, was sie sagte, war: »Harte Zeit gehabt, hm?«
Ich antwortete nicht darauf, weil ich nicht hergekommen war, um zu reden oder zu denken. Ich wollte etwas fühlen, richtig fühlen. Einfach irgendwas anderes als das, was ich mit mir herumschleppte, seit Laurel vorhin ihren Namen erwähnt hatte.
Nachdem ich mir das Kondom übergestreift hatte, drückte Maxine mich fordernd aufs Bett hinunter und setzte sich kurzerhand auf meinen Schoß. Ich hatte nichts gegen diese Stellung, und wenn sie es so am liebsten mochte, würde ich keinen Einwand erheben. Trotzdem war mir diese plötzliche Nähe eine Spur zu intim, zu vertraut für etwas Fremdes.
Vorzugsweise nahm ich die Frauen, mit denen ich schlief, von hinten. Das funktionierte schnell und unkompliziert und erforderte in spontanen Momenten nicht einmal, sich vollständig entkleiden zu müssen. Zudem war ich auf diese Weise nicht gezwungen, sie anzusehen. Je unpersönlicher, desto besser. Das klang gemeiner, als es war, aber ich verspürte schlichtweg kein Verlangen, in ihren Gesichtern zu lesen. Es reizte mich nicht, zu beobachten, wie ihre Augenlider flatterten, ihnen Röte in die Wangen kroch oder sie ihre geschwollenen Münder verzogen. Es gab nur einen Menschen, bei dem das so gewesen war. Und leider fingen die Erinnerungen daran langsam an, zu verblassen. Da waren noch schwache Gefühlsschatten, nach denen ich tasten könnte, wenn ich gewollt hätte. Nur wollte ich das jetzt definitiv nicht, weshalb ich mich wieder auf Maxine konzentrierte, die sich nackt auf meinem Schoß wand.
Ich wich ihrem heißen Atem, vielleicht auch ihrem Blick aus, indem ich meine Nase in ihrer Halsbeuge vergrub. Irgendwann griff sie mir jedoch ins Haar und zog meinen Kopf leicht zurück. Als sie ihre Lippen das erste Mal auf meine presste, ließ ich es geschehen. Beim zweiten Mal drehte ich mich weg.
»Lass das.«
»Ist doch nur ein bisschen Küssen.«
»Und ich habe dir gesagt, dass das meine Grenze ist.«
Maxine lachte auf. »Du steckst quasi in mir drin und willst mir erzählen, dass Küssen deine Grenze ist? Was bist du, ein Callboy oder so was?«
Ich hatte geahnt, dass sie es nicht verstehen würde. Schon in der Sekunde, in der sie meine Bedingung mit einem Schmunzeln abgenickt hatte, was so viel ausgedrückt hatte wie: »Wir werden ja sehen, ob du deine Meinung noch änderst.«
Zugegeben, möglicherweise besaß auch ich irgendwo noch die leise Hoffnung, dass irgendwann wieder ein Paar Lippen dabei sein würde, das mich etwas fühlen ließ. Etwas, so brennend und alles verzehrend, dass es die Eisschichten, die sich um mein Herz gebildet hatten, zum Schmelzen brachte. Aber es passierte nie.
»Komm schon, war doch nur Spaß.« Maxine fuhr mit ihrem Daumen über meinen linken Mundwinkel und fing an, ihre Hüften wieder langsam vor und zurück zu wiegen. »Du bist so ernst. Werd mal ein bisschen lockerer.«
Als sie mich ein drittes Mal gegen meinen Willen küsste, war es mir schließlich zu viel. Ich packte sie an den Schenkeln und setzte sie vor mir auf dem Boden ab. Das Ganze geschah derart schnell, dass sie mich im ersten Moment nur verdattert anblinzelte. Dann schoben sich ihre Brauen zusammen wie zwei Sturmwolken vor einem Gewitter. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Willst du mich verarschen?«
Ich entsorgte das Kondom im Mülleimer neben dem Schreibtisch, schlüpfte zurück in meine Kleidung und griff nach Schlüssel und Handy. »Sorry, aber ich glaube, das mit uns passt nicht. War nett, dich kennenzulernen.«
Kaum war ihre Haustür mit einem gezischten »Fick dich doch!« hinter mir zugefallen, eilte ich die knarrende Holztreppe hinunter und zog dabei meine Zigarettenschachtel aus der Gesäßtasche. Sobald ich von dem feuchtwarmen Atem der Sommernacht umhüllt wurde, steckte ich mir eine Zigarette an und setzte mich auf die Steinmauer vor dem Wohnhaus, die vom schwachen Licht der Außenbeleuchtung erhellt wurde. Mit der freien Hand holte ich mein Smartphone hervor. Und auch wenn ich mir vorgenommen hatte, es nicht zu tun, tippten meine Finger wie von selbst den Namen ihres Vaters ein. Wenige Klicks später fand ich, wonach ich gesucht hatte.
Mit Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Ehemann, Vater und Freund Cornelius Harris, der eine Lücke in unserem Leben hinterlässt, die nur schwer zu füllen sein wird. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung auf dem Forest Hills Friedhof findet am 28. Juli um 12:30 Uhr statt. Wir möchten Freunde und Angehörige der Familie herzlich dazu einladen, seiner gemeinsam zu gedenken.
In liebevoller Erinnerung
Familie Harris
3
Nora
Das Alphabet hat sechsundzwanzig Buchstaben, die Kombination TOD nur drei. Bei Scrabble hätte sie mir einen Wert von gerade einmal vier Punkten eingebracht, und auch sonst war es ein ziemlich eigenartiges Wort. Viel zu winzig und unbedeutend für all das Leid, das es nach sich zog. Im Klang dennoch so angsteinflößend, dass Menschen sich davor hüteten, es in den Mund zu nehmen.
Der Tod ordnet die Welt neu.
Scheinbar hat sich nichts verändert,
und doch ist die Welt für uns ganz anders geworden.
Ich las den Trauerspruch wieder und wieder, schien mich mit jedem Mal ein Stück weiter davon zu entfernen, als sähe ich durch eine Kamera, die langsam herauszoomte, bis ich mich selbst von außen betrachten konnte. Ich war kaputt, glaubte ich. Irgendetwas in mir war zersprungen, und nun funktionierte ich nicht mehr richtig. Anders konnte ich mir nicht erklären, warum ich abwesend an meinem Glas nippte, während alle anderen um mich herum in Tränen ausbrachen oder in Erinnerungen versanken.
Meine Tante saß auf dem Sofa und schnäuzte sich mit verquollenen Augen in ein Taschentuch, mein Onkel strich ihr beruhigend mit der Hand über den Rücken, sein Gesichtsausdruck dabei genauso sanft und mitfühlend wie das, was er ihr ins Ohr flüsterte. Mein Cousin Benson war dazu übergegangen, das leere Geschirr der Gäste einzusammeln, wahrscheinlich um seine rastlosen Gedanken zu beschäftigen. Mein Großvater begutachtete mit verkniffenem Mund eines der gerahmten Familienbilder an der Wand gegenüber vom Esstisch. Und ich? Ich stand hier neben der Trauertafel mit dem Foto und diesem Spruch und tat … nichts.
Hin und wieder wanderte mein Blick zu der lichtdurchfluteten Eingangshalle. Als hätte ich noch nicht begriffen, dass Dad tatsächlich nicht mehr unter uns war und ich mich vor wenigen Tagen an seinem Krankenhausbett von ihm verabschiedet hatte. Als würde ich insgeheim immer noch darauf warten, dass er jeden Moment mit einem Grinsen und den Worten »Seht ihr? Reingelegt!« durch die Haustür spazierte. Stattdessen spuckte sie nur immer mehr fremde Menschen aus, die gekommen waren, um uns ihr Beileid auszusprechen, ein paar Blumen und Karten dazulassen oder sich an den Häppchen zu bedienen, die meine Mutter heute Morgen in gespenstischer Ruhe vorbereitet hatte.
Es war so makaber, dass ich lachen wollte, bloß konnte ich nicht. Da war kein Gefühl in mir, keine Regung. Meine Haut war Luftpolsterfolie, und alles prallte daran ab.
»Nora, Liebes.« Ich zuckte zusammen, als sich eine Hand auf meine Schulter legte und ich in das fahle Gesicht der alten Nachbarin von nebenan blickte. »Mein aufrichtiges Beileid.«
Mildred zog mich so fest an ihre Brust, dass mir ihr Duft nach Rosenwaschmittel und pudriger Cremelotion in die Nase stieg. Automatisch versteifte ich mich. »Es muss schwer für dich sein.«
Komisch. Alle sagten das, aber ich war nicht diejenige, die weinte.
»Danke«, brachte ich stockend hervor. »Ich bin sicher, es hätte ihn gefreut, zu sehen, dass Sie hier sind, Mildred.« Das war mein Standardtext. Ich hatte ihn vorhin von meiner Mutter abgekupfert und seitdem etliche Male in unterschiedlichsten Varianten benutzt. Nur meinen eigenen Text, den hatte ich irgendwie vergessen.
Mildred schenkte mir ein mitleidiges Lächeln und drückte noch ein letztes Mal meine Schulter, ehe sie meine Mutter am anderen Ende des Raums entdeckte, die mit ihrem hochgesteckten Haar und dem schwarzen Etuikleid selbst in ihrer Trauer noch die gewohnte Eleganz ausstrahlte. So reglos, wie sie dort stand und sich mit einem der Gäste unterhielt, hätte sie ein perfektes Schwarz-Weiß-Porträt abgegeben.
Es war ihr Vorschlag gewesen, anstelle eines traditionellen Traueressens nach der Beisetzung vorab einen kleinen Empfang im Garten zu veranstalten. Sie empfand es als stilvollere Art, sich zu verabschieden. »Nach der Beerdigung hat doch ohnehin niemand mehr Appetit.« Mir hätte es nicht gleichgültiger sein können. Für mich fühlte sich beides an, als würde ich den Tod feiern, und das erschien mir auf jede erdenkliche Weise falsch.
»Hey.« Mein Cousin Benson stupste mich an und musterte mich besorgt von der Seite. »Alles okay? Du wirkst ziemlich steif.«
Ich grunzte in mein Glas hinein und leerte den Orangensaft in einem Zug. »Ich bin nicht diejenige, die im Sarg liegt, oder?« Kaum war mir die Antwort über die Lippen gerutscht, bereute ich sie bereits. Noch mehr, als sich Bensons Brauen zusammenschoben.
»Nicht ganz der richtige Tag für solche Witze, oder?«
Er hatte recht. Gott, was war los mit mir? Brennende Röte schoss mir in die Wangen. »Tut mir leid. Es ist nur … So viele Leute sind gekommen. Man sollte meinen, das würde reichen, um zu begreifen, dass das hier wirklich passiert. Aber ich kann’s nicht.« Ich wollte einfach nicht.
Benson fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die blonden Locken und seufzte. »Ja. Ich weiß genau, wie du dich fühlst.«
Woher denn? Ich wusste doch selbst nicht, wie ich mich fühlte, was ich fühlte oder ob ich überhaupt irgendetwas fühlte. Ich wusste beim Anblick der verweinten Gesichter nur, was ich eigentlich fühlen sollte. Und ich glaubte nicht, dass das jemand verstand. Der Einzige, der es vielleicht getan hätte, war in diesem Moment nicht hier. Er war nie hier, aber trotzdem immer da, wie ein leidiges Phantomgefühl meines Herzens.
»Ist es nicht bescheuert, dass wir davon reden, einen Menschen verloren zu haben, wenn er stirbt? Als bestünde irgendwo noch die Hoffnung, ihn wiederzufinden«, flüsterte seine vertraute Stimme in meinem Kopf.
Mit aller Kraft versuchte ich, sie beiseitezuschieben und meine Gedanken anderweitig zu beschäftigen. Ich landete wieder bei PHANTOMGEFÜHL und begann, zu rechnen. Dreizehn Buchstaben, die selbst auf einfachem Wert stolze einunddreißig Punkte ergeben würden. Über die Jahre hatte sich diese Methode als hilfreich erwiesen, um die leise Kopfstimme zum Schweigen zu bringen. Seit ein paar Tagen war sie jedoch stärker als ich. Genau genommen, seit ich vor Kurzem zufällig meiner alten Kommilitonin Laurel begegnet war. Sie hatte erwähnt, inzwischen bei Gold, Bright & Partners zu arbeiten, der Kanzlei seiner Tante. Und nun konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Über ihn nachzudenken.
Er hatte nach dem Studium eigentlich immer woanders arbeiten wollen – weit weg von seiner Familie, am liebsten in Schottland. Der Traum war schnell zu unserem gemeinsamen geworden. Wir hatten uns sogar schon alles ausgemalt: den Juraabschluss, das kleine Cottage nahe der Küste und die Kanzleien, die für uns infrage kommen würden … Vielleicht lebte er diesen Traum im Gegensatz zu mir längst.
»Nora, was hast du denn da an?«, zischte meine Mutter. Es war das erste Mal seit Stunden, dass sie mir Beachtung schenkte. »Was ist mit dem schwarzen Kleid, das an deinem Schrank hing?« Sie zog mich mit sich in die Küche und blickte tadelnd an mir hinab, weshalb ich dasselbe tat. Mein Kleid war nicht schwarz, sondern weiß. Weiß wie die Trauer, nicht wie der Tod.
Ich zuckte mit den Schultern. »Hat mir nicht gefallen.«
Und Dad hätte es auch nicht gefallen. Er hatte mal gesagt, er hätte mir keinen Namen gegeben, der für das Licht stand, nur um mitanzusehen, wie ich meines von etwas, oder jemandem, schlucken ließ. Außerdem mochte ich die hellen Töne sowieso lieber als die dunklen. Sie waren die Erinnerung daran, dass die Welt nicht düster war, selbst wenn es sich zeitweise so anfühlte.
»Es muss dir auch nicht zu gefallen haben. Es gehört sich nun mal so«, erwiderte sie in strengem Tonfall und zupfte an einem Faden meines Ärmels. »Also geh nach oben und zieh es an. Wir müssen in einer halben Stunde auf dem Friedhof sein.«
Ich hätte problemlos ablehnen und mich weigern können, immerhin war ich fünfundzwanzig und somit durchaus in der Lage, selbst zu entscheiden. Allerdings hatte ich schon als Kind gelernt, dass es klüger war, sich nicht gegen meine Mutter aufzulehnen. Erst recht nicht an einem Tag wie diesem. Also lief ich gehorsam nach oben und schloss die Tür des Gästezimmers hinter mir, das einst meines gewesen war. Die lachsfarbene Ornamenttapete war geblieben, ebenso wie die weißen Holzmöbel. Trotzdem war es nicht mehr dasselbe. Das war dieses Haus schon lange nicht mehr.
Mit einem Seufzen sank ich auf den samtenen Hocker vor dem Schminktisch und betrachtete mich im Spiegel. Meine Wangen waren leicht gerötet. Vielleicht war es noch immer meinem deplatzierten Witz geschuldet, vielleicht auch der Hitze, die sich mit aller Kraft gegen die Fensterscheiben stemmte.
Das weißblonde Haar hatte meine Mutter mir heute Morgen aufwendig geflochten und hochgesteckt, nur zwei gelockte Strähnen umspielten mein Gesicht. Ich sah ihr mit dieser Frisur so ähnlich, dass ich schlucken und den Blick abwenden musste. Er fiel auf das kleine Schmuckkästchen neben dem Spiegel, das ich nach kurzem Überlegen zu mir zog. Darin befand sich eine mit Perlen besetzte Brosche meiner verstorbenen Großmutter, die ich mir an die Brust steckte, aber auch noch etwas, das ich ganz vergessen hatte: Dads alte Uhr. Die Unterseite des schwarzen Lederbands war abgenutzt und leicht zerfranst, hatte angefangen, sich abzulösen. Sie funktionierte nicht mehr. Ich hätte zu gern gewusst, ob sie es schon länger nicht mehr tat oder ob ihre Zeiger ganz symbolisch erst mit seinem Tod stehen geblieben waren. Ich wollte daran glauben, ahnte jedoch, dass sie schon vor langer Zeit den Geist aufgegeben hatte.
Meine Mutter hatte ihn früher ständig gefragt, warum er sich nicht endlich eine neue zulegte, und seine Antwort darauf war stets dieselbe geblieben: »Warum sollte ich mir eine neue kaufen, wenn diese noch wunderbar funktioniert?« So war das bei ihm immer gewesen. Trotz des guten Verdienstes meiner Eltern hatte er sich nie für etwas Besseres gehalten. Stattdessen hatte er seine Schuhe getragen, bis sie wortwörtlich auseinandergefallen waren. Er hatte Kassenbons auf Korrektheit überprüft, Schrammen im Autoblech eigenhändig mit Farbe übermalt und entgegen dem Protest meiner Mutter sogar auf seinen eigenen Namen auf dem Grabstein verzichten wollen, um Geld zu sparen. Benson hatte nach seinem Tod mal gesagt, genauso bescheiden, wie er für seine Verhältnisse gelebt hatte, sei er auch von uns gegangen. Und es stimmte. Mein Vater war für andere einer der leisesten Menschen gewesen – für mich der wahrscheinlich lauteste.
Warum also fühlte ich seit seinem Tod nichts? Das hatte er nicht verdient. Ich sollte hier sitzen und weinen, mit wunder Nase und wundem Herzen. Stattdessen starrte ich mit wutverzerrter Miene auf mein Spiegelbild und unterdrückte den Drang, meine Bürste dagegenzuwerfen. Du bist kalt, dachte ich, während ich mir die Uhr ums Handgelenk band. Du siehst nicht nur aus wie sie, du bist wie sie.
In einem aufkommenden Impuls riss ich mir die Spangen aus dem Haar, sodass mir die dicken geflochtenen Zöpfe auf den Rücken fielen und sich meine Kopfhaut augenblicklich entspannte. Ich schmiss sie zusammen mit den Haarbändern in die Schmuckschale, fuhr mir mehrmals mit den Fingern durch die blonden Wellen und sprang auf. Mein Blick glitt zu dem schwarzen Kleid an meiner Schranktür, im Hinterkopf wieder diese leise Stimme: »Lass dir nicht immer alles gefallen.« Er hatte recht. Sich alles gefallen zu lassen, bedeutete jedes Mal, selbst ein Stück weit zu fallen. Und ich war es leid, mir ständig die Knie aufzuschürfen, nur weil ich es aus irgendeinem Grund nicht hinbekam, standhaft zu bleiben.
In New York war mir das besser gelungen. Ich war eine optimierte Version meiner selbst gewesen, eine selbstbestimmtere Nora, die sich nicht mehr so viel von den Gefühlen und Meinungen anderer hatte beeinflussen lassen. Die es nicht mehr händeringend jedem hatte recht machen wollen. Seit ich jedoch vor einem knappen halben Jahr zurück nach Boston gezogen und mit meinem Elternhaus und meiner Kindheit konfrontiert worden war, erwischte ich mich etwas zu oft dabei, ins Denkmuster der alten Nora zurückzufallen.
Insgeheim schob ich es auf meine Mutter, in deren Nähe ich mich auch als Erwachsene noch wie ein Kind fühlte. Die Sache mit dem Kleid bewies es; ich hatte das Bedürfnis, ihrer Aufforderung nachzukommen, um den scheinbaren Frieden im Haus zu wahren. Heute war es nur leider der Tod, der diese vier Wände für sich eingenommen hatte, und mit dem befand ich mich auf Kriegsfuß. Dementsprechend schenkte ich dem schwarzen Kleid beim Verlassen des Zimmers auch keine Beachtung mehr.
Als wir eine knappe Viertelstunde später mit der Familie und den anderen Gästen zu den Autos aufbrachen und die Villa hinter uns ließen, bedachte meine Mutter mich unter ihrer Hutkrempe mit einem Seitenblick, der sich in meiner Schläfe festbiss. Sie hatte diese ganz bestimmte Art, ihren schmalen Mund zu verziehen, die mir sofort signalisierte, dass sie enttäuscht von mir war.
»Darüber reden wir noch«, raunte sie mir zu.
Ich nickte stumm, wusste, das würden wir nicht.
Das taten wir schließlich nie.
Während der Fahrt wünschte ich mir, ich hätte eines meiner Kreuzworträtsel eingepackt, um meine Gedanken zu beschäftigen. Stattdessen hielt ich die gesamte Zeit über die kalten, schwitzigen Hände meiner Tante Liz und von Benson, zwischen denen ich auf der Rückbank saß. Schwer zu sagen, ob ich den Tag ohne meinen Cousin überstanden hätte. Benson war wie der Bruder, den ich nie gehabt, mir aber immer gewünscht hatte. Für meine Eltern der Sohn, den sie sich immer gewünscht, aber nie bekommen hatten.
Manchmal hatten sie mich das etwas zu sehr spüren lassen. Meine Mutter, indem sie mich auch heute noch andauernd mit Benson verglich, als wäre er der Maßstab, an dem ich mich zu orientieren hatte. Mein Vater, indem er andere Dinge mit ihm unternommen hatte als mit mir: Modelleisenbahnlandschaften bauen, Holzboote schnitzen, auf dem matschigen Feld hinter dem Haus Football spielen – typischer »Jungskram«, der »nichts für Mädchen« sei. Er hatte es klingen lassen wie eine allgemeingültige Regel, und ich wusste bis heute nicht, wer sie aufgestellt hatte. Doch es hatte genügt, um mich als Kind zu fragen, ob ich weniger Mädchen war, nur weil ich gern mit ihnen Football gespielt hätte. Wahrscheinlich hätte ich Dad nur darauf ansprechen müssen, um etwas daran zu ändern, aber Mom hatte früher oft gesagt, wer zu viel fordern würde, mache sich schnell unbeliebt. Also hatte ich den Mund gehalten.
Man sollte meinen, diese Behandlung hätte mein Bild von Benson negativ beeinflusst, nur war dem nicht so. Er hatte sich schließlich nicht ausgesucht, auf diesen Sockel gestellt zu werden. Und ebenso wenig hatte er mir je das Gefühl gegeben, von dort oben auf mich hinabzublicken. Im Gegenteil.
Instinktiv verstärkte ich den Druck meiner Hand um seine. Als er es bemerkte, strich er mir mit dem Daumen über meinen Handrücken und schenkte mir ein warmes Lächeln.
Der Forest Hills Friedhof war mir fremd, doch auf der Stadtkarte wirkte er wie eine grüne Insel mit einem eigenen See, der ihn fast idyllisch aussehen ließ. Das Wissen, dass Dads Grab hier einen Platz gefunden hatte, erschien mir wie ein winziger Trost, als ich mich wenig später auf dem Parkplatz umschaute. Mein Blick wanderte zu dem imposanten Tor aus rötlichem Puddingstein, das zum Friedhof führte. Es wurde von zwei konischen Türmen und einem zentralen Steingiebel eingerahmt und hätte metaphorischer wohl kaum sein können. Als bildete es einen Übergang zwischen Ober- und Unterwelt. Ich hatte gerade die Autotür zugeschlagen, da kam direkt neben mir ein schwarzer Wagen auf dem knirschenden Kiesbett zum Stehen. Er wirbelte staubige Erde auf, sodass ich husten musste.
»Entschuldigt, dass wir es nicht früher geschafft haben.« Ich erkannte Tom, der als Erster ausstieg, sofort. Er war ein guter Freund meines Vaters gewesen, seitdem sie sich während ihrer Facharztausbildung im Krankenhaus kennengelernt hatten. Unsere Familien gingen seit Jahren regelmäßig miteinander essen, weshalb ich froh gewesen war, dieser Tradition mit meinem Umzug ans College entflohen zu sein. In den Semesterferien hatte ich sie trotzdem gelegentlich gesehen. Zu Tom gehörten seine Frau Louisa und seine zwei Söhne Adrian und Max. Max war gerade zwanzig geworden und offenbar nicht daran interessiert, an einer Beerdigung teilzunehmen, denn er war nicht hier. Adrian war zwei Jahre älter als ich und angehender Arzt. Seit unserem letzten Treffen war sein kastanienbraunes Haar an den Seiten länger geworden, der Bart dagegen kürzer, sodass die markanten Linien seiner Wangen und seines Kinns deutlicher hervortraten. Er sah gut aus, aber dessen war er sich für meinen Geschmack eine Spur zu bewusst.