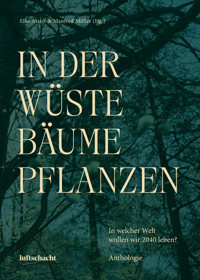
In der Wüste Bäume pflanzen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Klima- und Biodiversitätskrise, das rasante Tempo technologischer Entwicklungen, kriegerische Auseinandersetzungen, nukleare Bedrohung, geopolitische Verschiebungen, gesellschaftliche Umwälzungen prägen unsere Gegenwart. Wie ist eine wünschenswerte Zukunft überhaupt noch denkbar? Wie ist es bestellt um die Interdependenzen, die komplizierten Ungleichgewichte und Ambivalenzen zwischen Mensch / Natur / Künstlicher Intelligenz? Wie steht es um die Würde des Menschen, der Natur? Zu diesen und ähnlichen Fragen treten 14 österreichische Autor*innen mit Partner*innen aus dem Ausland in einen Dialog. Beim Ergebnis handelt es sich einmal um literarische Prosa, ein anderes Mal um Essays; manchmal beziehen sich die Texte aufeinander, manchmal stehen sie unabhängig nebeneinander. Dystopische und utopische Ansätze werden verwoben, vieles erinnert an Science-Fiction, die geschriebene Zukunft kann zum Denken anregen, zum Lachen bringen, aber auch erschrecken. Allen Texten gemein ist aber, dass sie brennende Themen literarisch-künstlerisch verhandeln. Olja Alvir kommuniziert mit Léonce W. Lupette (D/FR), Anna Baar mit Aleš Steger (SI), Mascha Dabić tauscht sich mit Katja Grcić (HR) aus, Walter Fanta mit Andy Jelčić (HR). Olga Flor bildet ein Team mit Radka Denemarková (CZ), Friederike Gösweiner mit Luiza Bouharaoua (HR). Andrea Grill arbeitet mit Albana Shala (AL), Anna Kim mit Arild Vange (NO), Elisabeth Klar mit S. Mahmoud Hosseini Zad (IR). Christina Maria Landerl tritt in Dialog mit I.V. Nuss (D), Tanja Maljartschuk mit Laryssa Denyssenko (UA). Carolina Schutti denkt gemeinsam mit Virgília Ferrão (MZ), Michael Stavarič mit Radmila Petrović (RS). Den Schluss bilden Andreas Unterweger und Volha Hapeyeva (BY).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klima- und Biodiversitätskrise, das rasante Tempo technologischer Entwicklungen, kriegerische Auseinandersetzungen, nukleare Bedrohung, geopolitische Verschiebungen, gesellschaftliche Umwälzungen prägen unsere Gegenwart. Wie ist eine wünschenswerte Zukunft überhaupt noch denkbar? Wie ist es bestellt um die Interdependenzen, die komplizierten Ungleichgewichte und Ambivalenzen zwischen Mensch / Natur / Künstlicher Intelligenz? Wie steht es um die Würde des Menschen, der Natur?
Zu diesen und ähnlichen Fragen treten 14 österreichische bzw. in Österreich tätige Autorinnen und Autoren mit Partnerinnen und Partnern aus dem Ausland in einen Dialog. Beim Ergebnis handelt es sich einmal um literarische Prosa, ein anderes Mal um Essays; manchmal beziehen sich die Texte aufeinander, manchmal stehen sie unabhängig nebeneinander. Dystopische und utopische Ansätze werden verwoben, manches erinnert an Science-Fiction, die geschriebene Zukunft kann zum Denken anregen, zum Lachen bringen, aber auch erschrecken. Allen Texten gemein ist aber, dass sie brennende Themen literarisch-künstlerisch verhandeln.
Olja Alvir kommuniziert mit Léonce W. Lupette (D/FR), Anna Baar mit Aleš Steger (SI), Mascha Dabić tauscht sich mit Katja Grcić (HR) aus, Walter Fanta mit Andy Jelčić (HR). Olga Flor bildet ein Team mit Radka Denemarková (CZ), Friederike Gösweiner mit Luiza Bouharaoua (HR). Andrea Grill arbeitet mit Albana Shala (AL), Anna Kim mit Arild Vange (NO), Elisabeth Klar mit S. Mahmoud Hosseini Zad (IR). Christina Maria Landerl tritt in Dialog mit I.V. Nuss (D), Tanja Maljartschuk mit Laryssa Denyssenko (UA). Carolina Schutti denkt gemeinsam mit Virgília Ferrão (MZ), Michael Stavarič mit Radmila Petrović (RS). Den Schluss bilden Andreas Unterweger und Volha Hapeyeva (BY).
Christoph Thun-Hohenstein
In der Wüste Bäume pflanzen
In welcher Welt wollen wir 2040 leben?
Anthologie
Herausgegeben von
Elke Atzler und Manfred Müller
im Auftrag der
Sektion für internationale Kulturangelegenheiten des
Bundesministeriums für europäische und internationale
Angelegenheiten
Mit einem Geleitwort von Christoph Thun-Hohenstein
Luftschacht Verlag
© Luftschacht Verlag – Wien
luftschacht.com
1. Auflage September 2024
Alle Rechte vorbehalten
© der Texte bei den Autorinnen und Autoren, der Übersetzungen bei den
Übersetzerinnen und Übersetzern.
Die von den Autorinnen und Autoren gewählte Rechtschreibung und die gewählte
Art der gendergerechten Schreibweise wurden beibehalten.
Planung und Projektbetreuung: Elke Atzler und Manfred Müller
Umschlaggestaltung: Michael Balgavy – balgavy.space
Lektorat: Stefanie Jaksch
Satz: Luftschacht
Druck und Herstellung: Finidr s.r.o.
Papier: Holmen book Cream 80 g/m2, Geltex glatt 115 g/m2
ISBN 978-3-903422-46-9
ISBN E-Book 978-3-903422-47-6
Inhalt
Geleitwort Christoph Thun-Hohenstein
Einleitung Elke Atzler & Manfred Müller
Olja Alvir & Léonce W. Lupette: Alles ist durchdrungen
Anna Baar: Gut genug
Aleš Šteger: Gespräch im Kaffeehaus
Mascha Dabić TALENT
Katja Grcić PARADIES_HÖLLE
Radka Denemarková und Olga Flor Kauderwelsch Intelligence
Walter Fanta: Nichts über Dummheit
Andy Jelčić: Natürliche Intelligenz trifft auf künstliche Blödheit
Friederike Gösweiner: Defining Nature’s Dignity Abschrift einer Flaschenpost
Luiza Bouharaoua: Melodien eines Instruments
Andrea Grill: Die DNA der Würde (Eine Utopie)
Albana Shala: Briefe aus der Zukunft
Elisabeth Klar: In Unruhe tanzen
Mahmoud Hosseini: Zad Aus einer anderen Welt komme ich
Tanja Maljartschuk: Zukunftsunterricht für Fortgeschrittene
Laryssa Denyssenko: Bäume pflanzen in der Wüste
I.V. Nuss & Christina Maria Landerl: Please Don’t Hesitate To Contact Me oder: GESPRÄCH MIT TOTEN FRIENDS
Carolina Schutti: Alma
Virgília Ferrão: Das Loch
Michael Stavarič: Wien 2040
Radmila Petrović: Meine einzige würdige Zukunft, Du
Andreas Unterweger: Was wir nicht über Vögel wissen
Volha Hapeyeva: Was wir nicht über Vögel wissen
Arild Vange: Warten im Garten. Vanessa
Anna Kim: Warten im Garten. Leonardo
Kurzbiografien
Geleitwort
Im Jahr 2023 beging das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten ein besonderes Jubiläum: 50 Jahre internationale Kulturarbeit für Österreich. Aus diesem Anlass wurde unter dem Titel „Imagine Dignity“ eine neue Initiative ins Leben gerufen, durch die Zukunftsthemen verstärkt in den Fokus von Kunst und Kultur gerückt werden sollten.
Imagine steht dabei für den Anspruch, unsere gemeinsame Zukunft mit künstlerischen Visionen und einer neuen Kultur des Dialogs zwischen Künsten und Wissenschaften mitzugestalten. Mit Dignity ist die Würde der Menschen ebenso gemeint wie die Würde der Natur und ihrer Ökosysteme.
Diesem Mensch-Natur-Bild stehen auf der Basis von Künstlicher Intelligenz die wirkmächtigsten Technologien gegenüber, die die Menschheit bisher erfunden hat. Seit ChatGPT und vergleichbaren, weitverbreiteten Systemen generativer KI ist die Künstliche Intelligenz und damit auch die Diskussion über Chancen und Risiken der dadurch möglich gewordenen Technologien in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Klar ist: Wie schon bei der globalen Klima- und Biodiversitätskrise kann kein Land der Welt das Rad der Zeit zurückdrehen. Worauf es jetzt ankommt, ist daher umsichtige menschliche Intelligenz. Gerade Kunst und Kultur eröffnen sich dadurch einzigartige Möglichkeiten, in der Gestaltung der Zukunft eine bedeutende Rolle zu spielen.
In nur 16 Jahren schreiben wir das Jahr 2040. Dies erscheint sehr nah, und doch kann angesichts diverser Krisen und des rasanten Tempos technologischer Entwicklungen niemand vorhersagen, in welcher Welt wir 2040 leben werden. Aber in welcher Welt wollen wir 2040 überhaupt leben? Wie können wir die Würde der Menschen und die Würde der Natur in Einklang bringen, die Erderwärmung und das Artensterben stoppen, die Natur und ihre Ökosysteme regenerieren? Welche Erwartungen haben wir an generative Künstliche Intelligenz und andere digitale Technologien, wie können wir ihre Stärken nützen und ihre Risiken möglichst geringhalten? Wie könnte Künstliche Intelligenz uns vielleicht sogar darin unterstützen, aus der Sackgasse zunehmender gesellschaftlicher Spaltung herauszufinden und die Weichen für neuen humanistischen Zusammenhalt in einer mehr-als-menschlichen Welt zu stellen?
Vor dem Hintergrund dieser Fragen hat die Sektion für internationale Kulturangelegenheiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten in bewährter Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur einen Literaturwettbewerb ausgeschrieben. Österreichische bzw. in Österreich tätige Schriftstellerinnen und Schriftsteller wurden eingeladen, im Spannungsfeld von Mensch, Natur und Künstlicher Intelligenz gemeinsam mit einer/einem ausländischen Partnerin oder Partner der Frage nachzuspüren, in welcher Welt wir 2040 leben wollen. Die Ergebnisse dieses Nachdenkens finden Sie in diesem Buch. Zahlreiche prominente Autorinnen und Autoren aus dem In-und Ausland haben ihre gewichtige Stimme erhoben und, teils aus überraschenden Perspektiven, in unterschiedlichsten Tonlagen auf differenzierteste Weise von einer imaginierten Welt erzählt. Ich möchte ihnen dafür danken, dass sie sich an dieser Initiative beteiligt, neue Blickwinkel eröffnet und damit nicht zuletzt aktiv an der Beantwortung wichtiger Fragen zu unser aller Zukunft mitgearbeitet haben.
Christoph Thun-Hohenstein
Leiter der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten
Einleitung
Die Temperaturen steigen, die Gletscher schmelzen, Naturkatastrophen stehen auf der Tagesordnung. Die Ökosysteme sind gefährdet. Die Klima- und Biodiversitätskrise, das rasante Tempo technologischer Entwicklungen, kriegerische Auseinandersetzungen, nukleare Bedrohung, geopolitische Verschiebungen, gesellschaftliche Umwälzungen prägen unsere Gegenwart. Wie ist eine wünschenswerte Zukunft überhaupt noch denkbar? Wie ist es bestellt um die Interdependenzen, die komplizierten Ungleichgewichte und Ambivalenzen zwischen Mensch / Natur / Künstlicher Intelligenz? Und wie steht es um die Würde des Menschen, der Natur?
Zu diesen und ähnlichen Fragen treten 14 österreichische bzw. in Österreich tätige Autorinnen und Autoren mit Partnerinnen und Partnern aus dem Ausland in einen Dialog. Manchmal beziehen sich die entstandenen Texte aufeinander, manchmal stehen sie unabhängig nebeneinander. Die Ausdrucksformen sind vielfältig: Literarische Prosa ist ebenso vertreten wie Essays, fiktive Korrespondenzen oder eine Flaschenpost. Dystopische und utopische Ansätze werden verwoben, manches erinnert an klassische Science-Fiction.
Die geschriebene Zukunft kann zum Denken anregen, zum Lachen bringen, aber auch erschrecken und sich einem leichten Zugang verschließen. Allen Texten gemein ist, dass sie das Bewusstsein schärfen, die Diskussion über mögliche Lösungsansätze für die anstehenden globalen Probleme anfeuern und aus einer künstlerischen Perspektive die gemeinsame Reflektion über unsere Zukunft stimulieren.
Olja Alvir und der französisch/deutsche Autor Léonce W. Lupette erforschen in ihrem gemeinsamen Text „Alles ist durchdrungen“, wie eine Sprache aussieht, die von Künstlicher Intelligenz fragmentiert und neu zusammengesetzt wird, als Zwischenstufe einer unaufhaltsam fortschreitenden Durchdringung von Mensch, Natur und Technologie.
In Anna Baars „Gut genug” geht es um die Frage, wonach zu streben es sich lohnt, wobei weniger eine ideale als vielmehr die bestmögliche Welt im Fokus steht. Ihr slowenischer Kollege Aleš Šteger tritt in seiner Arbeit „Gespräch im Kaffeehaus“ in einen Dialog mit einer Künstlichen Intelligenz und geht der spannenden Frage nach, wie es gelingen kann, die sprachliche Differenz zwischen Mensch und Maschine herauszuarbeiten.
Mascha Dabić kreiert in „TALENT“ ein Szenario, in dem ein weltumspannendes Computernetzwerk den Menschen versklavt. Die Kroatin Katja Grcić lotet, ausgehend von ökofeministischen Ideen, in ihrem essayistischen, dual angelegten Beitrag „PARADIES_ HÖLLE“ aus, mit welchen Lebensmodellen der Mensch mit der Natur koexistieren kann und ob sich Menschenwürde im kapitalistischen System verwirklichen lässt.
Die tschechische Autorin Radka Denemarková und die Österreicherin Olga Flor verhandeln in ihrem gemeinsamen Projekt „Kauderwelsch Intelligence“ politisch relevante Zukunftsthemen, wobei die Bedeutung des kritischen Diskurses zur Erhaltung der Demokratie, die Befürchtungen und Hoffnungen für die Zukunft und der ethische Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt stehen.
Walter Fanta hat sich mit dem kroatischen Übersetzer und Autor Andy Jelčić für ein Schreibprojekt zusammengetan, das den Anspruch erhebt, jeweils eine literarische Paraphrase auf Robert Musils Verständnis der „Dummheit“ zu erarbeiten. Während es in Fantas „Nichts über Dummheit“ um Künstliche Intelligenz und u. a. die Entwicklung eines Kunstmenschen geht, stellt Jelčić unter dem Titel „Natürliche Intelligenz trifft auf künstliche Blödheit“ die natürliche Intelligenz der Künstlichen Intelligenz gegenüber und spekuliert, in welche Richtung sich die Welt entwickeln könnte.
Friederike Gösweiner verfasst mit „Defining nature’s dignity. Abschrift einer Flaschenpost“ vor dem Hintergrund eines Prozesses gegen eine Umweltaktivistin eine digitale Flaschenpost, die sie als letzten, einzig möglichen Hilferuf verstanden wissen will, die Würde der Natur als ebenso schützenswert anzuerkennen wie die Würde des Menschen. Im Zentrum der Kurzprosa der kroatischen Autorin Luiza Bouharaoua „Melodien eines Instruments“ steht die für die Betroffenen tödliche Form der Immigration, die gleichzeitig mit dem Massentourismus an den europäischen Küsten einhergeht.
Andrea Grill tritt in einen Dialog mit ihrer albanischen Kollegin Albana Shala. Beide machen sich auf die Suche nach den Hoffnungsquellen für eine lebenswerte Zukunft. In „Die DNA der Würde (Eine Utopie)“ imaginiert Grill das Erwachsenenleben eines heutigen Kindes im Jahr 2040. Sie entwirft ein positives Bild vom zukünftigen Zusammenleben des Menschen in Harmonie mit seinen Mitmenschen und der Natur, das sie der menschenverursachten, fortschreitenden Zerstörung unseres Planeten entgegenhält. Den gleichen Ton schlägt Shala an, die mit „Briefe aus der Zukunft“ die Korrespondenz einer Großmutter mit ihrer fiktiven Enkelin vorlegt; darin spielen Themen wie Recht auf Bildung, Aufhebung sozialer Ungerechtigkeit, Demokratie und religiöse Toleranz eine zentrale Rolle.
Elisabeth Klar und der iranische Übersetzer und Autor Mahmoud Hosseini Zad haben es sich zur Aufgabe gemacht, darüber nachzudenken, wie ein „optimistisches Spekulieren über die Zukunft“ und die Rolle der Künstlichen Intelligenz aussehen könnten und dafür zwei unterschiedliche Perspektiven entworfen. Klar hinterfragt in ihrem Essay „In Unruhe tanzen“, explizit angelehnt an die kritischen, posthumanistischen Thesen der kalifornischen Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway, die Relevanz der Künstlichen Intelligenz und argumentiert, dass es andere Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunftsgesellschaft brauche. In seinem Beitrag „Aus einer anderen Welt komme ich“ beschäftigt sich Zad auch mit den positiven Möglichkeiten technologischer Entwicklungen und richtet einen optimistischen Blick in die Zukunft.
Von der in Österreich tätigen ukrainischen Autorin Tanja Maljartschuk stammt der Text „Zukunftsunterricht für Fortgeschrittene“. Zusammen mit der ukrainischen Menschenrechtsaktivistin Laryssa Denyssenko und deren Beitrag „Bäume pflanzen in der Wüste“ macht sie darauf aufmerksam, dass Themen wie Umwelt- und Artenschutz, aber auch Fragen um Künstliche Intelligenz in Zeiten des Krieges, wenn Raketen in Sekundenschnelle ein Haus zerstören oder eine immense Umweltkatastrophe auslösen können, zweitrangig werden. Aus der ukrainischen Perspektive ist die Zukunft nur eine Illusion, sie findet JETZT statt.
Einen gemeinsam verfassten Dialog in Briefform legen I.V.Nuss (Deutschland) und Christina Maria Landerl unter dem Titel „Please don’t hesitate to contact me oder: GESPRÄCH MIT TOTEN FRIENDS“ vor. Ausgehend von ihren eigenen, im Jahr 2040 dann 46- bzw.61-jährigen Ichs, malen sie ein tristes, dystopisches Bild der Zukunft, in der nur Freundschaft und Zusammenhalt Hoffnung bieten können.
Carolina Schutti tut sich mit der mosambikanischen Autorin Virgília Ferrão zusammen, wodurch eine europäische und eine afrikanische Sichtweise miteinander verbunden werden. In beiden Texten, in denen das Wasser eine Schlüsselrolle spielt, werden Frauen in einer krisenhaften Situation gezeigt. Während Schutti mit ihrem Beitrag „Alma” Künstliche Intelligenz positiv interpretiert, indem diese, verantwortungsvoll eingesetzt, zum Hoffnungsträger wird, kippt die Handlung in Ferrãos Text „Das Loch“ ins Dystopische.
Den Schnittpunkt zwischen Michael Stavarič und seiner Projektpartnerin, der serbischen Poetin Radmila Petrović, bildet die Stadt Wien. Stavarič entwirft in „Wien 2040“ ein utopisches Zukunftsszenario, spart allerdings auch die negativen Folgen des Klimawandels nicht aus, wenn etwa Feuerameisen die Stadt überrennen. Petrovič lässt in ihrem Text „Meine einzige würdige Zukunft, Du“ ihre Protagonistinnen auf der Suche nach Akzeptanz für ihre Beziehung von Belgrad nach Wien ziehen.
Mit dem gemeinsamen Titel „Was wir nicht über Vögel wissen“ nähern sich Andreas Unterweger und seine aus Belarus stammende Kollegin Volha Hapeyeva dem Thema von zwei verschiedenen Seiten und reflektieren über Sprache und Natur. Unterweger beschreibt das Fehlen einer adäquaten Sprache für die Natur. Diese spezielle Form des Analphabetismus könne, auf die Jugend bezogen, als bewusste Verweigerung verstanden werden, da diese begriffen habe, dass der Mensch ohnehin bereits zu viel in die Natur eingegriffen habe. Im Zentrum von Hapeyevas Auseinandersetzung steht die Frage, wie die Sprache mit Pflanzen und Tieren umgehe. Die Autorin konstatiert – und kritisiert – dabei einen katastrophalen die Natur überwältigenden Anthropozentrismus der Sprache.
Die Frage, wie Tiere auf die klimatischen Veränderungen reagieren, beschäftigt den norwegischen Übersetzer und Autor Arild Vange und Anna Kim, die die Welt aus der Perspektive zweier Gewinner des Klimawandels skizzieren. Vange schreibt in seinem Beitrag „Warten im Garten. Vanessa“ von einem Schmetterling, der sich von Griechenland nach Norwegen bewegt hat; Anna Kim in „Warten im Garten. Leonardo“ von einer Bernstein-Waldschabe, die ebenfalls in den Norden emigriert ist und den Wandel von einer Land- zu einer Stadtschabe durchmacht.
Weitere Informationen, Fotos und Materialien zu allen Projekten finden sich auf der Website www.literaturdialoge.at. Zudem haben Nicole Kiefer und Ines Scholz spannende Gespräche mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt, die im Podcast „Internationale Literaturdialoge“ nachzuhören sind.
Elke Atzler & Manfred Müller
Anna BaarGut genug
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
(John Lennon, Imagine)
Ein Mensch auf dem Weg nach Haus. Er ist weit gegangen, über den Stadtrand hinaus, ziellos, ohne Ehrgeiz. Es dunkelt, die Luft wird schärfer, große Flocken schaukeln Federn gleich zu Boden. Noch zwei-, dreihundert Meter bis zu seiner Gasse. Der Mensch ist übernächtig, aber einverstanden mit den Gegebenheiten. Er lauscht der Winterstille, dem leisen Schaben, Knacken, dem fernen Trambahnquietschen, dem Knirschen von Neuschnee unter rutschfesten Gummisohlen. Tags zuvor das Fest, das immer kürzere Zeitmaß bis zum Glockenläuten, wieder und wieder gezählt: Stunden, Minuten, Sekunden. Endlich zwanzigvierzig. Sekt aus der kleinen Reserve, der Tanz zum Mitternachtswalzer bei geöffneten Fenstern, bis Max so schwindlig wurde, dass Henry ihn stützen musste. Eine gelungene Nacht. Man wünschte einander Gesundheit und ein langes Leben.
Der Mensch auf dem Heimweg heißt zum Beispiel Jan Morewski, wird demnächst achtundsechzig, ist überwiegend heiter, seit drei Jahren in Pension und meist bei guter Gesundheit. Max und Henry, seine Freunde und Mitbewohner, sind zehn und zwölf Jahre älter. Wahrscheinlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Durchschnittslebenserwartung: Der naheliegenden Aussicht, die beiden zu überleben, nein, sie zu überdauern, kann der Liebende wenig abgewinnen. Er tröstet sich damit, dass das Los entscheidet.
Morewski grübelt nicht. Er weiß sich inzwischen zu helfen, wenn ihn die Schwermut anschleicht, lenkt die Gedanken zum Guten, erinnert sich an Schönes, schaut sich um und schmiedet immer neue Pläne. Seine Neujahrsvorsätze kreisen längst nicht mehr um die Überwindung von Lüsten oder Süchten – die meisten sind überwunden –, sondern um Besorgungen: Mehr Zeit mit den Enkeln verbringen, seinen Ehrenämtern noch sorgsamer nachgehen, gute Bücher lesen, im März das Frühbeet bestellen, kurz, das für morgen Erhoffte schon heute in Angriff nehmen. Die Welt ist erwiesenermaßen kein zugiges Wartezimmer, in dem man des Glückes harrt, als sei es ein freundlicher Zufall. Ja, so denkt Morewski.
Jetzt denkt er an den Fund beim gestrigen Waldspaziergang. Ein grellgelbes Plastikhütchen, wohl die Kuppe einer Feuerwerksrakete. Wie lange hätte der unverrottbare Pilz zwischen Laub und Moos auf seinen Finder gewartet, wäre Morewski nicht ins Unterholz abgebogen, um einen Ast zu brechen? Wer hätte ihn entdeckt? Ein Waldarbeiter vielleicht oder spielende Kinder?
Morewski behielt das Relikt als Erinnerungszeichen. Ob es als Glücksbringer taugte?
Wann war der Silvesterbrauch, Raketen abzufeuern, aufgegeben worden? Die Zeiten, da Krachmacherei zulasten von Mitgeschöpfen als Ausdruck der Freude durchging, scheinen in weiter Ferne und doch zum Greifen nahe. Sein Fund gab am gestrigen Abend den Anstoß für manche Rückschau auf etwas verhallt Geglaubtes, das aus sicherer Entfernung nachzuklingen anhob, aus staubigen Vokabeln – Pandemie, Vielfachkrise, KI, Klimawandel ... Die Freunde riefen sich die Misstöne ins Gedächtnis, die damals überwogen, und stimmten überein: Die Menschheit schien überfordert, die Gesellschaft uneins, misstrauisch gegen die politischen Eliten und die sie stützenden Interessengruppen.
Morewski erzählte den Freunden von einem Schreibwettbewerb kurz nach den großen Lockdowns. Zur Teilnahme habe ihn die Fragestellung gereizt, nicht etwa die Lust am Schreiben, das war nie seine Stärke. Wie lautete die Frage? „In welcher Welt wollen wir 2040 leben?“! Er habe sich gleich gefragt, wie einer erraten sollte, was gleich wer in mehr als zehn Jahren wollte, welches Wir gemeint war und ob er diesem Wir überhaupt angehörte. Das Wir da hatte den Anschein weltumfassender Geltung, absolut, unumstößlich, möglicherweise ein Pluralis Majestatis, der es ihm erlaubte, sein persönliches Wollen als allgemein zu behaupten, oder eine Art Krankenschwesternplural, herablassend, übergriffig – na, wie geht es uns heute? Und in welcher Welt wollen wir morgen leben? In der Welt von gestern oder gar auf einem anderen Planeten?
Ob sich sein eigenes Wollen mit dem der leichthin benannten unbekannten Größe halbwegs vereinbaren ließe? Wire gab es ja in unüberblickbarer Anzahl in den 20er-Jahren, und einem jeden ging es um einen eigenen Vorteil, oft auf Kosten anderer, deren Belange man leichthin geringer schätzte oder moralisch verdammte, um eigene Interessen bedenkenlos durchzusetzen. Zwar redeten alle von Gleichheit, Freiheit, Wohlstand, Frieden und so fort und so weiter, aber sobald es daran ging, all das gerecht zu verteilen, was jeder für sich verlangte, regte sich Widerstand bei den Privilegierten. Schon der Gedanke daran, ein bisheriges Vorrecht ersatzlos aufzugeben, schien ihnen unerträglich. Die Geprellten aber dachten nicht länger daran, Nachteile hinzunehmen und das Herrschaftssystem stillschweigend mitzutragen. Sie forderten immer lauter und angriffslustiger ein, was ihnen vermeintlich zustand. So trachteten alle Wire, die eigene Vision einer besseren Welt halsstarrig durchzusetzen, koste es, was es wolle. Die einen klebten sich zur Rushhour auf die Straßen, die anderen protestierten gegen Tempo 100 auf den Autobahnen. Und dass die einen von der „Festung Europa“ träumten, in der sich die Eingeborenen unberührt vom Kreuz der Zweiten und Dritten Welt gemütlich verschanzen konnten, ließ andere umso lauter für offene Grenzen trommeln. Die Mitte kam abhanden, die Vernunft, der Zweifel, der Wille zum Einvernehmen. Selbst Sprache wurde zum Streitfall im strengen Entweder-oder. Je präziser die Wörter, die man an die Stelle einstiger Spottnamen setzte, desto roher klang zwischen den Zeilen an, was die Wohlgesinnten abzustellen vermeinten. Der Hass, zuvor gebannt in schlüpfriger Spöttelei, trat nun offen zutage, befeuert durch heillosen Trotz, denn Takt und Zartgefühl wurden nicht beworben, sondern eingeklagt und rigoros verordnet, und jeder fromme Wunsch wurde zur Kampfansage, wo der Unlenksame damit zu rechnen hatte, um die Ehre gebracht und abgekanzelt zu werden. Man forderte Anteilnahme, ohne den Teilnahmslosen Anteile einzuräumen, da, so die Erzählung, ausschließlich Betroffene ein Unrecht ermessen und davon berichten könnten. So schrien alle Wire ungehört durcheinander, fuhren sich über die Münder, schnitten einander das Wort ab, ohne Acht zu geben, ob darin vielleicht ein Funken Wahrheit läge.
Alles schien festgefahren in einem endlosen Machtkampf – Morewski, Max und Henry waren sich darin einig, im Wissen, dass jeder von ihnen auf die Wettbewerbsfrage, in welcher Welt ein nicht näher bezeichnetes „Wir“ morgen zu leben gedächte, eigene Antworten hatte.
„Was hast du damals geschrieben?“, wollte Henry wissen.
Morewski kramte in einer Schreibtischlade, fand seinen Wettbewerbsbeitrag, und machte sich gleich daran, daraus vorzulesen: „Es scheint kein Wir zu geben, auf das man sich einigen will, kein solidarisches Wollen, das die Welt von morgen zum Guten wenden könnte.“ Die Zeilen waren durchgestrichen. Mit so einem Einleitungssatz, meinte Morewski erklärend, wäre der Wettbewerb nicht zu gewinnen gewesen. Wieder begann er zu lesen, und diesmal eine Suada gefälliger Hypothesen:
„Wir werden 2040 in einer Welt leben wollen, in der wir freien Zugang zu Bildungseinrichtungen haben, zu wertvollen Lebensmitteln, Trinkwasser, Heilverfahren und Freizeitangeboten. Wir wollen eine Welt der zivilisierten Völker und echten Demokraten, die keine Gewaltherrschaft der Mehrheit im Schilde führen, sondern die Interessen aller im Blick behalten, wünschen uns Zeitgenossen, die unsere Vertreter nicht aus Besorgtheit wählen oder um Rache zu üben, sondern von Wohlwollen geleitet. Der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Andersseins wäre 2040 endlich Einhalt geboten, ohne das Anderssein mutwillig totzuschweigen und damit erst recht zu etwas Unsäglichem zu stempeln. Die Leute hätten begriffen, dass, was man gemeinhin Glück nennt, auf Gerechtigkeit baut, nicht auf dem Rücken anderer. Die Produktion von Unsinn und Geiz-ist-geil-Konsumismus wäre unterbunden. Die Furcht vor künstlichen





























