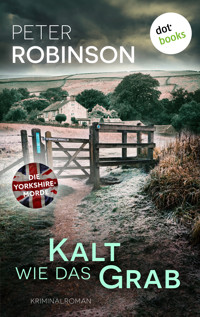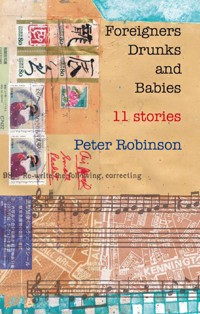Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Yorkshire-Morde
- Sprache: Deutsch
Ihr Schicksal scheint längst vergessen – doch Inspector Banks stellt sich den Dämonen der Vergangenheit … Eine Hitzewelle bringt die Yorkshire Dales zum Kochen und legt die Überreste von Hobb's End frei – eine verlassene Kleinstadt, die vor langer Zeit einem Stausee weichen musste. Doch nicht nur die Ruinen der Stadt kommen ans Licht, sondern auch das Skelett einer Frau, das dort seit den 1940er- Jahren unter den Dielen eines Hauses versteckt liegt. Inspector Alan Banks steht vor der unmöglichen Aufgabe in einem Dorf zu ermitteln, das bereits vor Jahrzehnten ausgestorben ist – die ehemaligen Bewohner tot und ihre Vergangenheit längst vergessen … »Geschichtenerzähler graben immer die Vergangenheit aus, doch nur wenige bringen dieser melancholischen Aufgabe die exquisite Feinheit entgegen, die Peter Robinson in seinem neuen Ermittlerkrimi erreicht hat.« The New York Times Ausgezeichnet mit dem Anthony Award – Band 10 der erfolgreichen Krimi-Reihe um Inspector Banks, in der jeder Titel unabhängig gelesen werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Hitzewelle bringt die Yorkshire Dales zum Kochen und legt die Überreste von Hobb's End frei – eine verlassene Kleinstadt, die vor langer Zeit einem Stausee weichen musste. Doch nicht nur die Ruinen der Stadt kommen ans Licht, sondern auch das Skelett einer Frau, das dort seit den 1940er- Jahren unter den Dielen eines Hauses versteckt liegt. Inspector Alan Banks steht vor der unmöglichen Aufgabe in einem Dorf zu ermitteln, das bereits vor Jahrzehnten ausgestorben ist – die ehemaligen Bewohner tot und ihre Vergangenheit längst vergessen …
Über den Autor:
Peter Robinson (1950-2022) wurde in Yorkshire geboren und lebte nach seinem Studium der englischen Literatur in Toronto, Kanada. Er wurde für seine Werke mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Edgar Allan Poe Award. Seine Bestseller-Reihe um Inspector Alan Banks feierte internationale Erfolge und wurde auch als Fernsehserie adaptiert.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor die »Yorkshire-Morde«-Reihe um Detective Chief Inspector Banks. Band 1 »Augen im Dunkeln« ist auch als Hörbuch bei AUDIOBUCH erhältlich.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »In a dry Season« bei Avon Books, New York.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1999 Eastvale Enterprises Inc.
Published by arrangement with Peter Robinson
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München/Ullstein Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-752-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Robinson
In einem heißen Sommer
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Andrea Fischer
dotbooks.
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Danksagung
Lesetipps
Widmung
Für Dad und Averil,
Elaine und Mick,
und für Adam und Nicola
Motto
Die Vergangenheit ist ein fremdes Land;
dort gelten andere Gesetze.
– L. P. HARTLEY, Der Zoll des Glücks
Prolog
August 1967
Es war der Summer of Love. Ich hatte gerade meinen Mann unter die Erde gebracht, als ich zum ersten Mal zurück zu dem Stausee fuhr, der das Dorf meiner Kindheit überflutet hatte.
Ich unternahm diese Fahrt nur wenige Monate, nachdem Ronald und ich von einem unserer häufigen langen Auslandsaufenthalte zurückgekehrt waren, die mir viele Jahre gut gefallen hatten. Auch Ronald hatte mir gut gefallen. Er war ein anständiger Kerl und ein guter Ehemann, gewillt zu akzeptieren, dass unsere Ehe aus Bequemlichkeit geschlossen worden war. Ich glaube, er sah in mir einen Pluspunkt für seine Karriere als Diplomat, obwohl es sicherlich weder blendende Schönheit noch funkelnder Verstand war, die ihn für mich einnahmen. Doch ich war vorzeigbar und intelligent, überdies konnte ich ausnehmend gut tanzen.
Wie auch immer – bald ging mir die Rolle der Gattin eines rangniederen Diplomaten in Fleisch und Blut über. Sie schien mir ein geringer Preis zu sein. In gewisser Weise war ich für Ronald der Schlüssel zu beruflichem Erfolg und Aufstieg und er ermöglichte mir – obwohl er es nicht wusste – Flucht und Abstand. Ich heiratete ihn, weil ich wusste, dass wir weit weg von England leben würden, und ich wollte so weit weg wie möglich von England sein. Jetzt, nach mehr als zehn Jahren im Ausland, ist das nicht mehr so wichtig. Es reicht mir nun, den Rest meiner Tage in der Wohnung in Belsize Park zu verbringen. Außerdem hinterließ mir Ronald, der immer klug investiert hatte, eine ansehnliche Geldsumme. Auf jeden Fall genug, um die nächsten Jahre ein sicheres Auskommen zu haben und mir einen neuen Sportwagen von Triumph zu leisten. Einen roten. Mit Radio.
Und so sang ich zu »All You Need is Love«, »Itchycoo Park« und »See Emily Play«, lauschte den vereinzelten Kurznachrichten über den Mord an Joe Orton und die Schließung der Piratensender vor der Küste, als ich zum ersten Mal nach über zwanzig Jahren zurück nach Hobb’s End fuhr. Aus unerklärlichem Grund gefiel mir die rohe, schlichte, sentimentale neue Musik, die die jungen Leute jetzt hörten, obwohl ich Anfang vierzig war. Wenn ich ihr lauschte, sehnte ich mich danach, wieder jung zu sein: jung, doch ohne die Erschwernisse meiner eigenen Jugend; jung, doch ohne den Krieg; jung, doch ohne den Kummer; jung, doch ohne Schrecken und Blut.
Nachdem ich vor Skipton die Hauptstraße verlassen hatte, sah ich kein anderes Auto mehr. Es war ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch: Die Luft roch süß nach geschnittenem Gras und Wildblumen. Ich bildete mir ein, sogar die warmen Ausdünstungen der Trockenmauern riechen zu können. Wie geschliffene Granate glänzten die Beeren an den Ebereschen. Über den Wiesen stiegen Kiebitze auf und ließen sich von der Luft tragen, Schafe blökten kläglich in den fernen Tälern. Die Farben waren so kräftig – das Grün grüner als je zuvor, das Blau des Himmels wolkenlos und strahlend klar.
Nicht weit hinter Grassington verfuhr ich mich. Ich hielt an und erkundigte mich bei zwei Männern, die eine Trockenmauer reparierten. Seit langer Zeit hatte ich den typischen breiten Dialekt der Yorkshire Dales nicht mehr gehört, so dass er zunächst fremd in meinen Ohren klang. Schließlich verstand ich sie jedoch, bedankte mich und fuhr weiter. Sicherlich zerbrachen sich die beiden den Kopf über die seltsame Dame mittleren Alters mit der Sonnenbrille, der Popmusik und dem schnittigen roten Sportwagen.
Die alte Straße endete am Waldrand, so dass ich aussteigen und den Rest des Weges zu Fuß über einen gewundenen Trampelpfad zurücklegen musste. Wolken von Mücken summten über mir, Zaunkönige raschelten im Unterholz und Blaumeisen hüpften von Zweig zu Zweig.
Dann lag der Wald hinter mir und ich stand am Ufer des Stausees. Mein Herz begann zu klopfen, ich musste mich gegen einen Baum lehnen. Die Borke fühlte sich rau an. Mein heißer Kopf und die kribbelnden Finger ließen mich kurz befürchten, ich würde ohnmächtig werden. Aber das Gefühl ging vorüber.
Natürlich hatte es hier auch früher schon Bäume gegeben, aber nicht so viele, und die meisten hatten nördlich des Dorfes im Wald von Rowan Woods gestanden. Als ich hier gelebt hatte, war Hobb’s End ein Dorf in einem Tal gewesen. Jetzt blickte ich auf einen waldgesäumten See.
Die vollkommen bewegungslose Wasseroberfläche spiegelte die Bäume und von Zeit zu Zeit eine vorbeifliegende Möwe oder Schwalbe. Rechts von mir konnte ich den kleinen Damm erkennen, hinter dem sich der Fluss bei der Einmündung in den Harksmere-Stausee verjüngte. Verwirrt und meiner Gefühle unsicher, setzte ich mich ans Ufer und betrachtete die Umgebung.
Wo ich saß, hatte früher die alte Eisenbahnlinie entlanggeführt, der Zug, mit dem ich während meiner Kindheit so oft gefahren war. Die einspurige Trasse nach Harrogate war für uns während des Krieges die einzig wirkliche Verbindung zur Welt jenseits der Grenzen von Hobb’s End gewesen. Natürlich hatte der Verkehrsminister sie vor drei, vier Jahren stilllegen lassen, die Schienen waren bereits mit Unkraut überwachsen. Die Gemeinde hatte an der Stelle, wo früher der Bahnhof gewesen war, Trauerweiden gepflanzt. Oft hatte ich dort bei Mrs. Shipley eine Fahrkarte gekauft und auf dem Bahnsteig mit wachsender Unruhe auf das ferne Stampfen und Pfeifen der alten Dampflok gewartet.
Die Zeit verging, während ich so dasaß und in Erinnerungen schwelgte. Ich war erst spät aufgebrochen, die Strecke von London hierher hatte sich hingezogen. Bald breitete sich im Wald um mich herum die Dunkelheit aus und machte sich zwischen den Zweigen und in der Stille zwischen den Rufen der Vögel breit. Eine wispernde Brise kam auf. Das schwindende Licht fiel schräg aufs Wasser, so dass die leicht aufgeraute Oberfläche aussah, als sei sie mit rosafarbenem Puder bestäubt. Langsam verdunkelte sich auch der See und nahm ein tiefes Tintenblau an.
Dann ging der Vollmond auf und verstreute sein knochenweißes Licht. Ich stellte mir vor, in seinem Schein das Dorf, das früher einmal gewesen war, im Wasser zu sehen, als sei es ein im Wasserglas bewahrtes Bild. Da lag es, das Dorf, ausgebreitet unter mir, glitzerte und schimmerte dunkel unter der kaum wahrnehmbar gekräuselten Oberfläche.
Beim Betrachten bekam ich das Gefühl, als bräuchte ich nur die Hand auszustrecken, um das Bild berühren zu können. Wie die Welt hinter dem Spiegel in Cocteaus Orpheus. Wenn man die Hand ausstreckt und das Glas berührt, wird es zu Wasser und gibt den Weg frei in die Unterwelt.
Was ich sah, war die Vision des Dorfes, so wie es gewesen war, als ich dort lebte: Rauchfahnen aus Schornsteinen auf Schiefer- und Steindächern, die dunkle Mühle auf dem kleinen Hügel im Westen, der gedrungene Kirchturm, die gewundene High Street neben dem schmalen Fluss. Je länger ich aufs Wasser blickte, desto mehr hatte ich den Eindruck, ich könnte die Menschen ihren täglichen Verrichtungen nachgehen sehen: einkaufen, ausliefern, tratschen. In meiner Vision konnte ich sogar unseren kleinen Laden erkennen, wo sie mir an jenem stürmischen Frühlingstag 1941 zum ersten Mal begegnete. Der Tag, an dem alles begann.
Kapitel 1
Adam Kelly spielte gern in verlassenen Häusern, er liebte den modrigen Geruch der alten Zimmer, das Ächzen und Stöhnen, wenn er darin umherlief, das durch die Dachbalken fallende Sonnenlicht, das gestreifte Schatten auf die Wände warf. Er fand es herrlich, über die fehlenden Treppenstufen zu springen, das Herz schlug ihm bis zum Hals, wenn er von Sparren zu Sparren hüpfte, Gipsstaub aufwirbelte und zusah, wie die Staubpartikel im gefilterten Licht tanzten.
An diesem Nachmittag hatte Adam ein ganzes Dorf zum Spielen.
Er stand am Rand eines flachen Tales, blickte auf die Ruinen hinunter und freute sich auf das bevorstehende Abenteuer. Dies war der Tag, auf den er gewartet hatte. Vielleicht eine Gelegenheit, die sich nur einmal im Leben bot. Dort unten war alles möglich. Heute hing die Zukunft des Universums von Adam ab; das Dorf war ein Test, eine Herausforderung, die er bestehen musste, bevor er zur Stufe 7 vorrücken konnte.
Die einzigen Menschen, die zu sehen waren, standen am hinteren Ende bei der alten Flachsmühle: ein Mann in Jeans und rotem T-Shirt und eine ganz in weiß gekleidete Frau. Sie taten, als seien sie Touristen, hielten ihre Videokamera in alle möglichen Richtungen, aber Adam argwöhnte, sie könnten die gleiche Absicht haben wie er. Er hatte das Spiel schon oft genug auf dem Computer gespielt, er wusste, Tarnung war alles und nichts war das, was es vorgab zu sein. Der Himmel steh uns bei, dachte er, wenn sie es vor mir schaffen.
Halb rutschte, halb lief er die morastige Böschung hinunter und kam unten auf der roten, ausgebrannten Erde schlitternd zum Stehen. Es gab noch immer viele sumpfige Stellen; er vermutete, dass das ganze Wasser nicht innerhalb weniger Wochen gänzlich verdunsten konnte.
Adam hielt inne und lauschte. Selbst die Vögel schwiegen. Die Sonne brannte vom Himmel und er schwitzte hinter den Ohren, im Nacken und in der Poritze. Seine Brille rutschte ihm immer wieder von der Nase. Die dunklen, verfallenen Cottages flimmerten in der Hitze wie die Wand neben dem Ofen eines Schmiedes.
Jetzt war alles möglich. Irgendwo war der Talisman versteckt, und Adam hatte die Aufgabe, ihn zu finden. Aber wo sollte er beginnen? Er wusste noch nicht einmal, wie er aussah, doch würde er es wissen, wenn er ihn gefunden hatte, und irgendwo musste ein Hinweis sein.
Er überquerte die alte Steinbrücke und betrat eines der halbzerstörten Cottages. Er spürte die feuchte, kühle Dunkelheit, die ihn wie ein Mantel umhüllte. Es roch wie in einer kaputten Toilette oder als hätte sich ein riesiger Alien zum Sterben in einen heißen, stinkenden Sumpf gelegt.
Schräg fiel die Sonne durch das Loch, an dessen Stelle vorher das Dach gewesen war, und beleuchtete die hintere Wand. Die dunklen Steine sahen so glitschig und schmierig aus wie Öl. An manchen Stellen hatten sich die schweren Steinplatten, die den Boden bedeckten, verschoben und waren gesprungen. Schwerer Lehm quoll aus den Furchen. Einige Platten wackelten, als Adam sie mit seinem Gewicht belastete. Er fühlte sich, als schwebe er auf Treibsand und würde jeden Moment ins Herz der Erde gesaugt, sobald er eine falsche Bewegung machte.
In diesem Haus war nichts. Also weiter.
Draußen war noch immer niemand zu sehen. Die beiden Touristen waren offenbar gegangen oder sie hatten sich versteckt und lauerten ihm hinter der Mühlenruine auf.
In der Nähe der Brücke entdeckte Adam ein kleines Nebengebäude, eine Art Steinschuppen, wie er vielleicht einmal benutzt worden war, um Kohle zu lagern oder Lebensmittel kühl zu halten. Er hatte von der alten Zeit gehört, als es noch keine elektrische Heizung und Kühlschränke gab. Vielleicht war es sogar eine Toilette gewesen. Schwer zu glauben, aber er wusste, dass man früher nach draußen aufs Klo hatte gehen müssen, selbst im Winter.
Was es auch gewesen war, die Zerstörer hatten den Schuppen ziemlich intakt gelassen. Das Gebäude war ungefähr zwei Meter hoch, hatte ein unbeschädigtes schräges Dach aus Steinplatten und schien ihn herbeizuwinken, schien eingenommen werden zu wollen. Endlich hatte er einen Bau gefunden, auf den er zwecks besserer Sicht klettern konnte. Wenn sich die Möchtegern-Touristen irgendwo versteckten, würde er sie von oben entdecken.
Adam ging um den Schuppen herum und registrierte erfreut, dass auf einer Seite mehrere Steine ein wenig hervorstanden, so wie Stufen. Vorsichtig verlagerte er sein Gewicht auf den ersten Stein. Er war glatt, doch er hielt. Adam begann zu klettern. Die Stufen kamen ihm ziemlich sicher vor, und schon war er oben.
Er hievte sich auf das Dach. Es hatte nur ein leichtes Gefälle, so dass er sich problemlos bewegen konnte. Zuerst stand er am Rand, legte die Hand über die Augen, um sie vor der grellen Sonne zu schützen, und blickte in alle Richtungen.
Im Westen erhob sich die Flachsmühle, die Unbekannten waren nicht mehr zu sehen. Im Norden und Süden bedeckte Wald das Land; durch das dichte grüne Blätterwerk ließ sich so gut wie nichts erkennen. Im Osten lag der tränenförmige Umriss des Stausees von Harksmere. Auf The Edge, einer Straße am Südrand des Sees, blitzten ein paar Windschutzscheiben in der Sonne. Davon abgesehen, bewegte sich fast überhaupt nichts, kaum ein Blatt zitterte.
Zufrieden, dass er nicht beobachtet wurde, setzte er den nächsten Fuß aufs Dach. Es war nicht breiter als einen Meter zwanzig, einen Meter fünfzig, aber als er in der Mitte stand, spürte er ein schwaches Zittern, und bevor er den kurzen Weg zur anderen Seite zurücklegen konnte, gaben die dicken Steinplatten unter ihm nach. Einen Moment lang hing er in der Luft, als wolle er für immer dort schweben. Er streckte die Arme aus und bewegte sie auf und nieder, als wären es Flügel, doch es half nichts. Mit einem Schrei stürzte er in die Dunkelheit.
Er landete mit dem Rücken auf einem Polster aus Schlamm; das linke Handgelenk stieß gegen eine heruntergefallene Steinplatte, und sein rechter Arm, den er zum Abbremsen ausgestreckt hatte, versank bis zum Ellenbogen im Morast.
Atemlos lag er da und blickte zu dem Viereck blauen Himmels hinauf. Plötzlich merkte er, dass sich zwei der auf dem Dach verbliebenden Platten neigten. Jede war ungefähr einen Quadratmeter groß und fünfzehn Zentimeter dick. Trafen sie ihn, würden sie ihn zu Brei quetschen. Aber er konnte sich nicht bewegen; er fühlte sich gefangen und starrte gebannt auf die herabfallenden Platten.
Sie schienen in Zeitlupe zu fallen, wie Herbstlaub an einem windstillen Tag. Sein Kopf war vollkommen leer. Er spürte keine Panik, keine Angst, nur so etwas wie Ergebenheit, als wäre er in seinem kurzen Leben an einem Wendepunkt angekommen, als läge es jetzt nicht mehr in seiner Hand. Er hätte es nicht erklären können, selbst wenn er es versucht hätte, aber in dem Moment, als er in seiner Wiege aus warmem Schlamm lag und die dunklen Steinplatten beobachtete, die ihm aus dem Blau des Himmels entgegenstürzten, wusste er trotz seiner Jugend, dass er nichts machen konnte, um dem auszuweichen, was das Schicksal für ihn bereithielt. Wie es auch weiterging, er konnte es nur hinnehmen.
Das muss die Stufe 7 sein, dachte er und hielt den Atem an, wartete auf den Aufprall, wartete darauf, seine Knochen brechen und knirschen zu hören.
Eine Platte fiel links von ihm herunter und blieb im Schlamm stecken, stand wie ein alter Grabstein schräg gegen die Mauer gelehnt. Die andere landete rechts von ihm und brach beim Aufprall auf eine Bodenplatte entzwei. Die eine Hälfte neigte sich ihm entgegen, streifte seinen aus dem Schlamm ragenden Oberarm und zerkratzte ihn, so dass er blutete.
Adam atmete mehrmals tief durch und sah nach oben durch das Dach in den Himmel. Keine Steine mehr. Er war also verschont geblieben; er lebte. Er fühlte sich ein wenig benommen. Ernstlich verletzt schien er nicht zu sein, dachte er, als er seine Glieder langsam bewegte. Das linke Handgelenk tat unheimlich weh, wahrscheinlich würde er dort einen riesigen blauen Fleck bekommen, doch gebrochen schien es nicht zu sein. Sein rechter Arm steckte noch immer tief im Schlamm, und die Steinplatte scheuerte an seinem aufgeschrammten Ellenbogen. Um herauszufinden, ob er seine Finger noch fühlte, versuchte er, sie im Morast zu bewegen, und stieß dabei gegen etwas Hartes.
Es fühlte sich an wie eine Ansammlung glatter, harter Spindeln oder wie ein Bündel kurzer Stöckchen. Neugierig schob er den Arm weiter nach unten und umfasste es fest, so wie er früher, als er noch sehr klein war und Angst vor den vielen Menschen hatte, in der Stadt die Hand seiner Mutter gehalten hatte. Dann verlagerte er sein Gewicht nach links und zog seine Hand mit einem Ruck heraus. Er musste die Zähne zusammenbeißen, so heftig schoss der Schmerz durch das verletzte Handgelenk.
Zentimeterweise zerrte er den Arm heraus, die Trophäe fest mit der Faust umschlossen. Der Schlamm machte saugende, schlürfende Geräusche. Endlich konnte er den Gegenstand in seiner Hand der Erde entwenden. Er stellte ihn vor die Steinplatte und schob sich rückwärts gegen die Hinterwand des Schuppens, um sein Fundstück besser betrachten zu können.
Im Dämmerlicht lehnte es an der Platte, seine Finger hakten sich über den Rand, als versuchten sie, sich selbst aus dem Grab zu ziehen. Es war das Skelett einer Hand, deren Knochen mit feuchter, dunkler Erde verkrustet waren.
Banks trat einen Schritt zurück, um seine Arbeit zu begutachten, und pfiff dabei die Habanera aus Carmen, die aus seiner Anlage dröhnte; da hatte Maria Callas ihre beste Zeit bereits hinter sich gehabt, aber sie klang trotzdem gut.
Nicht schlecht für einen Anfänger, dachte er, den Pinsel in eine Dose Terpentin tauchend, auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der schimmeligen Tapete, die er gestern von den Wänden seines neuen Hauses gerissen hatte.
Besonders gut gefiel ihm die Farbe. Der Mann im Heimwerkermarkt in Eastvale hatte gesagt, sie wirke beruhigend, und nach dem Jahr, das Banks gerade durchlitten hatte, war Beruhigung genau das Richtige für ihn. Der Blauton, den er gewählt hatte, sollte an die Farbe orientalischer Wandteppiche erinnern, doch als er die Wand damit gestrichen hatte, musste Banks eher an die griechische Insel Santorin denken, die er mit seiner von ihm getrenntlebenden Frau Sandra während ihres letzten gemeinsamen Urlaubs besucht hatte. Mit dieser Erinnerung hatte er zwar nicht gerechnet, aber er glaubte, damit leben zu können.
Zufrieden mit seiner Arbeit, zog Banks eine Packung Silk Cut aus der Tasche. Zuerst zählte er die Zigaretten. Nur drei weniger als am Morgen. Gut. Er versuchte, sich auf zehn oder weniger pro Tag zu beschränken, und das gelang ihm bisher recht gut. Er ging in die Küche und schaltete den elektrischen Wasserkessel ein.
Das Telefon klingelte. Banks stellte die Anlage ab und griff zum Hörer.
»Dad?«
»Brian, bist du’s? Ich hab schon versucht, dich zu erreichen.«
»Hm, tja ... wir sind auf Tour gewesen. Ich dachte, du wärst gar nicht da. Warum bist du nicht bei der Arbeit?«
»Wenn du gar nicht mit mir gerechnet hast, warum rufst du dann an?«
Schweigen.
»Brian? Wo bist du? Ist alles in Ordnung?«
»Ja, alles in Ordnung. Ich bin momentan bei Andrew.«
»Wo ist das?«
»In Wimbledon. Hör mal, Dad ...«
»Müssten deine Prüfungsergebnisse nicht schon raus sein?«
Wieder Schweigen. Herrgott noch mal, dachte Banks, es ist einfacher, die Wahrheit aus einem Politiker zu quetschen, als ein paar zusammenhängende Worte aus Brian herauszubekommen.
»Brian?«
»Ja, hm, deshalb rufe ich ja an. Weißt du ... eigentlich wollte ich nur eine Nachricht hinterlassen.«
»Verstehe.« Jetzt wusste Banks, was los war. Vergeblich sah er sich nach einem Aschenbecher um und benutzte dann stattdessen den Kamin. »Erzähl!«, forderte er Brian auf.
»Wegen der Prüfung, also ...«
»Wie schlimm ist es denn? Was hast du bekommen?«
»Tja, das ist es ja ... ich meine ... es wird dir nicht gefallen.«
»Du hast aber bestanden, oder?«
»Ja, klar.«
»Und?«
»Es ist nur, dass ich nicht so gut war, wie ich gedacht hatte. Es war wirklich schwer, Dad. Das sagen alle.«
»Wie hast du abgeschnitten?«
Brian flüsterte fast. »Dritter Klasse.«
»Dritter Klasse? Das ist aber eine ziemliche Enttäuschung, oder? Ich hätte gedacht, du könntest es besser.«
»Na ja, ist immerhin mehr, als du je geschafft hast.«
Banks holte tief Luft. »Das ist ja wohl scheißegal, was ich geschafft habe oder nicht! Wir sprechen hier über dich. Über deine Zukunft. Mit einem Abschluss dritter Klasse bekommst du nie und nimmer einen anständigen Job.«
»Und wenn ich gar keinen anständigen Job will?«
»Was willst du denn sonst? Dich zu den anderen Arbeitslosen stellen? Einer mehr? Noch so ’n arbeitsloser Penner?«
»Vielen Dank, Dad. Schön zu wissen, was du von mir hältst. Egal, auch wenn du’s nicht glaubst, ich leb nicht von der Stütze. Wir wollen’s mal versuchen, ich und die Band.«
»Ihr wollt was?«
»Wir wollen mal einen Versuch starten. Andrew kennt einen Typ mit so ‘nem Indie-Label, und der hat ein Studio und so, und er meint, wir können vorbeikommen und ein Demoband mit ein paar von meinen Songs aufnehmen. Auch wenn du es nicht glaubst, aber die Leute fahren auf uns ab. Wir haben so viele Gigs, dass wir kaum noch geradeaus denken können.«
»Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie schwer es ist, im Musikgeschäft Fuß zu fassen?«
»Die Spice Girls haben’s geschafft und die sind nicht gerade die begabtesten.«
»Tiny Tim hat’s auch geschafft, aber darum geht’s doch nicht. Begabung hat nichts damit zu tun. Für einen, der es schafft, bleiben Tausende auf der Strecke.«
»Wir verdienen ‘ne Menge Geld.«
»Geld ist nicht alles. Was ist mit deiner Zukunft? Was willst du machen, wenn du mit fünfundzwanzig die beste Zeit hinter dir hast, aber nichts auf der hohen Kante?«
»Wieso bist du eigentlich plötzlich ein Experte im Musikgeschäft?«
»Hast du deshalb bei der Prüfung so schlecht abgeschnitten? Weil du nichts anderes im Kopf hattest, als zu proben und auf Tour zu gehen?«
»Architektur ging mir sowieso schon lange auf die Nerven.«
Banks schnippte den Zigarettenstummel in den Kamin. Funken flogen gegen die dunkle Steinmauer. »Hast du das schon deiner Mutter erzählt?«
»Hm, ich dachte irgendwie, dass ... vielleicht ... weißt du ... dass du das machen könntest.«
Das soll wohl ein Witz sein, dachte Banks. Er sollte mit Sandra reden? Sie konnten sich momentan noch nicht einmal übers Wetter unterhalten, ohne sich zu streiten.
»Ich denke, du rufst sie besser selbst an«, sagte er. »Oder noch besser: Warum fährst du nicht bei ihr vorbei? Camden Town ist doch nicht weit.«
»Aber die geht doch an die Decke!«
»Geschieht dir recht. Daran hättest du vorher mal denken sollen.«
Der Kessel begann zu pfeifen.
»Vielen Dank auch, Dad«, sagte Brian mit scharfer, verbitterter Stimme. »Ich dachte, du würdest das verstehen. Ich dachte, ich könnte auf dich zählen. Ich dachte, du würdest Musik mögen. Aber du bist genau wie alle anderen. Los, geh zu deinem beschissenen Kessel!«
»Brian ...«
Aber Brian legte auf. Rums.
Das Blau des Wohnzimmers konnte Banks’ Stimmung nicht im Geringsten heben. Schon traurig, dachte er, wenn man Heimwerken als Therapie brauchte – Renovieren als Schutz vor der Düsternis. Kurz setzte er sich hin und starrte ein Pinselhaar an, das in der Farbe über dem Kaminsims klebte, dann stürzte er in die Küche und stellte den Kessel ab. Die Lust auf eine Tasse Tee war ihm vergangen.
»Geld ist nicht alles. Was ist mit deiner Zukunft?«Banks konnte nicht glauben, dass er das gesagt hatte. Nicht weil er der Meinung war, Geld sei alles, sondern weil es genau die Worte waren, die seine Eltern gefunden hatten, als er ihnen eröffnete, er wolle am Wochenende im Supermarkt arbeiten, um sich zusätzliches Taschengeld zu verdienen. Wie heftig und instinktgesteuert er auf Brians Mitteilung reagiert hatte, machte ihm Angst. Es war, als ob jemand anders – nämlich seine Eltern – gesprochen hatte und er nur die Puppe eines Bauchredners war. Manche behaupten, je älter man wird, desto mehr ähnelt man seinen Eltern, und Banks fragte sich langsam, ob das stimmte. Wenn ja, dann war es eine beängstigende Vorstellung.
Geld ist nicht alles, hatte sein Vater gesagt, obwohl es ihm selbst auf bestimmte Weise doch alles bedeutete, denn er hatte nie etwas besessen. Was ist mit deiner Zukunft?, hatte seine Mutter gefragt und ihm so zu verstehen gegeben, dass es wesentlich besser sei, zu Hause zu bleiben und für die Prüfungen zu büffeln, als am Wochenende Geld zu verdienen, das er sowieso nur in Billardhallen oder auf Bowlingbahnen ausgeben würde. Sie verlangten, dass er einen netten, angesehenen, sicheren Beruf am Schreibtisch ergriff, zum Beispiel bei einer Bank oder Versicherung, so wie sein älterer Bruder Roy. Mit einem guten Abschluss im Rücken könnte er sich verbessern, sagten sie und meinten damit, besser als sie leben. Er war gescheit, und diese Zukunft war in den Sechzigern für gescheite Arbeiterkinder vorgesehen.
Bevor Banks noch länger darüber grübeln konnte, klingelte das Telefon erneut. In der Hoffnung, dass es Brian sei, der sich entschuldigen wollte, lief er ins Wohnzimmer und hob ab.
Es war der Polizeipräsident, Chief Constable Jeremiah »Jimmy« Riddle. Scheinbar mein Glückstag heute, dachte Banks. Nicht nur, dass es nichtBrian war, der neue Anruf bedeutete auch, dass Banks nicht mehr die 1471 anrufen konnte, um Brians Telefonnummer in Wimbledon angesagt zu bekommen, nach der zu fragen er vergessen hatte. 1471 funktionierte nur mit dem letzten erhaltenen Anruf. Er fluchte und griff nach den Zigaretten. Wenn das so weiterging, würde er nie aufhören. Scheiß drauf. Außerordentliche Umstände erforderten außerordentliche Maßnahmen. Er zündete sich eine an.
»Drücken Sie sich mal wieder, Banks?«
»Urlaub«, erwiderte Banks. »Ganz offiziell. Können Sie nachprüfen.«
»Egal. Ich hab hier was für Sie.«
»Ich bin morgen früh wieder da.«
»Jetzt.«
Banks fragte sich, aus was für einem Grund Jimmy Riddle ihn aus dem Urlaub zurückrief. Seitdem Riddle ihn widerwillig hatte aufnehmen müssen, nachdem er ihn im Jahr zuvor voreilig vom Dienst suspendiert hatte, lag Banks Karriere auf Eis, mühte er sich mit Anzeigen, Statistiken und noch mehr Anzeigen ab. Es fehlte nur noch, dass er zur Verkehrserziehung von einer Schule zur nächsten geschickt wurde. Nicht ein einziger richtiger Fall in neun Monaten. Er war dermaßen aus dem Geschäft, er hätte genauso gut auf dem Mond sein können; selbst die wenigen Informanten, die er sich seit seiner Ankunft in Eastvale herangezogen hatte, waren ihm untreu geworden. So einfach würde sich das Blatt doch wohl nicht wenden. Da musste mehr dahinterstecken – Riddle tat nie etwas ohne einen Plan im Hinterkopf.
»Wir haben gerade einen Bericht aus Harkside bekommen«, fuhr Riddle fort. »Ein kleiner Junge hat auf dem Boden des Stausees von Thornfield ein paar Knochen gefunden. Das ist einer von den Seen, die im Laufe des Sommers ausgetrocknet sind. Ich nehme an, früher stand da mal ein Dorf. Jedenfalls gibt es in Harkside nur eine kleine Wache, und die haben nur einen Sergeant. Ich möchte, dass Sie als leitender Ermittlungsbeamter runterfahren.«
»Alte Knochen? Hat das nicht Zeit?«
»Wahrscheinlich schon. Aber mir wäre es lieber, wenn Sie sofort loslegen. Ist das ein Problem für Sie?«
»Was ist mit Harrogate oder Ripon?«
»Zu viel zu tun. Seien sie nicht so ein undankbarer Hund, Banks! Das ist die beste Gelegenheit, Ihre Karriere aus dem Loch zu holen, in das sie reingefallen ist.«
Klar, dachte Banks, man hat schon Pferde kotzen sehen. Er war in kein Loch gefallen, er war hineingestoßen worden, und wie er Jimmy Riddle kannte, würde ihn dieser Fall nur noch tiefer darin versenken. »Menschenknochen?«
»Wissen wir noch nicht. Genau genommen wissen wir bis jetzt noch gar nichts. Deshalb will ich ja, dass Sie runterfahren und es herausfinden.«
»Nach Harkside?«
»Nein, verdammt noch mal. Zum Thornfield-Stausee. Der Sergeant von Harkside ist schon am Tatort. Heißt Cabbot.«
Banks dachte nach. Was war hier los, in Teufels Namen? Riddle würde ihm mit Sicherheit keinen Gefallen tun; es musste ihn gelangweilt haben, Banks auf dem Revier einzusperren, deshalb hatte er sich eine neue interessante Möglichkeit einfallen lassen, ihn zu quälen.
Ein Skelett in einem ausgetrockneten Stausee?
Unter normalen Umständen würde man einen hohen Kripobeamten, einen Detective Chief Inspector, nicht in den letzten Winkel der Grafschaft entsenden, nur um einen Haufen alter Knochen zu inspizieren. Außerdem übertrug ein Polizeipräsident einem Kriminalbeamten niemals irgendwelche Fälle. Das machte normalerweise der Superintendent oder der Chief Superintendent. Nach Banks’ Erfahrung beschränkten sich die Tätigkeiten des Polizeipräsidenten gewöhnlich auf Fernsehauftritte, Eröffnungen von Landwirtschaftsausstellungen und die Beurteilung der Leistung von Blechblasorchestern. Aber das galt natürlich nicht für den verfluchten Jimmy Riddle, Mr. Lass-mich-das-Machen, der niemals eine Gelegenheit auslassen würde, frisches Salz in Banks’ Wunden zu reiben.
Wie beschäftigt die Dienststellen in Harrogate und Ripon auch sein mochten, Banks war überzeugt, dass sie einen qualifizierten Beamten für diese Aufgabe abstellen konnten. Riddle war offensichtlich der Meinung, der Fall sei langweilig oder unangenehm, vielleicht sogar beides, und könne nur mit einem Patzer oder einer Peinlichkeit enden – warum sonst sollte er ihn Banks übertragen? Und dieser Sergeant Cabbot, wer auch immer das war, war wahrscheinlich dumm wie Brot, sonst hätte man ihn das doch allein erledigen lassen. Denn warum hockte ein Detective Sergeant wohl ausgerechnet auf einer Wache in Harkside? War ja wohl kaum die Hauptstadt des Verbrechens im Norden.
»Und, Banks?«
»Ja, Sir?«
»Vergessen Sie Ihre Gummistiefel nicht.«
Banks hätte schwören können, dass er Riddle wie einen gehässigen Schuljungen kichern hörte.
Er kramte eine Karte der Yorkshire Dales hervor und überprüfte die Lage der Dinge. Thornfield war der westlichste von drei miteinander verbundenen Stauseen am Fluss Rowan, der von seiner Quelle oben in den Pennines mehr oder weniger in östlicher Richtung verlief, bis er sich nach Süden wandte und in der Nähe von Otley in die Wharfe floss. Obwohl Thornfield nur ungefähr fünfundzwanzig Meilen Luftlinie entfernt war, gab es keine direkte Verbindung dorthin, sondern fast nur kleinere, unbefestigte Landstraßen. Banks fuhr die Strecke mit dem Zeigefinger auf der Karte nach. Wahrscheinlich war es am besten, durchs Moor Richtung Süden zu fahren, durch Langstrothdale Chase bis Grassington, dann nach Osten Richtung Pateley Bridge. Selbst so würde es wahrscheinlich mehr als eine Stunde dauern.
Nachdem er kurz geduscht hatte, griff Banks nach seiner Jacke, klopfte sich aus alter Gewohnheit auf die Taschen, um sicher zu sein, Autoschlüssel und Portemonnaie dabei zu haben, und ging hinaus in den nachmittäglichen Sonnenschein.
Bevor er ins Auto stieg, blieb er einen Moment stehen, die Hände auf der warmen Steinmauer, und blickte hinunter auf die nackten Felsen, über die normalerweise der Wasserfall von Gratly rauschte. Eine Zeile aus einem Gedicht von T. S. Eliot, das er am Abend zuvor gelesen hatte, kam ihm in den Sinn: »Gedanken eines dürren Hirns zur dürren Jahreszeit.« Sehr passend. Es war eine lange Dürreperiode gewesen, alles in diesem Sommer war ausgetrocknet, auch Banks’ Gedanken.
Das Gespräch mit Brian spukte ihm noch immer durch den Kopf; wenn es doch nur anders verlaufen wäre. Obwohl Banks bewusst war, dass er sich mehr Sorgen um seine Tochter Tracy machte, die gerade mit ein paar Freundinnen in einem alten Lieferwagen durch Frankreich tourte, hieß das ja nicht, dass ihm Brian gleichgültig war.
Durch seine Arbeit hatte Banks so viele Kinder auf die schiefe Bahn geraten sehen, dass es schon nicht mehr komisch war. Drogen. Vandalismus. Diebstahl. Einbruch. Gewaltverbrechen. Brian sei zu sensibel, um so etwas zu machen, hatte Banks sich immer eingeredet; er hatte jegliche Unterstützung erhalten, die sie sich hatten leisten können. Mehr als Banks je bekommen hatte. Wahrscheinlich hatten ihn die Worte seines Sohnes deshalb so stark verletzt.
Ein Pärchen ging am Cottage vorbei, schwere Rucksäcke auf dem Rücken, knotige Wadenmuskeln, kurze Hosen, robuste Wanderschuhe, Generalstabskarten, die sie sich in Plastikhüllen um den Hals gebunden hatten, falls es regnen würde. Prinzip Hoffnung. Banks grüßte, äußerte sich zum guten Wetter und stieg in den Cavalier. Der Sitz war so heiß, dass er fast sofort wieder aufgesprungen wäre.
Als er nach einer Kassette tastete, dachte er, dass Brian alt genug sei, um selbst zu entscheiden. Wenn er für den Versuch, zu Ruhm und Geld zu kommen, alles hinschmeißen wollte, dann war das seine Sache, oder?
Immerhin hatte Banks nun eine Aufgabe zu erledigen. Diesmal hatte Jimmy Riddle einen Fehler gemacht. Zweifellos war er überzeugt, Banks einen ätzenden, ausweglosen Auftrag erteilt zu haben, der ihm unzählige Möglichkeiten zur Blamage bot; zweifellos waren die Würfel zu seinem Nachteil gezinkt; aber alles war besser, als auf dieser Dienststelle zu versauern. Riddle hatte die eine, alles überragende Eigenschaft von Banks übersehen, die ihn selbst in einer schweren Phase nicht verließ: seine Neugier.
Kurz fühlte sich Banks wie ein Pilot mit Startverbot, der plötzlich wieder Flugerlaubnis erhalten hatte. Er schob Forever Changes von Love in den Rekorder und fuhr mit quietschenden Reifen los.
Die Signierstunde begann um halb sieben, aber Vivian Elmsley hatte der Pressedame Wendi gesagt, sie würde gern frühzeitig da sein, sich mit der Umgebung vertraut machen und mit der Belegschaft sprechen.
Schon um Viertel nach sechs hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Das war zu erwarten gewesen. Nach zwanzig Romanen in ebenso vielen Jahren war ein Auftritt von Vivian Elmsley inzwischen zu einem Ereignis geworden.
Obgleich ihr Ruhm und ihre Verkaufszahlen im Laufe der Jahre stetig gewachsen waren, war es ihre fünfzehnbändige Inspector Niven-Reihe gewesen, die es vor kurzem mit einem gutaussehenden Hauptdarsteller, einer Hochglanzproduktion und großem Budget auf die Fernsehleinwand geschafft hatte. Die ersten drei Folgen waren bereits ausgestrahlt und von der Kritik bejubelt worden (besonders erfreulich angesichts der Tatsache, dass viele Fernsehkritiker keine Krimis mehr sehen mochten), und dementsprechend war Vivians Gesicht in den letzten Monaten der Öffentlichkeit so vertraut geworden, wie es für einen Schriftsteller nur möglich war.
Sie war auf der Titelseite von Night & Day gewesen, war von Melvyn Bragg für die South Bank Show interviewt und in der Zeitschrift Woman’s Own porträtiert worden. Immerhin war es eine Nachricht wert, wenn man mit über siebzig zum »Shooting Star« wurde. Manchmal wurde sie sogar auf der Straße erkannt.
Adrian, der alles organisiert hatte, reichte ihr ein Glas Rotwein, während Thalia die Bücher auf dem niedrigen Tisch vor dem kleinen Sofa arrangierte. Um Punkt halb sechs stellte Adrian sie mit den Worten vor, sie müsse nicht vorgestellt werden, und bei höflichem Applaus griff sie zu ihrem jüngsten Inspector Niven-Buch, Spuren der Sünde, und begann, aus dem Eingangskapitel zu lesen.
Ungefähr fünf Minuten würden reichen, nahm Vivian an. Weniger erweckte den Eindruck, sie könne nicht schnell genug wegkommen; bei längerem Lesen bestand die Gefahr, die Aufmerksamkeit des Publikums zu verlieren. Das Sofa war so weich und tief, dass sie darin zu versinken schien. Sie fragte sich, wie sie sich jemals daraus erheben sollte. Sie war ja kein gelenkiges junges Ding mehr.
Nach der Lesung stellten sich die Leute in einer ordentlichen Reihe an, und Vivian signierte die Bücher, hielt mit jedem Besucher einen kurzen Plausch, fragte nach einer besonderen Widmung und achtete darauf, die Namen richtig zu schreiben. Es war ja schön und gut, wenn jemand sagte, er heiße »John«, aber woher sollte man wissen, ob er sich nicht »Jon« schrieb?
Vivian betrachtete ihre Hand beim Signieren. Krallenähnlich, dachte sie, fast skelettartig, gesprenkelt mit Leberflecken, gerunzelte Haut, über den Knöcheln faltig, geschwollen um den Ehering, der sich nicht mehr abstreifen ließ.
Ihre Hände würden sie als Erstes im Stich lassen, dachte sie. Der Rest von ihr hatte sich erstaunlich gut gehalten. Sie war groß und schlank geblieben. Sie war weder geschrumpft oder, wie so viele ältere Frauen, aufgeschwemmt, noch hatte sie sich mit einem dicken, undurchdringlichen hausmütterlichen Panzer umgeben.
Das stahlgraue, streng zurückgekämmte und im Nacken festgesteckte Haar bildete auf der Stirn einen spitz zulaufenden Haaransatz über dem ausdrucksvollen, länglichen Gesicht. Die tiefblauen Augen, umgeben von Krähenfüßen, hatten eine fast orientalische Mandelform, die Nase war leicht gekrümmt, die Lippen dünn. Kein Gesicht, das oft lachte, dachten die Leute. Und sie hatten Recht, obwohl es nicht immer so gewesen war.
»Ein stählerner, unerschrockener Blick in die Abgründe des Bösen«, hatte ein Rezensent über sie geschrieben. Und war es nicht Graham Greene gewesen, der bemerkt hatte, jeder Schriftsteller habe einen Eissplitter im Herzen?
»Sie haben früher oben im Norden gelebt, stimmt’s?«
Vivian blickte auf, verblüfft über die Frage. Der Mann schien um die sechzig zu sein, dünn bis abgemagert, mit einem langen, hageren, blassen Gesicht und glattem hellem Haar. Er trug eine verblichene Jeans und ein grellbuntes T-Shirt, wie es Besucher von Freizeitparks gern tragen. Als er ihr das Buch zum Signieren reichte, bemerkte sie, dass seine Hände ungewöhnlich klein für einen Mann waren. Irgendetwas daran verwirrte sie.
Vivian nickte. »Vor langer Zeit.« Dann sah sie auf das Buch. »Wem soll ich das Buch widmen?«
»Wie hieß der Ort, wo sie wohnten?«
»Das ist schon lange her.«
»Hatten sie damals den gleichen Namen wie heute?«
»Hören Sie, ich ... «
»Entschuldigen Sie, Sir.« Höflich bat Adrian den Mann, weiterzugehen. Er tat, wie ihm geheißen, warf noch einen Blick zurück auf Vivian, dann schleuderte er ihr Buch auf einen Stapel und ging.
Vivian signierte weiter. Adrian brachte ihr noch ein Glas Wein, die Leute sagten ihr, wie wunderbar sie ihre Bücher fanden, und bald hatte sie den seltsamen Mann mit den bohrenden Fragen vergessen.
Als alles vorbei war, schlugen Adrian und die Mitarbeiter vor, essen zu gehen, aber Vivian war müde, ein weiteres Zeichen ihres fortgeschrittenen Alters. Sie wollte nichts anderes tun, als nach Hause fahren und ein langes, heißes Bad nehmen, dazu einen Gin Tonic trinken und die Erziehung der Gefühle von Flaubert lesen, aber zuerst brauchte sie ein bisschen Bewegung und frische Luft. Allein.
»Ich fahre Sie nach Hause«, sagte Wendi.
Vivian legte die Hand auf Wendis Arm. »Nein, meine Liebe«, sagte sie. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne allein ein bisschen spazieren gehen, dann nehme ich die U-Bahn.«
»Aber, wirklich, es macht keine Umstände. Dafür bin ich doch da.«
»Nein. Ich komme gut zurecht. Ich bin noch in den besten Jahren.«
Wendi lief rot an. Man hatte ihr wahrscheinlich gesagt, dass Vivian launisch sei. Die Pressedamen und Medienbeauftragten wurden immer gewarnt. »Tut mir leid. Das habe ich damit natürlich nicht gemeint. Das ist meine Aufgabe.«
»Ein hübsches Mädchen wie Sie muss doch weitaus Besseres zu tun haben, als eine alte Frau durch den Londoner Verkehr nach Hause zu kutschieren. Warum gehen Sie nicht mit Ihrem Freund ins Kino oder in die Disco oder so?«
Wendi lächelte und warf einen Blick auf die Uhr. »Hm, ich habe Tim gesagt, ich würde ihn erst später treffen können. Wenn ich ihn jetzt anrufe und mich an der Abendkasse anstelle, bekommen wir vielleicht noch Theaterkarten zum halben Preis. Aber nur, wenn Sie sich auch ganz sicher sind.«
»Das bin ich, meine Liebe. Gute Nacht.«
Vivian trat hinaus in die warme herbstliche Dämmerung auf der Bedford Street.
London. Manchmal merkte sie, dass sie noch immer nicht begreifen konnte, dass sie tatsächlich in dieser Stadt lebte. Sie erinnerte sich noch gut an ihren ersten Besuch – wie weitläufig, majestätisch und überwältigend die Stadt auf sie gewirkt hatte. Ehrfürchtig hatte sie die Sehenswürdigkeiten betrachtet, von denen sie gehört, gelesen oder die sie auf Bildern gesehen hatte: Piccadilly Circus, Big Ben, St. Paul’s, Buckingham Palace, Trafalgar Square. Natürlich war das schon lange her, doch noch heute verspürte sie denselben Zauber, wenn sie die Namen vor sich hinsprach oder durch die berühmten Straßen ging.
Charing Cross Road war voller Menschen, die spät von der Arbeit kamen oder ins Theater oder Kino gehen wollten und sich vorher noch mit Freunden auf ein Glas trafen. Bevor sie in die U-Bahn stieg, überquerte Vivian vorsichtig die Straße, wartete auf das Fußgängersignal und bummelte um den Leicester Square.
Neben Burger King sang ein kleiner Chor »Men of Harlech«. Wie sich alles verändert hatte: die Schnellrestaurants, die Geschäfte, selbst die Kinos. Nicht weit von hier, am Haymarket, war sie zum ersten Mal in London im Kino gewesen, im Carlton. Was hatte sie gesehen? Wem die Stunde schlägt. Natürlich, das war es gewesen.
Als sie zurück zum U-Bahn-Eingang Leicester Square schlenderte, dachte Vivian wieder über den seltsamen Mann in der Buchhandlung nach. Sie lebte nicht gern in der Vergangenheit, aber er hatte sie in eine nachdenkliche Stimmung versetzt, wie schon zuvor die jüngsten Zeitungsfotos vom ausgetrockneten Thornfield-Stausee.
Zum ersten Mal seit über vierzig Jahren waren die Ruinen von Hobb’s End ans Tageslicht gelangt und die Erinnerungen an ihr Leben dort stürzten auf sie ein. Vivian erschauderte, als sie die Stufen zur U-Bahn hinunterstieg.
Kapitel 2
Nach dem Gang durch den Wald blieb Banks stehen und holte Luft. Von seinem Standpunkt am Rand des Thornfield-Stausees ähnelte das lang gestreckte Becken mit den Ruinen, das vor ihm lag, einer hohlen Hand. Es war ungefähr vierhundert Meter breit und achthundert Meter lang. Er kannte zwar nicht die vollständige Geschichte, aber er wusste, dass dieses Tal viele Jahre unter Wasser gestanden hatte. Jetzt war es, wie die Ausgrabung einer prähistorischen Siedlung oder eine Art Atlantis der Neuzeit, zum ersten Mal wieder aufgetaucht.
Verknotete Baumwurzeln traten aus der gegenüberliegenden Uferböschung. Die unterschiedlichen Farben der Erde zeigten an, wo das Wasser gestanden hatte. Hinter dem Ufer erstreckte sich Richtung Norden der Wald von Rowan Woods.
Am dramatischsten war der Anblick direkt zu seinen Füßen: das versunkene Dorf. Flankiert von einer verfallenen Mühle auf einem kleinen Hügel im Westen und einer winzigen Packpferdbrücke im Osten, ähnelte die Anordnung dem Skelett eines Riesentorsos. Die Brücke bildete den Beckenknochen, und die Mühle war der Schädel, der abgetrennt und leicht links vom Körper platziert worden war. Der Fluss und die High Street stellten das leicht geschwungene Rückgrat dar, von dem die Nebenstraßen wie Rippen abgingen.
Es gab keinen Straßenbelag, aber der Verlauf der alten High Street entlang des Flusses war deutlich zu erkennen. Bei der Brücke verzweigte sie sich, ein Arm führte in Richtung Rowan Woods und verengte sich bald zu einem Fußpfad, der andere führte über die Brücke und verlief dann entlang der Harksmere-Uferstraße wahrscheinlich bis nach Harkside. Es kam Banks besonders merkwürdig vor, dass dort unter Wasser so viele Jahre eine völlig intakte Brücke gestanden hatte.
Unten sah er eine Gruppe von Menschen auf der anderen Seite der Brücke, einer davon in Uniform. Banks hastete den schmalen Pfad hinunter. Es war ein warmer Abend, und als er unten ankam, schwitzte er. Bevor er sich den anderen näherte, zog er ein Taschentuch hervor und tupfte sich über Stirn und Nacken. Gegen die dunklen Flecken unter dem Arm konnte er nichts machen.
Er war nicht übergewichtig und eigentlich auch nicht untrainiert. Er rauchte, ernährte sich ungesund und trank zu viel, doch hatte ihn sein unermüdlicher Stoffwechsel davor bewahrt, dick zu werden. Er mühte sich nicht mit sportlichen Übungen ab, aber seit ihn Sandra verlassen hatte, hatte er sich angewöhnt, am Wochenende lange, einsame Spaziergänge zu unternehmen, und ein- oder zweimal pro Woche zog er seine Bahnen im Schwimmbad von Eastvale. Das furchtbar heiße Wetter war schuld, dass er sich so schlecht in Form fühlte.
Die Talsohle war nicht so schlammig, wie er gedacht hatte. Die rötlichbraune Erde war größtenteils ausgetrocknet und durch die Hitze aufgesprungen. Dennoch gab es einige sumpfige Stellen, an denen Schilfrohr wuchs, und er musste über mehrere große Pfützen springen.
Als er die Packpferdbrücke überquerte, kam eine Frau auf ihn zu und hielt ihn mit ausgestrecktem Arm an. »Entschuldigen Sie, Sir«, sagte sie, »aber dies hier ist ein Tatort. Es tut mir leid, aber Sie dürfen nicht näherkommen.«
Banks grinste. Er wusste, dass er nicht wie ein Chief Inspector aussah. Er hatte seine Sportjacke im Wagen gelassen und trug ein am Hals offenes blaues Jeanshemd ohne Krawatte, eine beige Hose und schwarze Gummistiefel.
»Warum ist er dann nicht abgesperrt?«, fragte er.
Die Frau sah ihn an und runzelte die Stirn. Sie war Ende zwanzig oder Anfang dreißig und, nach dem ersten Blick zu urteilen – lange Beine, groß und schlank –, wahrscheinlich nur wenig kleiner als Banks mit seinen ein Meter achtundsiebzig. Sie trug Jeans und eine weiße Bluse aus einem seidenähnlichen Stoff. Über der Bluse hatte sie einen Blazer mit Fischgrätmuster, der ihre Taille und die sanft geschwungenen Hüften betonte. Das kastanienbraune Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel ihr in Stufen bis auf die Schulter. Das Gesicht war oval, sie hatte glatte, gebräunte Haut, volle Lippen und einen kleinen Schönheitsfleck rechts neben dem Mund. Sie trug eine Sonnenbrille mit schwarzem Gestell, und als sie sie abnahm, schienen ihre ernsten Mandelaugen Banks zu betrachten, als sei er eine bis dato unbekannte Lebensform.
Sie war keine klassische Schönheit. Ein Gesicht wie ihres fand man nicht in Zeitschriften, doch strahlte sie starke Persönlichkeit und Intelligenz aus. Und die roten Gummistiefel rundeten diesen Eindruck ab.
Banks lächelte. »Muss ich Sie erst von der Brücke in den Fluss werfen, bevor ich rüberkommen kann, so wie Robin Hood das mit Little John gemacht hat?«
»Ich glaube, es war eigentlich andersherum, aber Sie können es ja versuchen«, sagte sie. Nachdem sie sich gegenseitig kurz abgeschätzt hatten, blinzelte sie, runzelte die Stirn und sagte: »Dann sind Sie also Chief InspectorBanks?«
Sie wirkte weder nervös noch beschämt, weil sie ihn für einen Gaffer gehalten hatte; in ihrem Ton lag keine Spur von Entschuldigung oder Ehrfurcht. Er wusste nicht, ob ihm das gefiel. »Sergeant Cabbot, nehme ich an?«
»Ja, Sir.« Sie lächelte. Es war nicht mehr als ein Zucken der Mundwinkel und ein kurzes Aufleuchten ihrer Augen, aber es machte Eindruck. Viele Leute dachten bestimmt, dass es schön sei, von Sergeant Cabbot angelächelt zu werden, überlegte Banks. Was seinen Argwohn nur noch steigerte, welche Gründe Jimmy Riddle gehabt haben mochte, ihn hierher zu schicken.
»Und die da?« Banks zeigte auf den Mann und die Frau, die mit dem uniformierten Beamten sprachen. Der Mann richtete eine Videokamera auf den Schuppen.
»Colleen Harris und James O’Grady, Sir. Sie erkundeten die Gegend für eine Fernsehsendung, als sie den Jungen durchs Dach fallen sahen. Sie sind ihm zu Hilfe geeilt. Offenbar hatten sie auch die Kameras zur Hand. Ich schätze, es wird eine hübsche kleine Meldung in den Abendnachrichten geben.« Sie kratzte sich an der Nase. »Wir hatten kein Absperrband mehr, Sir. Auf der Wache. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass jemals welches da war.« Sie spielte beim Sprechen mit der Sonnenbrille, aber Banks hielt es nicht für Nervosität. Sie besaß einen leichten Akzent, ein kaum merklich rollendes R, aber doch nicht zu überhören.
»Gegen die Fernsehleute können wir jetzt nichts machen«, sagte Banks. »Vielleicht nützen sie uns sogar. Am besten erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ein Junge hier ein paar alte Knochen gefunden hat.«
Sergeant Cabbot nickte. »Adam Kelly. Er ist dreizehn.«
»Wo ist er?«
»Ich hab ihn nach Hause geschickt. Nach Harkside. Er kam mir ein bisschen durcheinander vor, außerdem hatte er sich an Handgelenk und Ellenbogen verletzt. Nichts Schlimmes. Jedenfalls wollte er zu seiner Mama, deshalb habe ich Constable Cameron da drüben gesagt, er solle ihn nach Hause bringen und dann zurückkommen. Der arme Junge wird bestimmt monatelang Albträume haben.«
»Wie ist es passiert?«
»Als Adam über das Dach lief, gab es unter ihm nach. Er kann von Glück sagen, dass er sich nicht die Wirbelsäule gebrochen hat oder erschlagen wurde.« Sie wies auf den Schuppen. »Die Balken, die die Steinplatten trugen, müssen nach so vielen Jahren unter Wasser morsch gewesen sein. Da braucht man nicht schwer zu sein. Ich schätze, das Sprengkommando sollte den ganzen Ort abreißen, bevor er geflutet wurde, aber an dem Tag haben sie wohl früh Feierabend gemacht.«
Banks sah sich um. »Es scheint, als hätten die Sprengmeister ein paar Ecken ausgelassen.«
»Warum auch nicht? Sie gingen wohl davon aus, dass niemand dieses Dorf jemals wieder zu Gesicht bekommen würde. Wer kann schon sagen, was noch steht, wenn alles unter Wasser ist? Na ja, jedenfalls hat der Schlamm Adam aufgefangen, sein Arm steckte im Dreck und er zog das Skelett einer Hand heraus.«
»Eine Menschenhand?«
»Weiß ich nicht, Sir. Ich meine, für meine Begriffe sieht sie menschlich aus, aber dafür brauchen wir einen Fachmann. Ich hab gelesen, Bärentatzen seien sehr leicht mit Menschenhänden zu verwechseln.«
»Bärentatzen? Wann haben Sie das letzte Mal einen Bär in dieser Gegend gesehen?«
»Och, noch vor ein paar Wochen, Sir.«
Banks stutzte, sah das Flackern in ihren Augen und lächelte. Irgendetwas an dieser Frau fesselte ihn. Ihr Ton verriet nicht den geringsten Selbstzweifel oder die kleinste Unsicherheit bezüglich ihres Tuns. Die meisten jüngeren Polizeibeamten ließen, wenn sie von einem Vorgesetzten nach ihrer Vorgehensweise befragt wurden, oft so etwas wie »Hab ich das richtig gemacht, Sir?« in ihre Stimme kriechen, oder sie nahmen eine Abwehrhaltung an. Susan Gay, seine ehemalige Mitarbeiterin, war so gewesen. Doch Sergeant Cabbot war völlig anders. Sie gab Dinge einfach so wieder, wie sie sich ereignet hatten, und erklärte die Entscheidungen, die sie getroffen hatte. Etwas an ihrer Art ließ sie vollkommen selbstsicher und beherrscht erscheinen, ohne im Geringsten arrogant oder aufsässig zu wirken. Banks fand sie beunruhigend.
»Gut«, sagte er, »sehen wir es uns mal an.«
Sergeant Cabbot klappte ihre Sonnenbrille zusammen, ließ sie in ihre Umhängetasche gleiten und ging voran. Banks folgte ihr in den Schuppen. Sie bewegte sich mit geschmeidiger Eleganz, so wie eine Katze, wenn sie nicht gerade gefüttert wurde.
Er blieb kurz stehen und sprach mit den Fernsehleuten. Sie konnten ihm nicht viel erzählen, nur dass sie sich die Gegend angeschaut und gesehen hätten, wie der Junge durch das Dach gefallen war. Sie seien sofort hingelaufen, und da hätten sie dann bemerkt, was er aus dem Boden gezogen hatte. Er sei ihnen für ihre Hilfe nicht sonderlich dankbar gewesen, sagten sie, und schon gar nicht erfreut, sie zu sehen, aber sie waren erleichtert, dass er nicht ernstlich verletzt war. Getreu ihrem Beruf fragten sie Banks, ob es ihm etwas ausmache, ihnen eine Stellungnahme auf Band zu sprechen. Er lehnte höflich mit dem Hinweis ab, ihm fehlten Informationen. Sobald er sich umgedreht hatte, sprach die Frau über Handy mit dem lokalen Nachrichtensender. Es klang nicht so, als handelte es sich um ihren ersten Anruf.
Der Schuppen war ungefähr zwei Quadratmeter groß. Banks stand in der Tür und betrachtete den Abdruck im Schlamm, den der Junge hinterlassen hatte, dann die zwei schweren Steinplatten links und rechts davon. Sergeant Cabbot hatte Recht: Adam Kelly hatte wirklich sehr viel Glück gehabt. Auf dem Boden waren weitere Steine verstreut, viele zerbrochen, einige Bruchstücke ragten aus dem Schlamm. Adam hätte ohne weiteres auf einen dieser Steine fallen und sich das Rückgrat brechen können. Aber wenn man so klein ist, hält man sich für unsterblich. So hatten sich auch Banks und seine Freunde gefühlt, selbst nachdem Phil Simpkins das Seil um einen Baumstamm gewickelt hatte, vom obersten Ast gesprungen und auf das spitze Metallgitter gefallen war.
Banks schüttelte die Erinnerung ab und konzentrierte sich auf die Szene vor sich. Die Sonne beschien den oberen Teil der hinteren Wand; die Steine glänzten feucht und glitschig. Obwohl meilenweit kein Salzwasser vorhanden war, roch es muffig, bemerkte Banks, außerdem nach totem Fisch, der wohl nicht so weit entfernt war.
»Sehen Sie, was ich meine, Sir?«, fragte Sergeant Cabbot. »Weil das Dach die Sonne nicht hereingelassen hat, ist es hier drinnen viel schlammiger als draußen.« Mit einer schnellen Bewegung strich sie eine Haarsträhne nach hinten. »Hat dem Jungen wahrscheinlich das Leben gerettet.«
Banks’ Blick blieb an dem Handskelett hängen, das sich um den Rand einer zerbrochenen Steinplatte krallte. Es erinnerte ihn an die Szene aus einem Horrorfilm, wenn sich das Monster aus dem Grab zieht. Die Knochen waren dunkel und schmutzverkrustet, aber Banks erkannte in ihnen ebenfalls eine Menschenhand.
»Wir holen besser ein paar Fachleute, die alles ausgraben«, sagte er. »Dann brauchen wir einen forensischen Anthropologen. Und bis dahin – ich hab noch nichts gegessen. Kann man hier irgendwo in der Nähe was zu essen bekommen?«
»Am besten im Black Swan in Harkside. Möchten Sie Adam Kellys Adresse?«
»Haben Sie schon gegessen?«
»Nein, aber ...«
»Dann können Sie doch mitkommen und mir beim Essen alles erzählen. Ich werde morgen früh ein Schwätzchen mit dem kleinen Adam halten, dann hat er sich bestimmt beruhigt. Constable Cameron kann hier die Stellung halten.«
Sergeant Cabbot warf einen Blick auf das Handskelett.
»Nun, los«, meinte Banks, »hier können wir nichts mehr tun. Das arme Schwein ist bestimmt schon länger tot, als wir auf der Welt sind.«
Vivian Elmsley war todmüde, als sie schließlich von der Signierstunde nach Hause kam. Sie stellte ihre Aktentasche im Flur ab und ging ins Wohnzimmer. Die meisten Menschen hätten gestaunt, im Haus einer Person von Vivians Alter eine moderne Einrichtung aus Chrom und Glas vorzufinden, aber sie mochte es lieber als die furchtbar kitschigen Antiquitäten, den Nippes und die restaurierten Holzbalken, mit denen alte Menschen ihre Häuser vollstopften – wenigstens die, die sie kannte. Das einzige Bild, das ihre schlichten weißen Wände schmückte, hing über einem schmalen gläsernen Kaminsims: ein gerahmter Druck einer Blume von Georgia O’Keeffe, überwältigend in ihrem Gelbton und einschüchternd in ihrer Symmetrie.
Zuerst öffnete Vivian die Fenster, um frische Luft hereinzulassen, dann goss sie sich einen starken Gin Tonic ein und begab sich zu ihrem Lieblingssessel. Die Konstruktion aus verchromtem Stahl und schwarzem Lederpolster hatte genau den richtigen Neigungswinkel, um Lesen, Trinken oder Fernsehen sündhaft gemütlich zu machen.
Vivian warf einen Blick auf die Uhr, deren glänzendes Innenleben aus Messing und Silber durch die Glaskuppel zu sehen war. Kurz vor neun. Zuerst wollte sie die Nachrichten sehen. Danach würde sie ein Bad nehmen und Flaubert lesen.
Sie griff nach der Fernbedienung. Fast ihr ganzes Leben lang hatte sie mit der Hand geschrieben und zur Zerstreuung lediglich ein altes Radio in einem Gehäuse aus Walnussholz besessen, doch vor fünf Jahren hatte sie dem technischen Fortschritt nachgegeben. Einen Tag, nachdem sie einen großen Vorschuss von ihrem neuen amerikanischen Verlag erhalten hatte, machte sie sich auf und erstand in einem Kaufrausch einen Fernseher, einen Videorekorder, eine Stereoanlage und den Computer, an dem sie nun ihre Bücher verfasste.
Sie legte die Füße hoch und drückte auf die Fernbedienung. In den Nachrichten kam der übliche Schrott. Größtenteils Politik, ein bisschen Mord, Hunger in Afrika, ein verpfuschtes Attentat im Mittleren Osten. Sie wusste nicht, warum sie sich überhaupt noch die Mühe machte. Gegen Ende kam dann eine dieser kleinen Klatschgeschichten, die immer als Lückenbüßer dienen mussten.
Doch diesmal setzte sich Vivian auf und spitzte die Ohren.
Die Kamera schwenkte über eine Ansammlung vertrauter Ruinen, während der Sprecher erklärte, dass dieses vergessene Dorf aus den Yorkshire Dales namens Hobb’s End durch die jetzige Dürre zum ersten Mal seit der offiziellen Flutung 1953 ans Tageslicht gelangt sei. Das wusste sie bereits – es war die gleiche Bildsequenz wie vor einem Monat, als sie die Geschichte zum ersten Mal im Fernsehen brachten –, aber plötzlich änderte sich die Perspektive, und sie sah ein paar Menschen neben der Brücke stehen, einer davon in Polizeiuniform.
»Heute«, fuhr der Sprecher fort, »entdeckte ein kleiner Junge beim Erkundschaften des Geländes etwas, auf das er nicht vorbereitet war.«
Die Stimme des Sprechers war locker, oberflächlich, sie erinnerte Vivian an die von ihr so verabscheuten lässigen Krimis, in denen die Welt des Verbrechens verniedlicht wurde. Dieser Fall rufe glatt nach einer Miss Marple, sagte der Sprecher, ein Skelett sei gefunden worden, zwar nicht in einem Schrank, liebe Zuschauer, sondern im sumpfigen Boden unter einem alten Schuppen. Wie konnte es dorthin gelangen? Lag hier ein Gewaltverbrechen vor?
Vivian umklammerte die kühlen Stahlrohre des Sessels, der Gin Tonic stand vergessen auf dem Glastisch neben ihr.
Die Kamera fuhr auf den Schuppen zu; Vivian sah einen Mann und eine Frau auf der Schwelle stehen. Der Kommentator berichtete weiter, die Polizei sei am Tatort angekommen und habe in diesem frühen Stadium keine Erklärung abgeben wollen, dann schloss er mit den Worten, man würde die Situation im Auge behalten.
Im Fernsehen lief schon längst der Wetterbericht, als sich Vivian von ihrem Schock erholt hatte. Sie merkte, dass ihre Hände das Chrom immer noch fest umklammert hielten, selbst ihre Leberflecken waren weiß geworden.
Sie ließ los, sackte im Sessel zusammen und holte tief Luft. Dann griff sie mit zitternden Händen nach ihrem Gin Tonic. Es gelang ihr, einen Schluck zu trinken, ohne etwas zu verschütten. Das half.
Als sie sich ein wenig beruhigt hatte, ging sie ins Arbeitszimmer und suchte in ihrem Sekretär nach dem Manuskript, das sie in den frühen Siebzigern geschrieben hatte, drei Jahre nach ihrem letzten Besuch des Thornfield-Stausees. Sie fand den Stapel Papier und trug ihn ins Wohnzimmer.
Es war nie zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. In vielerlei Hinsicht hatte sie den Text nur als Schreibübung verfasst, als sie sich nach dem Tod ihres Mannes für die Schriftstellerei zu interessieren begann. Sie hatte damit angefangen, als sie noch glaubte, die alte Regel »Schreib, was du kennst« bedeute, man solle über das eigene Leben, über die eigenen Erfahrungen berichten. Sie hatte ein paar Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass das so nicht stimmte. Zwar schrieb sie noch immer über das, was sie kannte – Schuld, Trauer, Schmerz, Wahnsinn –, nur packte sie es heute ins Leben ihrer Figuren.
Als sie zu lesen begann, wurde ihr klar, dass sie gar nicht genau benennen konnte, was sie da in den Händen hielt. Ihre Memoiren? Eine Novelle? Sicherlich enthielt das Geschriebene eine gewisse Wahrheit, immerhin hatte sie versucht, sich an die Fakten zu halten, hatte sogar bei Unsicherheiten in ihren alten Tagebüchern nachgeschlagen. Doch da sie den Text zu einer Zeit in ihrem Leben verfasst hatte, als ihr noch nicht bewusst gewesen war, wie fließend der Übergang von Autobiographie zu Fiktion war, hatte sie nicht mit Sicherheit sagen können, um was es sich handelte. War ihr das jetzt klarer? Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.
Banks war noch nie in Harkside gewesen. Sergeant Cabbot fuhr mit ihrem metallic-roten Astra vor, er folgte ihr durch die sich windenden Einbahnstraßen, die von Cottages aus Kalksandstein mit kleinen, bunten Gärten hinter niedrigen Mäuerchen gesäumt wurden. Viele Häuser, die direkt an der Straße standen, hatten Blumenkästen oder -körbe mit roten und gelben Blumen vor den Fenstern.