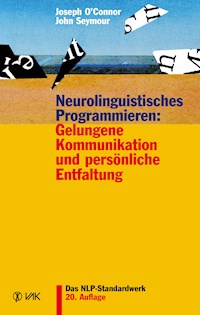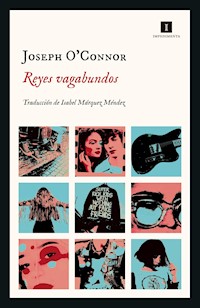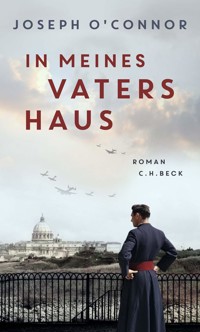
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rom, September 1943: Die deutschen Truppen kontrollieren die Ewige Stadt und der Chef des NS-Sicherheitsdienstes Paul Hauptmann herrscht mit brutaler Effizienz. Juden und geflüchtete Kriegsgefangene suchen Schutz im Vatikan, neutral innerhalb des besetzten Rom. Getarnt als Chor gerät eine kleine Gruppe unterschiedlicher Widerständler um den irischen Priester O'Flaherty in allergrößte Gefahr, als sie versuchen, den Schutzsuchenden zu helfen. Joseph O'Connors Roman, basierend auf wahren Begebenheiten, erzählt raffiniert und spannend eine unvergessliche Geschichte von Liebe, Glauben, List und Mut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JOSEPH O’CONNOR
IN MEINES VATERS HAUS
Roman
Aus dem Englischen von Susann Urban
C.H.BECK
ZUM BUCH
September 1943: Die deutschen Truppen haben Rom unter ihrer Kontrolle. Der Chef des NS-Sicherheitsdienstes Paul Hauptmann beherrscht die Ewige Stadt mit brutaler Effizienz. Hunger ist weit verbreitet. Die Gerüchteküche brodelt. Der Ausgang des Krieges ist alles andere als sicher. Diplomaten, Flüchtlinge, Juden und entkommene Kriegsgefangene fliehen zum Schutz in die Vatikanstadt, den neutralen, kleinen Staat inmitten der Stadt Rom. Eine kleine Gruppe ganz unterschiedlicher Freunde, angeführt von einem mutigen irischen Priester, gerät in allergrößte Gefahr, während sie versuchen, den Schutzsuchenden zu helfen.
Joseph O’Connors Roman ist inspiriert von der außergewöhnlichen, wahren Geschichte von Monsignore Hugh O’Flaherty, der zusammen mit seinen Komplizen sein Leben riskierte, um Juden und andere Flüchtlinge vor den Augen seines Nazi-Feindes aus Italien zu schmuggeln.
Spannend, szenisch und wunderschön geschrieben, erzählt In meines Vaters Haus eine unvergessliche Geschichte von Liebe, Glauben, strategischem Geschick, Aufopferung und Mut.
ÜBER DEN AUTOR
Joseph O’Connor war zunächst als Journalist, Kolumnist und als Kritiker tätig, bevor 1991 bereits sein erster Roman Cowboys and Indians in die Shortlist für den Whitbread Book Award kam. Seitdem hat O’Connor eine Vielzahl von Romanen, Essays und Stücken veröffentlicht.
O’Connor lebt mit seiner Familie in Dublin. Seit 2014 ist er Professor für kreatives Schreiben an der Universität von Limerick. Sein Roman Shadowplay (2019), die Geschichte von Bram Stoker, dem Autor des Dracula, war ein großer Erfolg und wird verfilmt. Auf Deutsch erschien zuletzt der Roman Die wilde Ballade vom lauten Leben (2015).
ÜBER DIE ÜBERSETZERIN
Susann Urban übersetzte für C.H.Beck u.a. Letzter Mann im Turm von Aravind Adiga (2011), Der Garten der verlorenen Seelen (2014) und Der Geist von Tiger Bay (2021) von Nadifa Mohamed und Mein Leben von M. K. Gandhi (2019).
INHALT
I. AKT: DER CHOR
– 1 –
Sonntag, 19. Dezember 1943 22.49 Uhr
Noch 119 Stunden und 11 Minuten bis zum Einsatz
– 2 –
DIE STIMME VON DELIA KIERNAN
7. Januar 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, Fragen nicht vernehmbar, geführt in White City, London
– 3 –
Montag, 20. Dezember 1943 6.47 Uhr
Noch 112 Stunden und 13 Minuten bis zum Rendimento
Dienstag, 21. Dezember 3.04 Uhr
Noch 91 Stunden und 56 Minuten bis zum Rendimento
Mittwoch, 22. Dezember 11.49 Uhr
Noch 59 Stunden und 11 Minuten bis zum Rendimento
Dienstag, 23. Dezember 7 Uhr
Genau 40 Stunden bis zum Rendimento
– 4 –
TESTAMENT UND VERMÄCHTNIS
23. Dezember 1943
– 5 –
– 6 –
DIE STIMME VON ENZO ANGELUCCI
7. November 1962
Aus einem BBC-Recherche-Interview, Tonband 1,geführt in Bensonhurst, New York City
– 7 –
Heiligabend 1943 9.11 Uhr
Noch 13 Stunden und 49 Minuten bis zum Rendimento
– 8 –
CONTESSA GIOVANNA LANDINI
Aus ihren unveröffentlichten Lebenserinnerungen, niedergeschrieben nach dem Krieg, undatiert
– 9 –
Heiligabend 1943 11 Uhr
Genau 12 Stunden bis zum Rendimento
– 10 –
SIR D’ARCY OSBORNE
Heiligabend 1943 12.32 Uhr
Verschlüsseltes Kommuniqué, überbracht durch diplomatischen Kurier
– 11 –
Heiligabend 1943 14.06 Uhr
Noch 8 Stunden und 54 Minuten bis zum Rendimento
– 12 –
DIE STIMME VON JOHN MAY
20. September 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, Coldharbour, Poplar, East London
– 13 –
Heiligabend 1943 15.29 Uhr
Noch 7 Stunden und 31 Minuten bis zum Rendimento
II. AKT: DAS SOLO
– 14 –
MARIANNA DE VRIES
November 1962
Schriftliche Äußerung anstelle eines Interviews
– 15 –
Heiligabend 1943 17.47 Uhr
Noch 5 Stunden und 13 Minuten bis zum Rendimento
– 16 –
Heiligabend 1943 20.31 Uhr
Noch 2 Stunden und 29 Minuten bis zum Rendimento
– 17 –
Heiligabend 1943 21.17 Uhr
Noch 1 Stunde und 43 Minuten bis zum Rendimento
– 18 –
DIE STIMME VON ENZO ANGELUCCI
8. November 1962
Aus einem BBC-Recherche-Interview, Tonband 3, geführt in Bensonhurst, New York City
– 19 –
Heiligabend 1943 23 Uhr
Das Rendimento
– 20 –
DIE STIMME VON JOHN MAY
20. September 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, geführt in Coldharbour, Poplar, East London
– 21 –
DIE STIMME VON SAM DERRY
27. September 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, geführt in Newark-on-Trent, Nottinghamshire
– 22 –
DIE STIMME VON JOHN MAY
20. September 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, geführt in Coldharbour, Poplar, East London
– 23 –
MARIANNA DE VRIES
November 1962
Schriftliche Äußerung anstelle eines Interviews
– 24 –
DIE STIMME VON SIR D’ARCY OSBORNE
14. Dezember 1962
Interview mit BBC-Journalisten, geführt in der Via Giulia 66, Rom
– 25 –
– 26 –
DIE STIMME VON DELIA KIERNAN
7. Januar 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, geführt in White City, London
III. AKT: DER JÄGER
– 27 –
– 28 –
– 29 –
– 30 –
MARIANNA DE VRIES
November 1962
Schriftliche Äußerung anstelle eines Interviews
CODA: DAS IST IHR LEBEN
– 31 –
CONTESSA GIOVANNA LANDINI
Aus ihren unveröffentlichten Lebenserinnerungen, niedergeschrieben nach dem Krieg, undatiert
VORBEHALT, BIBLIOGRAFIE, DANKSAGUNG
ZITIERTE LITERATUR
Für Emma, Laurence und Cormac, un abbraccio.
Liebe Mutter, lieber Vater, liebe Familie. Das ist der letzte Brief, den ich Euch schreiben kann, denn heute werde ich erschossen. Liebe Familie, ich habe mein Leben hingegeben für mein Land, für alles, was mir lieb war. Ich hoffe, dieser Krieg endet bald, damit Ihr alle für immer Frieden habt. Lebt wohl. Euer Euch stets liebender Soldat, Sohn und Bruder Willie.
Brief eines schottischen Kriegsgefangenen aus Italien
I. AKT
DER CHOR
September 1943: Deutsche Truppen besetzen Rom.
Gestapo-Chef Obersturmbannführer Paul Hartmann hat ein Regime des Schreckens errichtet.
Der Hunger ist allgegenwärtig. Die Gerüchteküche brodelt heftig. Der Ausgang des Krieges ist alles andere als gewiss.
Diplomaten, Flüchtlinge und entkommene alliierte Gefangene riskieren ihr Leben auf der Flucht nach Vatikanstadt, mit knapp einem halben Quadratkilometer der kleinste Staat der Welt, ein neutrales, unabhängiges Land mitten in Rom.
Eine kleine Gruppe ungleicher Freunde, angeführt von einem mutigen Priester, gerät in Todesgefahr.
Als es weihnachtet, gibt es kein Zurück mehr.
Sopran: Delia Kiernan, Marianna de Vries
Alt: Contessa Giovanna Landini
Tenor: Sir D’Arcy Osborne, Enzo Angelucci, Major Sam Derry
Bass: John May
Chorleiter: Monsignore Hugh O’Flaherty
– 1 –
Sonntag, 19. Dezember 1943 22.49 Uhr
Noch 119 Stunden und 11 Minuten bis zum Einsatz
Unter dunklen Auspuffwolken schiebt sich der schwarze Daimler mit Diplomatenkennzeichen verdrießlich hustend in die Via Diciannove, Graupelperlen zischen auf der Motorhaube. Eine einsame, matt leuchtende Straßenlaterne spiegelt sich in den Resten einer Pfütze wider, wo ein Gully übergelaufen ist. Das kaputte Neonschild eines Cafés blinkt unregelmäßig, wirft sein Licht auf die Worte MORTE ALFASCISMO, die jemand auf einen Rollladen geschmiert hat.
Scharlachrot.
Smaragdgrün.
Weiß.
Delia Kiernan ist vierzig, Ehefrau eines Diplomaten. Die Ärzte haben ihr das Rauchen verboten. Sie raucht.
Eine Woche vor Weihnachten ist sie tausend Meilen von zu Hause entfernt. Schweißfeucht kleben ihr die Strümpfe am Rock, sie kämpft mit dem widerspenstigen Schaltknüppel und legt den ersten Gang ein.
Der Mann auf dem Rücksitz versucht, ein schmerzerfülltes Stöhnen zu unterdrücken, er zieht an den Hakenkreuzen auf seinen Schulterklappen.
Der schwere Motor murrt. In Delias Schläfen hämmert das Blut. Auf dem Armaturenbrett liegt eine hastig gezeichnete Karte der Schleichwege zum Krankenhaus. Sollte sie einer SS-Patrouille begegnen, wird sie das Papier sofort zusammenknüllen und wegwerfen. Bedauerlicherweise sind die Bleistiftmarkierungen, hingekritzelt mit zittriger Hand, in der Dunkelheit schlecht lesbar. Sie lässt ihr Feuerzeug aufschnappen, der leichte Benzingeruch entlockt dem Mann einen Klagelaut.
Beim Einbiegen in die Via Ventuno stößt der Daimler gegen eine Mülltonne, die umfällt. Ihr Inhalt wuselt zum Rinnstein, wird aber von einem Rudel ausgezehrter Hunde verschlungen, das wie ein einziges Tier aus dunklen Eingängen stürzt.
Mit quietschenden Bremsen holpert der Wagen über Bodenwellen, taucht in Schlaglöcher, gerät ins Schleudern, das Heck bricht aus, die Trittbretter streifen etwas, der Daimler schlingert über von Maschinengewehrschüssen vernarbtes Kopfsteinpflaster hinein in eine Straße, in der nasses Laub den Straßenbelag in eine Eislaufbahn verwandelt hat.
Der Mann wimmert. Fleht, sie solle sich beeilen.
Es geht durch eine Nebenstraße. Vorbei an der Universität, die von den Invasoren niedergebrannt und zerstört worden ist. Der dazugehörige Fußballplatz wird von Unkraut erstickt, den Toren fehlen die Netze, die als Schwimmbecken gedachte Grube gähnt dem Mond und fünfhundert zerbrochenen Fenstern entgegen. Delia erinnert sich an die Verbrennung der Wandtafeln, an das Foto, das sie am Morgen des achtzehnten Geburtstags ihrer Tochter in der Zeitung sah. Vorbei am vieläugigen, mörderischen Koloss des Kolosseums, das dem Skelett eines an Land gespülten Seeungeheuers ähnelt.
Auf der anderen Seite der Piazza grinsen Wasserspeier anzüglich von der düsteren Fassade einer Kirche herab. Sie lässt die Scheinwerfer zweimal aufblitzen.
Die Turmuhr schlägt elf. Sie spürt das Wummern der Glocken in ihren Zähnen. Der Wind zerrt an den angeketteten Tischen und Stühlen vor einem Café und pfeift durch die mit Pfeilspitzen gekrönten Geländer.
Ein schwarz gekleideter Mann eilt vom Portal der Kirche zu ihr herüber, der feuchte Regenmantel klebt ihm am Leib, er überlässt seinen umgeklappten Schirm der Bö, als er sich hastig mit tropfendem Trilby auf den Beifahrersitz des massiven Autos schwingt.
Sie fährt los, er holt Kladde und Bleistift heraus und schreibt.
«Was machst du denn da?»
«Nachdenken», erwidert er.
Aus seiner Manteltasche zieht er ein Fläschchen Brandy heraus und hält es dem Stöhnenden auf dem Rücksitz hin, der sich einen seiner Lederhandschuhe in den Mund gestopft hat.
Mit verängstigtem Blick schüttelt der Mann den Kopf.
«Lass ihn um Himmels willen in Ruhe», sagt sie. «Gib her.»
«Konzentrier dich aufs Fahren.»
«Gib sofort her. Oder du gehst zu Fuß.»
Eine Ewigkeit stehen sie an der Kreuzung zwischen Via Quattordici und Piazza Settanta, während ein kampfzerschrammter Panzer vorbeirasselt, sein Turm dreht sich langsam, als wäre er gelangweilt.
«Was bedeutet das für den Einsatz, wenn er so krank ist?», fragt sie.
«Dann müssen wir Ersatz finden. Vielleicht Angelucci?»
«In der kurzen Zeit können wir Enzo nicht einarbeiten.»
Als sie am Gefängnis Regina Coeli vorbeikommen, prasselt der Hagel heftig auf die Windschutzscheibe. Sie zündet sich erneut eine Zigarette an, Asche rieselt auf den Kragen ihres Regenmantels. Er hat die Augen geschlossen, aber sie ist sich sicher, dass er nicht betet.
«Herrgott noch mal, Delia, fährt diese Rostlaube nicht schneller?»
Dampfende, blaue Straßenlaternen, Gassen, die sich die Hügel hinaufschlängeln, auf den Dächern der Kirchen reihen sich die Silhouetten von Märtyrern aneinander. Sie erinnert sich an ihren ersten Morgen in Rom, als sie die Treppe zum Dach des Petersdoms hinaufstieg, an den Statuen vorbei, denen Zeit und Sturm jegliche Individualität abgeschliffen haben. Rußgeschwärzte, verwitterte Stalagmiten.
Ein Hofgatter versperrt die Zufahrt. Er steigt hinaus in den tobenden Regen und versucht, das Gatter zu öffnen, wobei er so energisch zu Werke geht, dass ihm der Trilby vom Kopf fällt. Im Licht der Scheinwerfer rüttelt er an den Stäben.
«Abgeschlossen!», ruft er. «Ist Werkzeug im Kofferraum?»
«Geh aus dem Weg.»
«Delia –»
Sie jagt den Motor hoch, tritt aufs Gaspedal und rammt den schweren Wagen durch das splitternde Tor, das krachend aufspringt. Er steigt wieder ein und schüttelt den nassen, massigen Schädel, als würde er sich wundern, was aus seinem Leben geworden ist.
Es geht durch weites, flaches Gelände, wo durchnässte Schafe blöken, dann geht es wieder bergauf, und das Krankenhaus taucht auf, drei brachiale Betongebäude, die vor kahlen Fahnenmasten und Monstern strotzen, bei denen es sich nur um Wassertanks handeln kann.
Ein fluoreszierendes gelbes Straßenschild befiehlt in schwarzen Lettern: Rallentare!
Nach einer kurzen, kurvenreichen Fahrt geht eine Auffahrt hinauf, deren Schotter fast abgetragen ist, vorbei an einem Trio kränkelnder Ahornbäume und dem Betonkorb eines Geschützturms zu einem in Flutlicht getauchten Säulenvorbau, vor dem ein khakifarbener Krankenwagen mit rotem Kreuz parkt, der Motor läuft, drei Sanitäter spielen hinten Karten. Beim Anblick des Daimlers ziehen sie merkwürdigerweise die Autotüren zu. Kurz darauf erlischt das Flutlicht.
Delia steigt aus, lässt aber den Motor weiter vor sich hin brummen.
Die Tür des Krankenhauses ist abgesperrt, der Eingangsbereich liegt im Dunkeln. Sie zieht dreimal am Klingelzug und hört das ferne, einsame Bimmeln, das aus den Tiefen der verdunkelten Stationen dringt.
Sie tritt ein paar Schritte zurück und starrt zu den Fenstern hoch, deren Läden geschlossen sind, als könnte ihr Blick, so die Hoffnung jedes gläubigen Menschen, jemanden hervorlocken, aber niemand kommt. Als sie Hilfe suchend auf den Krankenwagen mit den geschlossenen Türen zugeht, ertönt hinter ihr ein anzüglicher Pfiff.
Ein Krankenpfleger Anfang zwanzig, mit Haartolle und Zigarette im Mund, erscheint in einer Tür, die ihr nicht aufgefallen war. Er sieht mürrisch aus, als hätte er vor zwei Minuten noch geschlafen, und bringt einen Schwall abgestandener Luft mit. Die Taschenlampe in seiner linken Hand flackert zweimal schwach auf, worauf das Licht noch spärlicher leuchtet. In der Rechten hält er einen Gegenstand, den sie erst einen Augenblick später als Klappmesser erkennt. Er sieht aus, als wüsste er, wie man damit umgeht.
«Ich habe einen Patienten für Sie, der sofort versorgt werden muss», sagt sie. «Dort, auf dem Rücksitz.»
«Wie heißen Sie?», seufzt er und wirft einen Blick in den Fond des vor sich hin murrenden Daimlers.
«Ich kann Ihnen meinen Namen nicht nennen, aber ich gehöre einer neutralen Gesandtschaft dieser Stadt an. Der Mann ist schwer krank, vor einer knappen Stunde habe ich ihn von unserem Arzt untersuchen lassen. Er meint, es handele sich um eine Bauchfellentzündung oder einen Blinddarmdurchbruch.»
«Was kümmert mich das? Ich bin Römer. Und Sie?»
«Das spielt keine Rolle, lassen Sie eine Bahre holen, verdammt noch mal.»
«Sie kommen her, kommandieren mich herum und erwarten, dass ich einem scheiß Nazi helfe?»
«Es ist Ihre Pflicht, jedem Kranken zu helfen.»
Er spuckt aus.
«Da haben Sie meine Pflicht», sagt er.
Der Schwarzgekleidete steigt aus dem Wagen, legt seine massige Hand aufs Dach, starrt grimmig in den Himmel, als ärgerte er sich über die Wolken, und geht langsam auf den jungen Mann zu.
«Küsst du mit diesem Mund auch deine Mutter?»
«Wer will das wissen?»
«O’Flaherty mein Name.» Als er seinen Regenmantel öffnet, sind Soutane und Kollar zu sehen.
«Pater. Entschuldigung, Pater.» Er bekreuzigt sich. «Das wusste ich nicht.»
«Die deutsche Uniform, die der Mann im Auto trägt, ist Tarnung. Er hat jemanden beschattet und wurde plötzlich schwer krank.»
«Pater –»
«Eine Frage, du harter Kerl. Gibt es in eurem Krankenhaus einen Zahnarzt?»
«Warum?»
«Weil du in einer Minute einen brauchen wirst, wenn ich dir deine Zähne in den Schädel ramme. Du ungehobelter Nichtsnutz, so benimmt man sich nicht gegenüber einer Frau. Geh morgen zur Beichte und bitte auf der Stelle um Entschuldigung.»
«Verzeihen Sie mir, Signora.» Der Sanitäter senkt den knallroten Kopf. «Ich habe seit drei Nächten weder gegessen noch geschlafen.»
«Entschuldigung angenommen», sagt Delia. «Können wir jetzt zum Wesentlichen kommen?»
«Unser Mann ist ein entflohener britischer Gefangener, Major Sam Derry vom Royal Regiment of Artillery», erklärt O’Flaherty. «Das Leben vieler Tausend Menschen hängt von ihm ab. Wenn du Italien liebst, schaff ihn in den Operationssaal. Sofort.»
Der junge Mann betrachtet ihn.
O’Flaherty hastet zum Krankenwagen, reißt die Tür auf.
«Andiamo, ragazzi», sagt er und deutet auf den Daimler. «Hoch mit euren Hintern. So ist’s recht, Männer. Packt mit an.»
Blut spuckend und seinen Unterleib umklammernd, taumelt Derry aus dem Wagen in die Nacht.
– 2 –
DIE STIMME VON DELIA KIERNAN
7. Januar 1963
Aus einem BBC-Recherche-Interview, Fragen nicht vernehmbar, geführt in White City, London
Wahrscheinlich trinke ich zu viel. Das erst mal vorab. Hat man Ihnen aber bestimmt schon verraten. Sie brauchen nicht um den heißen Brei herum zu reden.
Wir bereiteten einen Einsatz vor – Rendimento nannten wir das, italienisch für Aufführung –, für Heiligabend, elf Uhr nachts. Doch am Sonntag, fünf Tage davor, erkrankte Derry, unser Einsatzleiter, während er gerade observierte, und Angelucci wurde zum Ersatzmann bestimmt.
Wie denn das?, fragen Sie sich wahrscheinlich. Gute Frage.
Das Alter hat meinem Gedächtnis leider ein wenig zugesetzt. Zwar vergesse ich nichts, aber manchmal gerät die Reihenfolge meiner Erinnerungen durcheinander. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, wann ich den Monsignore zum ersten Mal traf. In Rom während des Kriegs, so viel ist klar. Verlangen Sie nicht von mir, dass ich ins Detail gehe, sonst muss ich mich erst mal für ein Nickerchen zurückziehen.
Nein, ich führte kein Tagebuch, Herzchen. Dazu hat mir die Geduld gefehlt.
Sie haben nicht zufällig eine Zigarette? Jetzt, wo wir so richtig einsteigen wollen.
Nein, nicht nötig. Ich habe Streichhölzer.
Als Frau eines hochgestellten irischen Diplomaten im Vatikan stand man dauernd auf offiziellen Empfängen herum, wurde von Erzbischöfen bequatscht und tat so, als hörte man ihnen zu. Man empfand eine Art Verpflichtung, sein Scherflein beizutragen, um die jungen Iren in der Stadt zu unterstützen, von denen die meisten einem Orden angehörten.
Ach, schätzungsweise fünfhundert in etwa, Priester und Nonnen. Viele Seminaristen. Aufgrund der Rationierung war es in Rom während des Kriegs schlecht um den Speisezettel bestellt – manchmal bekam man einen Monat lang keinen Kohlkopf, kein Hühnerbein in die Hände. Stattdessen schorfige Steckrüben. Armeekekse, die nach Sägemehl und Asche schmeckten. Würstchen, die so wenig Fleisch enthielten, dass man sie unbesorgt am Karfreitag hätte essen können.
Und viele dieser jungen Leute waren kaum erwachsen. Heutzutage würden wir sie als Teenager bezeichnen. Das Wort gab es damals nicht. Daher wirkten sie – wie soll ich es ausdrücken? – etwas verloren. Und erschöpft. Religiöse Kinder neigen dazu, die ganze Nacht wach zu liegen, denn um gläubig zu sein, braucht es Phantasie.
Einige waren gerade den kurzen Hosen entwachsen, und schon drohte ihnen das Priesteramt. Bei manchen fragte man sich, ob es nicht eher Mutterns Idee gewesen war als ihre eigene. Auch wenn mich der eine oder andere das nicht gern sagen hört, waren Nonnen häufig die jüngsten Töchter bettelarmer Familien, für die dieser Weg die einzig mögliche Zukunft war. Oder sie steckten mitten in der Pubertät und waren beeinflussbar, wie die meisten von uns in dieser Zeit. So manch eine pfiffige Mutter Oberin geht in den kleinen Schulen in Hutchesontown, Glasgow, auf die Jagd nach Berufenen. Annie, gerade mal dreizehn, hebt die Hand. Sie liebt die Muttergottes und den Blumenschmuck auf dem Altar. Und im Handumdrehen wird Annie ins Kloster gesteckt. Für den Rest ihres Lebens. Natürlich war das nicht bei jeder Novizin der Fall, aber man machte sich eben seine Gedanken.
Jedenfalls fühlte man sich, angesichts der Umstände, diesen Jugendlichen verbunden. Damals war Rom voller Angst und Hunger. Und der Sommer höllisch heiß, eine sengende, auslaugende Hitze. Im Park unserer prachtvollen Gesandtschaftsvilla gab es ein Schwimmbecken und bei sämtlichen Veranstaltungen und Feiern, an denen ich teilnahm, ließ ich verlauten, alle irischen Jugendlichen in der Stadt dürften ihn nutzen, und nannte ihnen auch die Straßenbahnlinien, mit denen sie von der Piazza del Risorgimento, gleich um die Ecke vom Vatikan, zu uns fahren konnten. Mein armer Tom verzweifelte schier an mir und bestand darauf, dass Männlein und Weiblein an getrennten Tagen schwimmen müssten. «Du bist eine Spaßbremse», sagte ich zu ihm. «Aber deswegen habe ich dich ja geheiratet.»
Im Ernst, natürlich stimmte ich seinem Kompromiss gern zu. Der Anblick dieser mageren Körper, die herumtollten und planschten, hätte ein Glasauge zum Weinen gebracht.
Daher führte ich ein, dass die Jugendlichen jeden Donnerstagabend in die Villa kommen durften, gewissermaßen als Abend der offenen Tür.
Ich ließ Terrinen mit köstlicher Minestrone auffahren und dieses herrliche lange italienische Brot, Sie wissen schon, und ein bisschen Obst, wenn ich welches auf dem Schwarzmarkt ergattern konnte – die Dienstmädchen der Gesandtschaft halfen mir dabei –, für ein paar Shilling war dort fast alles zu haben. Große Kessel mit Pasta, für ein Englisches Pfund bekam man so viel Spaghetti, dass man ein ganzes Bataillon hätte ernähren können. Dazu Oliven und ein oder zwei Käsesorten. Eine riesige, ofenheiße Lasagne. Außerdem ab und an Wurst und Speck aus Limerick, wenn es mir gelang, diese ins Diplomatengepäck zu schmuggeln. Eis oder pochierte Pfirsiche mit Zabaglione, manchmal sogar eine Zitronentarte. Ja, auch Wein. Warum denn nicht? Sie sollten sich in meinem Haus wohlfühlen. Wenn ihnen nach un bicchiere di vino rosso oder einer Flasche Stout war, was bei den wenigsten der Fall war, sollten sie das bisschen Alkohol genießen, ich wollte alles, was wir hatten, mit ihnen teilen. So bin ich erzogen worden.
Ich bin Katholikin, ich liebe meinen Glauben, so gut ich kann, aber die Kommunionbank küssen liegt mir nicht. Ganz und gar nicht. Zur Heiligen Maria eigne ich mich nicht. In allen Konfessionen gibt es gute Menschen und Schweine allererster Güte. Das Leben ist ein besserer Lehrmeister als jeder Katechismus.
Für Gästebewirtung in der Gesandtschaft war ein recht bescheidenes Budget vorgesehen. Ich trieb meinen unglücklichen Herrn und Meister in den Wahnsinn, weil ich es jede Woche überzog. Und wenn ich mich recht entsinne, konnte Dublin darüber ein wenig unwirsch werden. Es trafen dringliche Telegramme vom Außenministerium ein, die einen Beleg in dreifacher Ausfertigung für eine Flasche Prosecco forderten: RG, Betr., Datum, alles in Großbuchstaben. Mich kümmerte das nicht die Bohne, Herzchen. Wir werden noch lange genug im Grab liegen. Diese junge Frau ist nicht dafür bekannt, dass sie tut, was man ihr sagt. So ein kleiner wichtigtuerischer Bürohengst meint, er könnte bei meinereiner den großen Zampano spielen? Der kann mich kreuzweise im Mondenschein.
Am fraglichen Abend ging mir vieles durch den Kopf. Den Vormittag hatte ich im Tonstudio von Radio Roma verbracht, um eine Platte mit zwei Liedern aufzunehmen, die daheim in Irland herauskommen sollte. Ja, bevor ich heiratete, war ich Sängerin. Ich wollte meinen Beruf nicht ganz aufgeben.
An dem Tag? Ach, Herzchen, daran erinnere ich mich doch jetzt nicht mehr, wahrscheinlich Danny Boy und Boolavogue. Vielleicht The Spinning Wheel. Da müsste ich nachschauen.
Daheim hatte ich eine hübsche, kleine Karriere gehabt, die mich sehr erfüllte und anregte. Ehrlich gesagt fehlten mir die Konzerte und das ganze Herumreisen fürchterlich. Aber ’41 musste ich eine Pause einlegen, da wurde der Krieg schlimmer und Tom nach Rom versetzt. Am Abend, als die Luftwaffe Brandbomben auf das Theater von Belfast warf, hatte ich einen Auftritt. Das nennt man wohl eine durchwachsene Kritik.
Landauf, landab gab es in ganz Irland keine Stadt, in der ich nicht sang. Im Sommer auf der Isle of Man, in Liverpool, Manchester, oft in Dundee oder Ayrshire, einige Nächte in den Tanzsälen von Cricklewood. Ich habe in Durham, Kilmarnock, Northampton und sonst wo gesungen. Wenn eine Frau den ganzen Tag über ans Haus gefesselt ist, kann sie leicht ihr Selbstbewusstsein verlieren. Ich war immer der Meinung, in wem ein Lied klingt, der sollte singen.
Jedenfalls kommt an besagtem Abend dieser höfliche Kerl zu meinem fröhlichen Beisammensein und stellt sich als Monsignore O’Flaherty vom Heiligen Offizium vor. Da wurde mir ganz frostig ums Gemüt.
Monsignore ist ein Titel, den die Kirche einem Diözesanpriester verleiht, der seit fünf Jahren Dienst in der Kurie leistet. Er hat also ein gewisses Gewicht. Was nun das Heilige Offizium betrifft, das ist die Behörde des Vatikans, die ein wachsames Auge auf die sogenannte Einhaltung der Glaubenslehre hat und darauf achtet, dass alle spuren. Früher hieß sie Inquisition. Sie hat also auch Gewicht. Die wenigsten von uns freuen sich, wenn ein Inquisitor auf unserer Party erscheint.
Für gewöhnlich war es mir nicht recht, wenn an meinen Abenden zu viele hochgestellte Persönlichkeiten herumschwirrten, weil die Jugendlichen verkrampften und keinen rechten Spaß hatten, wenn die seltsamen alten Vögel anwesend waren. Eines Abends schlug ein Kardinal auf, dessen Name im Dunkeln bleiben soll: ein langes, schielendes Elend mit hervorstehenden Zähnen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat, das eine derartige Langeweile verbreitete, dass einem die Rotzpopel aus der Nase fielen. Es war, als hätte man einen Feuerwehrschlauch auf einen Kindergarten gerichtet. Er hatte eine Art zu lächeln, dass einem das Herz in der Brust gefror. Und was seine Selbstgefälligkeit betraf, wenn der eine Banane gewesen wäre, hätte er sich selbst geschält.
Aber dieser Monsignore war anders, bodenständig. Leutselig. Wie so viele aus Kerry hatte er etwas Verbindliches an sich. Damals verstanden sich zu viele Priester nicht als Verkünder der Barmherzigkeit, sondern als kleine, verkniffene Vorstadtrichter.
Hugh hatte es nicht so mit Autorität.
Noch etwas war anders, er war an jenem Abend auf einem Motorrad zu uns gekommen. Er schlendert also die Treppe zur Residenz rauf, staubgrau von den Stiefeln bis zum Helm, trägt Lederhandschuhe wie so ein Fliegerass und bekreuzigt sich im Eingangsbereich mit dem Wasser aus dem dortigen Weihwasserkessel, das aus Lourdes kommt. Als wäre ein Priester in diesem Aufzug das Alltäglichste der Welt. Und dazu der starke Geruch nach Motoröl. Ungewöhnlich.
Er sprach in schönstem Italienisch mit meinen Angestellten. Noch wusste ich es nicht, aber einen klügeren Kopf würde ich nie kennenlernen: Hugh hatte drei Doktortitel, beherrschte sieben Sprachen fließend, und sein Verstand war wie eine Rasenmäherklinge, er durchschnitt jeden Knoten und fand eine Lösung, wenn es denn eine gab.
Er schlendert also durchs Partyvolk, ein Glas limonata in der Hand, da ein Plauderwort, dort ein, zwei Witzchen. Zwei Studenten aus Liverpool spielten Schach, und er sah ihnen eine Weile zu, als sie die Partie beendet hatten, fragte er den Gewinner nach seiner Spielstrategie. Er rührte keinen Tropfen Alkohol an, aber es störte ihn keinen Deut, dass alle anderen ein Bierchen tranken. Nur zu. Ich nehme das Gleiche wie Sie.
Da war diese junge Frau aus Carrigafoyle, eine Karmeliternovizin, mit der unterhielt er sich blendend, und es stellte sich heraus, dass er daheim in Irland beim Golfspiel einen verstorbenen Onkel von ihr kennengelernt hatte, was für ein Zufall. Hugh war gewissermaßen auf einem Golfplatz aufgewachsen, wie Sie wahrscheinlich wissen. Sein Vater, ein ehemaliger Polizist, war in Killarney Golflehrer. Dann führten Hugh und die junge Karmeliterin – ich sehe die beiden immer noch ganz deutlich vor mir – der versammelten Gesellschaft mit einem Gehstock vor, wie man puttet. Man sprach über Angenehmes, kein Wort über den Krieg.
Ach, ich vergaß zu erwähnen, dass sein Name, als wir später Codenamen verwendeten, «Golf» lautete. Er war von der Vorstellung besessen, dass die Deutschen uns belauschten. Entflohene Gefangene hießen «Bücher», ihre Verstecke «Regale». Wir verwendeten nie die echten römischen Straßennamen, sondern dachten uns eigene aus, die auf Zahlen basierten wie in Manhattan. Oder wir benannten sie nach den großen italienischen Komponisten. Damit wir der Gestapo voraus waren, mussten wir die Codes ständig ändern. Dazu gleich mehr.
Tom war an diesem Abend nicht da, er besuchte drei Männer aus Dublin, die unvorsichtigerweise gegenüber den Fascisti eine kesse Lippe riskiert hatten und ins Regina Coeli, das römische Gefängnis, geworfen worden waren, nachdem man sie in ihrem Versteck aufgespürt hatte. Er war ohnehin selten bei meinen Treffen anwesend. Tat gern so, als missbilligte er sie, obwohl das gar nicht der Fall war. Irgendwann an dem Abend kam der Moment, als die Jugendlichen mich aufforderten zu singen. Einige von ihnen, oder wohl eher ihre Eltern, besaßen daheim in Irland meine Schellackplatten. In dem Sommer lief eine davon – Die Stimme von Delia Kiernan – ständig auf Raidió Éireann, auch im Third Service und auf American Forces Network. Der große Richard Tauber persönlich hatte in einem Interview gesagt, die Platte gefalle ihm, das war ein Grund, stolz zu sein. Der Monsignore redete mir zu, den Wunsch der jungen Leute zu erfüllen. «Los, Mrs Kiernan, sonst zertrümmern die Ihnen noch die Möbel.» Ich sagte, es gebe niemanden, der mich begleiten könne, und ohne dieses Sicherheitsnetz sei ich nervös. In Wahrheit hatte ich zwei Whiskey intus.
Er sei kein Paderewski, antwortete er, aber er werde so gut wie möglich improvisieren, wenn ich ihm die Tonart angab. Ich hatte an ein Lied in As gedacht, was für eine Stegreifbegleitung knifflig ist, doch ich könne es in A-Dur umbiegen, erklärte ich. Wir zwei also rüber zum Flügel, einem herrlichen alten Bösendorfer, und los ging’s. Es war ein altes Liebeslied, eine Arietta von Bellini, die mir seit Langem am Herzen lag – eine liebliche, leichte Melodie wie ein beschwingtes Volkslied. Sie erinnert mich immer an meinen Vater, Gott sei seiner Seele gnädig, denn sie gehörte zu seinen Lieblingsstücken. Anhand der Version von John McCormack, die er besaß, lernte ich als kleines Kind dieses Lied. Einige der Jugendlichen stimmten mit ein.
Vaga luna, che inargenti
Queste rive e questi fiori
Ed inspiri agli elementi
Il linguaggio dell’amor
War keine falsche Bescheidenheit von Hugh, wie er sein musikalisches Können eingeschätzt hat, muss ich schon sagen. Allmächtiger, ich habe viele schlechte Pianisten erlebt, aber der Gute schoss wirklich den Vogel ab. Er hatte Pranken wie Schaufeln, mit denen er unbeholfen herumklimperte. Trotzdem war es ein schönes Erlebnis, das im Gedächtnis blieb. In meiner Erinnerung verbinde ich Rom stets mit der Musik des Alltags: das Zuklappen eines Fensterladens an einem schwülen Nachmittag, die Verzückung, wenn man im Pantheon steht und die ersten Regentropfen fallen. Das erregte Gurren der Tauben, das Glucksen der Trinkbrunnen. Aber keine Musik war je süßer als der Gesang der Anwesenden an diesem Abend.
Es macht etwas mit einem Raum, wenn Menschen singen. Die Luft verändert sich wie bei Regen oder in der Dämmerung. Manche bezeichnen es als Eskapismus, aber mir erscheint das Leben dann wahrhaftiger.
Verzeihung. Bei dem Gedanken werde ich ganz rührselig.
So lernten wir uns also kennen und waren bald darauf gute Freunde. Gelegentlich kam er zu meinen Soireen und brachte ein, zwei Kameraden mit. Ja, Priester – einmal kam ein japanischer Franziskaner – oder Pilger aus der Heimat oder seinen geliebten Vereinigten Staaten, und immer eine Flasche ausgezeichneten Chianti dabei, nur der Allmächtige weiß, wie er an die rangekommen ist, obwohl er selbst nicht trank, wie schon gesagt. Manchmal brachte er ein kleines Fläschchen Brandy mit.
Ein gut situierter päpstlicher Conte hatte der irischen Gesandtschaft ein sündhaft teures Abo für eine Opernloge geschenkt, in die wir oft andere Diplomaten mit ihrer Familie einluden. Das unabhängige Irland war ein noch sehr junges Land, das darf man nicht vergessen, hatte erst 1921 seine Freiheit erlangt. Wir brauchten und schätzten die Solidarität anderer Länder. Von der Frau eines Diplomaten wurde erwartet, dass sie als Gastgeberin auftrat. Verdi erwies sich da manchmal gewissermaßen als Verbündeter.
An dem fraglichen Abend wären wir eigentlich zu siebt gewesen, aber dem portugiesischen Botschafter setzte die grauenvolle Hitze zu, die abscheuliche Kopfschmerzen verursachen konnte, man war dann wie gelähmt und bekam schwer Luft, daher lud ich den Monsignore ein, denn ich wusste, dass er Puccini liebte, außerdem spielt Tosca bekanntlich in Rom. Anwesend waren der schwedische Botschafter mit Ehefrau, der Schweizer Kulturattaché – eine Teilzeitstelle, wie sie im Buche steht – sowie eine Freundin, der Monsignore und meinereine samt Gatten. «Ein Aufstand der neutralen Staaten», scherzte Hugh beim Händeschütteln. «Unser Grüppchen könnte sich nicht mal den Weg aus einer Mausefalle freischießen.»
Der schwedische Botschafter lachte, der Schweizer Kulturattaché nicht, wenn ich mich recht entsinne, der sich auch verständlicherweise daran störte, dass Hugh die gesamte Aufführung über in ein Notizbüchlein kritzelte. Eine von Hughs Eigenarten: Wenn etwas nicht schwarz auf weiß dasteht, hat es nicht stattgefunden. Selbst die Marginalen seiner Bibel waren vollgekritzelt. Wie dem auch sei. Das ist eine andere Geschichte. Wo waren wir stehen geblieben?
Ach ja.
Es muss Ende ’42 gewesen sein, da versank er in eine Schwermut, wie ich sie noch nie erlebt habe. Eine Zeit lang hatte er als offizieller Beobachter des Vatikans die italienischen Kriegsgefangenenlager der Achsenmächte besucht. In jenem Herbst muss etwas mit ihm geschehen sein. Er war nicht mehr derselbe. Kam nicht mehr zu meinen Abenden, tauchte eine Weile unter. Jemand erzählte mir, er sei krank gewesen, habe Krebs gehabt und im Krankenhaus überlegt, ob er nicht in Massachusetts Gemeindearbeit tun sollte. Mein Tom hörte über den Flurfunk im Vatikan, dass er eventuell seinen Kragen ablegen wolle. Doch als er sich endlich zu einem Treffen mit mir bereit erklärte, sagte er, das stimme alles nicht, er sei beschäftigt gewesen, mit einer persönlichen Angelegenheit, wie er es nannte.
Als wir damals miteinander sprachen, hatte es schon seit Tagen geregnet und der Fluss war angestiegen, es war einer jener Abende, an denen der Tiber an den Baumwurzeln leckte. Ob er in Schwierigkeiten stecke, erinnere ich mich, ihn gefragt zu haben. Ob er jemanden zum Reden brauche?
Denn, um ehrlich zu sein, hörte man gelegentlich von Priestern, bei denen eine Frau im Spiel war. Die menschliche Natur lässt sich nicht unterdrücken. Wir werden uns kurz vor knapp nicht mehr ändern. Manch guter Mann fand heraus, dass der Zölibat nichts für ihn war, aber wenn er austrat, wurde er von der Kirche geächtet. In aller Regel schickte man solche Kandidaten in ein heruntergekommenes Hinterhofhotel, wo in einem Zimmer auf dem Bett ein Anzug aus dem Pfandhaus sowie drei Pfundnoten lagen. Der Mann zog seine Kutte aus, legte sie ordentlich zusammengefaltet aufs Bett, schlüpfte in den Anzug eines Toten und verließ das Hotel durch den Hinterausgang. Sie wussten, dass niemand aus ihrem alten Leben je wieder Kontakt mit ihnen aufnehmen würde. So machte die Kirche diesen Männern das Aussteigen schwer. Deshalb sind viele geblieben. Zu viele.
Nach all den Jahren kann ich gestehen, dass ich da eine bestimmte Dame im Sinn hatte, eine junge, seit Kurzem verwitwete Contessa, die man in ganz Rom in Hughs Begleitung in Kunstgalerien und ähnlichen Kultureinrichtungen sah, beide aus unterschiedlichen Gründen ganz in Schwarz. Eine Schönheit war sie, sah ein wenig wie ein gamine aus, wie die Franzosen die leicht knabenhafte Erscheinung eines Filmstars wie Leslie Caron nennen. Wir wurden enge Freundinnen, vor nicht einmal zwei Stunden habe ich mit ihr telefoniert. Wie jede Festung ist auch der Vatikan ein Hort des Neids und des Gemunkels. Ich weiß ganz sicher, dass die Gerüchte um ihre Freundschaft mit Hugh jeglicher Grundlage entbehrten. Kein Rauch ohne Feuer, heißt es bei den Klatschbasen. Ich sage immer, vielleicht ist da gar kein Rauch, sondern du solltest mal wieder deine Brille putzen.
Jedenfalls lachte er, als ich ihren Namen erwähnte. Die persönliche Angelegenheit, die er erwähnt habe, sei ganz anderer Natur, versicherte er mir. «Aber danke fürs Kompliment, Delia.»
Als ich nachbohrte, zeigte er mir einen Papierfetzen, einen Brief, der aus einem Kriegsgefangenenlager hinausgeschmuggelt worden war und von einem armen schottischen Jungen stammte, der kurz vor der Exekution stand. Der Arme hatte gebeten, dass er an seine Mutter weitergeleitet werden sollte. Die Worte des Briefes, die bevorstehende Hinrichtung – geben Sie mir bitte einen Augenblick – hatten sich zwischen Hugh und seinen Schlaf gedrängt.
Ich weinte, als ich den Brief las. Gab ihn Hugh zurück und weinte wieder. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht für diese Mutter bete.
Im Sommer darauf durchlitten wir die amerikanischen Bombardierungen, die ich nie vergessen werde. Vermutlich kann nur, wer selbst einen Luftangriff erlebt hat, diesen Horror nachempfinden. Kein Film kann das je einfangen. Die Schreie. Den Geruch. Die wochenlang blank liegenden Nerven.
Ein B-25-Mitchell-Bomber hat die Größe eines Londoner Busses. Man schaut nach oben, und da fliegen vierzig von ihnen, die Fünfhundert-Pfund-Bomben regnen lassen. Eine Straße wird davon nicht beschädigt, sie wird ausgelöscht. Platt gemacht. Ein Trümmerfeld aus stinkendem Rauch und zerbröselten Backsteinen. In der Nacht davor warfen die Flugzeuge achtzigtausend Flugblätter ab, auf denen stand, was am nächsten Tag passieren würde. Das Grauen hatte also genügend Zeit, einem in jedes noch so kleine Knöchelchen zu kriechen. Einer dieser Luftangriffe ereignete sich während einer meiner Donnerstagssoireen. Ich werde nie vergessen, wie sehr sich die jungen Leute fürchteten, sie weinten in Todesangst.
Mittlerweile hatte Hugh mitbekommen, dass gewisse Personen in Rom – eine hier, jemand anders dort – entflohenen alliierten Gefangenen und Juden halfen, in die Schweiz zu gelangen, und unterstützte sie heimlich, nicht in großem Maßstab, aber indem er unter falschem Namen Zugfahrkarten kaufte, Kleidung besorgte. Es geschah alles spontan und war nicht organisiert. Hugh hatte zwischenzeitlich viele Freunde in der Stadt, er gehörte nicht zu jenen Priestern, die im Gotteshaus essen, schlafen und sterben. Er spielte mit dem Gedanken, eine Gruppe zu gründen, um Geld für die Flüchtlinge zu sammeln und ihnen ein wenig unter die Arme zu greifen, aus der Entfernung, unter der Hand.
Diskret. Informell. Alles heimlich, still und leise.
Tom sollte ich lieber nicht einweihen, auch sonst niemanden aus der Botschaft. Es sei völlig gefahrlos, die Gruppe werde ausschließlich im Hintergrund wirken, wie eine Wohltätigkeitsorganisation.
Wenn ich gewusst hätte, wohin das führen würde, hätte ich umgehend das Weite gesucht.
Er überlegte, wie wir uns tarnen könnten.
Als Chor.
– 3 –
Montag, 20. Dezember 1943 6.47 Uhr
Noch 112 Stunden und 13 Minuten bis zum Rendimento
Ein paar Stunden nach der Fahrt zum Krankenhaus stürzt sich ein Schnupfen auf ihn. Durchdringendes Niesen, trockener Husten, Schüttelfrost, tränende Augen. Die Angst packt ihn, dies könnte der Anfang der gefürchteten Römischen Grippe sein, die im letzten Winter ein Dutzend seiner afrikanischen Erstsemester und neun seiner Chicagoer Studenten dahingerafft hat.
Erschöpft erzwingt er kurz vor Morgengrauen den Schlaf. Der Daimler röhrt durch seine Albträume.
Und verwandelt sich in den Mercedes des Gestapo-Chefs, Hauptmann. Sie schrauben sich durch unglaublich enge, gewundene Straßen einer Stadt, die gleichzeitig Rom und doch nicht Rom ist. Eichen. Blitze. Blutstropfen im Sand. Regen, der Muster auf ein Fenster zeichnet. Riesige Türme. Ein Brunnen, so tief, wie der Mond hoch steht. Gesichter, die zu Stein werden, während eine Nocturne von Chopin erklingt, ausdruckslos, gebrochen, ohne Hoffnung. Jetzt sitzt Hauptmann an seinem Bett, ein Mann wie ein Virus. Er hat Angst, ihn beim Luftholen einzuatmen. Sagen Sie mir, wen Sie getroffen haben. Sagen Sie mir, warum Sie diese Menschen getroffen haben. Die grauen Augen des Nazis. Graue Infanterietressen auf den Ärmelaufschlägen. Der graue Rauch seiner grauen Zigaretten. Die Wölfin, die auf einem Fresko Romulus und Remus säugt, wird lebendig und schlabbert ihre hungernden Kinder ab, ehe sie diese verschlingt.
Um zehn Uhr verlässt er sein Zimmer, geht unsicher hinüber ins theologische Seminar und beginnt seine dreistündige Vorlesung über Thomas von Aquin, die er auf Latein vor neunzig Seminaristen halten muss. Der Eisregen der vorigen Nacht graupelt immer noch in seinem Kopf, als er Halt suchend das Rednerpult umklammert, die gelben Fenster des Hörsaals wackeln. Die Studenten im dritten Jahr sind sehr aufgeweckt. Ihre Fragen schwirren wespengleich. Das heiße Wasser mit Zitrone, das er aufs Podium mitgenommen hat, schmeckt nach Schlamm und Bleistiftspänen.
Anschließend widmet er sich, in eine Decke gehüllt, den Benotungen ihrer Semesterabschlussprüfungen, schafft aber nur dreißig Arbeiten, ehe er sich aufs Krankenlager zurückziehen muss. Die restlichen sechzig zensiert er zwischen lidzuckendem Halbschlaf und hässlichen Hustenanfällen. Sein pfeifender Atem rast wie ein wild gewordener Köter im Zimmer umher. Sein Brustkorb steht in Flammen.
Kein Wort von Sammy Derry.
Über ihm Bomber.
Vielleicht kommt morgen eine Nachricht.
…
Abschrift eines Berichts, aufgenommen mit Magnetophon der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft AG
Hier spricht Obersturmbannführer Paul Hauptmann. Zu Händen Dollman, vertraulich. 20. Dezember ’43, Gestapo-Hauptquartier, Rom.
Erneuter Anruf von Himmler. Tobte, drohte. Außer sich, dass feindliche Gefangene in großer Zahl aus den italienischen Lagern fliehen. Sagt, die meisten flüchten Richtung Rom, wollen Asyl im Vatikan. Mir ist bewusst, dass Sie beschäftigt sind, aber ich habe meine Meinung geändert. Nehmen Sie einige der Verdächtigen unter die Lupe, über die wir uns unterhalten haben, darunter den bereits erwähnten, lästigen Priester. Ich weiß, Sie sind der Meinung, da steckt nichts dahinter. Wir müssen dem nachgehen.
Hören Sie sich um, haken Sie nach. Werden Sie rabiat. Die üblichen Spitzel einsetzen. Finden Sie heraus, ob er einen falschen Namen benutzt.
Ich schicke Ihnen mein Dossier über diesen Mann. Füllen Sie die Lücken und senden Sie die Mappe vor Weihnachten zurück.
Verhalten Sie sich diskret. Bleiben Sie im Hintergrund.
Dieses Unkraut muss mitsamt der Wurzel herausgerissen werden.
Unsere Pläne dürfen unter keinen Umständen torpediert werden.
Heil Hitler.
…
Dienstag, 21. Dezember 3.04 Uhr
Noch 91 Stunden und 56 Minuten bis zum Rendimento
Beim Aufwachen frühmorgens fällt ihm ein, dass sich heute seine Priesterweihe zum achtzehnten Mal jährt. Fiebrige Gedanken durchfluten ihn. Er sieht sich selbst an jenem Morgen vor dem Altar der Kathedrale liegen, dann mit gebundenen Händen, wie zu diesem Anlass üblich, den Gang zurückschreiten, die kerzenbeschienenen Habichtsgesichter der Bischöfe.
Bei Sonnenaufgang driftet er in eine zuckende, knackende Röte, die kein Schlaf ist, in ein Land, in dem sogar Kerzenständer Stimmen haben. Als er daraus auftaucht, rührt er in dem Glas mit Medizin, das ihm jemand auf den Nachttisch gestellt hat, und bekommt zwei Schlucke hinunter, ehe er trocken würgt.
Selten hat er so etwas Eigenartiges gesehen wie das Stück Zitrone auf dem Kupferlöffel neben dem Wecker, so gelb, dass es grün ist, so grün, dass es blau ist, der Geruch kriecht ihm die Nebenhöhlen hoch wie ein mitternächtlicher Einbrecher, bis tausend Insektenbeine daraus sprießen, die auf den Kissen herumwuseln und ein niederträchtiges, lästiges Summen verströmen, das sich in das Brummen einer Oboe verwandelt.
Ein Traum voller Wörter, die ihm wie Würmer aus den Ohren gleiten.
Im Zimmer stinkt es. Er stößt das Fenster auf.
Unten auf der verregneten Straße steht Hauptmanns schwarzer Mercedes.
Während er noch schaut, gehen die Scheinwerfer aus.
…
Abschrift eines Berichts, aufgenommen mit Magnetophon der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft AG
21. Dezember ’43, Gestapo-Hauptquartier, Rom, Hauptmann, zu Händen von Dollman. Vertraulich.
Heute Abend war ich mit dem Auto in der Nähe des Vatikans unterwegs. Aus einer Eingebung heraus beschloss ich, das Kolleg auszukundschaften, in dem HO’F wohnt. Das Gebäude sieht unwirtlich aus, hat einen eigenen Friedhof. Ziemlich schauerlich. Die Art Ort, bei dem man an Vampirpriester denkt. Um Mitternacht kam der Pförtner heraus, schloss aber die Tür nicht ab. Ich riskierte es und trat ein. Der Korridor war dunkel. Religiöse Bilder, ein effekthascherisches Kruzifix, der übliche Ramsch. Ein Stapel Post für die Bewohner; beim Durchsehen nichts für HO’F. Ich wollte die Treppe hinauf, hörte aber männliche Stimmen, die sich unterhielten (vermutlich Studenten). Überprüfen Sie, ob wir jemanden, der dort arbeitet, unter Druck setzen können. Einen Bediensteten oder eine Aushilfe. Vielleicht einen der anderen Priester. Die Kosten übernehmen wir.
…
Mittwoch, 22. Dezember 11.49 Uhr
Noch 59 Stunden und 11 Minuten bis zum Rendimento
Als er aufwacht, ist das Fieber gesunken. Seine Haut fühlt sich an wie neu. Im Zimmer riecht es nach Holzrauch und Bienenwachs.
Traurig läuten die Glocken des Petersdoms den Mittag ein. Frauen singen das Angelus.
Seiten seines Notizbuchs sind über die Daunendecke verstreut. Entsetzt erkennt er darauf in seiner Handschrift die Namen der Chormitglieder, Adressen der Verstecke. Er rafft die Blätter zusammen, zerreißt sie und wäscht sich die Tinte von den Fingern. Auch die Laken und der Kopfkissenbezug sind schwarz beschmiert. Der verräterische Füller auf seinem Nachttisch.
Manche Wintertage in Rom haben eisblaue Augen, einen frostigen Blick, der einen erstarren lässt.
Er holt seine Dartpfeile aus der Nachttischschublade, steht schwankend vor der Dartscheibe, die an der Innenseite der Tür hängt. Die kalten Pfeile liegen schwer in seiner Hand, sie ziehen ihre Flugbahn von seinen Fingerspitzen in die Segmente der Scheibe. Flugbahnen wie Fluchtrouten.
Wtsch.
Ftsch.
Doppel 20.
Einhundert.
Dann das zornrote Bull’s eye.
Als schriebe man etwas auf. Luft in Zahlen nageln. Seine Angst schwindet. Zieht man an den Pfeilen, lassen sie sich herausziehen. Wirft man sie präzise, bohren sie sich in die Scheibe. Ein Schlachtfeld aus Kork und Metall, wo ein zugekniffenes Auge ein Dolch ist.
Die Minuten vergehen im Spiel. Eine Stunde verrinnt. Er wägt die Würfe ab, plant, überlegt. Versucht, wie Hauptmann zu denken, zu kalkulieren, er zu sein. Trottet tausend Meter übers Linoleum zwischen Wurflinie und Scheibe, Scheibe und Wurflinie, geflügelte Fluchten in der Hand, geheime Routen im Kopf, und jeder Wurf rettet einen Entflohenen, jedes Wtsch macht Hauptmann fuchsteufelswild.
Er nimmt die Mappe mit den Zeitungsausschnitten, die er in der deutschen Abteilung der Vatikanbibliothek zusammengetragen hat, Artikel aus Zeitungen, in denen Hauptmann erwähnt wird: regionale und überregionale Blätter, Parteipublikationen, da eine Erwähnung in einem Nebensatz, dort ein kurzer Absatz, sogar ein Profil in der Festzeitung der Oberprima anlässlich der Reifeprüfung, damals in Stuttgart. Kenne deinen Feind, heißt es. Sieh durch seine Augen. Eine Fotografie, auf der er einen Wanderausflug der Hitlerjugend anführt. Seine Verlobungsanzeige. Name der Frau: Elise. Zwei Kinder, eines davon adoptiert. Trat ’34 der SS bei. Schloss ’38 die Führerschule der Sicherheitspolizei ab. Ehemaliger Kriminalkommissar. Der Absolvent mit den größten Karrierechancen.
Hin und wieder wirft er sich einen verschlissenen Morgenmantel über und schleicht barfuß in den Eingangsbereich hinunter, unter dem Vorwand, er erwarte einen Weihnachtsbrief von daheim, aber es ist keine Nachricht über Sam Derry eingetroffen – auch sonst nichts.
Er versucht, im Krankenhaus anzurufen, bei Delia Kiernan und der Contessa, aber die Leitungen des Vatikans sind tot; niemand weiß, wann sie repariert werden. Im heutigen Leitartikel des «Messaggero» wurde angedeutet, dass die Nazis die Leitungen gekappt hätten, da der Einmarsch in Vatikanstadt in wenigen Tagen bevorstehe.