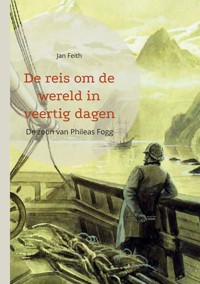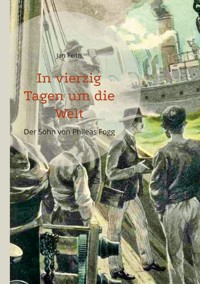
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ich, Phileas Fogg, vermache hiermit mein Vermögen, mein Archiv und meine Wohnung meinem einzigen Sohn, James Fogg, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass er mir die hier folgende Aufgabe erfülle: Um meine Tradition, die von Phileas Fogg, hochzuhalten, soll mein Sohn eine Reise um die Welt in der Hälfte der Zeit vollbringen, welche meine Reise um die Welt dauerte.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Nachbemerkung
Kapitel I
Worin Phileas Fogg verstirbt.
Am 1. Juli des Jahres 1908 starb Mister Phileas Fogg.
Er verstarb, wie man es von einem englischen Gentleman seines Schlages erwarten würde.
Es trug sich in London zu, in dem bekannten Haus in der Savile Row Nr. 7, im in der ganzen Welt bekannten Studierzimmer. Dieses wurde beinahe ganz von dem berühmten Bücherregal eingenommen; die schlichte goldene Ledertapete über der schweren, hohen Vertäfelung wurde bloß von zwei Porträts und einer Weltkarte geschmückt.
An der breiten Wand hing das Porträt einer jungen, schönen Frau östlichen Gepräges – das war Mrs Fogg. Daneben hing das Porträt eines Mannes mit einem offenen, frischen Antlitz, lockigem Haar über einem lachenden Gesicht mit zwei Backenbärten – das war Mister Passepartout. Die schmale Seite des Zimmers wurde wie gesagt von der großen Weltkarte eingenommen, über die mit roter Tinte eine dicke Linie gezogen war. Sie verlief von London über Paris und Brindisi, durch das Rote Meer nach Kalkutta, Bombay, über Singapur nach Shanghai, Yokohama, San Francisco, quer durch die Vereinigten Staaten nach New York und anschließend in gerader Linie wieder nach London. Unter der Karte stand das Bücherregal.
In dieser Umgebung hatte Phileas Fogg, abgesehen von den achtzig Tagen, die er auf seiner Reise um die Welt zugebracht hatte, sein ganzes Leben verbracht. Somit starb er hier auch in seinem Lehnstuhl sitzend, der auf seinen üblichen Platz vor dem Bücherregal geschoben war.
In diesem Raum befand sich in diesem Augenblick sein Sohn, James Fogg, der durch das einmalige Betätigen der Klingel verständigt worden war, dass sein Vater seine Anwesenheit verlangte. Außerdem stand da noch, hinten im Zimmer im Schatten der Türvorhänge, als ob er nicht dazu gehörte, der Notar; dieser wurde gemäß Absprache durch zweimaliges Betätigen der Klingel herbeigerufen.
Nachdem beide Herren das Studierzimmer betreten hatten, glaubte Phileas Fogg, der Augenblick sei gekommen, das Zeitliche mit dem Ewigen zu vertauschen. Er tat dies, wie gesagt, genau auf dieselbe Weise, wie er gelebt hatte: gemessen, steif, korrekt.
Bevor er seine Augen schloss, die die ganze Welt gesehen hatten, griff er langsam mit seiner Hand in die Innentasche seines Jacketts, welches er stets, auch in diesem feierlichen Moment, trug, und zog einen Umschlag heraus. Diesen überreichte er dem Notar. Dann streckte er seinem Sohn zwei Finger seiner Hand entgegen. Diese drückte der ebenso steif, wie sie ihm entgegengestreckt wurden.
Doch Phileas Fogg, der in seinem Leben nie ein Wort zu viel gesprochen hatte, schien vor seinem Tod noch etwas sagen zu wollen. Sein Sohn beugte sich vor, der Notar trat lautlos näher.
»Pass … Am-ster-dam«, klang die Stimme von Phileas Fogg beinahe unhörbar.
Das war alles.
Die Welt zählte einen großen Mann weniger.
Phileas Fogg wurde am 1. Juli des Jahres 1828 in diesem Zimmer geboren, und gemäß den Notizen seines Vaters, der gleichfalls ein Muster an Gewissenhaftigkeit gewesen war, hatte sich dieses bedeutende Ereignis morgens um fünf Uhr zugetragen. Mithin wartete Phileas Fogg, bis seine Uhr genau fünf Uhr anzeigte, drückte dann den Sekundenzeiger fest und tat vollkommen korrekt seinen letzten Atemzug.
Er war somit exakt achtzig Jahre alt geworden, eine Zahl, an der ihm – wie man sich vorstellen konnte – viel gelegen war.
Als James Fogg seines Vaters Augen geschlossen hatte, trat er an die große Weltkarte und steckte mit fester Hand einen Trauerflor, der schon bereitlag, an die Stelle, wo ein großer Punkt die Lage von London angab. Das war bereits zuvor von seinem Vater so verfügt worden. Danach zog er die Vorhänge zu, um das frühe Morgenlicht nicht hineinzulassen.
In diesem Augenblick trat der Notar aus dem Schatten der Tür nach vorn. Er nahm sein Brillenetui, klappte seine Brille auf und setze sie auf die Nase. Das gehörte möglicherweise nicht zum verfügten Ablauf. Doch die folgenden Handlungen waren gewiss entsprechend den Vorschriften des Verstorbenen.
Der Notar trat an den Tisch, öffnete mit dem bereitliegenden Brieföffner, dessen Knauf die Form einer Weltkugel hatte, den Umschlag, welchen Phileas Fogg ihm übergeben hatte; er nahm daraus ein kleines Blatt versiegeltes Pergament und las, ohne Eile, ohne Betonung, doch mit deutlicher und klarer Aussprache eines jeden Wortes, so wie es altmodische und gewissenhafte Notare, von denen er einer war, den Inhalt vor.
Dieser lautete:
»Ich, Phileas Fogg, vermache hiermit mein Vermögen, mein Archiv und meine Wohnung meinem einzigen Sohn, James Fogg, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass er mir die hier folgende Aufgabe erfülle: Um meine Tradition, die von Phileas Fogg, hochzuhalten, soll mein Sohn eine Reise um die Welt in der Hälfte der Zeit vollbringen, welche meine Reise um die Welt dauerte.
Phileas Fogg«
Der junge Fogg war unbeweglich neben dem Stuhl stehen geblieben, wo der Leichnam seines berühmten Vaters ruhte.
Der Notar schwieg, faltete das Papier und auch seine Brille wieder zusammen, steckte Ersteres in den Umschlag, Letzteres in das Brillenetui und sprach im selben Ton, in dem er vorgelesen hatte: »Mister Fogg, ich frage Sie Kraft meines Amtes, ob Sie bereit sind, der Bedingung dieses Testamentes Ihres Vaters nachzukommen? Mister Phileas Fogg machte seine Reise um die Welt vom 2. Oktober bis zum 20. Dezember des Jahres 1872. Das waren achtzig Tage. Das Testament von Mister Phileas Fogg stellt Ihnen die Aufgabe, Ihrerseits nun eine Reise um die Welt zu machen.«
Nur die letzten Worte hatte der Notar ein wenig nachdrücklicher gesprochen, da selbst ein Notar, zumal er während eines Menschenlebens der Whist-Genosse von jemandem wie Phileas Fogg gewesen war, einen Moment der Rührung haben mochte. Dieser Augenblick war jedoch unendlich kurz, denn in seinem eintönigen Notarton fuhr er fort: »Darf ich Ihnen, James Fogg, nun die folgende Frage stellen: Sind Sie bereit, Ihres Vaters letzten Willen durch eine Reise um die Welt in vierzig Tagen zur Ausführung zu bringen?«
James Fogg stand noch in derselben Haltung da. Ohne es sich zu überlegen, aber auch ohne die geringste Gefühlsregung zu zeigen, kam seine Antwort: »Ja.«
James Fogg, der Sohn von Phileas Fogg, hatte noch keinen Schritt aus London hinaus unternommen. Diese Antwort, seines Vaters würdig, war somit nicht ohne Bedeutung.
Während er die Sorge um das Begräbnis der sterblichen Überreste seines Vaters dem Notar überließ, trat er an die Wand des Zimmers, an der die große Weltkarte hing. Er blieb breitbeinig davor stehen, die Hände steckte er in die Taschen seines Norfolk-Jacketts; so schaute er.
Erst starrte er auf den Punkt, wohin er den Trauerflor gesteckt hatte, dann drehte er seinen Kopf mit der Präzision eines Zeigers von links nach rechts. Das ging sehr langsam, als ob eine Feder sein Haupt um eine Achse drehte.
Doch weiter als bis zum anderen Ende der Karte drehte er den Kopf nicht.
Das hatte genau eine halbe Stunde gedauert. Man konnte das wissen, da die Uhr auf dem Kaminsims nicht allein volle halbe Stunden mit »God save the King« angab, sondern auch alle fünf Minuten einige Takte verschiedener internationaler Volkslieder spielte. So hatte die Uhr das niederländische und das deutsche Volkslied bereits angestimmt, dann das russische und japanische geklimpert, danach gab sie fünf Takte von »Yankee Doodle« zum Besten.
Und gleichzeitig mit diesen internationalen Uhrenmelodien waren die Gedanken von James Fogg jeweils fünf Minuten bei jedem dieser Länder verweilt. Als fünfundzwanzig Minuten vorbei waren und das Pony von »Yankee Doodle« still stand, hatte seine Vorstellungskraft ihn durch die Niederlande, Deutschland, Russland, Japan und Amerika wieder zurück nach England geführt.
Eine halbe Stunde vor einer Weltkarte zu stehen, mochte lang erscheinen, um solch einen Ausflug um den Globus zu machen, aber James Fogg hatte in dieser Zeit mehr getan, als sich entlang der imaginären Linie, welche die Volksweisen der Uhr seines Vaters ihm von selbst angaben, zu bewegen. Seine Gedanken gingen mit Riesenschritten bei jedem neuen Motiv von Land zu Land.
Es kam James Fogg so vor, als verweilte er selbst während jedes dieser Fünfminutenabschnitte, welche ihm auf die Sekunde zugewiesen wurden, in einem dieser Länder.
Das war weniger befremdlich für ihn, als man denken könnte, da es nirgends das erste Mal war, dass er dort in Gedanken verweilte. Eigentlich war er überall zu Hause! Die Uhr hätte nötigenfalls alle Volkslieder der Welt spielen können – was sie übrigens des Sonntags in einem klimpernden Potpourri vollbrachte –, James Fogg hätte, ausgehend vom Klang dieser Landeshymnen, ohne jedwedes Zögern den ganzen Erdball von Nord nach Süd, von West nach Ost in seiner Vorstellung durchwandern können.
Der Lehnstuhl seines Vaters hatte immer rücklings vor dem großen Bücherregal gestanden; nicht von ungefähr nahm das Regal eine ganze Wand des Zimmers ein. Es war in fünf Abschnitte unterteilt, was sofort an den fünf Farben zu erkennen war, in denen die Bücher eingeschlagen waren. Es waren die Farben der fünf Erdteile; Europa war in Weiß, Asien in Gelb, Amerika in Rot, Afrika in Schwarz und Australien in Grün eingeschlagen.
Wenn sich der Dichter des geflügelten Wortes »Alles, was in Büchern steht, ist in diesen Kopf gegangen« nach einem zweiten Vorbild hätte umsehen wollen, dann hätte er es mit dem Kopf des jungen Fogg zur Hand gehabt.
Phileas Fogg war zeit seines Lebens ohne Zweifel ein Sonderling gewesen.
Hatten manche seine Reise von achtzig Tagen als nichts anderes durchgehen lassen wollen als eine sonderbare Schrulle des französischen Schriftstellers Jules Verne?
Doch in der eigenartigen Weise, auf die Fogg seinen Sohn James erzogen hatte, lag dann doch eine gehörige Portion Fogg’scher Fantasie und Philosophie.
Dass der einzige Sohn von Phileas Fogg eine besondere Erziehung genießen sollte, lag auf der Hand; man war nicht von ungefähr der Sohn eines berühmten Vaters. Und dass solch ein Vater den Grund für seinen weltweiten Ruhm als Richtschnur zur Erziehung seines Sohnes nehmen würde, schien in diesem Fall nur natürlich.
Ohne den traurigen Zwischenfall, der Phileas Fogg zum Witwer gemacht hatte, würde der junge Fogg möglicherweise eine Erziehung erhalten haben, in der die Charakterzüge des Vaters wie auch der Mutter im Gleichgewicht gewesen wären. Als aber Mrs Fogg, die schöne Aouda, bereits einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes durch den Meuchelmord eines Brahmanen aus der Region Bundelkhand gestorben war, ging die ganze Sorge für die Erziehung des Sohnes auf das Konto des Vaters.
Und dieser erfüllte diese Aufgabe auf vorbildliche, wenn auch etwas sonderbare Weise.
Nach seiner großen Reise um die Welt war Phileas Fogg nicht mehr gereist. Falls sich die Gelegenheit oder auch die Notwendigkeit ergeben hätte, dann wäre er sogleich wieder bereit gewesen, um die Menschheit aufs Neue über die Art in Erstaunen zu setzen, mit der ein englischer Gentleman, der sich einmal etwas vorgenommen hatte, sein Ziel zu erreichen wusste. Phileas Fogg war wirklich mit seinem Ruhm zufrieden gewesen. Die Welt und sein Name waren doch für immer miteinander verbunden? Warum sollte er den Erdball neuerlich bereisen? Konnte er sich selbst übertreffen? Zweifellos ja – falls die Umstände derlei vorgeschrieben hätten! Doch es gab kein Mitglied des Klubs, das jemals wieder daran gedacht hätte, Phileas Fogg zu einer neuen Wette zu bewegen; man wusste nämlich schon im Vorfeld mit Sicherheit, dass er auch diese gewinnen würde.
Und mangels eines Anlasses war daher der Weltreisende, der die Länder und Meere unseres Erdballes bereist hatte, als ob es für ihn keine Entfernungen, kein Ungemach, keine Schwierigkeiten, keine Gefahren zu bestehen gäbe, wieder zu seinem ruhigen Leben eines Einwohners von London zurückgekehrt.
Doch hatte es in seinem Leben eine Veränderung gegeben.
In dem einen Jahr, in dem er so glücklich mit der schönen Aouda vermählt gewesen war, hatte er sich ganz und gar dem häuslichen Leben gewidmet. Nur einmal in der Woche ging er abends in den »Reform Club« und spielte dort des Samstagabends seine Partie Whist an demselben Tischchen, mit denselben Mitspielern. Nachdem seine Frau gestorben war, nahm er sein Leben als ständiges Klubmitglied nicht mehr auf. All seine Zeit widmete er fortan seinem Sohn.
So wurde James ganz und gar das Produkt seines Vaters.
Die Reise um die Welt war der Grund für den Ruhm von Phileas Fogg gewesen, somit sollte die Erziehung des Sohnes ausschließlich in diese Richtung geleitet werden.
James war von frühester Jugend an von Gegenständen umgeben, welche in engstem Zusammenhang mit dem Bereisen der Welt standen. Die internationalen Weisen der bereits erwähnten Uhr waren die erste Musik, welche auf sein Kinderohr traf; die ersten Farben, auf die sich seine Augen richteten, waren die der fünf Fächer im Bücherregal; die ersten Worte, die er zu stammeln lernte, waren die Namen der fünf Erdteile; seine erste Buchstabierübung lehrte ihn sein Vater aus der »Travelling Gazette«; sein erstes Spielzeug war eine Mininaturerdkugel.
Auf diese Weise formte Phileas Fogg seinen Sohn James.
Der Vater lebte im quirligen London das Leben eines gelehrten Einsiedlers, der jedes der Länder auf der Welt, über das nur ein Buch erschien, gierig als Studienmaterial betrachtete. Er las es von A bis Z seinem Sohn vor und schob es dann gemäß der Farbe des Bandes, in welche er es selbst eingeschlagen hatte, auf die endlosen Bretter des Regals. Und fing wieder mit einem anderen an.
Das Sonderbare dieser Unterrichtsmethode, welche an sich nicht unpraktisch genannt werden konnte, lag wohl darin, dass der Vater offenbar nicht daran dachte, seinem Sohn irgendeine praktische Anwendung mit dieser besonderen Lehrmethode zukommen zu lassen.
Er ließ seinen Geist – und den seines Sohnes – reisen, während ihre Körper gemütlich zu Hause im Studierzimmer in der Savile Row blieben.
So gestaltete sich die Erziehung des Sohnes von Phileas Fogg.
Und der würdige Sohn eines würdigen Vaters hatte nie zu erkennen gegeben, dass er es anders wünschte.
Während andere Knaben in ihren Schulen Homer und Shakespeare lasen oder in ihrer Freizeit Rad fuhren und Fußball spielten, lauschte James der langsamen, stetigen Stimme seines Vaters, welcher immer ein Buch nach dem anderen vorlas, heute von einer Reise zum Pol, morgen von einer Expedition zu den Quellen des Sambesi.
James, der nichts anderes zu tun hatte, sammelte das alles in seinem Kopf, stopfte sein Herz voll mit all dieser Weltkenntnis. Und ebenso wie das Bücherregal in seines Vaters Studierzimmer hatte er sein Herz in Fächer aufgeteilt, in fünf, für jeden Erdteil eins. Da sein Kopf nichts anderes zu arbeiten hatte, war seine Gewandtheit äußerst entwickelt, jede Neuigkeit an Wissenschaft über die Erde sogleich an seinen richtigen Platz einzuordnen und auch die also angehäuften Kenntnisse auseinander zu halten.
Während James seinerseits nie gefragt hatte, wozu das Ansammeln all dieser Kenntnisse nötig sein könnte, hatte sein Vater ihm ebenso wenig jemals erklärt, warum er ihn lauter theoretische Weltkenntnis lehrte.
Bis Phileas Fogg, der Mann der achtzig Tage, seine achtzig Jahre gelebt hatte, die Augen schloss und das Testament eröffnet wurde.
Hier lag die Erklärung!
Und so stand dann James Fogg vor der Weltkarte und schloss mit dem Spiel der Melodien der Uhr einen nach dem anderen die Orte in seinem Herz auf, worin all die Kenntnisse angehäuft waren, so sorgfältig geordnet wie die Waren in einem Lagerhaus.
Ebenso schnell wie die zitternden Bilder eines Kinematografen ließ er das alles an sich vorbeiziehen.
Er kannte jede Grenze, jede Stadt, jede geografische Besonderheit; er kannte alle Völker, ihre Art und Wesen, ihre Geschichte in Gegenwart und Vergangenheit; er kannte ihre Entwicklung, Religionen und Staatsformen, ihre Lebensweise, Handel, Industrie, Ackerbau, Viehzucht, Bergbau, Kunst; auch kannte er von jedem Land die Lage und die Verkehrsmittel, den Verlauf ihrer Flüsse, die Länge ihrer Wege, die Höhe der Berge, die Ausdehnung der Wälder, die Fläche ihrer Weiden und des bebauten und unbebauten Grundes; alle Häfen kannte er, von denen die Reeder ihre Schiffe auslaufen ließen, alle Städte, an denen die Eisenbahnen entlang fuhren.
Das alles kannte er, und noch viel mehr!
Phileas Fogg hatte seinen Sohn zumindest mit allen nötigen Mitteln versehen, die ihn in die Lage versetzen konnten, seinen letzten Willen zur Ausführung zu bringen.
Als die Uhr zur halben Stunde schlug und das »God save the King« wieder durchs Zimmer klimperte, hatte sich der Kopf von James genau eine halbe Umdrehung von links nach rechts bewegt, er war wieder zurück in London.
Von Erdteil zu Erdteil, von Land zu Land, von Meer zu Meer, von Stadt zu Stadt sah er seine Reise vor sich.
Er brauchte nichts weiter zu tun, als sich auf die Reise zu begeben.
Würde er den letzten Willen von Phileas Fogg ausführen, der, selbst durch seine Reise um die Welt in achtzig Tagen weltberühmt geworden, seinem Sohn diese Aufgabe hinterließ, seinerseits eine Reise um die Welt in vierzig Tagen zu vollbringen?
***
Kapitel II
Worin der Sohn eines anderen alten Bekannten vorgestellt wird.
Nachdem der Bürodiener sorgfältig den Staub auf die Kehrichtschaufel gefegt hatte, trat er an die Vordertür, um ihn auf das Trottoir des Damrak-Boulevards in Amsterdam zu kehren. Es war kein Schutzmann in der Nähe, und auf eine Kehrrichtschaufel mit Staub mehr kam es in solch staubigen Straßen kaum an, meinte er, denn er war für das Büro und für sich selbst auf Reinlichkeit bedacht. Draußen schlug die Uhr der Börse ihre neun Schläge. »Wartet Eure Zeit ab« stand an der Kante über dem Zifferblatt geschrieben. Es war Abend, und er konnte es somit nun nicht lesen, aber er wusste, dass es da stand. Zweifellos waren es diese fleißigen Worte, die ihn sich beeilen ließen, wieder zurück ins Büro zu gehen, die Gießkanne zur Hand zu nehmen und langsam den Ladentisch entlang laufend den Raum abzugehen, um überall, wo er ging, mit zierlichen, ineinander verlaufenden Spiralen feine parallele Wasserlinien zu versprengen.
Damit war sein Werk für diesen Tag beendet, das Büro musste nun geschlossen werden.
Aber der Bürodiener zögerte noch etwas. Das war übrigens so seine Gewohnheit.
An einem Haken hinter dem Ladentisch bei der gläsernen Kabine, wo der Kassierer den ganzen Tag hinter dem Taubenschlagfensterchen mit den Münzen aus aller Welt klimperte, hing die Mütze mit den goldenen Knöpfen und den goldenen Lettern. »Thomas Cook & Son« stand darauf. Das war der Name des Büros. Die Mütze war von einem der Reiseführer im Dienste der Firma, morgens früh setzte er sie auf, zog mit den Ausländern in Amsterdam umher und kam abends wieder seine Mütze aufhängen.
Jeden Abend, nachdem das Büro gereinigt worden war, bemächtigte sich jedoch der Diener der Mütze. Er nahm sie vorsichtig vom Haken, besah sich von Nahem die goldenen Buchstaben und setzte sie vorsichtig auf.
So stand er dann im Büro wie ein Kaiser in seinem Thronsaal.
Um ihn herum hingen all die wunderschönen Bilder, die alle mit demselben Namen bedruckt waren, der in Gold auf seiner Kopfbedeckung stand.
Mit dieser Mütze auf war es, als trüge er einen Zauberhelm, war es, als lebten all diese bunten Darstellungen für ihn auf. Ohne Mütze war er der Bürodiener, dem durch die Gunst eines der Bediensteten, der seiner Mutter noch etwas schuldete, zu dieser düsteren Anstellung verholfen wurde, nach der es ihn dennoch so verlangt hatte.
Mit der Mütze war er selbst Reiseführer, gehörte er selbst zur Firma, war er selbst ein Teil von diesem Weltunternehmen, dessen Amsterdamer Filiale er vom Staub der amerikanischen Schuhsohlen, deren Träger sich den königlichen Palast auf dem Dam, die Nachtwache und Volendam ansehen kamen, sauber halten musste.
Ohne Mütze durfte er bei Einkäufen mithelfen, musste er schwere Koffer schleppen und die dickbauchigen Reisetaschen tragen. Mit der Mütze war er zum Reiseführer befördert, stellte er sich vor, dass er den Ausländern beigegeben sei, dass er sie zu allen Amsterdamer Sehenswürdigkeiten führte.
Ohne Mütze spürte er seine Unmündigkeit, seine Minderwertigkeit, seine ärmliche Existenz, aber mit der Mütze vertrat er seine Firma, seine Stadt, sein Land!
Am Ende eines jeden Tages waren das seine herrlichsten Augenblicke. Er fühlte sich, als wüchse sein Ansehen. Er begriff wohl, dass das bloß ein äußerer Glanz war, aber er wusste zugleich schon so viel von der Welt, dass mancherlei Beruf, so auch der eines Fremdenführers, nicht viel mehr bedeutete, als das Tragen einer Mütze mit goldenen Lettern. Sie war nur Kopfschmuck, denn was solche Reiseführer ansonsten zustande brachten, konnte er auch. Vorläufig war es nur sein Ehrgeiz, auch Fremdenführer zu werden, das war sicher. Aber er würde, wenn er es denn einmal so weit gebracht hatte, danach trachten, es dann doch besser zu machen als die anderen. Hatte er nicht oft genug gesehen, auf welche Weise man Ausländern Amsterdam zeigte. So wie das ablief, war das keine Kunst! Das konnte er besser. Ja, er machte es schon besser! An einem einzigen lebhaften Tag, an dem das Büro voller lispelnder amerikanischer Fräulein gewesen war, war auch er mangels genügender Hilfe losgeschickt worden, war er – nachdem er das feierliche Versprechen hatte abgeben müssen, dass er die Ehre des Büros nicht in den Schmutz ziehen würde – den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen: Dam, De Waag, Artis-Tierpark, Grachten, Vondelpark, die Amstel, Kalverstraat, das Panoptikum. Das war alles, was es Außergewöhnliches in Amsterdam zu sehen gab und was er mit seiner Herde, deren treuer Hirte er war, abklapperte. Seine Erläuterungen waren dabei sehr unterhaltsam gewesen, denn seine drei Lieblingsbücher »Der schnelle Franzose«, eine Anleitung, um ohne Lehrer in kurzer Zeit Französisch zu sprechen, »Deutsch auf Reisen« und »Wie man in 20 Lektionen Englisch spricht« hatte er nicht umsonst unter einem brennenden Kerzenstumpen wieder und wieder stur durchgearbeitet.
»Splendid interpreter!«, hatte eins der Fräulein gelispelt das mit seinem grünen Voile, dem grauen Leinenkostüm und grauen Handschuhen wie eine Schicksalsgöttin aussah. Es hatte den Aushilfsfremdenführer dabei freundlich seine gelben Zähne sehen lassen; es konnte aber auch ebenso gut sein, dass es den fröhlichen Lockenkopf und die gütigen Augen des jungen Mannes einer plötzlichen Erwähnung in ihren Reiseaufzeichnungen über Holland für würdig befand.
Er hatte auch einmal einen deutschen Professor umhergeführt, der natürlich so billig wie möglich reiste. Und dass der das Rijksmuseum von innen hatte sehen wollen, hatte seinen Übermut nicht abgeschreckt, so schlau war ein Amsterdamer Junge nun wohl, um immer wieder ein Bild weiter zu sein, um den Namen des Malers vorher abzulesen und damit die unverdrossene Begeisterung so eines bebrillten Deutschen aufrecht zu erhalten.
Und einmal hatte er einer Gruppe Franzosen, auf die er spät abends nach Büroschluss auf dem Nieuwezijds Voorburgwal gestoßen war, unschätzbare Dienste erwiesen, dadurch, dass er sie vom Postamt, das sie für ein Hotel gehalten hatten, zum Hotel Krasnapolsky geführt hatte. Sie hatten ihn bei sich behalten, und »Der schnelle Franzose« hatte zu vortrefflichen Resultaten geführt, denn sie lachten stets über seine Späße und fanden ihn unbezahlbar köstlich.
Oh, er würde im Laufe der Zeit seinen internationalen Weg wohl finden.
Heute goss er noch mit der Wasserkanne die wunderlichsten Arabesken und Hieroglyphen auf den Fußboden des Büros, aber später, wer weiß, würde er eine feste Anstellung erhalten, würde auch er die Mütze mit den goldenen Lettern auf seine Schläfen drücken.
Inzwischen half es ihm, die Wartezeit zu verkürzen, wenn er des Abends die Mütze vom Haken genommen hatte und er damit im Büro umherging. Immer wieder war es ein neuer Reiz für ihn, wenn er dort herumlief und sich Bild für Bild ansah, mit denen die Wände von oben bis unten behangen waren. Das eine war noch schöner als das andere. Auf einem stand in anmutiger Haltung eine Dame, sich über eine Terrasse lehnend, die an einen blauen, von gelben Bergen umgebenen See grenzte. Es gab ein anderes Bild mit einem echten Farbigen, der mit seinen Füßen im gelbsten Sand und mit seinem schwarzen Krauskopf bis in die blaueste aller Lüfte reichte. Auf wieder einem anderen Bild trieb eine voll getakelte Dschunke auf einem dunkelvioletten Meer, eine Palme beugte sich vornüber. Es gab Bilder mit Gletschern und Wasserfällen, es hingen dort große Fotos von riesigen Gebäuden und Palästen; vor allem gab es viele Bilder in verschiedensten Farben, auf denen unwahrscheinlich große Schiffe, die sich durch das ruhige Meer, manchmal durch dreiste Wellen ihren schäumenden Weg suchten und aus vielfarbigen, baumdicken Schornsteinen prächtig-bunte Rauchwolken über einen spiegelglatten oder beängstigend stürmischen Horizont ausschickten.
Das alles stieg dem Bürodiener dann jedes Mal wieder wie Champagner zu Kopfe, auf dem die Mütze prangte, die mit dem allen in Verbindung stand.
Doch das schönste Bildchen von allen, vor dem er zuletzt und am längsten stehen blieb, war die Darstellung eines gelben Teufels, der seinen Mantel wie Flügel gebrauchte und damit über eine lebhafte komponierte Landschaft flog, die wohl eine Musterkarte aller Länder der Welt zu sein schien. Man sah darauf Moscheen und Pyramiden, Häuser aus Marmor und aus Lehm, Urwälder und Steppen. Der Hintergrund bestand aus Bergen mit einem weißen Kamm aus ewigem Schnee, und ein breiter Strom schlängelte sich in endlosen Schleifen durch diese wundersame Landschaft. Auf dem ausgebreiteten Mantel des fliegenden Teufels standen mehrere Menschen, einige starrten durch Fernrohre nach vorne, andere schauten über den Rand des Mantels hinweg. Es waren Zugehörige von allerlei Hautfarben und Äußerem. Man sah dort weiße Europäer und gelbe Asiaten und rote Indianer. Sie alle machten die Flugreise über die schöne Welt mit, die unter ihnen lag.
Dann träumte der Bürodiener diese herrlichste Flugreise mit, er stieg auch auf den Mantel, fühlte sich hinaufschweben und schaute dann mit umher.
Wie er dann verstand, dass so eine Mütze – nicht einmal seine! –, dass der Zauber dieser goldenen Lettern nur einen kleinen Bruchteil all dieser Herrlichkeit bedeutete. Die Reisenden kamen aus ihren fremden Ländern hierher, zogen von hier aus in andere Länder weiter. Die Züge pfiffen, die Boote drehten ihre Schiffsschrauben, der ganze Erdball war nichts anderes als ein Reisegebiet.
Und mit seiner Mütze auf dem Kopf vor dem Bild stehend gab er die Antwort auf all die Fragen, die er sich so oft gestellt hatte, wenn er in der geschäftigen Reisesaison im Büro all die Ausländer wie Bienen um ihren Korb hatte umherschwirren sehen.
Woher kamen sie? Wohin gingen sie? Was hatten sie bereits von der großen, rätselhaften Welt gesehen, die sich in alle Richtungen erstreckte?
Dann begriff er, dass sein Verlangen weiter ging als nur bis zum Tragen der Mütze mit den goldenen Lettern, dass er mehr von seinem Lebensschicksal erhoffte, als »Ah!« und »Oh!« ausstoßenden Reisenden Amsterdam zu zeigen. Sein Blut raste durch seine Adern, seine Augen, die doch ganz klar und hell über seinen roten Wangen standen, glommen wie Kohlenfeuer, wenn der Winterwind durch den Schornstein es anfachte, er streckte seine Schultern nach hinten, blies seine Lungen auf, als wollte er mit einem gewaltigen Atemstoß den Mantel seiner eigenen Fantasie davonjagen, hinaus aus dem engen Büro, den Damrak-Boulevard hinunter zum Dam und da aufsteigen und wegwehen in jede Himmelsgegend, in die ihn der Wind nur wehen wollte!
Er stand da noch direkt vor dem Bild, Mütze auf dem Kopf und in der Hand die Wasserkanne, aus der noch ein letzter Strahl einen Fleck auf den Boden machte, als die Klingel ertönte, die Tür sich öffnete und ein Fremder hereintrat.
Es war absolut keine Schande, mit einer Wasserkanne in der Hand angetroffen zu werden, doch der Bürodiener glaubte das wohl. Es schoss ihm zumindest unmittelbar durch den Kopf, dass die Wasserkanne und die Mütze in diesem Augenblick nicht zueinander passten. Er zögerte daher kurz, ob er die Kanne in der Hand behalten und die Mütze abnehmen sollte oder die Kanne im Stich und die Mütze auflassen sollte. Er tat Letzteres.
Der Fremde, der mit einem Norfolk-Jackett bekleidet war und in der Hand einen weiß eingeschlagenen Reiseführer hielt, trat ruhigen, angemessenen Schrittes herein.
Der Bürodiener wollte seine Mütze abnehmen, doch ihm war zugleich klar, dass das bedeutete, Abstand zu nehmen vom Zeichen seiner Würde, also behielt er sie auf.
Er hatte sich abgeguckt, wie man Fremde nach ihrer Landesart grüßen und behandeln musste. Diesen konnte er nicht so schnell einsortieren. Die schlanke, aufrechte Gestalt, das sorgfältig rasierte, starke Kinn und die Wangen, die glatten, schmalen Lippen ohne Schnurrbart unter der feinen geraden Nase ließen ihn vermuten, dass er einen Engländer vor sich hatte. Aber die Augen waren dunkel und das Weiße der Augen leicht gelblich, so wie er es bei durchreisenden Javanern gesehen hatte.
Jemanden aus Fernost würde er mit tiefer Verbeugung begrüßt haben – da war einmal ein Radscha aus Britisch-Indien im Büro gewesen, der ganz östlich mit tiefen Verbeugungen begonnen hatte und auf ungefähr gleiche Weise hörte einer der Bürovorsteher ihm zu. Ein Engländer dagegen grüßte, wenn er ins Büro kam, selbst nicht und wurde daher genauso wenig zurückgegrüßt. Ein Amerikaner würde »Hello!« gesagt und sogleich auf den frisch begossenen Boden gespuckt haben. Ein Deutscher, ein Franzose, ein Italiener oder was da an Standardtypen dem Bürodiener so schnell im Vorstellungsbereich lag, schien der Fremde ebenso wenig zu sein.
Darum erbot er den Gruß, der am besten zu seiner Mütze passte und zugleich auf ungezwungene Weise die Aufmerksamkeit darauf richtete: Er tippte daran.
Der Fremde schaute dann auch auf die Mütze. Er hielt direkt vor dem Bürodiener an, stellte sich breitbeinig hin, steckte die Hände in die Taschen seines Jacketts und fragte: »Cook?«
»Yes, Sir!«, antwortete der Bürodiener eilig. Es dämmerte ihm dunkel, dass er damit eine Lüge aussprach, dass er zumindest mehr zu sein schien, als ihm eigentlich zukam, aber gleichzeitig dachte er auch: Wer ist Cook eigentlich?
Es war ein Firmenname, der Klang einer Reise, ein Lückenfüller. Es war zu diesem Zeitpunkt niemand sonst im Büro, die Büroleiter, die Angestellten, die Reiseführer, die Verkäufer waren nach einem anstrengenden, ermüdenden Tag nach Hause gegangen: Er vertrat somit das Büro, die Filiale, die Firma. Ja, er war in diesem Moment, an diesem Ort Cook selbst!
»Well«, sagte der Fremde. »Just tell me when the first train starts for Vladivostok?«
Der Bürodiener hätte sicher seine Wasserkanne fallen lassen, wenn er die noch in der Hand gehabt hätte. Doch er hatte diesen Gegenstand schon dem Ruhm seiner Mütze geopfert, die durfte er nicht beschämen!
Er hatte hinlänglich verstanden, was der andere ihn gefragt hatte. Aber man hätte ihn ebenso gut wie nach dem ersten Zug nach Wladiwostok fragen können, wann das erste Luftschiff zum Mond abflog! Er ließ sich wirklich absolut nicht aus der Ruhe bringen, denn er dachte an die goldenen Lettern über seiner Stirn. Um jedoch Zeit zu gewinnen, wieder holte er langsam: »Wla-di-wo-stok?«
Der Fremde machte eine kurze Geste mit der einen Hand, es musste jemand sein, der es gewohnt war, auf seine Fragen sogleich eine Antwort zu erhalten.
Der Bürodiener verstand das Gewicht, das seine Mütze ihm auferlegte. Und in demselben Augenblick fiel ihm ein sehr passender Satz ein, der ihm zumindest etwas Zeit gewinnen würde. Er fragte: »By which way, Sir?«
»You scoundrel!«, fuhr ihn der andere an.
Das dürfte kein wohlwollendes Wort gewesen sein. Die Sprachkenntnisse des Bürodieners waren wirklich nicht so tiefgehend, dass er dieses Wort der subtileren Bedeutung nach hätte übersetzen können. Zudem kam dieses Wort in »Wie man in 20 Lektionen Englisch spricht« nicht vor. So konnte er selbst gelassen bleiben und selbst förmlich antworten: »Please, Sir!«
Der Fremde war davon genauso verblüfft. Er sah den Bürodiener an, nickte unwirsch und sagte kurz angebunden: »Gefällt mir … hast zudem recht … kann auf zwei Arten hinkommen … will den kürzesten Weg nehmen … wann der erste Zug Berlin?«
Das wusste der Mann, der die falsche Mütze trug. Er hatte öfter reichlich Gepäck dorthin getragen. Draußen stimmte das Glockenspiel der Oude Kerk »Du bist verrückt, mein Kind« an. Es war 22 Uhr.
Er sagte: »Bereits abgefahren, mein Herr!«
Der Fremde hatte ein kurzes Zucken über den Augenbrauen.
»Der nächste?«, fragte er.
Auch das wusste die Cook-Mütze.
»Morgen früh um acht Uhr, mein Herr.«
»Anschluss nach Moskau?«
Der Bürodiener war diesmal nicht erschrocken, er wäre ungerührt geblieben, selbst wenn er nach der ersten Reisemöglichkeit zum Mittelpunkt der Erde gefragt worden wäre. Er gab sich also nicht erst Mühe, den Anschein zu wahren, als hätte er darüber nachgedacht, sondern antwortete rundheraus mit seinen roten Wangen: »Direkter Anschluss, mein Herr!«
Er wusste kaum, was Berlin war, und überhaupt nicht, was Moskau bedeutete. Das musste sehr weit weg sein. Er hatte wirklich unbegrenztes Vertrauen in den Weltverkehr.
Wenn die Firma, deren Mütze er in diesem Augenblick trug, Fahrkarten an alle Orte der Welt verkaufte, musste es dort auch Züge, Straßenbahnen, Boote oder andere Verkehrsmittel geben. Er hätte die Würde seiner Kopfbedeckung zu kurz kommen lassen, falls er anders geantwortet hätte. Und mit voller Überzeugung verband er die Hauptstädte des Deutschen Kaiserreichs und die des Moskauer Zarenreichs.
Er rettete sich damit nicht aus seiner Not. Im Gegenteil! Die ehrliche Überzeugung, welche aus seinen offenen Augen lachte, musste sicher Vertrauen einflößen. Der andere fragte weiter: »In Moskau Anschluss nach Sibirien?«
Der Bürodiener hatte A gesagt, nun musste er auch B sagen. Warum solle er zudem auch diese Antwort schuldig bleiben? Falls kein Anschluss nach Sibirien bestehen sollte oder in welches Land in der Gegend auch, taugten die Zustände da nichts! Und warum sollte man Letzteres unterstellen? Darüber hinaus war »Anschluss« ein dehnbarer Begriff. Gab es denn einen Ort auf der Welt, der nicht angeschlossen war? Er war einmal an einem Sonntag mit der Tochter seines Nachbarn, der hübschen Dientje, in Muiderberg gewesen, und unterwegs hatte der Schaffner der Straßenbahn gesagt, dass Muiderberg das Ende der Welt sei, weil man von da nicht weiterkam. Aber selbst waren sie von dort mit einem Plattboot aus Elburg, das irrtümlich angelegt hatte, abends noch zurück nach Amsterdam gekommen.
Auf die Frage, ob irgendwo auf der Welt Anschluss bestehe, konnte somit nur mit Bestimmtheit geantwortet werden. Er zögerte also keinen Augenblick und sagte: »Zweifellos, mein Herr!«
»Nach Japan?«, fragte der Fremde unbeirrt weiter.
»Gleichfalls, mein Herr!«
Es war nun bloß die Frage, wer es durchhalten würde. Die Mütze brannte wie ein flammender Heiligenschein auf seinen Schläfen. Was wollte der Fremde denn unternehmen? Warum wollte er all die Anschlüsse wissen? Sibirien! Japan! Das musste am anderen Ende der Welt sein!
Aber er hatte keine Zeit, sich zu besinnen, denn kurz angebunden fragte der andere weiter: »Von Japan nach Amerika?«
Der Bürodiener begann, Gefallen an der Sache zu finden. Der Fremde im Norfolk-Jackett kam ihm vor wie der Teufel mit dem fliegenden Mantel. Die ganze Welt wirbelte vorbei. Und ohne sich Zeit zu lassen, kam schon seine Antwort: »Hervorragende Verbindungen, mein Herr!«
»Zurück nach Europa?«
»Natürlich, mein Herr, natürlich!«
Der Bürodiener mit seinem Kopf voller Fantasien lebte wie in einem Zaubermärchen. Was war das für ein wunderlicher Reisender, der da spät abends ins Büro kam, der mit Siebenmeilenstiefeln auf dem Erdball umherwandelte, als ob der nicht größer wäre als ein Taubenschlag in der Goudsbloemdwarsstraat?
Der Fremde schien zu Ende gefragt zu haben, ohnehin hätte der Bürodiener alle weiteren Fragen bejaht. Er musterte ihn von den Schuhen, die durch das Tragen ungehörig schwerer Koffer etwas abgelaufen waren, bis zur Mütze, auf der die goldenen Lettern standen.
Und ebenso unerwartet wie seine ersten Fragen kam nun diese: »Gefällt mir … brauche einen Diener für die Reise … willst du mit?«
Das drohte dem Bürodiener zu viel zu werden. Ihm wurde schwindelig. All die bunten Bilder an den Bürowänden drehten sich wie ein Kaleidoskop vor seinen Augen. Der Ladentisch schien die Form eines Dampfschiffes anzunehmen. Der Fußboden wogte unter seinen Füßen wie einer der blauen oder grünen Ozeane.
Aber vor ihm stand der Fremde, unverändert, noch immer breitbeinig, die Hände in die Taschen seines Jacketts geschoben. Er sah ihn ruhig an, als ob das die gewöhnlichste Frage der Welt gewesen wäre.
Und was wäre auch gewöhnlicher als diese Frage gewesen?
Gab es irgendeinen Grund, überrascht zu sein?
Doch musste er sich mit gewaltig großer Selbstbeherrschung im Zaum halten, als er im selben Ton antwortete: » Jawohl, mein Herr!«
Damit war er in den Dienst des Fremden getreten. Einfacher ging es nicht! Der befahl: »Abreise morgen früh … kümmere dich um alles.«
»Gut, mein Herr.«
»Machen Reise um die Welt.«
»Ja, mein Herr.«
»In vierzig Tagen, von morgen an gerechnet.«
»Zu Diensten, mein Herr.«
Das war alles. Der Fremde ging bereits weg. Der Bürodiener schaute schon nach dem Haken, um die Mütze daran aufzuhängen. Aber der andere drehte sich an der Tür noch um und fragte: »Dein Name?«
»Passepartout junior, mein Herr«, sagte der Bürodiener.
Der Fremde hatte wieder dieses Zucken über den Augenbrauen, das er aber sogleich unterdrückte.
»Und der Name meines neuen Herrn?«, fragte der Mann mit der Mütze, die er aus Höflichkeit abgenommen hatte.
»James, Sohn von Phileas Fogg«, sagte James Fogg.
Dann fiel plötzlich die Mütze mit den goldenen Lettern mitten auf den Boden, worauf die Wasserstrahlen aus der Kanne schon beinahe getrocknet waren. Und Passepartout saß neben der Mütze, gerade als ob er vom Teufelsmantel in die bunte Welt unter ihm hinuntergepurzelt wäre.
***
Kapitel III
James Fogg und Passepartout reisen aus Amsterdam ab.
Im Hauptbahnhof stand am Donnerstagmorgen, den zweiten Juli, der deutsche Zug bereit. Von der einem Rammbock gleichen Spitze der Lokomotive brach bedrohlich wie bei einem mächtigen Monster die überschüssige Kraft in großen Wolken weißen Dampfes hervor; die zwei Laternen starrten lauernd wie Augen hinter großen, kupferumrahmten Helmschlitzen entlang der Gleise nach vorne, auf denen sie alsbald ihren Weg suchen würde; nun schauten sie unbeweglich Richtung Osten.
Es war noch früh, sieben Uhr. Doch Gepäckträger trugen bereits Fracht herbei, Handkarren mit Koffern rollten über die Bahnsteige, Schaffner liefen an den Waggons entlang.
Passepartout war um exakt sieben Uhr da. Er kannte die Gewohnheiten seines neuen Herrn noch nicht, doch er meinte, dass es zu seinen Pflichten gehöre, alles geregelt zu haben, bevor Mister Fogg erschien.
Sein neuer Beruf, wie unerwartet er ihn auch erlangte, war ihm nicht so unerwartet zugefallen, er hatte es verstanden, seine Geisteskraft und vor allem seine Nettigkeit beisammen zu halten, und darum war er ein echter Amsterdamer Junge, einer aus dem Stadtviertel Jordaan.
Eine Reise um die Welt zu unternehmen, war schließlich nicht viel anders, als eine Erledigung für sein Büro zu machen, um zwei Plätze im Carré-Theater für Unterhaltung suchende Reisende zu reservieren. So schlau war er doch, sich keine Karten nur bis zum halben Wege in die Hand drücken zu lassen, wenn sein neuer Arbeitgeber nach Berlin musste. Der Rest würde schon von alleine kommen! Mister Fogg machte bestimmt keine überflüssigen Worte, aber an Deutlichkeit ließen seine Befehle nichts zu wünschen übrig. Gestern Abend hatte er es ihm überlassen, für Karten für den ersten Zug nach Berlin zu sorgen, dort würde er dann sicher wieder weitersehen. Sorgen über diese Zeit kannte der junge Passepartout nicht.
Seine einzige Sorge war gewesen, welches die geschicktesten Einkäufe für die Reise sein würden. Sein Herr hatte ihm eine Hand voll Geldscheine gegeben, damit hatte er für den Reisebedarf zu sorgen gehabt. Das hatte ihm Schwierigkeiten bereitet, und nicht gerade wenig. All das Geld. Und dann die Verantwortung, dass alles eingekauft wurde, was sein Herr unterwegs nötig haben könnte.
Darum hatte er eine ruhelose Nacht verbracht.
Für manch einen anderen wäre eine solche Aufgabe zu viel gewesen. Nicht für Passepartout. Das war genau das Richtige für ihn. Er hatte immer auf etwas so Ungewöhnliches gehofft. Was konnte er nun mehr verlangen? In seinen kühnsten Träumen, die unter seiner Mütze aufkamen – noch dazu der eines anderen –, hatte er sich so etwas oftmals vorgestellt: Wie es doch sein müsste, so eine Reise in fremde Gefilde zu machen? Und nicht umsonst hatte er Koffer mit Anhängern aus der ganzen Welt in Abteile geschleppt, hatte er mithelfen müssen, die sich ausbeulenden Seiten von Koffern wieder platt zu drücken, wenn die fremden Reisenden in verschwenderischer Kaufsucht ihre letzten Souvenirs noch in ihrem Gepäck verstauen wollten. Passepartout hatte dabei seine Augen offen gehalten. Er wusste so in etwa, was den Inhalt eines solchen Koffers oder einer solchen Reisetasche ausmachte.
Mit seinem Vermögen an Geldscheinen – er war nur ein armer Junge aus dem Stadtteil Jordaan! – war er noch am selben Abend unterwegs gewesen. Sein Herr hatte begonnen, grenzenloses Vertrauen in ihn zu setzen, daher würde er sich dieses Vertrauens auch würdig erweisen!
Und was möglicherweise kein anderer fertiggebracht hätte, in einer Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Ausrüstung für eine Weltreise zusammenzusuchen, gelang ihm. Das war genau sein Fall gewesen. Links in der Goudsbloemdwarsstraat wohnte Frau van der Tuin, deren Sohn vor ein paar Tagen von großer Fahrt nach Hause gekommen war; zwei Häuser weiter wohnte Müsellheim, der Kaufmann, der sein Lebtag mit allem gehandelt hatte; zwei Querstraßen weiter lebte Stappert als Rentier, der aus dem Dienst entlassene alte Soldat aus dem Westen. Und spät in der Nacht des Mittwoch hatte er die alle darauf angesetzt.
Er selbst war auf dem Nieuwmarkt gewesen. Glück gehabt, dass gerade Markttag war und dass man dort sehr früh erscheinen konnte. Nach seiner launenhaftesten Wahl hatte er die besonderen Einkäufe erledigt, die er keinem der anderen hatte anvertrauen wollen.
Um halb sechs waren alle gekauften Gegenstände im Vorraum in der Goudsbloemdwarsstraat gesammelt, dann hatten sich alle daran gemacht, zu packen – zwei große Koffer voll. Es blieb noch genug übrig für zwei weitere, mindestens ebenso große Koffer. Aber Passepartout hatte seine Wahl aus dem Vorrat getroffen und das Allernötigste noch in eine Extratasche seiner Mutter gesteckt.
Frau Passepartout war zu nervös gewesen, um selbst mit anzupacken. Als er um sechs Uhr die Koffer schloss, war sie endlich so weit, dass der Kaffee fertig war und die Butterbrote geschmiert waren. Aber der Matrose, der Sohn von Frau van der Tuin, der auch dabei war, zog flink den Korken aus einer der kleinen Flaschen, mit deren Einkauf er unter anderem beauftragt gewesen war, und schraubte, als ob er sein Leben lang nicht anderes getan hätte, den Deckel von einer Dose getrüffeltem Kalbsfleisch.
So war der Abschied mit einem Zimmerchen voller Menschen eher lautstark als trübselig gewesen. Abgesehen von den Frauen, zu denen sich auch die Tochter der Nachbarin, die hübsche Dientje, gesellt hatte. Sie hatten alle ziemlich nah am Wasser gebaut.
Frau Passepartout hatte ihr buntes Tuch umgelegt, um ihren Sohn zum Bahnhof zu bringen. Der Gepäckträger von der Straßenecke hatte die Koffer bereits ergriffen, um sie die steile Treppe hinunter zu seinem Karren auf dem Bürgersteig zu bringen, wo sich bereits die halbe Goudsbloemdwarsstraat versammelt hatte. Dann hatte der alte Soldat einen Einfall gehabt und mit der Rückseite eines Beils aus der Küche hatte er ein Hufeisen auf den Koffer genagelt. Das hatten die meisten in den Kolonien so gemacht, und fast alle, die das gemacht hatten, waren auch wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Der Matrose wollte immer wieder »Nun denn, leb wohl!« singen, und der Kaufmann feilschte noch um einen Kakianzug, für den er den feinsten Laden aus dem ganzen Heiligenweg hatte wach klingeln müssen.
Aber Passepartout, der seinen Verstand beibehielt, rief auf Französisch »Au revoir!« und schob den Gepäckträger die Treppe hinunter, der Rest half mit. Draußen gab es ein großes Juchhei, die ganze Nachbarschaft hing im Morgenmantel über den Geranien. Die Koffer auf dem Gepäckkarren zogen sicher die meiste Aufmerksamkeit auf sich, und Passepartout und seine Mutter entwischten ihnen, um in Ruhe zum Bahnhof kommen zu können. Dientje lief auch mit, aber die konnte nichts sagen, weil sie andauernd einen Zipfel ihres Taschentuchs zwischen ihren Lippen hielt.
Mutter Passepartout, eine dicke, stille Frau, war es auch schwer ums Herz. Sie liebte ihren Jungen sehr und außerdem begann ihr träges Herz in dieser Stunde des Abschieds die Geschichte von Heimweh zu erzählen zurück zu der Zeit, zu der ihr Mann noch lebte. Das war alles mehr als dreißig Jahre her und es war ihr nicht mehr so ganz deutlich vor Augen. Als junges Ding war sie mit ihrem Vater auf dem Londoner Boot gefahren, dann war sie mal in England, dann wieder in Holland. Mit dem zweiten Steward hatte sie sich eingelassen, aber gleich nach der Hochzeit war der vor der Küste ertrunken. Und das Kindlein, das später geboren wurde, vertrug seine erste Seereise nicht und verstarb nach einer Woche. Dann hatte sie eine weniger gute Stelle bei einer englischen Familie bekommen, bei der die Frau verstorben war. Und vom einen war es dann zum anderen gekommen. Es gab da über den Flur einen französischen Hausknecht, der viel Geschmack an der holländischen Frische gehabt hatte und der sie später heiratete, obwohl sie einander nicht viel mehr als die Hälfte verstanden. Schließlich wohnten sie in Amsterdam, nachdem etwas zwischen dem englischen Herrn und seinem Knecht passiert war, was ihr nicht so ganz klar war. Aber lange hatte das so nicht gedauert, denn kaum, dass ihr Junge geboren wurde, verstarb ihr Mann an einem Anfall der in Amsterdam auftretenden Malaria.
Nun brach das alles wieder hervor, und langsam, in mühsamen Sätzen, erzählte sie nun ihrem Sohn zum Abschied, wie sein Vater zu seiner Zeit auch gereist war, auch eine Reise um die Welt gemacht hatte, und wie es sich komisch zufällig traf, dass der eigene Sohn von diesem einen Vater mit dem eigenen Sohn des anderen Vaters auf dieselbe Reise ging.
Aber ihr Sohn, der den Beginn der Erzählung in ihren undeutlichen Umrissen schon öfter gehört hatte, sagte, dass es auf der Welt keine Zufälle gebe und dass der junge Mister Fogg sicher mit Absicht auf ihn zugekommen sein müsse. Und dass, da sein Vater den alten Mister Fogg um die Welt gelotst hatte, er, der Sohn, den jungen Mister Fogg genauso gut führen könne. Aber die Mutter, die vor allen Verkehrsmitteln fürchterliche Angst hatte, hatte wieder eine Träne mit ihrem Umschlagtuch weggewischt und ihren Jungen angefleht, doch bei den Türen des Zuges aufzupassen, auch mit Erkältungen auf dem Schiff und vorsichtig zu sein mit seinem nagelneuen Anzug, der ihren Pass – so nannte sie ihn kurz – nun so richtig wie einen Herrn kleidete.
Dann umarmte Pass seine dicke, gutmütige Mutter mitten auf dem noch leeren Noordermarkt, tröstete sie mit dem Versprechen schönster Ansichtskarten und sagte, dass sie sich dann auch etwas beeilen müsste, da er vor sieben Uhr das Gepäck aufgegeben, die Fahrkarten geholt und die besten Plätze für seinen neuen Herrn reserviert haben wollte.
Als es eine Minute vor Abfahrt des Zuges war – Pass hatte bereits aus Nervosität ein Taschentuch von dem neuen Dutzend allein bei dem Gedanken daran gebraucht, dass sein Herr zu spät kommen würde –, kam Mister James Fogg würdevoll und gelassen aus dem dunklen Loch des Treppenaufgangs. Pass hätte die königlichen Bahnhofstüren gerne für ihn öffnen wollen, aber der Portier hatte ihn gähnend angeschnauzt, als er dazu ansetzte.
»Ich brauche zwei Zeugen«, sagte Mister Fogg zu seinem Reisediener.
Pass winkte seiner Mutter und auch Dientje, die beide mit roten Augen hinter dem Zeitungskiosk standen und schauten. Sie kamen zögernd näher, ganz durcheinander vom ungewohnten Gedränge, dem unangenehmen Abschied, der fürchterlichen Aussicht, dass ihr Pass hier sogleich zu seiner Weltreise aufbrechen sollte. Aber Pass winkte noch dringlicher, und dann traten die zwei Frauen bis ganz dicht an das Abteil. Ein Schaffner eilte am Zug entlang, bellte Pass an, dass man abfahren würde. Auf der großen Bahnhofsuhr war es fast 7:10 Uhr.
Mister James Fogg hatte einen Füllfederhalter aus seiner Tasche gezogen und auf eine Visitenkarte einige Worte geschrieben. Nun reichte er Pass seinen Füller und das Kärtchen, damit dieser die zwei Zeugen dieser merkwürdigen Abreise mit ihrem Namen unterzeichnen lassen sollte.
Zuerst musste Dientje ihren Namen schreiben, sie tat das ordentlich verärgert mit zwei dickköpfigen Tränen, die ihr immer wieder in die Augen stiegen, wenn sie mit ihrem Taschentuch gerade zwei andere weggewischt hatte. Aber durch ihre Tränen hindurch sah sie, was auf der Karte geschrieben stand:
»Am heutigen Morgen des 2. Juli 1908 um 7:10 Uhr Bahnhofszeit reiste James Fogg aus Amsterdam ab.«
Sie schrieb mit zitternder Hand ihren Namen: Dientje.
Danach unterschrieb die Mutter von Passepartout. Der Füller ruhte fest in ihrer dicken Hand, aber Tropfen perlender Gemütsbewegungen glänzten auf ihrer Stirn, denn zu schreiben war nicht ihr tägliches Werk – und dann unter solchen Umständen! Der Hauptschaffner hielt die Pfeife an seine Lippen. Sie schrieb langsam die Buchstaben ihres schwierigen Namens: Witwe Passepartout.
»Hm«, machte James Fogg, der das las. Und wieder zuckte es über seinen Augenbrauen.