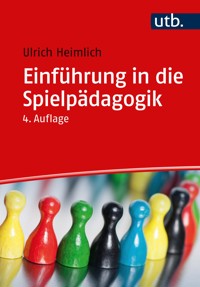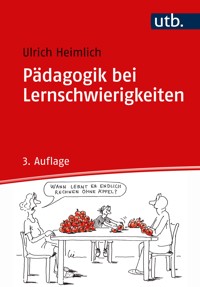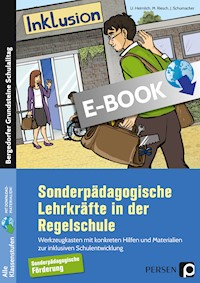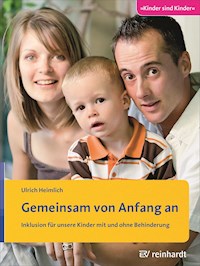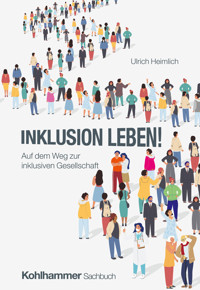
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Ist schon alles gesagt über Inklusion? Sind wir am Ziel einer selbstbestimmten gesellschaftlichen Teilhabe aller? Im Gegenteil: Inklusion ist noch nicht bei uns angekommen. Aussonderung von Menschen mit Behinderung, Benachteiligung von Frauen, Anfeindungen von Menschen mit Migrationshintergrund - all das ist Realität. Demgegenüber sind inklusive Momente zu gestalten, an denen alle teilhaben und zu denen alle beitragen können. Willkommenskulturen schaffen, regionale Netzwerke entwickeln, verborgene Potenziale entdecken - dazu bedarf es einer inklusiven Haltung, die Vielfalt begrüßt. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele aus seinen Erfahrungen mit Inklusion schildert Ulrich Heimlich, wie wir gemeinsam eine inklusive Gesellschaft schaffen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Prolog
1 Teilhabe, Teilgabe, Teilsein Inklusive Momente
I wie Initiative oder:
»Die Initiative zur Inklusion muss von den Beteiligten ausgehen!«
Inklusion als Völkerrecht
Von der Exklusion zur Inklusion
Teilhabe und Selbstbestimmung
Frühstückseinkauf mit Sarah
Alle gleich, alle verschieden?
Teil-Sein
2 Be-hindern ver-hindern Inklusive Situationen I
N wie Normal oder:
»Es ist normal, verschieden zu sein.« (Richard von Weizsäcker)
Teufelskreis Behinderung
Behindert-werden
Behindern, Fördern, Unterstützen – ja, was denn nun?
Kompetenzbrille
Erschwerte Lebenssituationen
3 Geschlecht selbst bestimmen? Inklusive Situationen II
K wie Kooperation oder:
»Was wir in der Inklusion allein nicht schaffen, schaffen wir kooperativ im Team.«
Ein Blick zurück
Bewegte Frauen
Neuer Feminismus (Simone de Beauvoir)
Zweite Frauenbewegung (Alice Schwarzer)
Divers oder nicht divers – ist das die Frage? (Judith Butler)
Ein Blick nach vorn
4 Unterschiede feiern! Inklusive Situationen III
L wie Lernen oder:
»In inklusiven Settings lernen alle Beteiligten miteinander und voneinander!«
»I am not your negro«
Sprache verändert Sein?
Unterschiede sind schön!
5 Willkommenskulturen schaffen! Inklusive Institutionen
U wie Umgang oder:
»Inklusion heißt, dass alle respektvoll miteinander umgehen!«
Und die Förderschulen?
Schonräume oder Erfahrungsräume?
Individuelle Bedürfnisse
Gemeinsame Spiel- und Lernsituationen
Kein Feld für Einzelkämpfer:innen
Teilhabe als institutionelles Leitbild
Sozialräumliche Vernetzung
6 Kleine Netze knüpfen! Inklusive Regionen
S wie Systementwicklung oder:
»Die Entwicklung der Inklusion ist ein gemeinsamer Prozess, der Zeit benötigt!«
Auf der Suche nach Ressourcen
Gelingende Kooperationen
In kleinen Netzen denken
Der sozialräumliche Blick
7 Kreative Gesellschaft mitgestalten! Inklusive Kulturen
I wie Individualisierung oder:
»Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und so, wie er, ist einfach richtig ist!«
Musik und Tanz als Sprache?
Bildet Kunst?
Humor inklusive?
8 Vielfalt leben! Inklusive Haltungen
O wie Offenheit oder:
»Inklusive Entwicklungen benötigen offene Türen!«
Haltung zeigen!
Aussonderung verhindern!
Inter-esse füreinander zeigen!
Aufmerksamkeit schenken!
Auf Schatzsuche gehen!
Begegnung ermöglichen
Sich befreunden können
9 Denkverbote auflösen! Inklusive Gesellschaft
N wie Netzwerk oder:
»Inklusion heißt, dass wir in Netzen denken und leben lernen.«
Menschenrechte und Menschenpflichten
Freiheit und Gleichheit
Teilhabe und Teilgabe
Gemeinsinn und Eigensinn
Politik der Inklusion
Epilog
Danksagung
Personenregister
Literaturverzeichnis
Der Autor
Prof. em. Dr. Ulrich Heimlich war Universitätsprofessor für Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Lernbehindertenpädagogik und hat sich 40 Jahre lang sowohl in der pädagogischen Praxis als auch in Forschung und Lehre mit dem Thema Inklusion beschäftigt.
Ulrich Heimlich
Inklusion leben!
Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagsabbildung: SiberianArt/iStockphoto1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045061-5
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045062-2epub:ISBN 978-3-17-045063-9
Für Mino,dem ich eine inklusivere Gesellschaft wünsche
Prolog
In der zweiten Dekade nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und über 40 Jahre nach dem Beginn der Bemühungen um Inklusion befinden sich Menschen mit Behinderung in Deutschland immer noch zum überwiegenden Teil in Sondereinrichtungen (z. B. Förderschulen, Wohnheimen, Werkstätten). Im Staatenbericht der UN zur Umsetzung der UN-BRK von 2023 wird darauf verwiesen, dass unser Land viel zu wenig in Sachen Inklusion insbesondere im Bildungsbereich unternimmt. Von rechtsradikaler Seite ist sogar das gesamte Projekt Inklusion infrage gestellt worden, zum Glück von breiten Protesten der Zivilgesellschaft beantwortet und kritisiert. Nach vielen Jahren der eigenen beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft für Sonderpädagogik an unterschiedlichen Schulformen und als Wissenschaftler in der sonderpädagogischen Lehrkräftebildung an verschiedenen Universitäten stellt sich mir die Frage, warum in unserem Land nicht das gelingt, was in allen europäischen Nachbarstaaten und insbesondere in den skandinavischen Ländern längst Alltag ist: die umfassende und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Bildung und Gesellschaft im Sinne von Inklusion.
Möglicherweise liegt es daran, dass es in unserem konservativen Land einen grundlegenden Widerstand gegen jegliche Formen von Veränderungen gibt, sei es im Bildungsbereich oder im gesellschaftlichen Raum. Die Beharrungskräfte sind immer wieder so stark, dass es am einfachsten zu sein scheint, alles beim Alten zu lassen. Veränderungen schaffen Unsicherheit, Zwang zur Veränderung führt gar zu Widerstand. Ich habe in den letzten Jahren insbesondere im Bildungsbereich Menschen kennengelernt, die ihre gesamte Lebensenergie aufwenden, damit die Zustände so bleiben, wie sie sind, auch wenn sie noch so unzulänglich sind. Deshalb ist das Eintreten für Veränderungen nicht nur im Bildungsbereich so ein zähes und mühsames, manchmal sogar zermürbendes Geschäft.
Vielleicht kommt die Aufrechterhaltung von Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung weit weg von der Gesellschaft, nicht selten auf der »grünen Wiese« ohne Kontakt zum sozialen Umfeld, aber auch einem gesellschaftlichen Verdrängungsmechanismus entgegen. Es mag sein, dass viele Menschen nicht mit ihrer eigenen Verletzbarkeit und Angewiesenheit auf die Hilfe anderer konfrontiert werden wollen. Es wird lieber weggeschaut. So kann die eigene Hilfsbedürftigkeit, die wir als Kinder erlebt haben, und die zunehmende Zerbrechlichkeit als alter Mensch dem Vergessen anheimgegeben werden. Viele Menschen erleben es als Beschädigung ihrer eigenen Identität, wenn sie ihre Selbstbestimmungsfähigkeit aufgeben müssen und auf Hilfe angewiesen sind, und brechen deshalb in Tränen aus. Hier kann man z. B. von Menschen mit Behinderung lernen, mit Hilfe souverän umzugehen. Darin haben sie eine Stärke entwickelt.
Ein Hauptgrund für das Stocken der Inklusionsentwicklung liegt jedoch meiner Meinung nach in den erstaunlichen Beharrungskräften des Bildungssystems. Der deutsche Sonderweg des Aufbaus von eigenständigen Sonderschulen z. B. für alle Behinderungsarten hat zu einem differenzierten Sonderschulsystem geführt. Ganz knapp ist der Versuch aufgegeben worden, noch eigene Sonderschulen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen zu schaffen. Ist eine solches Sonderschulsystem erst einmal geschaffen, dann finden sich auch die Schüler:innen. Das haben alle Schulgründungen in diesem Zusammenhang gezeigt. Das wird ebenso an den höchst unterschiedlichen Zahlen von Schüler:innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den einzelnen Bundesländern deutlich, die schon einmal zwischen 4 % und 14 % schwanken können. Ich komme zu der Einsicht, dass wir es in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft haben, das System der Sonderbeschulung und das mehrgliedrige Bildungssystem als Ganzes infrage zu stellen. Inklusion ist gewissermaßen ein zusätzlicher Zweig im Bildungssystem geworden, für den ebenfalls neue Schüler:innengruppen erschlossen werden. Die Zahl der Schüler:innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf steigt im Zeitalter der Inklusion kontinuierlich an, zum Erstaunen vieler Verantwortlicher auf der bildungspolitischen Ebene sowie in der Wissenschaft und Forschung. Wir haben das System der separierenden Beschulung im Grunde noch nicht angetastet.
So verwundert es nicht, dass Inklusion immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern eher im Bereich wissenschaftlicher Diskurse bleibt. Wenn Inklusion ähnlich wie in den skandinavischen Ländern oder in den USA gesellschaftlicher und bildungspolitischer Alltag sein soll, so ist dazu nicht weniger als ein demokratischer Umbau des Bildungssystems und eine gesamtgesellschaftliche Reform vonnöten. Dazu sollten zunächst einmal liebgewordene Denkverbote aufgegeben werden – nach dem Muster »Geht nicht, weil ...« oder »Das haben wir ja noch nie so gemacht!«. Menschen mit Behinderung werden nach wie vor bei der Wahrnehmung ihrer Rechte so viele Steine in den Weg gelegt, dass sie nicht selten entnervt aufgeben und auf Leistungen, die ihnen gesetzlich zustehen, lieber verzichten. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen mit Behinderung endlich vermehrt in der Öffentlichkeit sichtbar sind und ihre Belange selbst in die Hand nehmen. Sie lassen nicht mehr andere für sich sprechen, sondern sprechen selbst in eigener Sache. Auch Künstler:innen mit Behinderung wie Schauspieler:innen, Maler:innen, Musiker:innen oder Kabarettist:innen wollen öffentlich wahrgenommen und mit ihren spezifischen Fähigkeiten ernst genommen werden. Das gilt ebenfalls für andere marginalisierte Gruppen, die aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer kulturellen Herkunft an den Rand gedrängt werden.
Inklusion berührt letztlich die Grundlagen unseres demokratischen Gemeinwesens. Demokratie bedeutet nicht, alle paar Jahre ein Kreuz auf einem Wahlzettel zu machen. Demokratie soll eine Lebensform sein. In demokratischen Gesellschaften soll idealerweise eine soziale Erfahrung möglich werden, an der alle teilhaben und zu der alle etwas beitragen können. Insofern sollten in einer demokratischen Gesellschaft wie der unseren andere Formen des Umgangs miteinander gelebt werden. Wir müssen lernen, aufmerksamer miteinander umzugehen. Dann könnten viele inklusive Momente der Begegnung und des Voneinander-Lernens entstehen. Wenn man sich diesen Anspruch an eine wirklich demokratische Gemeinschaft bewusst macht, wird rasch deutlich, wie weit wir davon noch entfernt sind.
Mit diesem Buch möchte ich gern das Thema Inklusion mitten in die Gesellschaft holen. Inklusion sollte alltägliche Erfahrung sein, beim Einkaufen, im Restaurant, bei der Arbeit und selbstverständlich ebenso in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Anfangen müsste diese Reform im Bildungssystem. Wir sollen lernen, Demokratie auch im Bildungssystem als Lebensform zu praktizieren, um damit Inklusion möglich zu machen.
Dabei ist zunächst zu klären, wie inklusive Momente überhaupt zustande kommen (▸ Kap. 1). Es geht nicht nur um Teilhabe, sondern ebenfalls um Teilgabe und letztlich um Teil-Sein. Menschen, die be-hindert werden, wollen z. B. nicht nur großzügigerweise alle Rechte wahrnehmen können, die alle anderen Menschen wie selbstverständlich wahrnehmen. Sie wollen ebenfalls etwas einbringen, etwas geben. Diese Erfahrung wäre also noch zu machen, wirklich etwas voneinander zu lernen, damit alle teilsein können. Dies würde voraussetzen, dass wir das Verbindende zwischen Menschen suchen und nicht das Trennende, sondern gemeinsame Erfahrungen zulassen. Aus dem Voneinander-Lernen könnte so ein Miteinander und Füreinander entstehen.
Wollen wir solche inklusiven Situationen schaffen, so stehen wir vor der Aufgabe, auf die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse je nach Geschlecht, sozialem und kulturellem Hintergrund sowie nach individuellen Fähigkeiten offen einzugehen (▸ Kap. 2, 3 und 4). Auf diesem Wege können zukünftig Situationen entstehen, in denen alle willkommen sind und die Begegnung zwischen unterschiedlichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bewusst als Reichtum angesehen wird.
Dazu ist es erforderlich, dass wir die Ressourcen in uns und in unserem jeweiligen Umfeld aktivieren. Diese Ressourcen kommen nicht von allein, man kann nicht bloß auf sie warten. Man muss sie aktiv erschließen und Angebote für alle Sinne gestalten, damit Teilhabe gelingt (▸ Kap. 5). Damit sind jedoch keine Inseln gemeint, die isoliert von ihrer Umgebung ein ideales Umfeld schaffen. Vielmehr geht es darum, die sozialräumliche Einbettung von Bildungseinrichtungen bewusst zu entwickeln und vielfältige Kontakte zum Stadtteil und zur Gemeinde aufzubauen, so dass regionale Netzwerke geschaffen werden (▸ Kap. 6).
Auf diesem Weg könnte eine Gesellschaft entstehen, die im besten Sinne des Wortes »schöpferisch« wird und so in der Lage ist, die anstehenden Probleme in einer gemeinsamen Anstrengung kreativ zu lösen. Das zeigt sich gegenwärtig bereits in vielen kulturellen Projekten (▸ Kap. 7).
Bei all diesen Entwicklungen hat sich eine Ressource als vordringlich herausgestellt: die eigene Haltung der Beteiligten zum Umgang mit Unterschieden. Hier stehen wir alle vor der Aufgabe, unsere eigenen Grenzen zu entdecken, möglicherweise zu verschieben, in jedem Fall aber als Aufgabe zu begreifen. Grenzen beenden nicht das Handeln, sondern sie fordern es geradezu heraus (▸ Kap. 8). Letztlich geht es jedoch stets darum, in diesem Prozess neben den äußeren Barrieren die inneren, die Barrieren in den Köpfen und die eigenen Denkverbote zu überwinden. Inklusion wird unsere Sprache und damit unser Denken verändern.
Zum Abschluss möchte ich einen Ausblick in die Zukunft wagen und die konkrete Utopie einer inklusiven Gesellschaft entwerfen (▸ Kap. 9).
Jedes Kapitel wird mit einem Fallbeispiel begonnen, in dem die Lebenssituation eines Menschen und seine Form der Bewältigung kurz geschildert wird. Zum Schluss wird dieser Mensch jeweils selbst vorgestellt, wobei Überraschungen nicht ausgeschlossen sind. Jedes Kapitel endet mit einer Provokation im Sinne eines besonders herausfordernden Gedankens, der zum Weiterdenken und insbesondere zum Gespräch mit anderen anregen soll. Gerade weil Inklusion die Herausforderung einer Veränderung unseres Denkens bedeutet, habe ich die Form eines provokanten Essays gewählt.
Mein persönlicher Zugang zum Thema »Inklusion« basiert im Rückblick auf einer 40-jährigen Reise durch eine immer inklusiver werdende Landschaft. Ich war zehn Jahre als Lehrkraft für Sonderpädagogik in mehreren Sonderschulen tätig. Danach bin ich in die Ausbildung von sonderpädagogischen Lehrkräften gegangen und war Lehrstuhlinhaber für Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Lernbehindertenpädagogik. Ich habe 30 Jahre wissenschaftlich gearbeitet. Inklusion war dabei stets mein Focus in Forschung und Lehre. Ich schreibe dieses Buch aus diesen praktischen Erfahrungen in unterschiedlichen Schulen und Universitäten. Auch in der Forschung war mir stets wichtig, inklusive Kindertageseinrichtungen und inklusive Schulen in unterschiedlichen Bundesländern und europäischen Nachbarländern zu besuchen und mit den dort tätigen pädagogischen Fachkräften sowie mit Eltern, Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Das vorliegende Buch ist deshalb aus der sonderpädagogischen Perspektive entstanden. Ich verstehe unter Sonderpädagogik eine »Pädagogik für besondere Bedürfnisse«. Mein Schwerpunkt liegt dabei auf Menschen mit Behinderung. Ich entscheide mich damit dafür, die Person in den Vordergrund zu stellen und nicht die Behinderung (person-first language). Behinderung verstehe ich als Behindert-Werden und nicht als Behindert-Sein. Mir ist bewusst, dass Inklusion noch sehr viel mehr Unterschiede zwischen Menschen umfasst. Gleichwohl ist es mir ein Anliegen, dass wir bei der anstehenden gesellschaftlichen Inklusionsentwicklung Menschen mit Behinderung nicht vergessen, weil andere Unterschiede zwischen Menschen wie kulturelle und soziale Herkunft, Alter und Geschlecht in den Vordergrund rücken. Menschen mit Behinderung haben aber ebenfalls eine kulturelle und soziale Herkunft, ein Alter und ein Geschlecht. Und sie sind die gesellschaftliche Gruppe, die nach wie vor besonders von Ausgrenzung bedroht ist.
Eberbach, im Oktober 2024Ulrich Heimlich
1 Teilhabe, Teilgabe, TeilseinInklusive Momente
I wie Initiative oder:
»Die Initiative zur Inklusion mussvon den Beteiligten ausgehen!«
Die Ärzt:innen sagten Torstein Lerhol im Alter von acht Monaten voraus, dass er nicht älter werden würde als zwei Jahre und niemals laufen, sprechen, lesen, schreiben oder rechnen lernen könnte. Auch auf dem Bauernhof der Eltern in Vang (Norwegen) würde er nie helfen können. Doch die Eltern entscheiden sich, Torstein trotz alledem wie einen normalen Menschen zu behandeln. Sie lernen auf das zu schauen, was bei Torstein funktioniert. Und sie sorgen für Unterstützung im Alltag mit einer Haushaltshilfe, Physiotherapeut:innen und der Hilfe von Freund:innen. Im Alter von 32 Jahren hat Torstein Lerhol sein Lehramtsstudium mit einem Master in Geschichte abgeschlossen. Er arbeitet in der Gesundheitsfirma Aleris, die persönliche Assistenz anbietet, und leitet dort eine Abteilung mit 700 Angestellten. Er ist Mitglied im Gemeinderat von Vang und kandidiert im Jahre 2019 dort als Bürgermeister. Torstein Lerhol benötigt rund um die Uhr persönliche Assistent:innen, um all das zu bewältigen. Sie helfen ihm beim Essen, beim Schreiben auf dem Computer, bei Fahrten und bei Auslandsreisen. Er muss im Liegen transportiert werden. Seine Diagnose ist Spinale Muskelatrophie (MSA). Er bezeichnet sich selbst als »Steichholzausgabe des Glöckners von Notre Dame«. Und er fühlt sich gesund.1
Inklusion ist in aller Munde. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Wie so oft ist die Häufigkeit des öffentlichen Gebrauchs von Begriffen nicht immer ein Zeichen dafür, dass hier eine eindeutige Klärung vorliegen würde. Möglicherweise liegt das daran, dass Inklusion immer noch mit zahlreichen Denkverboten belegt wird, wie sie in der Prognose von Ärzt:innen oder im Urteil anderen Expert:innen beispielsweise über Menschen mit Behinderung zum Ausdruck kommen. Viele Eltern von Kindern mit Behinderung haben das schon einmal gehört: »Sie müssen sich damit abfinden, dass ihr Kind niemals ...« Und dann folgt – laufen, sprechen, lesen, schreiben usf. Wie so häufig haben sich im Laufe der Entwicklung noch viele Überraschungen eingestellt. Es wird nach wie vor zu sehr auf das geschaut, was nicht möglich scheint, auf die Schwäche, das Defizit und das Leid.
Inklusion eröffnet stattdessen die Chance, auf Schatzsuche zu gehen und nach Ressourcen zu suchen, die in uns selbst liegen oder in unserem Umfeld oder auch in den Ressourcen, die wir einander sein könnten. Gerade die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen könnte so zu einer Bereicherung werden. Zu oft wird im Anders-Sein noch eine Bedrohung und die Abweichung von der Norm gesehen. Aber manchmal gelingt es, beim Spielen im Kindergarten oder auf dem Spielplatz, bei Projekten in der Schule oder bei der Kooperation am Arbeitsplatz oder bei kulturellen Veranstaltungen ein Gefühl von Gemeinsamkeit zu erfahren. Dann erleben wir die anderen nicht als störend, sondern können im Gegenteil von all dem profitieren, was die anderen einbringen, spüren ein gegenseitiges Wohlwollen und fühlen uns einbezogen.
Inklusion als Völkerrecht
Für Menschen mit Behinderung hat sich in dieser Hinsicht im Jahre 2019 etwas Grundlegendes geändert. In diesem Jahr unterzeichnete Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK)2 und hinterlegte die Ratifizierungsurkunde bei den Vereinten Nationen in New York. Seither ist die UN-BRK in der Bundesrepublik Deutschland verbindliches Völkerrecht. In der Konvention wird Menschen mit Behinderung ein grundlegendes Recht auf Teilhabe und Selbstbestimmung zugestanden. Inklusion bekommt in der Folge die Bedeutung eines Menschenrechts. Dieses Recht gilt lebenslaufbegleitend und in allen Lebensphasen. Im Bereich der Bildung wird ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen gefordert (Art. 24). Die Umsetzung der UN-BRK wird laufend überprüft und in Staatenberichten – zuletzt 2023 – zusammengefasst. Im Parallelbericht zum letzten Staatenbericht Deutschlands aus dem Jahre 2023, herausgegeben vom Institut für Menschenrechte in Berlin, wird Deutschland in den Bemühungen um die praktische Umsetzung des Menschenrechtes Inklusion kein gutes Zeugnis ausgestellt.3 Nach wie vor dominieren bei uns die Sondereinrichtungen wie Förderschulen, Werkstätten für behinderte Menschen und Wohnheime für Menschen mit Behinderungen. Die Maßnahmen zur Förderung der Inklusion lassen immer noch keine konsequente Umsetzung erkennen – und das mehr als zehn Jahre nach deren Inkrafttreten. Bei der Verabschiedung der UN-BRK im Deutschen Bundestag war die Mehrheit der Abgeordneten wohl der Meinung, dass in Deutschland schon viel für die Integration von Menschen mit Behinderung getan wird. Bei ersten internationalen Vergleichen dämmerte uns jedoch, dass mit dem neuen Leitbild der Inklusion mehr gemeint ist.
Von der Exklusion zur Inklusion
Aber was ist nun das Neue an der Inklusion? Das wird am ehesten verständlich, wenn wir z. B. einen kleinen Rückblick auf die Geschichte des Umgangs mit Behinderungen werfen. Im antiken Griechenland war es keineswegs gesichert, dass Kinder mit Behinderung die ersten Lebenstage überlebten. Selbst anerkannte Philosophen wie PLATON (427/428 v. Chr.–348/347 v. Chr.) und ARISTOTELES (384 – 322 v. Chr.) waren nicht der Meinung, dass es eine moralische Pflicht gebe, Kinder mit Behinderung wie alle anderen Kinder zu versorgen und aufwachsen zu lassen.4 Die Tötung von Kindern oder das Aussetzen von Kindern mit Behinderungen war damals keine Seltenheit. Bis hinein in das Mittelalter blieben Kinder mit Behinderung von der Gesellschaft und insbesondere von Bildungsangeboten ausgeschlossen. Sie wurden auf Jahrmärkten zur Schau gestellt und zum Betteln gezwungen.5 Wir sprechen in diesem Fall von einer Phase der Exklusion.
Im Zeitalter der Aufklärung lassen sich erste Versuche verzeichnen, Kinder mit Behinderung an Bildungsprozessen zu beteiligen. In der Regel ging das mit öffentlichen Veranstaltungen einher, in denen die Bildungsfähigkeit von Kindern mit Behinderung unter Beweis gestellt werden musste. Der Schriftsteller T.C. BOYLE hat beispielsweise in seinem Roman »Das wilde Kind«6 die Geschichte von Viktor, dem Wolfskind, erzählt. Im Jahre 1797 wurde im Süden Frankreichs ein völlig verwahrlostes Kind gefunden und in eine Pariser Taubstummenanstalt gebracht. Dort erhielt es eine intensive Förderung, um zu belegen, dass auch in diesem Fall Bildung möglich ist. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass von solchen öffentlich bekannt gewordenen Bildungsversuchen Impulse ausgingen, um für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ebenfalls ein Bildungsangebot zu entwickeln. Es entstanden erste Methoden zur Förderung, wie die Blindenschrift und die Lautgebärdensysteme für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen.7 Allerdings war man seinerzeit noch der Auffassung, dass diese Förderung nur in eigenständigen Bildungseinrichtungen erfolgen könne. Deshalb nennen wir dies die Phase der Separation. In der Folge entstanden sowohl Heime für Kinder und Jugendliche mit Behinderung als auch eigenständige Schulen und Kindertageseinrichtungen. Auf diese Weise entwickelte sich ein eigenständiges System von Sondereinrichtungen. In Deutschland wurde dies noch nach 1945 zu einem differenzierten Sonderschulsystem weiterentwickelt, in dem es nahezu für jede Behinderungsart eine eigene Schule gab.
Erst um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert lassen sich erste Bemühungen feststellen, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam zu fördern und in einer gemeinsamen Bildungseinrichtung zusammenzuführen. Sie wurden in eigenständigen Klassen zusammengefasst, die aber allgemeinen Schulen mit Kindern ohne Behinderung angeschlossen waren. Teilweise erhielten sie gemeinsamen Unterricht. Aber diese Versuche blieben zunächst noch sehr vereinzelt. Erst im Zeitalter der Bildungsreform nach 1968 setzte eine Bewegung ein, die zunächst von engagierten Eltern und pädagogischen Fachkräften aus der Praxis getragen worden ist, Kinder und Jugendliche mit Behinderung wie alle anderen in allgemeine Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzunehmen. Was zunächst getrennt worden ist, sollte also wieder zusammengeführt werden. Ab den 1970er Jahren mehrten sich die erfolgreichen Versuche der gemeinsamen Förderung. Es zeigte sich, dass weder Kinder und Jugendliche mit noch Kinder und Jugendliche ohne Behinderung dadurch Nachteile hatten. Im Gegenteil: Hinsichtlich der Schulleistungsentwicklung stellten sich sogar Vorteile heraus. Und in Bezug auf grundlegende soziale Kompetenzen sowie einen toleranten Umgang miteinander, lernten alle voneinander.8
Damit war die Phase der Integration eingeleitet. Von der Wortbedeutung her meint Integration die Wiederherstellung eines Ganzen, was vorher getrennt war. Im Bildungsbereich sollten beispielsweise Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die vorher getrennt von anderen Kindern in Sondereinrichtungen untergebracht worden sind, nunmehr gemeinsam spielen und lernen. Integration setzt also die vorherige Separation voraus. Die Beharrungstendenzen der separierten Sondersysteme waren allerdings doch so hoch, dass diese Integrationsbemühungen nur für einen geringen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zur Verfügung standen. Andere Länder ohne ein ausgebautes und differenziertes System von Sondereinrichtungen hatten hier von Beginn der Integrationsbewegung an Vorteile.9
Spätestens mit der Ratifizierung der UN-BRK durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2009 ergibt sich nun die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der integrativen Bemühungen. Es soll von vornherein auf jegliche Aussonderung verzichtet werden. Kinder und Jugendliche mit Behinderung sollen in allen Bildungseinrichtungen willkommen geheißen werden und mit ihren Freund:innen und Nachbarskindern in die Kindertageseinrichtungen und Schulen vor Ort gehen. Ziel ist es laut UN-BRK, dass das für die Mehrheit der Menschen mit Behinderungen möglich ist. Schnell wird bei dieser Entwicklung hin zur Inklusion im Lebenslauf deutlich, dass sich dafür viele Institutionen als System verändern müssen. Inklusion soll nunmehr zum Leitbild sowohl im Bildungsbereich als auch im gesellschaftlichen Zusammenleben werden.
Dazu ist es erforderlich, dass Inklusion in den Einrichtungskonzepten (z. B. in Kindertageseinrichtungen und Schulen) an zentraler Stelle verankert ist. Wir befinden uns deshalb nun in einer Phase der Inklusion. Inklusion bedeutet wörtlich Enthaltensein in etwas. Inklusion kann deshalb definiert werden als selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft. Teilhabe ohne Selbstbestimmung gerät schnell zu einer Zwangsmaßnahme und einseitigen Anpassung an die Gesellschaft. Menschen mit Hörbeeinträchtigungen nehmen demgegenüber z. B. ihr Recht wahr, nicht teilzuhaben und in einer Gehörlosengemeinschaft mit einer eigenen Gebärdensprache zu leben. Was hier zunächst am Beispiel Behinderung und bezogen auf das Bildungssysstem deutlich wird, erweitert sich mittlerweile auf weitere Bereiche. Inklusionsbemühungen sollten darüber hinaus Menschen mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung einbeziehen, die Ungleichbehandlung von Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern sowie alten Menschen aufgreifen. Inklusion ist letztlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir stehen vor der Herausforderung, eine inklusive Gesellschaft zu entwickeln.
Teilhabe und Selbstbestimmung
Ich möchte nun vorschlagen, dass wir diese Mammutaufgabe eines gesellschaftlichen Reformprozesses bescheiden angehen und uns mit der Gestaltung von inklusiven Momenten beschäftigen. Das sind Momente, in denen wir uns begegnen, teilhaben und etwas beitragen können. Inklusion bedeutet eben nicht nur Teilhabe im Sinne von Dabeisein. Erst wenn wir uns mit unseren Fähigkeiten einbringen können, entsteht das Gefühl mittendrin zu sein.
Nach meiner Erfahrung haben inklusive Momente etwas Entlastendes. Vielfach wird mit Momenten eine kurze Zeitspanne verbunden, ein Augenblick. Historische Momente können jedoch ebenso größere Zeitspannen umfassen. So zeigt sich in dieser Bandbreite des Erlebens von Momenten zugleich unser subjektives Zeitempfinden. Nicht in der messbaren Zeit, die wir von der Uhr ablesen (chronos), erschöpft sich unsere Zeitvorstellung. Vielmehr gehört zu unserem Zeiterleben stets die persönlich empfundene Dauer (kairos).10 Inklusive Momente sind »Sternstunden« eines gelingenden Zusammenlebens. Wir freuen uns, wenn sie gelingen. Aber sie sind keineswegs in jedem Moment unseres Lebens zu erreichen. Auch in Bildungseinrichtungen heißt Inklusion nicht, dass Kinder, Jugendliche oder Erwachsene ständig alles gemeinsam machen. Neben den gemeinsamen Erlebnissen kann es ebenso Phasen des Rückzugs oder der Zweisamkeit geben. Die jeweilige Spiel- und Lerngruppe muss nicht immer miteinander tätig sein. Der Ausschluss aus der Gemeinschaft im Sinne von Exklusion ist in unserer Gegenwart nach wie vor Realität, wie unschwer an den Armutszahlen oder an rassistischen und fremdenfeindlichen Tendenzen abzulesen ist. Gleichwohl streben wir inklusive Momente an. Insofern handelt es sich um eine Zielvorstellung, auf die wir hinarbeiten. Es kann durchaus viele inklusive Momente geben. Und man kann versuchen, diese auf Dauer zu stellen. Aber stets sind dabei die selbstbestimmten Entscheidungen des Einzelnen zu berücksichtigen.
Bei einem Schulbesuch mit mehreren Kolleg:innen in einer Grundschule habe ich vor einiger Zeit im Unterricht eine Situation erlebt, für die mir der Begriff »inklusive Momente« eingefallen ist. Alle Schüler:innen haben sich mit dem Unterrichtsthema beschäftigt, sie haben allein, zu zweit oder in Gruppen gearbeitet, sich gegenseitig geholfen, sich selbstständig im Klassenraum bewegt und sind von der Lehrkraft eher beobachtet und begleitet als unmittelbar angeleitet worden. Alle Lernmaterialien sind frei zugänglich gewesen. Es herrschte eine konzentrierte Aufmerksamkeit in der gesamten Klasse. Die Situation vermittelte eine Art Schwebezustand, in dem alle relevanten Aspekte im Gleichgewicht waren. Als ich spontan sagte: »Das ist ein inklusiver Moment!«, fand diese Bezeichnung sofort Zustimmung bei den anderen Besucher:innen im Klassenraum. Allerdings hätte niemand sagen können, was damit eigentlich genau gemeint ist. Ich hatte zunächst das Gefühl, dass ich hier einen Begriff geprägt habe, der sich selbst erklärt und unmittelbar verstanden werden kann. Auch die Lehrkräfte, die schließlich den Unterricht vorbereitet hatten und die Lernsituation über die Bereitstellung der Lernmaterialien und die Erarbeitung der Lernmethoden mit den Schüler:innen gestaltet hatten, konnten uns diese Frage nicht beantworten.
Offenbar beinhaltet der Begriff »inklusive Momente« ein Grundverständnis von Inklusion, das miteinander geteilt werden kann, ohne dass es gleich ausformuliert wird. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich den Begriff »inklusive Momente« genauer beschreiben konnte.11 Dazu habe ich mir Protokolle von Schulbesuchen und Besuchen in Kindertageseinrichtungen noch einmal angeschaut. Außerdem habe ich versucht, mir meine Erfahrungen aus der Beobachtung von inklusiven Prozessen in unterschiedlichen Settings sowie aus Gesprächen mit frühpädagogischen Fachkräften, Lehrkräften, Eltern sowie Kindern und Jugendlichen noch einmal in Erinnerung zu rufen. Der Begriff »inklusive Momente« ist also im Grunde aus der praktischen Erfahrung mit inklusiven Prozessen hervorgegangen.
Gleichwohl ist zu klären, was inklusive Momente im Einzelnen ausmachen und wann und wie sie zustande kommen. Gibt es vielleicht sogar eine Möglichkeit, inklusive Momente zu planen?12 Ich möchte mit einem Beispiel für einen inklusiven Moment aus der inklusiven Schulpraxis beginnen, um zu beschreiben, was ich unter einem inklusiven Moment verstehe. Diese Szene habe ich in der inklusiven Grund- und Mittelschule in Huglfing (Bayern) bei einem Schulbesuch erlebt.
Frühstückseinkauf mit Sarah
Bald ist Pause in der 9a der Mittelschule. Sarah hat ihren Einkaufszettel schon einmal herausgeholt. Sie wartet bereits ungeduldig auf das Zeichen der Lehrkraft. Jetzt darf sie loslegen. Heute ist sie dran mit der Frühstückbestellung. Sie geht zu den Mitschüler:innen und fragt, was zum Frühstück gewünscht wird. »Für mich eine Butterbrezn!« »Ich hätte gern eine Käsestange!« »Mir reicht heute ein Apfel!« »Ich will auf jeden Fall einen Kakao!« Sarah kreuzt alles sorgfältig mit ihrem Folienstift an. Die Bilder des Frühstücksangebotes helfen ihr dabei. Aber dann wird es kompliziert. Sie muss auch das Geld einsammeln. Da heißt es höllisch aufpassen, damit hinterher das Wechselgeld stimmt. In der kleinen Pause um 9:00 Uhr kann Sarah dann losziehen zum Hausmeister, der schon in seinem Glaskasten in der Pausenhalle sitzt und auf seine Kunden wartet. Sarah tritt an die Theke und legt los. »Eine Butterbrezn, eine Käsestange, ein Apfel, ein Kakao ...« Und so geht es weiter, bis alle Wünsche erfüllt sind. Dann kommt das Bezahlen. Der Hausmeister weiß genau, dass Sarah das Geld selbst abzählen will. So wartet er geduldig und gibt ihr das Wechselgeld heraus. Sie will schon davon stürzen, da fragt der Hausmeister: »Hast Du denn das Wechselgeld nachgezählt?« »Ja, wird schon stimmen«, ruft sie ihm auf dem Weg zurück in die Klasse noch zu. Zum Frühstück kann Sarah nun ihre Einkäufe verteilen. Alle Mitschüler:innen, die bei ihr eine Bestellung aufgegeben haben, bedanken sich. Sarah steht die Freude über die Anerkennung ins Gesicht geschrieben. Sarah will immer dabei sein. Der Unterrichtsstoff in der 9. Klasse der Mittelschule fällt ihr ganz schön schwer. Sie hat das Down-Syndrom. In der Klasse ist sie sehr beliebt. Und den Frühstückseinkauf lässt sie sich ganz bestimmt nicht mehr nehmen.
Auch bei dieser Szene handelt es sich um einen inklusiven Moment. Aber was ist das Inklusive an diesem Moment? Die Antwort ergibt sich meiner Meinung nach aus der Qualität der Lernerfahrung von Sarah. Dazu ist es erforderlich, dass möglichst das gesamte Potenzial einer Lernsituation ausgeschöpft wird. Das gelingt nach meiner Erfahrung immer dann, wenn alle Schüler:innen an der Lernsituation teilhaben können und wenn alle etwas dazu beitragen können.
Sarah ist in das Geschehen in der Klasse einbezogen, indem sie eine Aufgabe im Rahmen der Klassendienste übernimmt (Erfahrung des Teilhabens). Zugleich kann sie mit ihren Fähigkeiten etwas in die Situation einbringen und den anderen Schüler:innen einen Dienst erweisen. Sie denkt mit, achtet auf die Organisation des Klassendienstes und gestaltet die Situation mit ihren sozialen Fähigkeiten auf eine ganz persönliche Art und Weise (Erfahrung des Beitragens). Teilhaben und Beitragen sind die beiden Seiten der Lernerfahrung, die in inklusiven Momenten möglich werden. Teilhaben und Beitragen sind deshalb Grunddimensionen von inklusiven Momenten.
Betrachten wir diesen inklusiven Moment aus der Perspektive von Sarah, so können wir feststellen, dass Sarah einerseits durchaus gefordert ist, ihre Fähigkeit zu sprechen und nachzudenken einzusetzen, wenn sie die Mitschüler:innen nach ihren Wünschen fragt, beim Hausmeister die Bestellung aufgibt oder das Wechselgeld berechnen soll (kommunikative und kognitive Kompetenzen). Andererseits bietet der Einkauf für Sarah aber ebenfalls viele handlungsorientierte Elemente und sinnlich-bewegungsorientierte Erfahrungsmöglichkeiten, wenn sie etwa den Einkauf in die Klasse transportiert, an die Mitschüler:innen verteilt und das Wechselgeld ausgibt (sensomotorische und sozial-emotionale Kompetenzen). Inklusive Momente sollten sich stets auf die ganze Person beziehen. Das ist der personale Aspekt von inklusiven Momenten.
Nehmen wir hingegen die Perspektive der Mitschüler:innen ein, so wird Sarah einerseits als Person mit ihren Fähigkeiten wahrgenommen, auf die von der Klasse eingegangen wird und deren Fähigkeiten als Ausgangspunkt ihrer Lernerfahrungen akzeptiert werden (Individualisierung). So kann sie sich als Person aufgrund der Wertschätzung durch Mitschüler:innen weiterentwickeln. Über ihren Beitrag zur Vorbereitung des Frühstücks erfährt Sarah andererseits ebenfalls die Bedeutung von sozialen Beziehungen in der Schulklasse und fühlt sich hier mit einbezogen (Gemeinsamkeit). Ihr Mitschüler:innen bedanken sich für den Service und erkennen sie damit zugleich als Teil ihrer Gruppe an. Inklusive Momente entstehen aus der Begegnung von unterschiedlichen Menschen, die ihre jeweilige Einzigartigkeit in ein Miteinander einbringen und daraus etwas Gemeinsames hervorgehen lassen. Deshalb ist die Qualität der Interaktion aller Beteiligten in inklusiven Momenten von so großer Bedeutung. Das ist der soziale Aspekt von inklusiven Momenten.
Schauen wir auf die Gesamtsituation, in der dieser inklusive Moment stattfindet, so gestaltet Sarah einerseits den Frühstückseinkauf als Lernsituation weitgehend selbstständig. Sie bestimmt selbst den Zeitpunkt, wann sie mit den Vorbereitungen beginnt. Auch den Weg zum Hausmeister in der Pausenhalle bewältigt sie ohne Hilfe (Offenheit