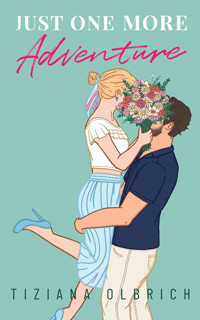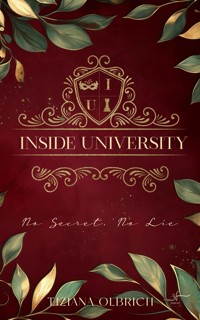5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An der Inside University ist Rache süß, Verrat tödlich und Geheimnisse sind die Währung der Macht.
Für Noa wird mit der Aufnahme an der elitären Inside University ein Traum wahr – bis sie im glamourösen Chateau nahe Paris ausgerechnet auf Julie, ihre Erzfeindin aus Schultagen, trifft. Diese ahnt nichts von Noas Racheplänen und steckt selbst in einem Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach finanzieller Sicherheit und der Versuchung einer verheißungsvollen Affäre.
Parallel dazu kämpft Pilar darum, das plötzliche Verschwinden ihrer Schwester auf dem Campus aufzuklären. Um Antworten zu erhalten, muss sie erst die Gunst einer mysteriösen Studentenverbindung gewinnen. Doch sie ist nicht die Einzige mit Interesse an diesem Club: Ein anonymer Podcast deckt die dunklen Geheimnisse der Schlosselite auf und stiftet Unruhe unter den Studierenden.
Das erste Semester wird zu einem gefährlichen Spiel – und für eine von ihnen endet es tödlich.
Pretty Little Liars meets Gossip Girl in diesem fesselnden Auftakt einer New-Adult-Dilogie über Liebe, Intrigen und die Suche nach Gerechtigkeit, die tief in die Abgründe der prestigeträchtigen Inside University blickt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INSIDE UNIVERSITY:
NO BODY, NO CRIME
BUCH 1
TIZIANA OLBRICH
Verlag:
Zeilenfluss Verlagsgesellschaft mbH
Werinherstr. 3
81541 München
_____________________
Texte: Tiziana Olbrich
Cover: Zeilenfluss
Satz: Zeilenfluss
Korrektorat:
Tanja Eggerth – TE Language Services,
Nadine Löhle – Goldfeder Texte
_____________________
Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung oder Vervielfältigung dieses Buches – auch auszugsweise – sowie die Übersetzung dieses Werkes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Handlungen und Personen im Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
_____________________
ISBN: 978-3-96714-462-8
TRIGGERWARNUNG
Liebe Leser*innen,
ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass dieses Buch einige Elemente enthält, die unter Umständen triggern können.
Für den Fall, dass ihr sie braucht, findet ihr die Triggerthemen unter zeilenfluss.de/product/inside-university-no-body-no-crime/, da sie Spoiler für das ganze Buch enthalten.
Für meine Insead-Crew,
vielen Dank für das unvergessliche Frankreichjahr
und die Inspiration für diese Geschichte.
Für all die Noas da draußen,
euren Selbstwert findet ihr nicht in den Köpfen anderer.
PROLOG
Ich bin keine hinterhältige Person, und doch bin ich kurz davor, eine echt miese Sache abzuziehen. Aus Selbstschutz, aber vor allem für dich. Selbst, wenn es bedeutet, dass du mich dafür verabscheuen wirst. Auch wenn mich alle hassen werden, bleibt mir keine andere Wahl.
Noa Bernstein muss verschwinden.
Nur so kann ich sie davon abhalten, uns zu verraten. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, wie sehr es mir widerstrebt, einen anderen Menschen zu verletzen. Aber ich muss tun, was getan werden muss.
Es war nie meine Absicht, dich in Gefahr zu bringen. Frankreich sollte der langersehnte Neuanfang werden. Jetzt steht unsere gemeinsame Zukunft auf dem Spiel, und natürlich ist es meine Schuld. Es tut mir leid. Ich hoffe, du verstehst eines Tages, dass es der einzige Weg war, sie zu stoppen. Genauso wie dieses wahnwitzige Spiel.
JULIE
Freitag,
01. September,
14:12
Wenn du mit 19 Jahren dein Elternhaus in der Bronx zurücklässt, um in der Mode-Metropole zu studieren, bist du entweder ein verdammtes Glückskind oder geübt darin, gut platzierte Lügen einzusetzen. Ab heute zählte nicht mehr, wie ich es nach Paris geschafft hatte. Mir lag die Welt zu Füßen, und ich würde sicherstellen, dass sie in Louboutins steckten. Für den Kauf der Schuhe mit den roten Sohlen, deren raffiniertes Markenzeichen symbolisch für Liebe, Blut und Leidenschaft stand, brauchte ich nur ein bisschen Hilfe von meinem Freund. Aber das würde kein Problem sein – Jonah war geübt darin, mir Wünsche von den Augen abzulesen.
Noch bevor ich dazu kam, meiner Bitte Ausdruck zu verleihen, entwich meiner Kehle ein Freudenschrei. Zwischen den altehrwürdigen Stadthäusern zeichneten sich die majestätischen Konturen des Eiffelturms ab, und ich konnte mein Glück kaum fassen. Gierig saugte ich die Eindrücke der Stadt auf. Jede Straße und jedes Monument strahlte Geschichte aus; selbst die Luft roch nach Magie.
Ich streckte den Kopf aus dem Taxifenster, und es kümmerte mich nicht, dass der Fahrtwind meine honigblonde Mähne zerzauste. Der Ausblick machte mich auf eine Art und Weise glücklich, die schwer in Worte zu fassen war. Wir fuhren vorbei an Denkmälern, die von vergangenen Jahrhunderten erzählten. Überwältigt von ihrer Schönheit speicherte ich alles ab: Die Straßen, die Menschen und allem voran ihre Outfits. Der Kleidungsstil der Pariser war minimalistisch, geradezu reduziert: feine Armreifen, ein eleganter Gürtel, ein Seidenschal, der gekonnt zweimal um den Hals geschlungen und geknotet wurde – aber nie alles auf einmal! Fasziniert beobachtete ich die Gestalten, deren Styling ebenso einmalig war wie die Stadt, in der sie lebten.
Vom heutigen Tag an war ich eine von ihnen.
Jonah drückte meine Hand. Ihm hatte ich es zu verdanken, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben den Atlantischen Ozean überquert hatte.
Auf Geheiß von Jonahs Familie hatte uns am Flughafen ein Fahrer abgeholt und kutschierte uns durch die Stadt. Auf der Landstraße, die direkt vom Flughafen zu unserem neuen Zuhause geführt hätte, gab es aufgrund einiger Umbauarbeiten einen Stau. Mir kam der Umweg durch die Stadt gelegen. Ich liebte Paris und wäre am liebsten hiergeblieben. Leider war mein Freund anderer Ansicht.
»Wohin fahren wir als Erstes?«
»Ins Château«, entgegnete Jonah mit einem Gähnen. »Schließ doch bitte das Fenster. Es zieht.«
Notgedrungen wandte ich mich von den vorbeiziehenden Häusern ab. Unbeeindruckt von dem Freilichtmuseum vor unseren Scheiben las Jonah einen Zeitungsartikel auf seinem Handy. Sein Desinteresse weckte Verärgerung in mir, was ich mir nicht anmerken ließ, da ich nur aufgrund seiner Güte hier saß.
Chacun est l’artisan de sa fortune, wuchs ein Plan in meinem Kopf. Jeder ist seines Glückes Schmied. Mit einer geschmeidigen Geste streckte ich die andere Hand aus und legte sie auf Jonahs Knie. Ich drückte es kurz, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Dann neigte ich den Kopf, sodass mir einige Ponyfransen in die Augen fielen, und setzte meinen bezauberndsten Blick auf. Ich hatte mir die Frisur erst kurz vor dem Abflug zugelegt und war verliebt in den, meines Erachtens, französischen Look. Fehlte nur noch eine schief sitzende Baskenmütze auf dem Kopf, und ich lebte den wahr gewordenen Traum als Emily in Paris. Es war nur eine Frage der Zeit, bis meine Garderobe ebenso imposant sein würde wie die in der Serie. Zumindest meine Französischkenntnisse saßen, dafür hatte ich in den letzten zwei Jahren gesorgt. So lange träumten Jonah und ich bereits von unserem glamourösen Leben in Frankreich.
»Können wir nicht erst zur Champs-Élysées?«
Jonahs Blick wurde weich, und ich schob ein ›S’il te plaît‹ nach. Ich liebte die französische Sprache; sie klang zärtlich und doch verrucht in meinen Ohren.
Jonah schüttelte leicht den Kopf. »Jules, also wirklich. Wenn du mich so anschaust, kann ich dir nichts abschlagen.«
Trotz seiner Widerworte schlich sich ein amüsiertes Lächeln auf seine Lippen. Ein klares Indiz dafür, dass ich gewonnen hatte. Natürlich hatte ich das. Von Jonah bekam ich alles, was ich wollte, deswegen mochte ich ihn ja so. Nun, alles, bis auf eine winzige Ausnahme, die mich vorerst nicht kümmerte.
Wir waren seit etwas über zwei Jahren ein Paar, und mein Leben hatte mit seiner Hilfe eine 180-Grad-Wende hingelegt. Jonah King war großzügig, charmant und alleiniger Erbe eines globalen Energiekonzerns. Seine vornehme Herkunft sah man seiner exquisiten Garderobe an. Er trug glänzende Schnürschuhe und ein hochwertiges hellblaues Hemd, das lässig aus der beigen Hose hing. Es war aus einem sündhaft teuren Stoff und wies selbst nach unserem Langstreckenflug keinerlei Knitterspuren auf. Seine welligen dunkelbraunen Haare waren nach hinten frisiert, und an seinen ordentlich manikürten Fingern steckte ein protziger Siegelring, dessen Wert meine Studiengebühren überstieg. Was einer der Gründe war, warum es für Jonah kein Problem darstellte, diese mit einer Selbstverständlichkeit zu bezahlen, als handle es sich um ein Abendessen. Zwar war der Wirtschaftsstudiengang Business Administration, in den wir uns auf Anweisung von Jonahs Vater eingeschrieben hatten, nicht mein Wunschstudium, aber die Kurse würden mir bei meinem Ziel, Modedesignerin zu werden, sicherlich von Vorteil sein. Ich hatte es nach Frankreich geschafft, nur das zählte. Dafür war ich auch bereit, in ein altertümliches Schloss in einem Provinzort zu ziehen. Auch wenn Jonah mir versichert hatte, dort fänden die legendärsten Partys statt, ging ich davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Jonah einsehen würde, wie viel mehr Paris uns zu bieten hatte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich in eins der famosen Fashion-Programme gewechselt oder noch besser, direkt mit einem Designer zusammengearbeitet.
Jonah wandte sich an den Fahrer und erklärte ihm in schnellem Französisch die Planänderung. Ich lehnte mich entspannt zurück und schaute wieder aus dem Fenster, das ich meinem Freund zuliebe schloss.
Paris war noch bezaubernder, als ich mir die Stadt der Liebe in meinen Träumen vorgestellt hatte. Unser Fahrer chauffierte uns durch das Künstler- und Vergnügungsviertel Montmartre, wo ich mich wie in einer anderen Welt fühlte. Der fabelhaften Welt der Amélie, deren Film in meiner Kindheit das Faible für den Pariser Modestil geweckt hatte. Es war bekannt, dass Mode die Welt regierte, aber Pariserinnen beherrschten die Mode. Und ich war auf dem besten Weg dahin, selbst eine zu werden. Mein Pass wies mich zwar als Amerikanerin aus, doch das machte nichts, denn viele Pariser Stilikonen kamen ohnehin von anderswoher. Genau wie ich waren sie nicht in der französischen Hauptstadt geboren worden, dafür hatte die Stadt sie mit ihrem Zauber wiedergeboren und in Legenden verwandelt. Wie hatte Ernest Hemingway so treffend gesagt? Es gab nur zwei Orte auf der Welt, an denen man glücklich leben konnte: zu Hause und in Paris. Zeit, Paris zu meinem Zuhause zu machen!
Der Fahrer hielt im Halteverbot an. Statt wie erwartet wild zu hupen, wie es auf den New Yorker Straßen zum Alltag gehörte, manövrierten die umstehenden Wagen um uns herum. Jonah stieg zuerst aus und reichte mir galant seine Hand, um mir aus dem Fahrzeug zu helfen.
»Merci, mon amour«, säuselte ich, woraufhin Jonahs Mundwinkel vergnügt zuckten. »Wir sind wirklich hier, jetzt sind wir endlich frei.«
Ich hakte mich bei Jonah unter und zog ihn zu den Eingangstüren einer der sagenumwobenen Boutiquen in der berühmten Prachtstraße. Mein Herz machte aufgeregte Sprünge. Der verheißungsvolle rote Teppichboden war nur wenige Schritte von uns entfernt, da weckte eine Bewegung zu unserer Rechten mein Interesse. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich eine Gestalt. Sie stand am Ende des Blocks unter einer der verschnörkelten Straßenlaternen und starrte uns an. Es war mehr als nur eine flüchtige Musterung, prüfend glitt der Blick über unsere Körper. Hitze breitete sich in meinem Nacken aus. Sie kam nicht von der Shopping-Vorfreude. Normalerweise genoss ich es, im Augenmerk anderer zu stehen, aber etwas an dem Starren missfiel mir. Es weckte Selbstzweifel, die ich nicht auf diesen Kontinent hatte mitbringen wollen.
Ruckartig blieb ich stehen. Bereit, der Person einen abschätzigen Blick zuzuwerfen. Ich hatte gelernt, dass man Kritik am besten mit Selbstvertrauen begegnete. Eine schlagfertige Erwiderung auf den Lippen riss ich den Kopf herum, da wandte sich die Gestalt abrupt ab. In einem im Wind flatternden schwarzen Mantel lief die Person zügigen Schrittes in die entgegengesetzte Richtung. Die schmale Statur sprach für eine Frau, allerdings war ich mir aufgrund der tief ins Gesicht gezogenen Schirmmütze nicht sicher.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Jonah.
»Alles bestens«, murmelte ich und zog Jonah entschlossenen Schrittes in die Boutique. »Lass uns mein Traumpaar finden.«
Umgeben von den schönsten Designerschuhen probierte ich ein Paar nach dem anderen an. Aber das merkwürdige Empfinden blieb. Es war bereits das zweite Mal, dass ich heute ein ungutes Gefühl verspürte. Am Flughafen hatte ich ebenfalls den Eindruck gehabt, beobachtet zu werden. Ich schüttelte den Kopf über mich selbst. Wir waren auf einem neuen Kontinent; keine Menschenseele interessierte sich für Jonah oder mich. Es waren mit Sicherheit nur die angespannten Nerven, immerhin zog man nicht jeden Tag in die Stadt seiner Träume.
NOA
Freitag,
01. September,
23:35
Umziehen war anstrengend; seinen Wohnsitz auf einen anderen Kontinent zu verlegen, verlangte jedoch ein völlig neues Maß an Selbstständigkeit. Obwohl ich für gewöhnlich die Organisiertheit in Person war, überforderte mich die Tatsache, von nun an alle Entscheidungen selbst treffen zu müssen. Ein Problem bei der Kofferausgabe? Keine Eltern, die es für einen lösten. Eine Endlosschlange am Service-Schalter? Niemand, der mit einem wartete. Mein Kopf dröhnte. Ich war erledigt von der langen Anreise, den engen Sitzen in der Economy-Class und bereute die Entscheidung, in eine französische Kleinstadt umzuziehen. Fontainebleau lag laut der Landkarte meines iPhones zwar nur 40 Minuten Fahrzeit entfernt, als Pariser Vorort hätte ich es trotzdem nicht bezeichnet. Dafür hatte der Taxifahrer bereits zu viele kleine Ortschaften durchquert.
»Schüttet es hier immer so?«
Wie um meine Worte zu unterstreichen, erklang ein Donnergrollen. Der Taxifahrer murrte etwas Unverständliches auf Französisch. Ich warf ihm einen raschen Blick zu, aber er starrte nur auf die Straße. Ich kaschierte ein Gähnen mit der von Sommersprossen gesprenkelten Hand und rieb mir müde über die Augen.
»Ah … Oui, oui«, murmelte ich zaghaft.
Der karge Wortwechsel war mir unangenehm. Ich hatte keinen Schimmer, was der Mann gesagt hatte. Zudem konnte ich nicht nachvollziehen, wieso er trotz seiner Berufswahl kein Englisch sprach. Zwar hatte ich in der Highschool anderthalb Jahre einen Sprachkurs belegt, mit den Einheimischen konnte ich mich trotzdem kaum verständigen. Die Franzosen redeten so schnell, dass die Sätze sich wie ein einziges langes Wort anhörten. Nur gut, dass die Collegekurse in meiner Landessprache stattfinden würden.
Mit der Aufnahme in die anspruchsvolle Inside University war ein Traum für mich wahr geworden. Das internationale Institut galt als europäisches Pendant zu Harvard und verhieß eine Karriere voll vielversprechender Möglichkeiten. Das hart erarbeitete Stipendium war mein Ticket in ein anderes Leben. Monatelang hatte ich den Tag herbeigesehnt, an dem ich endlich die vorurteilsbehaftete Highschool verließ. Statt der scheuen Rothaarigen, die in keine Clique reinpasste, würde ich zukünftig eine Wissbegierige unter vielen sein. An einem Ort, an dem Fleiß mehr zählte als der Einfluss der Eltern. Der einzige Haken war die unhöfliche Art der Franzosen.
Wobei, wenn ich gewusst hätte, dass Frankreich mich mit diesem Mistwetter willkommen heißen würde, hätte ich die London Business School in Betracht gezogen. Wenn es dort regnete, war man zumindest nicht vom Wetter enttäuscht, es erfüllte die Erwartungen. Mit der Sprachbarriere hätte ich dort ebenfalls nicht zu kämpfen gehabt. Letztlich hatte die signifikant höhere Summe des französischen Stipendiums den Ausschlag gegeben.
Der Fahrtzeit zufolge waren wir nicht mehr weit von unserem Ziel entfernt. Durch die dicke Regenwand waren nur grobe Umrisse der Umgebung zu erkennen, da erregte ein Lichtschein meine Aufmerksamkeit. Ein Blick in den Rückspiegel verriet mir, dass ein rot blinkendes Fahrzeug näher kam. Das Rauschen des Regens hatte die Sirenengeräusche zuvor verschluckt, jetzt dröhnte das Warnsignal in meinen Ohren. Ein Stechen durchfuhr meinen Schädel, und ich kniff die Augen kurz zusammen. Ein Krankenwagen zog haarscharf an uns vorbei, wir scherten nach rechts auf einen Ackerbau aus, um nicht zu kollidieren. Ich keuchte auf, presste mir die Hand auf den Mund und betete lautlos dafür, die holprige Achterbahnfahrt möge bald ein Ende finden.
Wir überquerten zwei Kreuzungen, dann nahm die Straße eine scharfe Rechtskurve. Mein Herzschlag verlangsamte sich ebenso wie unser Fahrzeug. Zu meiner Erleichterung setzte mein Taxifahrer den Blinker, und wir bogen auf einen Kiesweg ab. Ein verzücktes Keuchen verließ meinen Mund. Die weichen Umrisse des Anwesens zeichneten sich im schwachen Lichtschein des Nachthimmels ab. Wir durchquerten einen Rundbogen und steuerten auf ein geschichtsträchtiges Schloss zu. Der Anblick ließ mich die abflauende Übelkeit vergessen. Mein neues Zuhause für die nächsten Studienjahre sah aus wie der wahr gewordene Hogwarts-Traum. Das Château war symmetrischer und hatte nur einen mittelalterlichen Turm statt einer Vielzahl an Kegeldächern, aber in meinen Augen war es perfekt. Ich würde in einem echten Schloss leben!
Um eine bessere Sicht zu bekommen, beugte ich mich im Sitz nach vorne und ignorierte dabei den Gurt, der scharf in meine Schulter schnitt. Die Scheibenwischer gaben ihr Bestes, um die Flut an Regentropfen abzuwehren. Zu meinem Missmut bogen wir kurz vorm Erreichen des Herrenhauses nach links ab und passierten einen Rundbogen aus hellen Ziegeln und rostrotem Stein. Das Rauschen des Regens hatte abgenommen, sodass ich hörte, wie die groben Kieselsteine unter den Rädern knirschten. Wir fuhren an überraschend vielen Fahrzeugen vorbei. Schicke Cabriolets, große Landrover und eindrucksvolle SUVs reihten sich aneinander. Der Parkplatz war gut gefüllt, was mich wunderte, da der Broschüre zufolge nur eine Handvoll Appartements zur Verfügung standen. Im Gegensatz zu amerikanischen Colleges gab es keine Studentenunterkünfte auf dem Campus. Die Studierenden der Inside University wohnten überall in der Stadt verteilt in Wohnungen oder Studentenhäusern. Früher hatten alle Studierenden in Châteaus rund um den Campus gelebt. Über die Jahre waren die meisten verkauft worden, was Fleury zum letzten verbleibenden Traditionshaus kürte, das Studierende beherbergte. Statt gemischter Zimmer gab es geschmackvoll eingerichtete Studios und Appartements, die Platz für 14 Bewohner schufen.
Das Château de Fleury lag eine Viertelstunde Fahrtzeit von der Universität entfernt und wurde von einem Wald umrundet. Meiner Recherche nach hatten die erfolgreichsten Absolventen, die heute CEOs namenreicher Unternehmen waren, bis auf wenige Ausnahmen hier gelebt. Das Château de Fleury beherbergte die Elite von morgen, und ich wollte zu ihrem auserlesenen Club dazugehören. Zum ersten Mal in meinem Leben hatten gute Noten den Wohlstand ausgestochen. Durch die frühe Zusage war ich eine der Ersten gewesen, die sich nach dem Château erkundigt hatten und somit eins der Appartements ergattert hatten. Chambre 4 würde für die nächsten Monate mir gehören.
Der Wagen hielt abrupt an. Einen Wimpernschlag lang schnürte der Sicherheitsgurt mir die Luft ab. Durch den Regen waren die unscharfen Umrisse vor uns schwer zu erkennen. Ich ordnete die Farbtupfer Gestalten zu. Sie standen da, harrten einfach nur aus, und doch hatte es etwas Chaotisches an sich, was mich irritierte. Ich blinzelte schnell, aber natürlich half es nicht, meine Sicht zu schärfen. Gebannt starrte ich auf das Geschehen. Nicht das rot blinkende Licht des Krankenwagens, der nur wenige Meter entfernt stand, erregte meine Aufmerksamkeit, sondern die Menschentraube daneben. Es waren mindestens 100 Leute, wenn nicht sogar mehr.
»Nous sommes arrivés, Mademoiselle«, wies der Fahrer mich auf unsere offensichtliche Ankunft hin. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er den Schlüssel im Zündschloss und schaltete den Motor ab. Ungeduldig stieg er aus und knallte die Wagentür hinter sich zu. Von der Menschenmasse abgelenkt, scherte mich seine Unhöflichkeit kurzzeitig nicht. Statt ihm zum Kofferraum zu folgen, hielt ich bei dem Anblick vor mir inne.
Sanitäter bahnten sich einen Weg durch die Menge. Die Schaulustigen wichen zurück, schufen Platz für einen Durchgang. Erst jetzt erahnte ich, worauf sie zusteuerten. Da lag etwas am Ufer des Sees. Nein, jemand. Ich starrte auf die Gestalt, zu der die Rettungssanitäter eilten. Einer der Sanitäter untersuchte eine am Boden liegende Person, während zwei andere mit einer Trage zur Hilfe kamen. Im hellen Strahl einer Taschenlampe erkannte ich eine reglose, blonde Frau. Ihr langes Haar lag wie ein Heiligenkranz um ihren Kopf. Wirr und zerzaust. Mir juckte es in den Fingern. Ich wollte hinlaufen und es glattstreichen. Mein Gehirn brauchte einen Augenblick, um die Informationen zu verarbeiten. Der Moment, in dem ich realisierte, wer dort vor mir lag, würde sich nicht mehr aus dem Gedächtnis streichen lassen. Auch wenn sie die Letzte war, die ich an meiner neuen Universität erwartet hatte, war mir augenblicklich klar, um wen es sich handelte. Dort auf dem Boden lag Julianna Hill.
Unverkennbar.
Ich kannte sie aus der Highschool. Sie war von allen Schülern diejenige gewesen, die am nettesten zu mir gewesen war. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Nun war sie die Person, der ich das Schlimmste an den Hals wünschte. Einen juckenden Hautausschlag oder eine Durchfallattacke, während sie auf einer Bühne stand – aber nicht das!
Hunderte Male hatte ich sie verflucht. Sie dort liegen zu sehen – hilflos und verletzlich – brachte jedoch nicht die Genugtuung, mit der ich gerechnet hatte. Übelkeit stieg erneut in mir auf und verdrängte die Müdigkeit von der strapaziösen Anreise. Keuchend zerrte ich am Anschnallgurt. Mehrere Anläufe waren nötig, bis er endlich mit einem Klicken aufsprang. Bevor ich mich versah, rannte ich zur Menge. Der Boden unter meinen Füßen war matschig, ich rutschte und sackte weg. Ich schaffte es nicht weit, da hielt mich jemand an der Schulter fest.
»Lass mich!«, spie ich aus und versuchte, mich aus dem Griff zu winden. Die Umklammerung wurde fester, und ich gab auf. Zu geschockt, um den Blick vom leblosen Körper zu lösen. Juliannas Kopf hing regungslos zur Seite. Blut konnte ich nicht erkennen, dafür war ihre Kleidung völlig durchnässt. Kommt das vom Regen?, wunderte ich mich und begriff erst jetzt, dass sie neben einem See lag.
Jemand rempelte uns an, die Menge drängte sich ans Geschehen. Ich wippte vor auf die Zehenspitzen. Lehnte mich nach links, um etwas zu erkennen. Leises Wispern hallte durch die Nacht. In meinen Ohren rauschte Blut, was verhinderte, dass die Wortfetzen Sinn ergaben.
»Je sens un pouls!«, rief einer der Sanitäter.
Augenblicklich fiel mir eine Last von den Schultern. Erleichtert atmete ich auf. Der Sanitäter hatte einen Puls gespürt, so viel verstand ich auch mit meinen mickrigen Sprachkenntnissen.
Nicht auszumalen, wenn ihr etwas zugestoßen wäre.
Hektische Worte wurden auf Französisch gerufen. Ich verstand Unterkühlung und Decke. Es ging so schnell, mein Kopf kam kaum mit. Wie gebannt hing mein Blick an den Sanitätern. Sie hievten Julianna auf eine Trage, bedeckten sie zur Hälfte mit einer Decke und massierten ihren Brustkorb. Dann schoben die Sanitäter sie auf die Trage, und die Türen wurden mit einem lauten Knall zugeschlagen. Der Krankenwagen fuhr bereits davon, erst da löste sich die Anspannung allmählich. Es war, als hätten alle Anwesenden gleichzeitig die Luft angehalten. Von einer Sekunde auf die andere überschlugen sich die Stimmen um mich herum. So schnell, als müssten sie die verpassten Minuten nachholen.
Schlagartig strömten all die Eindrücke der Umgebung auf mich ein: Die Geräusche des Nieselregens, das Stimmengewirr, das klamme Gefühl der feuchten Kleidung auf meiner Haut und der feste Griff um meine Schultern, der mich noch immer zurückhielt. Instinktiv versuchte ich, ihn abzuschütteln. Der herbe Geruch der Rauchwolke, die ein dunkelhaariger Typ zu meiner Linken soeben mit einer abstoßenden Entspanntheit in die Nachtluft blies.
»Hey, ganz ruhig«, erklang sachte eine Stimme an meinem Ohr. Die wenigen Worte genügten, um einen britischen Akzent herauszuhören. Mit einem Kloß im Hals hob ich den Kopf. Zum zweiten Mal am heutigen Abend wurde ich von einem Anblick überrumpelt – dieses Mal von einem schönen. Obgleich der Innenhof nur von einigen Lichtern erhellt wurde, blitzten die fuchsfarbenen Augen meines Gegenübers auf. Es musste am Kontrast zu seiner dunkelbraunen Haut liegen, dass die von der weißen Sklera umrahmten Augen derart hervorstachen.
»Oh, hey.« Ich gab einen kehligen Laut von mir und räusperte mich. Verlegen schaute ich zur Seite, dann wieder hoch zu dem jungen Mann, dessen Hände noch immer auf meinen Schultern lagen. Mir blieb nichts anderes übrig, als den Kopf in den Nacken zu legen, um ihn anzusehen. Sein Blick war behutsam, als hätte er ein verschrecktes Reh vor sich, was passte, da ich mich genau so fühlte.
»Bist du okay?«, fragte er im selben Augenblick, in dem ich »Was ist hier passiert?« ausstieß.
»Das …«, er stockte, biss sich auf die Lippe und löste den Griff von mir, »ist eine gute Frage. Die Feier ist etwas … aus dem Ruder gelaufen.«
»O wow, die Uni hat nicht einmal angefangen, und schon verpasse ich die erste legendäre Party.« Mir entfuhr ein nervöser Lacher. Großer Gott, Noa, wie unsensibel! Mit dem Kommentar hatte ich mich sicher geradewegs ins Aus befördert. »Ich meine, ein ziemlicher Schock, zu so später Stunde.«
Der süße Typ nickte knapp, wobei seine Miene unergründlich blieb. Ich folgte seinem Blick zu der Stelle, an der noch vor wenigen Minuten die Sanitäter gestanden hatten. Wenn ich nicht miterlebt hätte, welches Horrorszenario sich eben erst abgespielt hatte, hätte ich den See in der Mitte des Hofes als beruhigend wahrgenommen. Der stürmische Regen hatte nachgelassen, und es hatte etwas Tröstliches an sich, wie die Regentropfen auf die dunkle Wasseroberfläche plätscherten. Hatte Julianna da drin gelegen? Schnell verdrängte ich den Gedanken und wandte mich wieder meinem Gegenüber zu.
»Du hast nichts verpasst. Und Julie …«, sagte er mit einem Ausdruck in den Augen, der an Wehmut erinnerte, »wird hoffentlich wieder.«
Julie hatte ein Talent dafür, anderen ans Herz zu wachsen. Ich riss mich zusammen, um kein Schnauben auszustoßen. Jetzt, wo meine ehemalige Erzfeindin auf dem Weg ins Krankenhaus war, machten sich andere Gedanken in mir breit. Wie hatte sie es bloß hierher geschafft? Welche Tricks hatte sie diesmal genutzt, um sich in die höhere Gesellschaft zu mogeln? Ihren akademischen Leistungen hatte sie es sicherlich nicht zu verdanken. Ein Teil von mir hoffte auf ihre Genesung, aber vor allem verabscheute ich die Vorstellung, ihr abermals zu begegnen.
»Sie wird sich wieder erholen, da bin ich mir sicher. Du hast ansonsten nichts verpasst. Nur eine kleine Willkommensfeier, mehr nicht.«
Die Menschentraube um uns herum strafte seine Worte Lügen. Hatten sie eben noch auf einem Fleck dicht gedrängt gestanden, verteilten sich nun an die 150 Studierende auf dem Hof. Der Großteil unseres Jahrgangs musste anwesend sein.
»Ich bin übrigens Noa.«
»Kieran, freut mich.« Er nickte mir zu, und für einen Moment war es mir unangenehm, wie schnell ich in seinen Augen versank.
»Du, sag mal, ich bin eben erst angekommen, und du kennst dich hier ja bereits aus …« Meine Bitte, mich auf dem Gelände herumzuführen, ging in einer ungeduldigen französischen Schimpfsalve unter. Missmutig wandte ich mich ab und sah den Taxifahrer erbost auf meine Koffer deuten. »Entschuldige mich kurz.«
Ich eilte zum Taxifahrer, um ihm trotz seines unangenehmen Fahrstils ein Trinkgeld zu geben. Dieselbe Höflichkeit brachte der Taxifahrer nicht auf. Weder lächelte er noch bedankte er sich. Lediglich ein kurzes Nicken erhielt ich, schon lief er von dannen. Mit quietschenden Reifen preschte das Taxi über den Kiesweg, und ich blieb mit meinen Koffern im Nieselregen zurück. Der Fahrer hatte sie achtlos auf den matschigen Boden gestellt. Hoffentlich würde das keine Flecken hinterlassen. Ich schaute mich nach Hilfe um, von Kieran war keine Spur mehr zu sehen. Er hatte sich unter die Partygäste gemischt, und ich war wieder mal außen vor – unterkühlt, triefend und fehl am Platz.
Würde ich ihn wiedersehen? Wer wusste schon, ob wir überhaupt im selben Studiengang waren, die Inside University war immerhin riesig. Herrje Noa, du bist zum Studieren hier, nicht, um mit irgendwelchen Jungs zu flirten!
Ich schnappte mir die Koffer und Taschen. Vollbeladen folgte ich der Wegbeschreibung auf dem Handy geradewegs zu den Schlossarkaden. Mit einigem Abstand zum See durchquerte ich den trotz der Dunkelheit herrschaftlich anmutenden Innenhof. Ich ließ die Partygäste hinter mir zurück und lief an einigen Türen vorbei, bis ich den richtigen Eingang fand. Nordarkaden stand auf einem kupfernen Schild über dem Hauseingang. Erleichterung überkam mich, als ich die massive Tür aufschob. Eilig trat ich ein, um dem Regen zu entkommen, bevor ich mich genauer umsah.
Während das Schloss äußerlich mit seinem Glamour aus vergangenen Zeiten beeindruckte, war der Eingangsbereich ernüchternd schlicht gehalten. Dem äußeren Anschein nach hätte ich vermutet, im Inneren auf einen Gemeinschaftsraum mit verzierten Kaminen und opulent eingerichtete Räume zu treffen. Ich hatte mir einen hölzernen Duft nach Kaminfeuer und eine wohlige Wärme erhofft. Statt einer Wendeltreppe erwartete mich hingegen eine kantige, abgenutzte Holztreppe. Die Henkel der Taschen schnitten mir das Blut in der Armbeuge ab, und ich wollte sie schnellstmöglich absetzen. So lief ich vorbei an zwei hellgrau gestrichenen Holztüren, an denen Goldziffern in Größe meines Zeigefingers hingen. Den Nummern zufolge war mein Appartement im oberen Stockwerk. Keuchend wuchtete ich mein Gepäck die Treppe hoch. Die Holzstufen knarzten bei jedem Schritt. Antike Ölgemälde von unglücklich dreinschauenden Menschen hingen an den Wänden, die dringend einen frischen Anstrich benötigten. Im oberen Stockwerk angekommen, fand ich ebenfalls zwei Türen vor. Die rechte mit der Ziffer Nummer vier würde von heute an der Eingang zu meinem eigenen Reich sein. Halleluja, ich hatte es geschafft!
Ich drückte die Klinke hinunter und stieß entschlossen die Tür auf. Das Erste, was mir ins Auge fiel, waren ein dunkler Holzboden und verzierte Tapeten an den Wänden. Es roch leicht holzig, aber nicht abgestanden; jemand musste kürzlich durchgelüftet haben. Neugierig trat ich über die Schwelle. Mit einem Ächzen stellte ich die Taschen ab und streckte mich kurz. Erst dann fand ich den Lichtschalter, und das Entree wurde hell. Die Fenster gaben Aussicht auf den Hof samt Partygelage. Zu meiner Rechten und geradeaus gingen zwei Türen ab, die vordere führte in einen Wohn- und Schlafbereich, die hintere in die Küche. Diese war besser ausgestattet, als ich erwartet hatte, und es waren allerlei Kochutensilien vorhanden. Sogar ein kleiner Tisch fand in dem Raum Platz, auf dessen Tischplatte die Wohnungsschlüssel sowie eine Champagnerflasche mit einer Karte standen. Stimmt, in Europa durfte ich mit meinen 18 Jahren bereits Alkohol trinken. Ich überflog die knappen Willkommenszeilen, stellte den Champagner in den Kühlschrank und schaute mich weiter um. Das Schlafzimmer war hell und schlicht – genau so hatte ich es gern. Voluminöse, schwere Vorhänge umrahmten ein Erkerfenster, das ich direkt zu meiner neuen Leseecke auserkor.
Den Großteil des Raumes nahm ein schmales Doppelbett ein, es gab einen Einbauschrank sowie einen weißen Schreibtisch, auf dem einige Schreibutensilien lagen. Das Highlight war ein alter Kamin, der bedauerlicherweise stillgelegt worden war. In seinem Inneren standen Dutzende Kerzen in verschiedenen Größen. Einige waren über die Hälfte runtergebrannt, und Wachs hing an ihren Seiten. Das anschließende Badezimmer war klein, aber ausreichend. Ein Blick in den Spiegel ließ mich erschaudern. Ich sah fürchterlich aus. Die Haare klebten strähnig am Kopf. Statt kastanienrot zu leuchten, sahen sie dunkelbraun und stumpf aus. Die Wimperntusche war verschmiert, und dunkle Schatten lagen unter den Augen. Na super, da hatte ich ja einen klasse ersten Eindruck hinterlassen. Eilig strich ich unter den Lidern lang.
Eine Holzdiele knarrte, und ich hielt inne. Kam das aus dem Flur? Die Wohnungstür knallte zu, und vor Schreck stach ich mir mit dem Daumen ins Auge. Ich fluchte, kniff die Augenlider zusammen und lauschte. Ein Poltern ertönte, und ich zitterte, was nicht nur an der Tatsache lag, dass ich bis auf die Knochen durchnässt war. Schritte näherten sich. Da war eindeutig jemand in meiner Wohnung. Verdammt, warum hatte ich die Tür nicht geschlossen?
Hoffentlich war das kein angetrunkener Partygast, der auf der Suche nach einer Toilette aufdringlich werden würde. Das mulmige Gefühl im Magen breitete sich aus, und mein Puls schoss in die Höhe. Mein Blick flog durch den Raum. Außer einem Stapel Handtücher, die kaum zur Selbstverteidigung dienten, fand ich nichts. Sollte ich mich hier einsperren? Aber woher wusste ich, wie lange ich warten musste? Mist, das Türschloss hatte keinen Schlüssel!
Vorsichtig reckte ich den Kopf ins Schlafzimmer. Das Augenpaar auf die Schlafzimmertür geheftet, lief ich in Richtung Flur und siehe da: Sie hatte einen Schlüssel! Nur noch wenige Schritte trennten mich vom Ziel, als mich ein weiteres Knarzen erstarren ließ.
»Ich habe schon auf dich gewartet.«
Die Stimme klang erschreckend nahe. Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Zu eingeschüchtert, um auch nur einen Ton herauszubringen, riss ich den Kopf zum Erkerfenster herum. Augenblicklich schickte ich ein Stoßgebet gen Himmel. Welch ein Glück, es war nur eine Frau! Eine anmutige noch dazu, wie ich bei genauerem Hinsehen feststellte. Sie strahlte eine betörende Ruhe aus, wobei ihre dunklen Leggings und das T-Shirt eher nach Sport statt nach einem Partyoutfit aussahen.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken«, sagte die Frau. Sie war kaum größer als ich selbst, hatte langes dunkelbraunes Haar, welches ihr in Wellen über die linke Schulter fiel. Ihre dunklen Augen schimmerten amüsiert. »Ich dachte, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Pilar, deine Nachbarin.«
Sie begrüßte mich mit einem Akzent, der zweifelsfrei aus Lateinamerika kam, das erkannte ich an der Art, wie sie das R weich rollte. Ihre Worte klangen musikalisch – als würde sie singen, statt zu sprechen –, was mich noch mehr beruhigte. Darüber vergaß ich, wie merkwürdig es war, zu später Stunde unangekündigt bei neuen Nachbarn aufzutauchen. Ich selbst hätte mich das nie getraut.
»Ich bin Noa, Noa Bernstein. Willkommen in meinem neuen Reich.« Ich streckte die Arme aus und machte eine ausladende Geste, die mir sofort ungelenk vorkam. Abrupt ließ ich die Arme wieder sinken. Dann verschränkte ich sie vor der Brust, nur um sie kurz darauf in meinen hinteren Hosentaschen zu verstecken; unsicher, wie ich mich am besten präsentieren sollte.
»Mach’s dir lieber nicht zu gemütlich, das Appartement ist verflucht, weißt du?«
Ich lachte auf, aber Pilars Miene blieb ernst. Sie scherzte, oder?
»Kein Witz, die letzte Bewohnerin ist spurlos verschwunden, und der Typ davor soll hochkant aus der Uni geflogen sein. Keine guten Vibes, wenn du mich fragst.«
Wo zum Henker war ich hier bloß reingeraten?
PILAR
Samstag,
01. September,
23:52
»Bitte was?!«
Entsetzen stand der Rothaarigen ins Gesicht geschrieben. Gut so. Jetzt wirkte sie noch blasser, und ich musste mich zusammenreißen, um zu verhindern, dass sich ein Grinsen auf meinen Lippen ausbreitete. Das Mädchen sah aus wie ein Häuflein Elend. Die Haare klebten unansehnlich in ihrem fleckigen Gesicht, und die rosafarbene Haut glühte wie nach einer Joggingrunde. Ihre rehbraunen Augen waren von verlaufender Mascara umrandet, und in dem übergroßen Hoodie wirkte sie wie eine Schülerin und nicht wie die taffe Wirtschaftsstudentin, auf die ich mich eingestellt hatte. Das hier würde ein Klacks werden.
»Okay …«, erwiderte Noa zaghaft und betrachtete das Zimmer mit neuen Augen.
»Wenn du möchtest, tauschen wir«, bot ich in einem gönnerhaften Ton an. »Mir macht das nichts. Ich weiß, wie man böse Geister vertreibt. Komm, ich zeige dir meins.« Ich gab mir Mühe, unbekümmert zu klingen. Ohne ihre Antwort abzuwarten, stieß ich mich von dem Erkerfenster ab und lief los. Noa folgte mir zögerlich, nichts anderes hatte ich erwartet.
Zu meinem großen Missmut hatte sie als Erste die Anfrage für Chambre 4 gestellt. Der Stil der Studentenwohnungen schwankte enorm, während einige mit Stuckverzierungen überzeugten, bestachen andere durch ihre moderne Ausstattung. Für mich spielte die Optik keine Rolle, mir ging es einzig um die Zimmernummer. Bei meiner Ankunft hatte ich mich in Noas Appartement umgesehen. Vorerst war mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Es war schwer, etwas zu finden, wenn man nicht wusste, wonach man suchte.
Zügigen Schrittes lief ich über den Hausflur und öffnete die Wohnungstür zu Chambre 3. Ich ließ der Amerikanerin den Vortritt, die mir ein zögerliches Lächeln schenkte.
»Schau dich nur um. Du wirst sehen, es ist bezaubernd.«
Die Wohnung war spiegelverkehrt zu ihrer aufgebaut und unterschied sich von der Größe kaum. Während Noas kahl wirkte, sprühte meine dank der Vielzahl an Pflanzentöpfen vor Leben. Bereits im Flur begrüßte uns eine Monstera, und auf den Fensterbänken standen zahlreiche Grünpflanzen, Kakteen und Palmen. Passend dazu waren sowohl der Flur als auch das Schlafzimmer in einem angenehmen Hellgrün gestrichen. Antike Holzmöbel bestachen mit ihrem natürlichen Charme. Statt eines Kamins hatte ich einen hübschen Frisiertisch mit goldenem Spiegel. Das Herzstück des Schlafzimmers war ein goldglänzender Kronleuchter, der von einigen Stuckbögen umzogen war und ein angenehmes Licht spendete.
Noa lief durch die Wohnung und sah sich in der Küche um, in der eingetopfte Kräuter auf dem Fenstersims standen. Der letzte Mieter musste ein Händchen für Pflanzen gehabt haben. Ich selbst liebte das Gefühl von feuchter Erde unter meinen Fingern. Nur ungern würde ich mich von der Wohnung trennen, aber was tat man nicht alles für seine Liebsten. Pflanzen gab es überall zu kaufen, aber das Appartement 4 war einmalig.
»Was sagst du? Tauschen wir?«, hakte ich mit einer betont munteren Stimme nach. »Hier wirst du dich um einiges wohler fühlen.«
Mädchen, die sich für das Leben im Château entschieden, waren Romantikerinnen, die sich nach einem Märchenschloss sehnten. Die verschnörkelten Möbel, der antike Kronleuchter und die verspielten Stuckleisten würden sie überzeugen, da war ich mir sicher.
»Wirklich schön«, entgegnete Noa im Plauderton. Ihr Blick blieb an meinem Gepäck haften, das ich vorerst in die Ecke gestellt hatte. Im Gegensatz zu Noa war ich nur mit einem Backpackrucksack angereist. Ich brauchte nicht viel und würde ohnehin nicht lange bleiben.
»Bist du auch erst angekommen?«
»Vor ein paar Stunden«, behauptete ich, dabei war ich am frühen Morgen angekommen. »Angeblich ist deine Vorgängerin im See ertrunken. Ihr Geist soll Gerüchten zufolge noch immer durch ihre Wohnung ziehen und Rache fordern.«
Entgeistert starrte Noa mich an, lachte dann zu meiner Verblüffung auf.
»Dann wird es Zeit, die Pechsträhne zu beenden.«
So viel Schneid hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Mission Appartement-unter-den-Nagel-reißen war somit gescheitert. Das hieß, ich würde mir anderweitig Zugang verschaffen müssen.
»Alles klar. Das Angebot steht, falls du der Bürde nicht gewachsen bist«, gab ich im Bemühen, mir die Verärgerung nicht anmerken zu lassen, von mir. Ein tiefer Gong erklang, und Noa schreckte zusammen. »Geisterstunde, gewöhnst du dich noch dran.«
Wir lauschten, wie die tiefen Glocken des nahegelegenen Kirchturms zwölfmal läuteten und Mitternacht ankündigten. Bei meiner nachmittäglichen Erkundungstour hatte ich die Glocken gehört, ohne ihren Ursprung ausfindig zu machen. Einer aus dem älteren Semester hatte mir auf meine Rückfrage hin erzählt, dass die Kapelle außerhalb unserer Reichweite im Garten des Haupthauses stand. In Brasilien hatte ich jedes Wochenende in die Kirche gemusst, darauf konnte ich hier verzichten.
»Danke fürs Vorstellen, wir werden bestimmt eine gute Zeit miteinander haben. Nimm’s mir nicht übel, der Flug hat mich echt ausgeknockt. Ich muss mich unbedingt hinlegen.«
Noa hob eine Hand zum Winken, im Anschluss drehte sie sich um und verließ meine Wohnung. Der erste Versuch war gescheitert. Blieb mir nichts anderes übrig, als sie auf andere Art zu vertreiben. Kein Problem, Noa würde noch merken, wie standhaft ich sein konnte.
JULIE
Sonntag,
02. September,
06:19
Rot-blaues Licht umhüllte mich, Sirenen hallten in den Ohren. Ich spürte die Berührungen anderer auf meinem Körper, bewegen konnte ich mich nicht. Stimmen, Dunkelheit und wieder gleißendes Licht.
Oberlichter, Gesichter starrten auf mich herab. Stimmen, die meinen Namen sagten. Über mich redeten. Über mich, nicht mit mir. Als wäre ich gar nicht da oder nur ein kleines Kind. Abgehackte Worte, die sich meinem Verständnis entzogen.
Ein dröhnender Schädel. Die Kehle trocken wie Schmirgelpapier. Ich keuchte, hustete – und gab mich der Dunkelheit hin. Eine schier endlos lange Zeit vernahm ich das Surren einer Maschine. Die Augenlider zu klebrig, um sie zu öffnen. Der Körper steif, ein schwerer Druck lastete auf der Brust, und mein Arm schmerzte, wie von 1000 Nadeln durchbohrt.
»Mademoiselle Hill«, drang eine sanfte Stimme an mein Ohr und leitete mich aus dem Trancezustand. Meine Augenlider flatterten. Ich blieb noch einen Moment mit geschlossenen Augen liegen. Mein Körper fühlte sich schwer wie Blei an. Selbst das Atmen war ein enormer Kraftakt. All meine Reserven musste ich aufbringen, um die Lider hochzuschieben.
Eine dunkelhaarige Frau, kaum älter als ich selbst, stand vor mir. Sie trug eine hellblaue Uniform, und ich brauchte einige Sekunden, bis ich begriff, dass es sich um eine Krankenschwester handelte. Die Räder in meinem Kopf setzten sich allmählich wieder in Bewegung. Die Pflegerin tastete mein Handgelenk ab, verschwand kurz aus meinem Blickfeld, dann musterten mich ihre hellblauen Augen erneut.
»Mademoiselle Hill, hören Sie mich?« Ihre Stimme wurde lauter. »Wie fühlen Sie sich?«
Ich öffnete den Mund, nur ein Krächzen kam heraus. Ich schluckte, nickte stattdessen leicht. Die verschwommenen Umrisse wurden schärfer. Ich erkannte ein Zimmer, hell und steril.
»Sie befinden sich im Centre Hospitalier de Fontainebleau. Erinnern Sie sich, wie Sie hergekommen sind?« Ihre französische Aussprache ließ die Worte wie Poesie klingen.
Ich schüttelte den Kopf, dann drehte ich ihn leicht. Zu meiner Erleichterung war ich nicht allein.
»Jo-naah.« Sein Name war eher ein Krächzen, das mich augenblicklich husten ließ. Sofort trat er ans Bett und griff nach meiner Hand. Seine Körperwärme erzeugte einen angenehmen Schauer auf meiner Haut. Erst jetzt fiel mir auf, wie bitterkalt mir war. Ich drückte seine Finger leicht, und die Berührung beruhigte mich. Jonah war hier, alles würde gut werden.
»Verdammt, Julie, du hast mir einen Riesenschrecken eingejagt.«
Jonahs Stimme klang besorgt und ungewohnt fürsorglich. Er war blass, seine Kleidung verknittert, und das sonst ordentlich frisierte dunkle Haar stand in wirren Locken von seinem Kopf ab. Derart übernächtigt hatte ich ihn noch nie gesehen. Nicht einmal in den Nächten, in denen seine Eltern sich stundenlang im Wohnzimmer angeschrien und wir uns in seinem Zimmer verkrochen hatten, war seine Miene derart sorgenvoll gewesen.
»Was ist passiert?«
»Du hast ein wenig über den Durst getrunken«, sagte Jonah mit einer Sorgenfalte zwischen den Augenbrauen.
Ich runzelte die Stirn und versuchte, die Bedeutung seiner Worte zu begreifen. Ich schüttelte leicht den Kopf, hielt jedoch abrupt inne, da mich ein Schwindelgefühl überkam. Auf den Feiern von Jonahs Familie hatte ich nur höflichkeitshalber an den edlen Champagnerflöten genippt, um mit den anderen anzustoßen. Ich mochte nicht, was Alkohol aus Menschen herausbrachte. Hatte zu oft gesehen, wie meine Mutter ihren Kummer in Weißwein ertränkt hatte, nur um ihn später an mir auszulassen. Am nächsten Morgen hatte sie ihre Taten stets hinter einem Filmriss versteckt, aber ich hatte die harschen Worte nie vergessen. Der Gedanke an meine Familie schmerzte. Sie scherte sich seit Jahren keinen Deut um mich und hatte vermutlich nicht einmal bemerkt, dass ich nicht mehr die Wohnzimmer-Couch bewohnte.
Jonah wusste das.
Wieso behauptete er, ich hätte mir auf einer Studentenparty mutwillig die Kante gegeben?
»Wir haben Ihnen den Magen ausgepumpt«, informierte mich die Krankenschwester. »Beim nächsten Mal gehen Sie es lieber langsamer an.« Dem Schild ihres Kittel zufolge trug sie den klangvollen Namen Manon. Sie half mir, mich in eine sitzende Position zu bringen, sodass ich in einem 45-Grad-Winkel den Raum begutachten konnte. »Ruhen Sie sich erst einmal aus. Monsieur King, würden Sie mir folgen? Wir benötigen noch einige Informationen für unsere Unterlagen.«
Krankenschwester Manon schenkte mir ein aufmunterndes Lächeln und gab meinem Freund ein Handzeichen, ihr zu folgen. Der Ruf von Jonahs Familie eilte ihm selbst ins kleine Fontainebleau voraus. Anders konnte ich es mir nicht erklären, dass die Krankenschwester ihn anstelle von mir befragte. Für den Moment störte ich mich nicht an der Bevormundung und war froh, mich nicht selbst um den Papierkram und die entstandenen Kosten kümmern zu müssen.
»Sicher doch. Bin gleich wieder da, Jules.«
Ich ließ nur widerwillig seine Hand los. Die beiden verließen das Zimmer, und ihre Schritte entfernten sich. Ohne Jonahs Hand war mir augenblicklich kalt. Über den Durst getrunken, klangen seine Worte in mir nach. Ich presste die Lippen aufeinander. Was für eine Unverschämtheit!
Ohne Vorwarnung prasselten Erinnerungen auf mich ein wie Polaroid-Bilder. Verschwommen und abgehackt sah ich mich, die Tanzfläche und das Glas Cola in meiner Hand. Der ungewohnt zitronige Geschmack. Ich war zu einer Toilette gestürzt. Allein. Nein, eine dunkle Gestalt war mir gefolgt und dann … wurde alles dunkel.
Ich kniff die Augen zusammen. Mein Kopf hämmerte, und ich schaffte es nicht, mich zu konzentrieren. Ein Piepsen lenkte meine Aufmerksamkeit zurück ins Zimmer. Aufrecht sitzend hatte ich eine bessere Sicht auf den Raum. Er war karg eingerichtet, in hellen, sauberen Farben. Lediglich ein Farbtupfer fiel mir ins Auge: Das Piepen kam von dem veilchenfarbenen Handy, das auf meinem Nachttisch lag. Ich griff danach, um die eingehende Nachricht zu lesen. Beim Blick auf die Uhrzeit erschrak ich. Hatte ich die ganze Nacht verschlafen? Trotzdem fühlte ich mich wie nach drei schlaflosen Nächten. Ich klickte auf den Nachrichteneingang. Die Mitteilung kam von einer unterdrückten Nummer.
Anonymer Absender:
Ich weiß, wer dir das angetan hat.
Ungläubig starrte ich auf den Text. Da erlaubte sich wohl jemand einen Scherz mit mir. Ich wollte das Handy gerade wieder weglegen, als eine zweite Nachricht eintraf.
Anonymer Absender:
Wenn du herausfinden willst, wen du dir zum Feind gemacht hast, dann komm am Freitagabend in Chambre 1. Ich warte auf dich.
Kein Wort zu Jonah.
Wer war der Absender, und woher kannte er mich und meinen Freund?
Und warum hatte Jonah behauptet, ich hätte zu viel getrunken? Nur weil er nach legendären Partys lechzte, hieß das noch lange nicht, dass ich meine Sorgen ebenfalls im Alkohol ertränkte. Wozu auch? Ausgerechnet jetzt, wo sich alle meine Träume erfüllten …
Die Erinnerungen an die vergangene Nacht lagen in einem unergründlichen Nebel. Es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren. Welchen Grund hätte ich haben sollen?
»Alles in Ordnung?«
Ich schrak hoch. »Hm?«
Jonah lehnte am Türrahmen und sah mich mit einem undeutbaren Gesichtsausdruck an. Ich öffnete den Mund. Jonah war mein engster Vertrauter, mein Freund. Wenn ich jemandem etwas anvertraute, dann ihm.
Vielleicht war ich gekränkt aufgrund seiner Anschuldigung. Anders konnte ich es mir nicht erklären, als ich den Handybildschirm sperrte und meine Lippen zusammenkniff. Ich schwieg, vorerst. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt. Erst musste ich selbst wieder zu klarem Verstand kommen. Herausfinden, was diese Botschaft bedeutete. Und warum der Absender nicht wollte, dass ich Jonah davon berichtete.
»Schon okay«, sagte Jonah und ließ sich neben mir nieder. »Ich bin nicht böse auf dich. Das passiert allen mal. Pass beim nächsten Mal nur besser auf.«
Er legte seinen Arm um meine Schulter, und ich kuschelte mich eng an ihn. Sein vertrauter Geruch stieg mir in die Nase. Ich bettete den Kopf in seine Halskuhle und verschränkte die Finger mit seinen. War froh, meine plötzliche geistige Abwesenheit nicht erklären zu müssen. Bei Jonah hatte ich mich von Anfang an sicher gefühlt, und so glitt ich auch jetzt in einen tiefen Schlaf.
NOA
Sonntag,
02. September,
08:34
Die Vögel trällerten am nächsten Morgen voller Inbrunst, weswegen ich bereits zur Morgendämmerung erwachte. Wer hätte gedacht, dass es in der Natur derart laut war, da vermisste man beinahe den New Yorker Straßenlärm. Grummelnd zog ich die Decke über den Kopf. Die Willkommensfeier war ihrer Musik zufolge noch bis in die frühen Morgenstunden gegangen. Zwar hatte ich nicht mitgefeiert, fühlte mich aber ebenso verkatert. Die anstrengende Anreise, das unerwartete Wiedersehen und Pilars Gruselgeschichten waren zu viel gewesen. Auch die ungewohnten Umrisse meines neuen Zuhauses mit all seinen fremdartigen Geräuschen hatten nicht zu meinem Wohlfühlfaktor beigetragen.
Stundenlang hatte ich mich hin und her gewälzt, bis ich in einen unruhigen Schlaf geglitten war. Mein Biorhythmus litt unter der Zeitumstellung, und im Schloss war es verdammt kühl. Nicht auszudenken, wie eisig es im Winter werden würde. Da der Kamin nicht mehr funktionierte, würde ich leider in wärmere Schlafkleidung investieren müssen.
Eine Weile döste ich, bis mich ein schabendes Geräusch aufschreckte. Was war das? Ruckartig richtete ich mich im Bett auf. Kam das Geraschel vom Kamin? Nein, das konnte nicht sein. Für Santa Claus war es zu früh, und ein anderer würde sich kaum den Schornstein hinunter abseilen. Es klang vielmehr, als würde jemand mit seinen Nägeln über den Fußboden kratzen. Ich suchte den Raum ab, aber fand nichts. Hatte diese Pilar recht und es spukte im Schloss?
Langsam ließ ich mich aufs Kissen sinken, da hörte ich es wieder. Schnell griff ich nach dem Handy und schaltete entschlossen meine Muntermacher-Playlist auf Spotify an. Eine Viertelstunde später war ich frisch geduscht. Das Heizsystem war so veraltet, dass man die Wärme des Wasserstrahls regulierte, indem man Heiß- als auch Kaltwasser einzeln aufdrehte. Erst war das Wasser eiskalt und dann viel zu heiß gewesen. Es hatte ewig gedauert, eine angenehme Temperatur zu finden. Zumindest war der Wasserdruck stark, und so hatte ich den Unmut fortgespült. Heute war der erste Tag meines neuen Lebens, den ließ ich mir nicht von den Eigenheiten eines altertümlichen Schlosses vermiesen.
Ich hatte allerhand vor und den Tag in einer detaillierten To-do-Liste geplant. Mein Kalender war der einzige Bereich in meinem Leben, in dem ich mich farbtechnisch austobte. Eine Stunde später durchflutete mich ein wohlwollendes Gefühl beim Abhaken einiger Aufgaben. Ich hatte den Großteil meiner Kleidung in den Schrank gehängt, auf dem Schreibtisch lagen mein Notebook und ein alter Lederrucksack, den ich seit der Middle School besaß. Fehlte nur noch die Kaffeepackung, die ich sogleich in der Küche einsortierte. Ich konnte auf vieles verzichten, aber nicht auf das unvergleichliche Aroma meiner Lieblingsmischung. Sie stammte aus einer kleinen Rösterei in meinem Viertel und beinhaltete Kaffeebohnen aus Costa Rica, Kenia und Brasilien. Ich gab einen Teil des Pulvers in einen Espressokocher. Es dauerte nicht lange, bis sich der vertraute Geruch ausbreitete, und zum ersten Mal seit meiner Ankunft entspannte ich mich. Ich befüllte eine Tasse. Auf Milch verzichtete ich, da ich noch keine Vorräte besorgt hatte. Da kam mir eine Idee. Ich goss eine weitere Tasse ein, überquerte den Flur und klopfte an die Tür der Nachbarswohnung. Erst zögerlich, dann stärker, aber nichts geschah. Entweder schlief Pilar noch oder sie war bereits unterwegs.
Zurück in meiner Wohnung gönnte ich mir den verheißungsvollen ersten Schluck. Meine Lippen trafen auf die brühheiße Flüssigkeit, und ich seufzte entspannt auf. Selbst ohne Milchschaum war das Aroma sanft, und ich spürte die revitalisierende Wirkung des Heißgetränks. Mit jedem weiteren Schluck verflog ein bisschen meiner Müdigkeit. Ich trank die Tasse in einem Zug leer und schnappte mir direkt die zweite. Gerade als ich sie an den Mund setzte, zischte ein schwarzer Fellball an mir vorbei. Kreischend ließ ich die Tasse fallen. Sie zerbarst in unzähligen Scherben, und der leckere Kaffee spritzte in alle Richtungen. Mist!
Ich sah mir das Malheur genauer an. Da erkannte ich, dass der Fellball sich unter einem der Stühle versteckte. Es war eine schwarze Katze, deren Fell bedrohlich gesträubt war. Sie starrte mich entgeistert an, dabei war sie der ungebetene Gast und nicht ich.
»Wo kommst du denn her?«
Die Katze maunzte zur Antwort. Sie war kleiner als eine gewöhnliche Hauskatze, sah aber nicht nach einem Kätzchen aus. Zumindest nahm ich das an. Sicher war ich mir nicht, da ich nie ein Haustier besessen hatte. Ich beeilte mich, die Scherben einzusammeln. Wusch mir die Hände und hockte mich vor die Katze. Ich streckte die Hand aus, um sie näher zu locken. Ein Miauen ertönte, und ich wich verunsichert zurück. Einen Augenblick verharrte ich in meiner gehockten Position. Das Fell der Katze glättete sich, und sie tapste neugierig auf mich zu. Sachte strich ich über ihren Kopf. Mit erhobenem Schwanz stolzierte sie weiter und sprang aufs Fensterbrett. Sie maunzte erneut. Ich lief ihr hinterher und folgte ihrem Blick in den Innenhof. Auf den Holzbänken saß Pilar mit einigen Studierenden zusammen. Sie hatte ein Croissant in der einen Hand und eine Tasse in der anderen. Auf dem Tisch lagen Bäckertüten, aus denen sich alle bedienten. Sie lachten über irgendetwas. Wie es aussah, hatte Pilar bereits Anschluss gefunden. Und es nicht für nötig gehalten, mich dazu einzuladen. Ein Schnurren ertönte, und zu meiner Überraschung schmiegte sich die Katze an meinen Oberkörper.
»Wenigstens eine, die mir Gesellschaft leistet.«
Ich drehte dem Fenster den Rücken zu, um nicht beim Beobachten erwischt zu werden. Kurzerhand griff ich in die hintere Hosentasche und startete einen Videocall auf meinem Handy. Es dauerte nicht lange, bis der Anruf angenommen wurde, aber lediglich ein dunkler Bildschirm war zu sehen.
»Noa?« Meine Schwester gähnte ins Telefon. »Ist was passiert?«
»O Scheiße, die Zeitverschiebung!« Ich stöhnte auf und tippte mir mit den Fingerspitzen gegen die Stirn. »Tut mir leid! Ganz vergessen, bei euch ist es ja noch morgens. Schlaf weiter.«
»Schon gut, jetzt bin ich ja wach«, beruhigte Sonia mich und knipste die Lampe auf ihrem Nachttisch an. Sie blinzelte und rieb sich gähnend über die Augen. Ihr kurzer schwarzer Bob war zerzaust und klebte an der Stirn. Selbst über die große Distanz bildete ich mir ein, ihren vertrauten Vanillegeruch wahrzunehmen. O Gott, wie ich sie bereits vermisste!
»Na, wie lebt es sich in einem Traumschloss? Hast du bereits Geister und alte Ritterrüstungen gefunden?«
»Nicht ganz.« Seufzend ließ ich mich aufs Bett fallen. Meine Familie sollte nicht von meinem schlechten Start erfahren.
»Wieso machst du dieses Gesicht?«
»Wie?«
»Du siehst aus, als hätte jemand verkündet, Chanukka würde dieses Jahr ausfallen. Was ist los?«
Kleine Schwestern waren die nervigsten, sie kannten einen zu gut. Aber hatte ich sie nicht deswegen angerufen?
»Nichts, es ist alles toll, nur … Die anderen sitzen draußen und frühstücken zusammen«, gab ich zu und pulte am Daumennagel.
»Und?«, hakte Sonia nach und zog eine Augenbraue hoch. Meine Antwort würde ihr nicht gefallen. »Du traust dich nicht, dich dazuzusetzen.«
»Sowas liegt mir halt nicht.«
Natürlich meinte sie es nur gut, auf eine Predigt à la Spring einfach über deinen Schatten hatte ich allerdings keine Lust. Ich war kein Typ, dem neue Situationen leichtfielen, und brauchte stets eine Weile, um mich an Veränderungen zu gewöhnen. Wenn ich die Karriereleiter hätte erklimmen können, ohne dafür mein Zimmer zu verlassen, hätte ich es getan. Sich in die Welt hinauszuwagen war zermürbend, nervenaufreibend, und es gab mir das Gefühl, ständig auf der Hut sein zu müssen.
»Du bist in Frankreich, um endlich etwas zu wagen. Wenn du dich nur in deinem Zimmer verschanzt, wird das nichts.«
Ich stöhnte genervt auf. »Ja, Mama, schon klar.«
»Ich meine es nur gut mit dir.«
»Hm.«
Ich überlegte, ihr von dem unerwarteten Aufeinandertreffen mit Julianna zu erzählen, wollte aber nicht, dass Sonia sich sorgte. Wenn sie gewusst hätte, wie überfordert ich war, hätte Sonia auf mich eingeredet, bis ich im nächsten Flieger zurück gesessen hätte. Ich hatte zu hart für den Auslandsaufenthalt gearbeitet, um jetzt klein beizugeben. Auch meine Eltern meinten es nur gut, das taten sie immer. Trotzdem erdrückten sie mich mit ihrer Liebe, und ich brauchte Abstand, um meinen eigenen Weg zu finden.
Das fand auch Sonia und sagte: »Na los, heute beginnt dein Abenteuer. Zeit zu leben, statt immer nur zu planen.«
Manchmal brauchte ich diesen kleinen Tritt in den Hintern, zumindest was soziale Aktivitäten anging. So geschickt ich mich in der Schule anstellte, so unbedarft verhielt ich mich in der Gesellschaft anderer. Und Fremde waren mir ein ganz besonderer Graus.
»Willst du etwa als die komische Einzelgängerin bekannt sein?«
»Quatsch, so bin ich gar nicht!«
»Aber sowas von!«
»Meine Güte, ich geh ja schon und sage hallo!«
»Sehr schön.« Sonia grinste selbstzufrieden. »Das ist deine Chance, alles mitzunehmen, was geht! Schnupper ein bisschen Studentenluft für mich mit und vergiss nicht, mich mit dem heißen Uniklatsch auf dem Laufenden zu halten.«
Sonia war zwei Jahre jünger und steckte mitten in der Highschool-Zeit. Sie hatte aus meinen Fehlern gelernt und kam um einiges besser klar. Nun, zumindest hatte sie einen Freundeskreis und war selbst unter der Woche unterwegs. Zwar freute ich mich für sie, aber es war ein komisches Gefühl, wenn die kleine Schwester einem in Sachen Jungs voraus war und man sich ihre gut gemeinten Ratschläge anhören durfte.
»Schon klar, es ist nur … Ich habe das Gefühl, nicht reinzupassen.«
»Ach, und das weißt du nach gerade mal zwölf Stunden? Gib dem Ganzen eine Chance.«
Die Handyverbindung war erstaunlich gut, als säßen wir Seite an Seite und wären nicht von den endlosen Weiten des Atlantischen Ozeans getrennt. Eigentlich war es ein Glücksfall, hier zu sein und gleichzeitig meine Schwester nur einen Handgriff entfernt zu haben.
»Ich wünschte einfach, du wärst auch hier.«
»Klar, das wäre bombastisch, aber dann würden wir uns bestimmt wegen irgendeines Beaus in die Haare kriegen.« Sie kicherte, und ich musste mitlachen.
Es war offenkundig, dass sie scherzte. Sonia hätte mir jeden Typen problemlos vor der Nase weggeschnappt. Zwar hatten wir beide noch keinen offiziellen Freund gehabt, aber dafür sammelte sie Date-Erfahrungen. Eines der Dinge, auf die ich mich neben dem Lehrplan am meisten freute, war auch, endlich meinen allerersten Freund zu haben. Weit weg von zu Hause, außer Reichweite meiner Familie und ihren rückständigen Ansprüchen wollte ich jemanden kennenlernen, mit dem ich eine gute Zeit verbringen konnte. Wer weiß, vielleicht war dieser Kieran ja auch beim Brunch. Vorher wollte ich Sonia noch eine kleine Room-Tour geben – und ihr meinen neuen Gefährten vorstellen. Da würde sie Augen machen! Ich wechselte in die Kameraperspektive und suchte das Zimmer nach der Katze ab. Merkwürdig, sie konnte sich doch nicht in Luft aufgelöst haben!
PILAR
Sonntag,
02. September,
09:22
Während andere ihren Tag mit Hilfe einer To-do-Liste strukturierten, setzte ich mir Missionen. Die erste Mission des Tages: die beste Boulangerie in meinem neuen Wohnviertel finden. Die französische Gemeinde Fleury-en-Bière hatte gerade einmal 600 Einwohner, und außer einer Poststelle war das Dorf wie ausgestorben. Es gab weder einen Supermarkt noch kleine Cafés oder andere Geschäfte. Das Schloss lag abseits des Dorfes mitten in der Walachei. Wälder, Wiesen und zahlreiche Felder, die konträr zu meiner Heimat waren, versprachen idyllische Laufstrecken, die ich zeitnah erkunden würde.
Zum Glück bot das Château seinen Bewohnern die Nutzung von Fahrrädern an, sodass wir bequem in den nächstgelegenen Ort fahren konnten. Ich hatte meine Lieblingsleggings angezogen, in der ich praktisch lebte, und ein hellgrünes Shirt übergeworfen, dessen Ärmel bis zu meinen Ellenbogen reichten. Meine vom Langstreckenflug angespannten Muskeln freuten sich auf die Bewegung. Hoffentlich würde mir warm werden, sobald ich in die Pedale trat. Für meine Verhältnisse war das Wetter frisch. Ich sehnte mich nach der brasilianischen Sonne, die selbst in den Wintermonaten warme Temperaturen garantierte. In São Paulo wurde es selten kälter als 15 Grad. Die Winter waren kurz und zeichneten sich durch einen bewölkten Himmel aus. Mir stand eine ganz schöne Umgewöhnung bevor.
Ich stellte die Route in meinem Handy ein. Glücklicherweise war ich gestern so geistesgegenwärtig gewesen, mir am Flughafen eine französische Simcard zuzulegen, sonst wäre ich jetzt aufgeschmissen gewesen. Auch wenn meine Wohnung allerlei Kräuter und einen gut gefüllten Gewürzschrank aufwies, fehlten frische Lebensmittel. Ich würde später eine ausgiebige Einkaufstour machen und mir eine Grundausstattung zulegen. Dafür brauchte ich nur eine Mitfahrgelegenheit. Einer meiner Mitbewohner wäre sicherlich bereit gewesen, mich mitzunehmen – wofür hatte man schließlich Nachbarn? Ein Grund mehr, die besten Croissants der Gegend zu finden. Sie waren die ideale Bestechung und eigneten sich zudem dazu, Katerstimmung zu vertreiben.
Ich tippte eine Nachricht in den Gruppenchat, den wir Château-Bewohner gestern Abend eingerichtet hatten. Zwar war der Chat noch nicht vollständig, aber wir hatten bereits genügend Mitglieder, dass ich sicherlich jemanden fand.
Pilar:
Morgen ihr Schnarchnasen, wer hat Lust auf eine Einkaufstour? Tausche knusprige Croissants gegen Chauffeur!
Die ersten Antworten ließen nicht lange auf sich warten. Marieke bot sofort ihre Fahrdienste an. Die Deutsche war auf keinen Mietwagen angewiesen, da sie ihren violett-folierten Mini Cooper mitgebracht hatte. Das knallige Fahrzeug harmonierte nicht mit ihrer sonstigen Erscheinung. Marieke hatte kinnlange hellgrau gebleichte Haare, trug ihrer eigenen Angabe nach nur Schwarz und hatte einen rockigen Kleidungsstil. Gestern Abend hatte sie mir weismachen wollen, dass Schwarz verschiedene Nuancen besaß und sie je nach Stimmung zu unterschiedlichen Tönen griff.
Auch Frédéric und Graham, die ebenfalls Erstsemester waren, stimmten zu, und wir verabredeten, uns später im Innenhof zu treffen. In der Nähe des Sees, der den Großteil des Hofes einnahm, standen Holztische mit festmontierten Sitzbänken, die ausreichend Platz für ein gemeinsames Frühstück boten. Wir waren zehn Neulinge und fünf Studierende aus den älteren Semestern, wobei ich noch nicht auf alle getroffen war. Lediglich eine Frage der Zeit, dafür würde ich sorgen. Ich wollte alles und jeden kennenlernen, der zum Château de Fleury gehörte. Und vor allem jeden Winkel des Schlosses erkunden. Am besten heftete ich mich dafür an die Fersen der älteren Kommilitonen, die sich auf dem Gelände bereits auskannten.
Ich steckte das Handy wieder in die Seitentasche meiner Leggings und rollte mit dem Rad über den Hof. Die Mauern des Schlosses ragten imposant in die Höhe. An manchen Stellen hatten sich im Laufe der Zeit Unebenheiten und Risse in die Fassade gezogen, welche dem Château keinen Abbruch taten. Der architektonische Stil war anders als bei allen Gebäuden, die ich aus meiner Heimat kannte. Ich war eine melodische, bunte und gut gelaunte Umgebung gewohnt; die abgeschottete Stille, in welcher der eigene Atem zu den lautesten Geräuschen zählte, irritierte mich. Auch wenn ich nachvollziehen konnte, wieso andere sich in der Idylle wohlfühlten, wurde ich das Gefühl nicht los, nicht hierher zu passen. Fühlte ich mich wie ein schillernder Papagei, der sich zusammenriss, um nicht in den kühlen Gemäuern aufzufallen.
Beim Anblick des Sees musste ich an den gestrigen Vorfall denken. Während das Gewässer gestern Nacht beinahe ein Leben gekostet hätte, schimmerten nun Sonnenstrahlen auf der ruhigen Wasseroberfläche. Im Tageslicht war von seiner Bedrohlichkeit kaum etwas übrig. Wie viele solcher Vorfälle hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten schon ereignet? Es war gewiss nicht das erste Mal gewesen, dass ein betrunkener Studierender auf die hirnrissige Idee gekommen war, darin zu schwimmen.
Aller Voraussicht nach würde die Verletzte keine schwerwiegenden Schäden davontragen. Schlechte Nachrichten verbreiteten sich schnell, und da es in der Chatgruppe bislang keine Neuigkeiten gab, nahm ich an, sie würde sich wieder erholen.
Ich schwang mich auf den Sattel des hellblauen Damenrads, der für ein geliehenes Fahrrad ausgesprochen stylisch war. Zwar erkannte ich an den verschmutzten Reifen und dem ehemals eierschalenfarbenen Sattel klare Gebrauchsspuren, dafür funktionierte alles einwandfrei. Die richtige Sitzhöhe ließ sich mit einem gekonnten Griff schnell einstellen. Es hatte eine Sechs-Gang-Schaltung und vorne einen Korb, was gut passte, da ich im Vorfeld nicht darüber nachgedacht hatte, wo ich meine Ausbeute verstauen wollte.