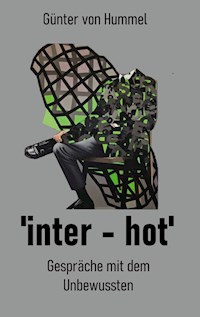
Inter - hot E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Wesen des Sternenhimmels kann nur schlecht durch Astronomie (Astrophysik) und Astrologie und das Wesen der Natur nur unvollkommen durch Biologie und Ökologie erfasst werden. Einen authentischeren und auch wissenschaftlicheren Zugang bietet die Psychoanalyse. Es sind vor allem J. Laeans Bildtheorie und seine aus der Linguistik stammenden Kurzformeln, die ein Rüstzeug für eine neue ganzheitliche (bild- und wortbezogene) Orientierung ergeben, die darüber hinaus sogar ein praktisches, therapeutisches (meditatives) Verfahren ermöglicht. Kombinierte bild- und wortbezogene Elemente wirken wie ein Schicksalslogo, das der Autor auch aus Geschichten von Odysseus, Saint Exupery, einem indischen Heiligen und anderen Geschehnissen zusammenstellt, um das Verfahren anschaulich zu machen. Der Autor ist Arzt und Psychoanalytiker und hat seine Methode in zahlreichen Büchern und Seminaren veröffentlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Umschlagsbild von T. Heydecker hat den Titel ‚Gefangen im Netz‘. Gemeint ist das Netz des seelisch Unbewussten, in dem der Mensch mehr als woanders gefangen ist. Nicht so sehr eine Revolte gegen äußere Zwänge ist daher gefragt, sondern gegen das innere Chaos, das aus den verwirrenden Buchstaben besteht, in die die sitzende Gestalt verwickelt ist. Sie stellt zudem ein ‚Subjekt ohne Kopf‘ dar, was dafür spricht, dass es sich um einen Psychoanalytiker handelt, der nichts rationalisieren darf. So tauchen aus dem Unbewussten rätselhafte Worte auf – wie das ‚inter-hot‘.
Inhaltsverzeichnis
Bild- und Wort-Wirkendes
1. Linguistik der Lüge I
2. „inter-hot“
3. Der „Andere der Sterne“
4. Das untere und das obere Herz
5. Das Gehirn des Odysseus
Sublimationen
6. Intra- und Interstehen
7. Bildtheorie und Malerei
8. Sar Bachan
9. Primärvölker
10. Repression und Involution
Das ‚materiale Subjekt‘
11. Die
Pass-Worte
12. Linguistik der Lüge II
13. Der Knacks und das Genießen
14. Der erlernte Wille und die Epigenetik
Anhang
Literaturverzeichnis
Bild- und Wort-Wirkendes
1. Linguistik der Lüge
NOMENSCIS oder ENSCISNOM, egal von welchen Zeichen bzw. Buchstaben oder Runen ausgehend man das im Kreis Geschriebene liest, es kommt jedes Mal eine andere Bedeutung zustande und ein anderer Sinn heraus.1 Diesem hier gezeigten Beispiel liegt die lateinische Sprache zugrunde, aber es könnte auch eine andere sein, die man auswählt. Da die Formulierung in ihrer Vielschichtigkeit keine endgültigen Bedeutungs- oder Sinnzusammenhänge ermöglicht, entsteht die Frage, was das Ganze überhaupt soll. Nun, es soll der einzig mögliche ‚Anfang’ sein, der heutzutage noch in der Wissenschaft gemacht werden kann. Üblicherweise beginnen Geisteswie auch Naturwissenschaftler mit schon vorgefassten Feststellungen oder Begriffen, und sie begründen den Anfang – sozusagen – gar nicht mehr anfänglich.
Sie beginnen z. B. mit ‚Am Anfang war . . . . . . .‘, ‚Durch Beobachtung von . . . .‘, oder die Wahrheit ist . . .‘ usw. Aber macht es Sinn so zu beginnen? Mit dem Wörtchen ‚Am‘ oder ‚Beobachtung‘ ist ja etwas gemacht worden, was eigentlich den Anfang schon ohne Begründung darstellt und so einen nur überrumpelt. Gott und Wahrheit? Eine Bedeutung ist schon vorzeitig gesetzt worden, auch wenn der letztliche Sinn vielleicht noch offen bleibt. Mit dem Halbsatz‚Am Anfang war‘ ist es noch schlimmer, und wenn dann auch noch weitere Wörter dazugesetzt werden, ist der Blödsinn fast vollendet. Woher will jemand wirklich sagen können, was den Anfang macht? Die feministische Philosophin und Physikerin K. Barad schreibt: „Anfang“ ist wie alle Anfänge immer schon durchwirkt mit der Erwartung, wo es hinführt, aber nie ankommen wird, und von einer Vergangenheit, die erst noch kommen muss.“2 Mit anderen Worten: es gibt gar keinen Anfang, es sieht nur so aus. Wenn die Astrophysiker ganz einfach sagen: anfänglich war der Urknall, vergessen sie, dass es hier nur um Physik geht, und wenn es im Neuen Testament heißt: es am Anfang war das Wort, ist das genauso kühn.3 In Goethes Faust wiederum liest man unter anderem, dass die Tat den Anfang gemacht habe, und noch kurioser haben es die Linguisten versucht, das A des Anfangs zu begründen.
Sie haben behauptet, einen grammatikalisch einwandfreien Satz gefunden zu haben, der sinnlos (ohne Semantik) und damit ein Modell für das Vorsprachliche, für den Anfang der Sprache ist (als allein urgrammatikalisch). Die Linguisten wollten damit zeigen, dass die Grammatik (z. B. Chomskys generative Grammatik) die Urformel schlechthin darstellt. Erst später haben sich daraus Semantik, also Bedeutungszusammenhänge und anderes entwickelt. Der gerade erwähnte Satz, der auch von dem berühmten Sprachforscher N. Chomsky stammt, lautet folgendermaßen: „Colorless green ideas sleep furiously“ (farblose grüne Ideen schlafen fürchterlich). Nun ist dieser Satz absolut nicht sinnlos.
Er wurde vielleicht in einer Zeit erfunden, als es noch keine Grünen Parteien gab oder entsprechende Politiker. Denn dass ‚grüne Ideen‘ ‚farblos‘ sein können und vielleicht sogar gerade dadurch ‚fürchterlich schlafen‘, klingt – zumindest psychologisch – gar nicht so unsinnig. Politisch mag man darüber diskutieren oder gar das Gegenteil zutreffen. Später haben die Linguisten daher einen anderen Satz gewählt: „Der Gnafel gircht, dass Inkeln schnofel sind“. Aber auch hier ist eindeutig – vielleicht sogar noch besser als im ersten Satz – ein Sinn heraus zu lesen. Der ‚Gnafel‘ ist ein Jemand, möglicherweise eine mythisch märchenhafte Figur, ein Kobold oder Gnom, egal, er ist auf jeden Fall einer, der nicht moderne Sprache spricht, sondern ‚gircht‘, raunzt, grunzt, röchelt oder sich irgendwie sonst artikuliert. Zudem wird ganz klar etwas ausgedrückt, und zwar dass die ‚Inkeln‘ (wohl ähnliche und doch gegensätzliche Wesen als die ‚Gnafels‘) ‚schnofel‘ sind (blöd, schäbig, schofelig oder was auch immer eher Abwertendes gemeint ist). Die Aussage dieses Satzes ist also weitgehend klar.
Der französische Psychoanalytiker J. Lacan meint daher zu Recht, dass jeder Satz – wie entstellt er auch sein mag – Sinn habe. Er wollte damit auf den Sinn des Unbewussten hinweisen, jenes seelischen Bereiches, der – wie er sagt – ‚wie eine Sprache strukturiert ist‘ und damit sich auch irgendwie sinnvoll artikulieren kann, auch wenn es nicht von selbst geschieht. Zudem: ‚W i e eine Sprache‘ soll eben heißen: das Unbewusste ist einer symbolischen Ordnung, einer Laut-Zeichen-Ordnung folgend so aufgebaut, dass die Dimension des logischen sich Vermittelns vollständig vorhanden ist, in der – wenn auch nicht umgangssprachlich – die Wahrheit (und damit freilich auch die Lüge) eine Rolle spielen können. Denn die Natur und auch die nüchterne Linguistik selbst kennt keine Wahrheit. Es gibt in ihr vielleicht Begriffe wie ‚richtig’ im Sinne von passend und ‚falsch’ (negativ, unangepasst), aber nicht Wahrheit und Lüge.
All die erwähnten Wissenschaftler verwenden nämlich damit – wie Lacan weiter sagt – das ‚präformierte Modell einer richtigen Antwort’– und legen nicht Wert auf den Kampf um das Wesen der Sprache und um die Wahrheit.4 Damit der Hörer exakt das sagen wird, was man möchte, liefert man ihm ein scheinbar völlig unabhängiges, neutrales und schon vorgefasstes Modell, aus dem heraus eine Aussage entwickelt werden kann, die jedoch nichts anderes als die mit vorprogrammierte Antwort selbst ist. ‚Am Anfang war’ ist ein präformiertes Modell, das schon die richtige Antwort enthält, nämlich dass der Betreffende, der das sagt, bereits alles darüber weiß. Er kennt nicht nur den Anfang, sondern weiß auch davon, wie es weitergeht oder – ging. Er hat es gesehen, gemessen oder gut ausgedacht. Er hat der Unwissenheit einfach ein Wissen gegenübergestellt, anstatt eine Wahrheit auszudrücken, in der sich der Begriff Unwissenheit erst richtig konstituieren kann.
Denn die Unwissenheit ist nicht etwas, das man durch mehr und neues Wissen ersetzen kann. Vielmehr – und jetzt kommt nochmals so ein pfiffiger Lacanscher Satz - „konstituiert die Unwissenheit sich polar zur Beziehung auf die virtuelle Position einer zu erreichenden Wahrheit.“5 Das klingt kompliziert, heißt aber nur, dass die Unwissenheit eben nur durch ein Wissen, das den Blick strikt auf die Wahrheit gerichtet hat, ausgeglichen werden kann. Ohne entscheidende Orientierung an der Wahrheit, die virtuell über allem thront, kann Unwissenheit nie mit noch so viel gutem und neuem Wissen aufgehoben werden. Noch weiter vereinfacht: für das menschliche Subjekt muss das Wissen der Wahrheit dienen und nicht umgekehrt. Die Wahrheit will wissenschaftlich auf sie selbst bezogen gewusst werden, anders ist sie heute für das Subjekt nichts wert.
Deswegen ist der Urknall nur ein Nebenschauplatz des Anfangs. Man muss bestimmte Experimente machen und Maschinen bauen, Teilchenbeschleuniger z. B., um etwas über diese Art von angeblichem Anfang sagen zu können. Ich will jedoch etwas über den Anfang des Anfangs sagen, und so ist jedes Subjekt also selbst der Anfang, auch wenn seine Wahrheit noch versteckt oder zerstückelt ist wie das ebenso zerstückelte E-N-S-C-I-S-N-O-M, das eben nichts präformiert und so das Subjekt seine Antwort selbst finden lässt.6 Deswegen habe ich N-O-M-E-N-S-C-I-S oder S-C-I-S-N-O-M-E-N geschrieben, weil dies völlig auf das dem Unbewussten unterstellte Subjekt bezogen ist, das seine Wahrheit aus seiner ihm meist unbewussten Zerstückelung heraus in einem zusammenfassenden, vereinheitlichenden Sinn noch finden muss.
Das Verfahren, um das es in diesem Buch hauptsächlich gehen wird und das ich Analytische Psychokatharsis nenne, benutzt genau diese Art des Anfangs. Es verbindet Psychoanalyse und Meditation und ist äußerst einfach zu erlernen Im folgenden Text und speziell im Anhang wird es genau erklärt. Dennoch muss ich in den verschiedenen Kapiteln in essayistischer Form einiges über die Theorie sagen, das auch manchmal komplizierter ausfallen kann. Man muss allerdings nicht alles ganz präzise verstehen, denn der durch die einfache Anwendung erreichte Erfolg kann auch als ein Stück des Beweises gelten. Mit dem E-N-S-C-I-S-N-O-M und anderen sogenannten Formel-Worten wird der Anfang des meditativen Teils des Verfahrens gemacht (erste Übung von zweien), indem man diesen Wortlaut rein gedanklich meditiert.7 Nun noch ein Wort zur Psychoanalyse, mit der die zweite Übung zu tun hat.
Auch die Psychoanalytiker machen mit ihrem Vorgehen einen besonderen Anfang. Sie lassen ihren Adepten, dem Patienten oder Analysanden, den Vortritt, indem diese sagen sollen, was immer ihnen einfällt. Sie sollen ‚frei assoziieren’, freie Einfälle äußern. Erst dann, wenn der Betreffende nicht mehr redet oder stolpert, geben sie vorsichtig eine Interpretation nach Maßgabe dessen, was sie selbst in solch einer Situation, nämlich in ihrer eigenen Analyse, in ihrer Lehranalyse, gelernt haben. Sie haben zu unterscheiden gelernt, was nur Erzählmaterial ist und was Übertragung ist, nämlich Erzähltes, das aus der Vergangenheit oder aus irrelevanten Beziehungen des Patienten selber stammt und er jedoch auf den Therapeuten ‚überträgt‘. Das ist kein schlechter Ansatz, und er hat auch über hundert Jahre lang gut funktioniert. Trotzdem steckt in der sogenannten ‚Grundregel‘, mit der der Therapeut dem Patienten erst erklärt, dass und wie er ‚frei assoziieren‘ muss, dass er reden muss auch wenn ihm Peinliches oder Blödheiten einfallen, ebenfalls etwas für den Anfang zu Suggestives. Warum kommt man nicht einfach ins Sprechzimmer des Analytikers, sieht sich an, und sagt vielleicht erst einmal gar nichts.8
Früher war es tatsächlich oft so, dass Therapeut und Patient sich mehrere Sitzungen lang gar nichts sagten, und das war gar nicht so schlecht. Irgendein Hüsteln, eine unruhige Bewegung oder ein schneller werdender Atem gab irgendwann ja dann doch eine Möglichkeit zu vorläufiger Interpretation oder Frage. Seit einiger Zeit aber bröckelt die Authentizität und Aufrichtigkeit der Psychoanalyse. Das Formulieren einer letztlichen Wahrheit will nicht mehr so gelingen wie noch in den Jahren einige Zeit vor und nach dem Krieg. Das ist schon an den brillanten Veröffentlichungen der ersten Analytiker-Generation zu sehen, während heute nicht mehr Wesentliches zustande kommt. Die Gegebenheiten sind theoretisch ausgezuzelt.
Heutzutage klammert man sich weltweit an eine feste, bürokratische Zeit für die analytische Sitzung, immer mehr werden Rekonstruktionen des gedanklichen Materials, das von den Patienten geäußert wird, in recht intervenierender und künstlicher Form (‚Enactments‘) erstellt, immer mehr ‚Schulen’ begründen eigene, feste Anschauungen, so dass es ein gemeinsames Instrumentarium für die tägliche Arbeit in strenger Weise nicht mehr gibt. Erst vor kurzem erschien in der Zeitschrift PSYCHE ein Artikel von ca. hundert bekannten Psychoanalytikern, die die Krise in ihrer Wissenschaft deutlich zum Ausdruck brachten. Anpassung, Institutionalisierung, biopolitische Kontrolle, Psychiatriesierung und vieles mehr bedrohen Freuds ursprüngliche geniale Öffnung zur Einsicht und Bewusstwerdung, zur Kreativität und Verwirklichung neuer autonomer Lebensformen und zum Anfangdes Anfangs.9
Beim ENSCISNOM muss der Leser sich nur hinsetzen und diese Formulierung auf sich wirken lassen, er kann es meditieren, um zu erfahren, dass hier wirklich ein subjekt- und wahrheitsbezogener ‚Anfang’ gefunden wird, weil nichts vorgegeben ist. Ich behandelte einmal einen ernsthaft psychisch Erkrankten, der Deutschkurse für Ausländer gab. Auch er erfand einen Weg gegen dieses förmliche, sterile Anfangen. Er nahm z. B. dem Klienten den ‚Mantel‘ (und sprach dazu das Wort) ab, hängte ihn auf den ‚Haken‘ und erklärte ihm diesen Vorgang gleich in zwei oder drei weiteren deutschen Worten. Er ließ ihn auf den ‚Sessel‘ ‚setzen‘, das ‚Buch‘ auf den ‚Tisch‘ ‚legen‘ und ‚öffnen‘ usw. Gleich handlungsbezogen in den Dialog einsteigen, sagte er, geht über das Emotionale und Direkte stärker ins Gedächtnis ein als das Lernen in Schulmeistermanier. Wenn der Lehrer erst Erklärungen daher labert, schlafen die ersten Schüler schon wieder ein. Sie fühlen sich nicht wahrgenommen. Genauso wie der Deutschlehrer für Ausländer möchte ich, dass das Subjekt selbst ohne Vorgaben bei sich selbst anfängt zu wissen und zu sagen, zu was es bestimmt sein möchte und wer es ist.
Am Beginn der Kindheit existiert nur ein vorwiegend bildbezogenes Wahrnehmen, meint Lacan. Es besteht in einem Bildhaften, Imaginären, das schon mal irgendwie wahrgenommen ist und wieder und wieder wahrgenommen werden muss, um ein primäres Gedächtnis zu bilden, das trotz allem nur ein Modellbild, ein Urbild, eine Reminiszenz, ein doppelt Gesehenes darstellt. Anders gesagt: Das Kleinkind nimmt schon reale Bilder wahr, kann sie aber nicht integrieren, nicht systemisch im Gedächtnis ordnen, nicht durch ein Logo festhalten. Man kann es nur so sagen, dass das beginnend Psychische eben zugleich paradox und voll Bedeutung ist.10 Das Kind wird kaum wahrgenommen und verstrickt sich in seine Selbstwahrnehmung.
Oder doch: da gibt es diese zwei ‚augengleichen Punkte‘, die der Psychoanalytiker R. Spitz auf einen Karton gemalt hatte und das der Säugling anlächelte. Im Gegensatz zu Freuds Auffassung, dass die Mundregion die erste erogene Zone und damit die Mutterbrust als das sogenannte orale Objekt des Triebs ist, scheint es hier der Blick, scheinen es die Augenblicke zu sein, um den es in erster Linie geht. Der Psychoanalytiker H. Kohut hat diesbezüglich vom „Glanz im Mutterauge“ gesprochen, ein erstes Liebäugeln, das dem bewegten, sich wölbenden und wieder schließenden, leuchtenden und wieder sich verdunkelnden, phantasmatischen Überraum, einen anfänglichen, imaginären, aber nur scheinbaren Halt geben kann. Ist also umgekehrt wie bei Freud der Eros des Auges vor dem des Mundes da? Ist etwas Bildbezogene schon vor dem Wortbezogenen da, oder existieren beide gleichzeitig, kombiniert?
Mit dem Begriff ‚Logo‘ habe ich schon darauf hingewiesen, dass es – speziell hinsichtlich des vorhin bereits erwähnte Freud’sche Unbewussten – ein Wortbezogenes, besser: Wort-Wirkendes, Symbolisches gibt, das nicht weniger einfach zu erklären ist wie das Bildbezogene, Bild-Wirkende, das Imaginäre. So existiert, wenn man nun überhaupt definitiv werden will, ein zweifacher Anfang, ein Bild- und ein Wort-Wirkendeses, ein Es Strahlt und ein Es Spricht, wenn ich das voreilig schon so sagen darf, weil es kürzer und präziser ist, wie ich noch belegen will. Genau dies steckt auch in ENSCISNOM, im Klang seiner Buchstaben, in seinem ‚universellen Gemurmel‘ wie Lacan das Verlauten des Unbewussten auch nennt. Aber auch das dürfte ich ja wiederum nicht sagen. Ich müsste doch abwarten, was das Ergebnis der erwähnten Meditation ist und nicht vorausgreifend alles erklären. Ich müsste mir treu bleiben: ENSCISNOM, nimm es und lass es meditativ wirken.
Nun ist es aber so, dass schon viele Menschen mit diesem und ähnlichen Formel-Worten meditieren und bereits Ergebnisse vorliegen, von denen ich ja in diesem Buch einige zitieren will. Meditieren heißt nachsinnen, nicht denken, sondern nach innen gehen und dort verweilen, wie man es eben wohl immer schon ganz früh als Kind versucht hat. Das Kleinkind kann – wie gerade betont - in seiner bildhaften Wahrnehmung nicht alles gleich und umfassend anerkennen, es muss immer einen Teil negieren, verwerfen (der Ausdruck ‚verdrängen‘ wäre hier zu schwach) und neu versuchen eine Einheit mittels des Logos, des Worthaften, zu finden, sonst bleibt es in der komplexen Verflechtung zwischen dem Bildhaften und dem Realen stecken.11 Die Stimme der Mutter beginnt neben ihrem Augenglanz an Wichtigkeit zu gewinnen.
Die Lösungen, die man für Gott und für Goethe, deren Anfänge ich eingangs erwähnt habe, finden kann, sind nicht reale Illusionen, sondern symbolische Realitäten, also das wortbezogene Pendant zum Bildhaft-Realen. Damit bin ich wieder bei meinem ENSCISNOM oder wie man es immer schreiben mag, denn es vereint diese beiden Grundprinzipien. Die Zeichenkette der Buchstaben überlappt sich also wie es bei den Freud‘schen Versprechern auch der Fall ist. Auch die Versprecher sind Anfänge, in ihnen will sich die Wahrheit durchsetzen, die verdrängt oder verworfen worden ist. Denn – so Lacan – die Wahrheit ist die eigentliche Ursache von allem, nicht die Materie und die Gene. Die Wahrheit als ein unbewusstes Es Strahlt / Spricht.
Man kann diese Überlappung, die in der Psychoanalyse generell (besonders hinsichtlich des Wort-Wirkenden) eine große Rolle spielt, am besten an der Geschichte eines Mannes studieren, die Heinrich Heine erzählte. Dieser Mann wollte nämlich mit seiner Bekanntschaft des reichen Baron Rothschilds prahlen. Er wollte sagen, dass er mit ihm wie „familiär“ verbunden sei, sagte aber: „ich bin mit ihm so „famillionär“. Die Wahrheit also, dass es doch die Millionen sind, die ihn faszinierten, rutschte ihm so aus dem Unbewussten heraus. Und genauso wie im „famillionär“ durch Überlappung der Buchstaben eine Mehrfachbedeutung steckt, nämlich die des Familiären und der Millionen (und somit die Unverblümtheit einer Habgier), so auch in diesem Formel-Wort von ENS – CIS – NOM, das jedoch mehrere sinngebende Bedeutung in der Weise enthält, dass man sich auf keine festlegen kann. Vielmehr liegen ihm eben drei oder mehr bild- und wortbezogene Bedeutungen zu Grunde, die völlig disparat und unzusammenhängend sind.
Abb.2 Die Vielschichtigkeit dreier Bedeutungen entsprechend ihrer klangbildlichen Struktur unter einander ge schrieben.
Die Abbildung zeigt die bildliche und worthafte Überlappungen der drei verschiedenen Bedeutungen. In dem auf der ersten Seite abgebildeten und kreisförmig geschriebenen Formel-Wort kommen – gerade auch wegen der fremdartigen Buchstaben – Bildhaftes, Imaginäres und Worthaftes, Symbolisches viel stärker zum Ausdruck, vor allem, wenn man weiß, dass hinter den meisten Buchstaben Schnittstellen liegen, von denen aus gelesen verschiedene Bedeutungen herauskommen. Aber auch das Bild soll diese Überlappung schon andeuten, die jedoch noch besser in der Form herauskommt, in der das Formel-Wort wie unten zu sehen in eine topologische Form, in eine dem geometrisch Realen zugeschriebene Art, beispielsweise in ein Möbiusband oder in den mehrdimensionalen Raum (Hopf-Fibration bzw. Calabi-Yau-Raum) geschrieben ist.
Möbius- band links und Yau Calabi- Raum rechts
Diese topologisch ineinander geschachtelten Buchstabenebenen werde ich noch ausführlicher behandeln. Vorerst soll genügen, dass das bild-wirkend Imaginäre und das wort-wirkend Symbolische in dem Verfahren der Analytischen Psychokatharsis sich im menschlichen Psychismus in derartiger Weise überlappen, verwickeln, verbinden, kombinieren. Es verhält sich umgekehrt wie bei dem Versprecher im obigen Beispiel, indem die Überlappungen jetzt konstruktiv, progressiv verwendet werden.
Denn indem das Formel-Wort nunmehr meditiert wird, also rein gedanklich, rein mental wiederholt wird, es aber nur eine Formulierung zeigt, obwohl ein Mehrfaches an Bedeutungen in dieser Formulierung, in diesem Schrift-Zug des Formel-Wortes steckt, weckt es das Unbewusste. Es verhält sich rein strukturell also genauso wie in dem oben genannten Beispiel, in dem man familiär, Millionär oder eben „familiär mit den Millionen“ heraushören kann, nur dass diesmal das Unbewusste selbst die Deutung ausspucken muss. Denn es ist nun einem derartigen ‚Versprecher‘ nachgebildet, der jedoch in Wirklichkeit ein nach Maßgabe psychoanalytischer Strukturen gebildetes Instrument zur Weckung des Unbewussten ist. Das Unbewusste wird so mit seinen eigenen Waffen, mit seiner eigenen Art von Sprache geschlagen.12
Auch in ENS – CIS – NOM überlappen sich also die Bedeutungen. Aber lesen wir einmal. Geht man einmal vom M oben links aus, so heißt MENS CIS NO, der Gedanke diesseits, innerhalb von No, vom N ausgehend: NOMEN SCIS, du kennst den Namen, OMEN SCIS N, du kennst das Omen N, CIS NO, MENS, diesseits schwimme ich, oh Geist, ENS CIS NOM, das Ding diesseits von Nom, C IS NOMEN S, hundert dieser Name S, usw. So unsinnig einzelne der Bedeutungen auch sind, sie sind doch grammatikalisch und syntaktisch normal und sogar auch semantisch in Ordnung. Der Sinn dieser Formulierung besteht ja gerade darin, dass sie keinen vordergründigen Sinn schon parat hat, sondern durch die Überlappung überdeterminiert ist und nur das Unbewusste anregt, ja provoziert, torpediert wird, einen Sinn heraus zu geben. Das Formel-Wort ist Sprache am Rande des Sprachlichen. Bei ihm ist exakt genau so wie im Unbewussten das Wort mehrdeutig, zwingt aber zur Eindeutigkeit. Im ‚famillionär‘ hört jeder den eindeutigen Sinn heraus.
Im E.N.S.C.I.S.N.O.M dagegen wird er umgekehrt dem Unbewussten abgepresst. Semantisch, linguistisch, ist die paradoxe, sich überlappende Formulierung des E.N.S.C.I. S.N.O.M allerdings neuartig. Jeder einzelne Ausdruck ist semantisch klar, aber da sie in einer geschlossenen Formulierung geschrieben sind, bleibt der letzte Sinn zuerst verborgen. Er muss erst meditativ gefunden werden. Die Formel-Worte stellen zwar perfekt diese linguistische Struktur dar, die durch ihre Überlappungen Lüge, Versprecher und Zerredung ausschließen und doch Sprache sind. Sprache am Rande von Sprache wie Tschuang Tse es formuliert hat, aber es eben dadurch gerade kompakt, konkret und bis fast zur Unkenntlichkeit von Sprache hin vereinfacht hat. 13
Wie in der Psychoanalyse muss der Sinn also erst entschlüsselt werden, jedoch nicht durch einen Therapeuten, sondern mit Hilfe des Unbewussten und des meditativen Verfahrens selbst. Übt man rein gedanklich den Kreis der Buchstaben im Formel-Wort mehrmals hintereinander oder übt man mehrere derartiger Formel-Worte hintereinander (was zweckmäßiger ist), wird sich ein meditativer Effekt in Form einer Katharsis herstellen; es wird aber auch zu einer verbal formulierten Antwort, linguistischen Entsprechung, aus dem Unbewussten kommen, die ich Identitätsworte (und auch, anders verwendet als beim Computer) Pass-Worte nenne.
Das Definitive, das die meditierende Person in seiner Identität Betreffende, muss also das Unbewusste selbst sagen. D. h. ‚Es’ (das Subjekt, das Unbewusste) muss den Anfang machen, indem Es die Buchstaben schon vorgekaut hat, die man dann selbst nur noch essen muss wie es in der Offenbarung des Johannes heißt, jetzt jedoch positiv zu verstehen: „Nimm das Buch und iss es auf, es wird im Bauch bitter, aber es wird im Mund süß wie Honig werden“.14 Meditiere es, doch meditieren bedeutet eine kleine Anstrengung, ist ein bisschen bitter, aber die Katharsis, das befreiende Erleben mit dem Pass-Wort wird süßer Erfolg sein. Daher schlage ich vor, an Hand der Formel-Worte wie dem ENS – CIS – NOM schon eine Meditation auszuüben, die das Unbewusste zwingt, selbst sprechend den Anfang zu machen, das Ganze also nicht nur geschluckt zu haben, sondern es auch als neues, verändertes, wahres Sprechen wieder herauszugeben.
Dieses Sprechen in der Meditation auch richtig zu erfassen, verlangt einige Übung. Aber es ist dann doch so, dass gerade durch die eng, mit bildlich gedrängten, überlappten Buchstaben geführte Provokation des Unbewussten vermittels der Formel-Worte, dieses ebenso knappe Äußerungen kundgibt. Im erweiterten Sinne spreche ich von derartig knappen Formulierungen, die an der Grenze des Sprachlichen stehen, aber mit dem Unbewussten zu tun haben, von einem einem Logo, einer Art Epigramm der Identität. Solch ein Logo, Pass-Wort, typologische Erfahrung, kann einen lebenslang bestimmen. Freud hatte diesbezüglich vom ‚Triebschicksal’ gesprochen. Die Triebe und ihre ‚Objekte’ gehen oft lang anhaltende Fixierungen ein, die eben wie ein schicksalshafter Spruch das Leben des Menschen beeinträchtigt. In der psychoanalytischen Therapie kann dieses Schicksalshafte aus der Unbewusstheit herausgearbeitet und neu gedeutet werden, in dem von mir inaugurierten Verfahren der Analytischen Psychokatharsis taucht es – nachdem es durch das rein schematische Formel-Logo geweckt wurde – spontan als Heils-Logo, Pass-Wort im Buchstabenraum des Meditationsvorgangs auf.
Dann äußert es sich so als würde man es wie von ferne oder aus der Tiefe her plötzlich denken, hören oder wie stimmlich erfahren, was ich analog zu den Formel-Worten auch Pass-Worte oder Identitätsworte genannt habe. Als ich begann diesen Text hier zu schreiben und meditierte, nahm ich Farben von wunderschöner Klarheit wahr, die ich gar nicht sehen wollte. Denn ich suchte ja einen gescheiteren Anfang als alle anderen Wissenschaftler, Philosophen, Psychoanalytiker usw. bisher gefunden haben. Ich konzentrierte mich auf das innere ‚Gemurmel‘, auf den ‚Klang‘ des Unbewussten und wollte schon aufgeben, da vernahm ich in der Meditation plötzlich die Formulierung „inter – hot“. „inter-hot“? Seltsam, was soll das heißen?
1 Die etwas seltsame Schrift soll der Verbildlichung dienen, um den Kontrast zum Worthaften herauszustellen. Weiteres später.
2 Barad, K., Verschränkungen, Merve (2015)
3 Johannes 1,1
4 Lacan, J., Seminar I, Walter (1986) S. 202
5 Lacan, J., Seminar I, Walter (1986) S. 214
6 Ich erwähne später die einzelnen Bedeutungen, die heraus zu lesen sind und sich gegenseitig überlappen.
7 Genauere Erklärungen zum Formel-Wort später.
8 Die Anfangs-Meditation eines Formel-Wortes ist keine Suggestion, denn die Formulierung hat keinen eindeutigen Sinn. Wie gesagt dazu noch in diesem Kapitel Ausführlicheres.
9 Dahmer, H., Kontroverse. Zur gegenwärtigen Situation der Psychoanalyse, PSYCHE 5 (2014) S. 477 - 484
10 Lacan, J., Seminar I, Walter (1984) S. 81
11 Was Lacan damit ausdrückt, dass er sagt: „Der [bildliche] Reflex der Einheit des Körpers ist eine reale Illusion.“
12 Ich komme gleich zu Lacans Satz, dass das Unbewusste strukturiert ist wie eine Sprache.
13 Der chinesische Philosoph Tschuang Tse sagte: „Ach würde ich doch einen Menschen kennen, der die Sprache vergessen hat, ich hätte endlich jemand, mit dem ich wirklich reden könnte.“
14 Offenbarung 10, 9, wo zuerst davon gesprochen wird, dass man die Buchstaben essen muss, bis sie den Bauch bitter machen, bevor sie schließlich süß wie Honig werden.
2. ‚inter-hot‘
War es ein eigener oder fremder Gedanke? Egal, er war klar erfahrbar und sicher einer, der von Unbewussten in eben dieser konkreten, durch die gedanklich wiederholten Formel-Worte angestoßenen Weise zustande kam. Ich dachte sofort an ‚Interpol’, ‚Internet’, an ‚hot-spot’ und natürlich auch an das von Psychoanalytikern wahrscheinlich favorisierte Heiße (‚hot’) eines zwischen (‚inter’) den Menschen stattfindenden Beziehungsgeschehens. Damit meine ich eine Bedeutung, die in Richtung des englischen Wortes ‚inter-course’ geht, das neben anderen Bedeutungen ja oft oder manchmal sogar ausschließlich im Sinne von ‚sexual inter-course’, ‚sexueller Verkehr’, benutzt wird. Es ist sicher etwas dran, dass mit dem „inter-hot“ auch derartiges gemeint war.
Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Erstens bin ich jetzt beim Schreiben dieses Buches bereits in meinem achtundsiebzigsten Lebensjahr. Es ist bekannt, dass mit zunehmendem Alter die Sache mit dem ‚inter-course’ Probleme machen kann. Man ist nicht mehr so überzeugt davon, selbst wenn die Physiologie noch funktioniert. Zweitens aber verhält es sich auch so, dass ich seit vierzig Jahren die Seminare von Lacan lese, in denen auf jeder dritten Seite steht, dass der ‚sexual inter-course’ gar nicht existiert. Für Lacan hat nur all das ein wirkliches Sein, was man auch sprachlich, symbolisch und echt ausdrücken kann, und vom Sex, so viel man auch darüber redet, kann man nichts Definitives, nicht ganz Bestimmtes oder gar Logisches sagen und erfahren. Er kann geschehen und man kann auch darüber reden, aber nichts davon sagen, was das Geschlechtsverhältnis überhaupt ist, was es ausmacht, was es heißt. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatten die alten Griechen gar kein Wort für Sex. Während die Psychoanalyse eine ‚logische Praxis‘ ist (ein Ausdruck, der den ihr oft abgesprochenen Wissenschaftsanspruch ersetzen soll), ist der Sex pure Praxis ohne Logik - jedenfalls weitgehend.15
Ich bin also vom ‚inter-course’ nicht mehr so überzeugt wie früher. Schon Freud meinte, dass das Sexuelle stark überbewertet wird und Lacan setzt dem hinzu, der direkte sexuelle Akt sei eine Freud‘sche Fehlleistung und gehe ohnehin mehr oder weniger immer daneben. Er sei eine Scheinbeziehung, die zwar hell scheint, strahlt, aber eben eine Beziehung nur dem Anschein nach ist. Eine echte, klare, wahre und definitive Aussage hat noch niemand davon gemacht. Dies ist auch unter Schriftstellern bekannt, die sich immer wieder daran versuchen, den Akt zu beschreiben, wozu es schon Preise für die kuriosesten Schilderungen und Mondkalbereien auf diesem Gebiet gegeben hat. Man kann das Tun beschreiben, das Drumherum, das Ontische, aber nicht das Wahre. Man kann Filme davon anschauen, aber nichts enthüllen, was es mit dem Geschehen zwischen den Geschlechtern in Wahrheit auf sich hat. Es geht um ein Erleben, das einfach nicht voll verifizierbar ist.
Weil es das vielleicht auch nicht sein muss, hat der französische Philosoph J. Nancy ein Buch veröffentlicht, das die Lacansche These zu konterkarieren schien.16 Der Text bezieht sich bei Nancy deutlich nur auf das Gegebene, das „Ex-sistieren“ in der sexuellen Beziehung. Nancy stellt ganz besonders das „Verhältnis“ und nicht den Sex als ‚Exsistierendes’ bzw. als ein eigenständiges Wesen heraus.17 Was wirklich gilt, schreibt er, ist der „Intimitäts-Zwischenraum“, in dem es um ein „Verhältnis zum Verhältnis geht“, das nicht „ein Seiendes ist, sondern das sich zwischen dem Seienden ereignet“, schreibt Nancy in typisch abstrakter, philosophischer Manier. Das Sexuelle, schreibt er weiter, sei seine eigene Differenz, es ist ein „Eins-Nichts“, was heißen soll, dass man eigentlich nur wetten kann, ob es existiert oder nicht. Der ‚inter-course‘ bleibt einfach ein Zwischenvorgang und sonst lässt sich nichts weiter damit anfangen. Und so sagt Nancy auch: diesen seinen Text lesen heißt, ihm bei seiner Art Sex zu haben zuzuschauen. Sein Schreiben ist seine eigentliche Lust.
So trifft sich Nancy dann doch noch mit Lacan, der meinte, wahren Sex gäbe es nur vom bewussten Ich zu einem ganz und total unbewussten Anderen in einem selbst, von sich also zu diesem „Schatzhaus der Signifikanten“,18 der auch Hort der Lustworte ist, der Eros Vokabeln, der Bedeutungsmacher, kurz: dem Zentrum des Bild-Wort-Wirkenden. Denn das eignet sich natürlich viel mehr dazu, ein echt erotisches Verhältnis zu kreieren. Weil der wahre Sex eben da abgeht, wo er scheinbar ist, d. h. da, wo nur Geschlechtsverkehr ist, gibt es kein wirkliches Verhältnis der Geschlechter, das irgendwie signifikant wäre, wahr lebbar, wahr aussagbar, real symbolisierbar und auf den Punkt gebracht.
Der übliche und schlichte Sex sei eben ein Patt, ein Patzer oder einfach nur ein Symptom.19





























