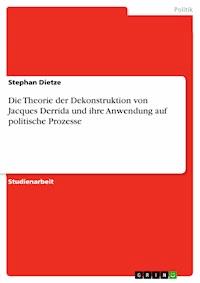36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien, Note: 1,3, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Medien- und Kommunikationswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: „Weblogs sind die Klowände des Internets“ Mit dieser sehr provokanten Aussage reizte seiner Zeit Jean-Remy weite Teile der Internetgemeinschaft und tatsächlich, bei so manchem Getwittere und manchem Weblog findet man diese Einschätzung auf den ersten Blick bestätigt. Doch daneben existieren heute eine ganze Reihe verschiedener und vor allem gesellschaftsrelevanter Weblogs, die sich nicht nur mit profanen Themen wie den Essensgewohnheiten irgendwelcher D-Prominenten beschäftigen oder nur Banales zum Besten geben. So gibt es Weblogs aus Krisen- und Kriegsgebieten, Weblogs die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen oder jene, die sich mit den traditionellen Medienangeboten der Presse, des Radios oder des Fernsehens auseinandersetzen und deren Berichterstattung kritisch reflektieren. Ließe man also die Aussage Jean-Remy´s unreflektiert so stehen, würde man eventuell all denjenigen Unrecht tun, die über und mit Weblogs gerade andere Ziele verfolgen. Denn insbesondere in nicht-demokratischen Systemen werden die Weblogs genutzt, um der öffentlichen Meinung eine eigene, kritische Sichtweise entgegenzusetzen. So kann Immanuel Kants Ausspruch „sapere aude“ auch als ein für die Weblogs gültiges Extrakt vorangestellt werden. Gleichsam ist mit diesem ersten Eindruck dann aber auch die Frage aufgeworfen, ob und wenn ja, wie Weblogs tatsächlich wirken können und welche Potentiale in ihnen stecken. Um wissenschaftlich fundierte Aussagen darüber treffen zu können und sich nicht gleichfalls dem Vorwurf auszusetzen, ebenfalls nur an eine wie auch immer geartete Klowand geschrieben zu haben, ist die Kommunikationsform der Weblogs aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Die Betrachtung kann dabei unter verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten erfolgen und in verschiedenste theoretische Bezugsrahmen gesetzt werden. Ganz im Sinne der übergeordneten medien- und kommunikationswissenschaftlichen Frage, wie sich Online-Kommunikationssysteme als Internetsubsysteme auf Gesellschaftsprozesse auswirken können, soll dann auch hier der Gang der Untersuchung erfolgen. Dafür ist in einem ersten Teil zu erörtern, in welcher Weise sich die Weblogs unter den Begriff der Internetsubsysteme subsumieren lassen. Dazu ist es erforderlich, das Medium Internet und dessen spezifische Funktionsweise gegenüber anderen Medien abzugrenzen. Anschließend ist zu beschreiben, wie sich innerhalb dieses Funktionssystems die Weblogs als selbständige Subsysteme herausgebildet haben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkun-gen von Online-Kommunikationssystemen auf Ge-sellschaftsprozesse.
Vorgelegt am:
Page 5
Einführung
„Weblogs sind die Klowände des Internets“1
Mit dieser sehr provokanten Aussage reizte seiner ZeitJean-Remyweite Teile der Internetgemeinschaft und tatsächlich, bei so manchem Getwittere und manchem Weblog findet man diese Einschätzung auf den ersten Blick bestätigt. Doch daneben existieren heute eine ganze Reihe verschiedener und vor allem gesellschaftsrelevanter Weblogs, die sich nicht nur mit profanen Themen wie den Essensgewohnheiten irgendwelcher D-Prominenten beschäftigen oder nur Banales zum Besten geben. So gibt es Weblogs aus Krisen- und Kriegsgebieten, Weblogs die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen oder jene, die sich mit den traditionellen Medienangeboten der Presse, des Radios oder des Fernsehens auseinandersetzen und deren Berichterstattung kritisch reflektieren. Ließe man also die Aussage Jean-Remy´s unreflektiert so stehen, würde man eventuell all denjenigen Unrecht tun, die über und mit Weblogs gerade andere Ziele verfolgen. Denn insbesondere in nicht-demokratischen Systemen werden die Weblogs genutzt, um der öffentlichen Meinung eine eigene, kritische Sichtweise entgegenzusetzen. So kann Immanuel Kants Ausspruch „sapere aude“ auch als ein für die Weblogs gültiges Extrakt vorangestellt werden. Gleichsam ist mit diesem ersten Eindruck dann aber auch die Frage aufgeworfen, ob und wenn ja, wie Weblogs tatsächlich wirken können und welche Potentiale in ihnen stecken. Um wissenschaftlich fundierte Aussagen darüber treffen zu können und sich nicht gleichfalls dem Vorwurf auszusetzen, ebenfalls nur an eine wie auch immer geartete Klowand geschrieben zu haben, ist die Kommunikationsform der Weblogs aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Die Betrachtung kann dabei unter verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten erfolgen und in verschiedenste theoretische Bezugsrahmen gesetzt werden.
Ganz im Sinne der übergeordneten medien- und kommunikationswissenschaftlichen Frage, wie sich Online-Kommunikationssysteme als Internetsubsysteme auf Gesellschaftsprozesse auswirken können, soll dann auch hier der Gang der Untersuchung erfolgen.
Dafür ist in einem ersten Teil zu erörtern, in welcher Weise sich die Weblogs unter den Begriff der Internetsubsysteme subsumieren lassen. Dazu ist es erforderlich, das Medium Internet und dessen spezifische Funktionsweise gegenüber anderen Medien abzugrenzen. Anschließend ist zu beschreiben, wie sich innerhalb dieses Funktionssystems
1Zum Zitat vonJean-Remyund den dadurch ausgelösten Debatten findet sich ein Artikel vom 20.1.2006 bei Tecchannel.de. Abrufbar unter: http://www.tecchannel.de/news/themen/business/434199/ blogs_klowaende_des_internet/.
Page 6
die Weblogs als selbständige Subsysteme herausgebildet haben und durch welche spezifischen Funktions- und Wirkweisen sich diese wiederum auszeichnen. Gegenüber anderen Medien spezielle Auswirkungen können Weblogs allerdings nur unter der Bedingung besitzen, dass sie spezifische Potentiale aufweisen. Erste Erkenntnisse darüber lassen sich bereits aus deren besonderer Funktions- und Wirkweise extrahieren, sollen in einem zweiten Teil aber auch unter dem Aspekt kommunikationstheoretischer Modelle gewonnen werden. Eine Einordnung wird hier speziell nach den KommunikationsmodellenFlussers,als auch unter den Medientheorien vonBrechtundEnzensbergervorgenommen werden.
Um abschließend die Potentiale und die damit verbundenen Auswirkungen der Weblogs auf gesellschaftliche Prozessen analysieren zu können, ist es notwendig danach zu fragen, welche gesellschaftlichen Prozesse überhaupt beleuchtet werden sollen. Denn unter den Begriff des Gesellschaftsprozesses lassen sich diverse soziorelevante Bezüge fassen. Um dabei eine Ausuferung der Untersuchungsgegenstände zu vermeiden, soll sich im Rahmen dieser Untersuchung darauf konzentriert werden zu erforschen, wie sich die Weblogs auf einen der bedeutendsten Gesellschaftsprozess auswirken können: Hierunter soll hier das kollektive Gedächtnis verstanden werden; also dasjenige Gedächtnis, das einer Gesellschaft innewohnt. Denn dieses bildet gleichsam das erinnerbare Vergangenheitsregister einer Gesellschaft ab und verbindet die Gesellschaft gleichsam in identitätsstiftender Weise. Dieser Aspekt stellt sich insbesondere unter dem Eindruck als erörterungsbedürftig heraus, als dass das Internet die Welt sprichwörtlich kleiner werden lässt, da über das Internet unendlich viele Informationen raum- und zeitunabhängig kommuniziert werden können. Den theoretischen Bezugsrahmen bilden dafür die Untersuchungen von Assmann zum kollektiven Gedächtnis. Die Darstellung und Erörterung seiner Theorien wird in einem dritten Teil erfolgen. In einem vierten und letzten Teil können dann die Einzelerkenntnisse synoptisch zusammengefasst und aufeinander bezogen werden. Am Ende wird dann, unter den Bedingungen der dieser Untersuchung zugrundegelegten wissenschaftlichen Bezugsrahmen, ein Beitrag zur Beantwortung der Frage geleistet werden können, wie sich Weblogs als Online-Kommunikationssysteme des Internets auf den Gesellschaftsprozess des kollektiven Gedächtnisses auswirken können.
Begriffsbestimmungen
Für diese Untersuchung sollen einige Begriffe zunächst definiert werden, um spätere Wiederholungen zu vermeiden.
So sollen unter dem Begriff der traditionellen Medien alle Medien außer die speziellen Subsysteme des Internets verstanden werden; die neuen Medien bilden demnach spiegelbildlich die Internetsubsysteme hier also insbesondere die Weblogs. Neben anderen Online-Kommunikationssystemen werden unter diese hier nur die Weblogs und die sogenannten Microbloggingdienste wie Twitter gefasst, die ein Subsystem des Internets darstellen.
Als Gesellschaftsprozess wird weiterhin, wie beschrieben, das kollektive Gedächtnis im Sinne eines erinnerbaren Vergangenheitsregisters nachAssmannbegriffen.
Page 7
Unter Öffentlichkeit soll hier ein Kommunikationssystem verstanden werden, in dem Einstellungen zu bestimmten Themen diskursiv bearbeitet werden, zu denen mit Hoffnung auf Anschluss kommuniziert werden kann. Damit verbunden ist dann all das, was für die Allgemeinheit, also für ein nicht näher spezifiziertes Publikum, relevant sein kann. Öffentlichkeit wird durch den Mechanismus des kommunikativen Anschlusses erzeugt, der in und durch Medien stattfindet. Denn nur wenn vorhandene Informationen in anderen Medien wieder aufgegriffen und diskursiv behandelt werden, bleiben sie allgemein im Gedächtnis. Öffentlichkeit ist hiernach also als ein Netzwerk von Kommunikationseinflüssen zu verstehen.2
1. Teil: Internetsubsysteme
Um die Auswirkungen von Online-Kommunikationssystemen als Internetsubsysteme3auf gesellschaftliche Prozesse untersuchen zu können, ist in einem ersten Schritt zu erörtern, welche spezifische Funktionsweisen und Eigenschaften diese Online-Kommunikationssysteme aufweisen, wie sie sich entwickelt haben und wie diese innerhalb des Mediums Internet heute gebraucht werden. Dazu soll zunächst holzschnittartig die Internetentwicklung selbst dargestellt werden, um anschließend die Weblogs als spezielles Online-Kommunikationssystem innerhalb des Internets einordnen zu können.
1. Die Entstehung des Internets, Der ‚Sputnik-Schock‘
Das Medium Internet hat im Vergleich zu anderen Medien - Sprache, Schrift, Radio oder Fernsehen - augenscheinlich die kürzeste Geschichte. Es entstand erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts und setzt als ‚neues‘ Medium die Reihe der bestehenden traditionellen Medien fort. Die Entstehungsgeschichte ist bereits ausführlich deskriptiv dargestellt worden.4In diesem Rahmen sollen sich daher die Ausführungen dazu auf diejenigen prominenten Eckpunkte beschränken, die für diese Untersuchung von Relevanz sind.
Seine Geburt verdankt das Medium Internet der Beziehung zwischen der UdSSR und den USA im Kalten Krieg. Um ihre Überlegenheit im All und damit auch ihre kriegsstrategische Überlegenheit gegenüber den technischen Möglichkeiten der USA zum Ausdruck zu bringen, schoss die UdSSR im Jahre 1957 den ersten Satelliten ‚Sputnik I‘ erfolgreich in die Erdumlaufbahn, was auf Seiten der USA einen Schock, den sogenann-2DerÖffentlichkeitsbegriff ist dem vonAlbrecht u.a.entlehnt. HierzuAlbrecht, Steffen / Hertig-Perschke, Rasco / Lübcke, Maren:Wie verändern neue Medien die Öffentlichkeit? Eine Untersuchung am Beispiel von Weblogs im Bundestagswahlkampf 2005, In:Stegbauer, Christian / Jäckel, Michael:Social Software. Formen der Kooperation in computerbasierten Netzwerken, 2008, S. 96 f.
3Zum Systembegriff unten 1. Teil, 2., S. 6.
4Umfassend hierzu siehe nurBunz, Mercedes:Vom Speicher zum Verteiler: die Geschichte des Internet, 2009;Hafner, Katie / Matthew, Lyon:Arpa Kadabra: Die Geschichte des Internets, 1997.
Page 8
ten ‚Sputnik-Schock‘ auslöste.5Damit schien der Wettlauf um die Vorherrschaft im All, die es nun auch möglich machte über große Distanzen einen Angriff auf den Gegner durchzuführen, zugunsten der UdSSR auszugehen6und verlagerte die Machtverhältnisse im Kalten Krieg zu ihren Gunsten.7
Um die technische Überlegenheit und Souveränität der USA wiederherzustellen, gründete die US-Regierung 1958 die ‚Advanced Research Projects Agency‘ (ARPA), die zunächst auch für Raumfahrtangelegenheiten zuständig war.8Für eine effizientere Aufgabenerfüllung wurde dann aber schnell die Zuständigkeit für die Raumfahrt- und Raketenprogramme auf eine speziell für diesen Aufgabenbereich eingerichtete Organisation, die NASA übertragen.9Der Forschungsschwerpunkt der ARPA wurde daraufhin speziell auf die Grundlagenforschung der Informationsverarbeitung verlagert. Eben die revolutionären Erkenntnisse dieser Organisation in den Folgejahren ebneten schließlich den Weg zur Entstehung des Internets mit.10
Allerdings war es nicht allein der Erfindergeist der ARPA-Mitarbeiter, sondern es waren auch militärische Gründe, die die Entwicklung vorantrieben.11Daran mitbeteiligt war die ‚Research and Development Corporation‘ (RAND), eine usamerikanische staatliche Organisation, die sich im Auftrag des Verteidigungsministeriums um die Überlebensmöglichkeit der Kommunikationsnetze nach einem möglichen atomaren Angriff kümmern sollte.12Man ging kriegsstrategisch davon aus, dass bei einem atomaren Angriff zunächst die Kommunikationsleitstellen des Kriegsgegners außer Gefecht gesetzt werden würden, um einen kommunikativ geordneten Rückschlag zu vermeiden13. Da das damalige Informationsnetz zentral gestaltet war, hätte dies bei einem direkten Angriff zu einem Totalausfall führen können. Deshalb sollte die RAND ein Kommunikationssystem entwickeln, das selbst nach einem solchen Angriff noch funktionsfähig sein würde.14Diese stellte erste theoretische Überlegungen über eine vernetzte und offene Kommunikationsform an und entwickelte so erste computerbasierte Netzwerke.15
Anfang der 1960er Jahre entwickelte nunmehr u.a. Paul Baran eine Methode, um digitale computerbasierte Netzwerke zu schaffen, die sogenannte Paketschaltung.16Die Funktionsweise dieser paketorientierten Datenübertragung ist einer Paketverschickung per
5Hafner, Katie / Matthew, Lyon:Arpa Kadabra: Die Geschichte des Internets, 1997, S. 15.
6Teuteberg, Hans-Jürgen / Neutsch, Cornelius:Vom Flügeltelegraphen zum Internet. Geschichte der modernen Telekommunikation, 1998, S. 227.
7Rheingold, Howard:Virtuelle Welten. Reisen im Cyberspace, 1992, S. 111.
8Ebd.,S. 111.
9Matis, Herbert:Die Wundermaschine. Die unendliche Geschichte der Datenverarbeitung: Von der Rechenuhr zum Internet, 2002, S. 304.
10Bolz, Norbert / Kittler, Friedrich, A. / Tholen, Christoph:Computer als Medium, 1999, S. 190.
11Coy, Wolfgang:Media Control. Wer regiert das Internet?, In:Krämer, Sybille:Medien, Computer, Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und neue Medien, 1997, S. 133.
12Hafner, Katie / Matthew, Lyon:Arpa Kadabra: Die Geschichte des Internets, 1997, S. 64.
13Tanenbaum, Andrew S.:Computernetzwerke, 2003, S. 68.
14Bühl, Achim:Die virtuelle Gemeinschaft des 21. Jahrhunderts. Sozialer Wandel im digitalen Zeitalter, 2000, S. 116.
15Detaillierte Ausführungen zur Entstehungsgeschichte des Internets beiHafner, Katie / Matthew, Lyon:Arpa Kadabra: Die Geschichte des Internets, 1997.
16Hierzu und zum FolgendenKyas, Othmar:Internet. Zugang, Utilities, Nutzung, 1994, S. 31.
Page 9
Post sehr ähnlich. Bestimmte Informationen wie Zieladresse, der Inhalt der Information, der Absender oder die Sequenznummer müssen gegeben sein, um das Datenpaket senden zu können. Die einzelnen Datenpakete werden nun durch das Netzwerk gesendet und je nach Möglichkeit auf direktestem Wege zum Zielcomputer geschickt. Treffen die Datensegmente dabei auf zerstörte oder besetzte Leitungen, kann die Information über die noch erhaltenen Leitungen umgeleitet werden. Dieses Verkehrslenkungssystem zielt auf eine schnelle und direkte Weiterleitung der Daten durch einen Verteiler ab. Am Zielcomputer angekommen, werden die Datensegmente dann wieder zusammengesetzt. Fehlt dabei ein Paket, wird der absendende Computer benachrichtigt und der Sendevorgang nochmals durchgeführt. Auch wenn die Reihenfolge der Datenpakete durch die unterschiedliche Navigation durcheinander kommen kann, kann sie am Zielcomputer dennoch anhand der Sequenznummer korrekt zusammengefügt und die Information somit exakt wiederhergestellt werden. Durch die feste Größe der Datenpakete (1024 Bit) wurde eine einfache und universelle Methode geschaffen. Diese hatte zudem den Vorteil, dass sie die Nachrichtenentschlüsselung schwieriger machte, da die Datenpakete zerstückelt waren, was insbesondere für militärische Zwecke wichtig war. Ein weiterer aber nicht minder wichtiger Vorteil war die bessere Ausnutzung der Telefonnetzressourcen. Denn während bei einem Telefongespräch die Leitung besetzt ist, auch wenn nicht gesprochen wird, ist bei einem digitalen Datenstrom nur bei der direkten Informationssendung das Netzwerk belastet.17
Abbildung 1.1: Das Datenpaket mit den Informationseinheiten18
Um die Vernetzung von Universitäten und Forschungseinrichtungen zu ermöglichen, entwickelte wiederrum die ARPA im Jahr 1969 das sogenannte ‚ARPANET‘ (Advanced Research Projects Agency Networks) und griff dazu die durch die RAND entwickelte Paketschaltungsmethode auf. Das so entstandene Netzwerk verknüpfte anfangs erfolgreich dezentral vier unterschiedliche US-Universitäten. Die Möglichkeiten dieser Vernetzung sollten nun auch einem größeren Kreis an Nutzern zugänglich gemacht werden, wozu die ARPA - nunmehr umbenannt in DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) - 1973 das sogenannte ‚Internet-Projekt‘ forcierte.19Um zu erreichen, dass zwischen den Großrechnern und den jeweiligen Computern fehlerfrei
17Hafner, Katie / Matthew, Lyon:Arpa Kadabra: Die Geschichte des Internets, 1997, S. 70 f.
18Baran, Paul: Memorandum RM-3420-PR, 1964, abrufbar unter: http://www.rand.org/pubs/research _memoranda/2006/RM3420.pdf, S. 22.
19Rheingold, Howard:Virtuelle Welten. Reisen im Cyberspace, 1992, S. 110.
Page 10
Daten ausgetauscht werden konnten, was bislang auf Grund ihrer noch verschiedenen Protokolle nicht möglich war, entwickelte die DARPA ein einheitliches Internetprotokoll (TCP/IP) unter eben der Verwendung der Paketschaltungsmethode. Dabei übernimmt das Transmission Control Protocol (TCP) die Aufgabe, anhand der Paketschaltungsmethode die Informationen in kleine Pakete aufzuteilen und sie am Zielort wieder zu einer Informationseinheit zusammen zu setzen. Das Internet Protokoll (IP) wiederrum übernimmt die korrekte Zustellung der Pakete an den Zielort.20Die sich im Laufe der Folgejahre durchsetzende Verwendung des TCP/IP als Standardprotokoll für alle Rechner, bildet letztlich auch die Grundlage des modernen Internets. Jeder Rechner, der Zugang zum Internet herstellen will, muss es verstehen.21Denn die speziell definierten TCP/IP-Referenzmodelle verbinden heute weltweit agierende unterschiedlichste Netzwerke miteinander und ermöglichen dadurch erst die Kommunikation und den Datenaustausch.
War die Entstehung des Internets zunächst stark an militärische Zwecke gekoppelt, wurden seine Vorteile dann aber auch schnell für zivile Aufgaben wie die Wissenschaft fruchtbar gemacht. Spätestens als das ARPANET im Jahre 1990 abgeschaltet wurde, wurde das Internet auch für den privaten Anwender zugänglich gemacht, da seine Verbreitung nun auch ökonomische Optionen eröffnete.22Letztlich entwickelte sich das Internet so bis heute, nicht zuletzt auch durch die stetig voranschreitenden Preissenkungen für Computer und Modems, zu einem weltumspannenden gesellschaftlichen Phänomen.
2. Das World Wide Web als spezielles Internetsubsystem
Innerhalb des so entstandenen weltumspannenden Kommunikationsnetzes Internet bildeten sich schließlich im Laufe der Zeit spezielle Subsysteme aus.23Über die Bezeichnung als System wird so augenscheinlich eine Abgrenzung zwischen diesem und anderen Systemgebilden vermittelt. Dies wirft zugleich die Frage danach auf, wie sich das Internet und sich darin unterteilbare sogenannte Subsysteme gegeneinander abgrenzen lassen. Für die hier zu untersuchende Ausgangsfrage, wie sich Weblogs auf gesellschaftliche Prozesse auswirken können, ist also nach einem Klassifizierungsmodell zu forschen, das es vermag, gesellschaftliche beziehungsweise mediale Systemkomplexe zu beschreiben. Eine solche soziologische Systemtheorie entwickelte insbesondere Niklas Luhmann. Danach wird ein System ganz grundsätzlich als eine Art Identität verstan-
20Gralla,Preston:So funktioniert das Internet. Ein visueller Streifzug durch das Internet, 1999, S. 13 f.
21Kreuzberger, Thomas:Internet. Geschichte und Begriffe eines neuen Mediums, 1997, S. 12.
22Ebersbach, Anja / Glaser, Markus / Heigl, Richard:Social Web, 2008, S. 19.
23Dazu zählen unter anderem die Subsysteme World Wide Web (WWW), die E-Mail-Kommunikation, das Usenet (Newsgroup) und der Internet Relay Chat (IRC). Die exakte Unterscheidung zwischen dem Internet und dem WWW findet im Alltagsgebrauch kaum mehr Beachtung. Wie sich zeigen wird, sind aber beide nicht synonym zu verwenden. HierzuStrohmeier, Gerd:Politik und Massenmedien. Eine Ein- führung, 2004, S. 51.
Page 11
den, die sich in einem Umweltkomplex durch eine Verfestigung einer Innen/Außen-Differenzierung am Leben erhält.
„Ein System entsteht durch Grenzziehung und Konstituierung einer Differenz von Außen und Innen, durch die Schaffung von Bereichen unterschiedlicher Komplexität, durch Reduktion von Komplexität.“24
Wenn man nun unter Zugrundelegung dieser grundlegenden Konkretisierungskriterien ein bestimmtes Funktionssystem abgrenzen kann, das gerade über die Massenmedien vermittelt wird25, lässt sich für die hiesige Untersuchung folgendes festhalten: Die Massenmedien als Kommunikationssysteme ermöglichen es aufgrund für sie geltender Kriterien, die vorhandenen und weltweiten Aktivitäten über eine räumliche und zeitliche Distanz abzubilden und diese selektiv zu senden. Diese Formen der gesendeten Selektionen bilden wiederum das ab, was wir lesen, hören oder sehen.26Allerdings bilden diese Selektionen Geschehnisse unterschiedlich ab und so kann man nicht mehr von einem System schlechthin sprechen. Denn die moderne Gesellschaft ist nicht mehr zentral beschreibbar und so entstehen Teilsysteme.
„Eine Folge dieser „multiperspektivischen“, „polykontexturalen“, zentrumlosen Kommunikationsverhältnisse ist der Verlust einer universalen und unangreifbaren Beschreibung der Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht mehr als Ganzes begreifbar ist.“27
Die Entstehung und der Umfang solcher Teilsysteme hängt damit aus systemtheoretischer Sicht von der Verbreitung der Massenmedien ab. Die quasi zerfallene Gesellschaft wird durch die Massenmedien insofern kompensiert, als dass sich durch ihre Informationsselektion und Vermittlung solche Informationsfokusse bilden, welche die entstandene gesellschaftliche Vielfalt überlagern und auf die sich jeder Einzelne als Teil der Gesellschaft wie auf ein gemeinsames Hintergrundwissen beziehen kann. Dieser gemeinsame Wissenspool bezieht sich gleichsam auf alle Gesellschaftsteile und schafft durch die Massenmedien für ein unbestimmtes Publikum ein Informiertsein, trotz des intermediären Zerfalls. Die Medien vermitteln damit Informationen, die wiederum zu Anschlusskommunikationen unter den Rezipienten führen können.28Diese schaffen damit einen Prozess, dem sie eine Realität zur Verfügung stellen, auf die sich die Gesellschaftsteile jeweils beziehen können und damit Raum für eine weitere Ausbildung eigensinniger Kommunikationsformen. Die spezielle Funktion der Massenmedien besteht
24Unter Bezugnahme aufLuhmannbeiHillmann, Karl-Heinz:Wörterbuch der Soziologie, 1994, S. 858.
25So auch mit umfassender Herleitung und BegründungWehner, Josef:Wie die Gesellschaft sich als Gesellschaft sieht - elektronische Medien in systemtheoretischer Perspektive, In:Neumann-Braun, Klaus / Müller-Doohm, Stefan:Medien- und Kommunikationssoziologie. 2000, S. 100-105.
26Ebd., S. 105.
27Ebd., S. 106.
28Zu der sich über diese Funktionsweise vermittelten Öffentlichkeit unten 1. Teil, 3.6., S. 34.