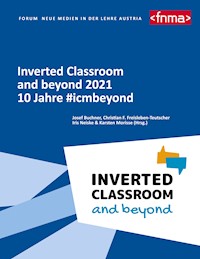
Inverted Classroom and beyond 2021 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Tagungsband zur Konferenz "Inverted Classroom and beyond 2021" zeichnet sich durch vielfältige Beiträge aus, die einmal mehr zeigen, dass das Inverted Classroom Modell (ICM) für alle Fachdisziplinen und Formate von Lehrveranstaltungen hoch spannende, wertvolle Impulse liefern kann. Weiters zeigt sich das Potenzial, mit Ansätzen aus dem ICM Hochschuldidaktik insgesamt weiterzuentwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Voller Freude präsentieren wir den Tagungsband zur Konferenz “Inverted Classroom and beyond 2021”. Dieser zeichnet sich durch vielfältige Beiträge aus, die einmal mehr zeigen, dass das Inverted Classroom Modell (ICM) für alle Fachdisziplinen und Formate von Lehrveranstaltungen hoch spannende, wertvolle Impulse liefern kann. Weiters zeigt sich das Potenzial, mit Ansätzen aus dem ICM Hochschuldidaktik insgesamt weiterzuentwickeln.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns beim Forum Neue Medien in der Lehre Austria, nur durch die Unterstützung des Vereins war die Erstellung dieses Tagungsbandes möglich. Unser Dank gilt weiters den Sponsoren der Tagung sowie dem Programmkomitee der ICM & beyond 2021!
Besonders bedanken möchten wir uns wieder bei allen Autorinnen, Autoren und Beitragenden der Konferenz und dieses Sammelbandes. Leserinnen und Leser können sich auch in diesem Band wieder auf die inhaltliche Vielfalt freuen, die auch bereits andere Bände ausgezeichnet hat.
Josef Buchner, Christian F. Freisleben-Teutscher,
Iris Neiske & Karsten Morisse
Inhalt
Einleitung
Rebekka Schmidt, Ilka Mindt
Inverted Classroom: Beyond and within
Angelika Neudecker
Ästhetische Praxis: Werte-Dreiklang nach Carl R. Rogers in der Out-of-Class-Phase eines Inverted Classrooms
Claude Müller, Josef Buchner, Jennifer Erlemann, Sandra Spörri
Lernaktivierung in digitalen Lernangeboten mit myScripting designen
Hubert Gruber
ICM und Padlet – Konzepte und Werkzeuge für ein dialogisch-integratives Lernen mit Musik
Karsten Morisse
ICMScrum: Inverted Classroom trifft Scrum
Katja Wengler, Linda Lichel, Judith Hüther
Wie können wir das Flair unserer Hochschule in den virtuellen Raum übertragen? – Onboarding für Studienanfänger*innen im Corona-Jahr
Christoph Schärtl
Kompetenzorientierter (Rechts-)Unterricht – Der
Virtual Enhanced Inverted Classroom (VEIC) in der Unterrichtspraxis
Isabell Grundschober, Stefan Oppl
Constructive Alignment in der agilen Lehrveranstaltungsentwicklung
Jutta Pauschenwein, Wolfgang Kühnelt
Wir produzieren eine Serie!
Ariane S. Willems, Angelika Thielsch, Katharina Dreiling
Peer Learning im virtuellen Inverted Classroom – Erfahrungen aus der Distanzlehre
Bernhard Spangl, Dora Kertesz, Christian F. Freisleben-Teutscher
Kollaborative Lehr-Lernformate für das virtuelle Klassenzimmer
Christian F. Freisleben-Teutscher, Gerlinde Koppitsch
„In Ihrer Lehrveranstaltung muss ich viel mehr arbeiten“ – warum es das ICM oft schwer hat …
Elke Höfler
Doppelt geflippt: Praxis-Theorie-Praxis-Transfer in der Lehramtsausbildung
Iris Neiske
Geflippte E-Tutor*innenschulungen
Mario Liftenegger
Der In-Class-Flip. Vorteile von ICM in allgemeinbildenden Gegenständen ohne Heimarbeitszeit
Einleitung
Am 23. Und 24. Februar 2021 fand bereits zum zehnten Mal die Konferenz Inverted Classroom and beyond statt. Und das zehnjährige Jubiläum war etwas ganz besonderes, wurde die Konferenz doch zum ersten Mal, Corona-bedingt, gänzlich als Online-Konferenz organisiert. Als Gastgeber fungierte die FH St. Pölten: Das Team um Christian Freisleben-Teutscher demonstrierte in beeindruckender Weise, dass auch online innovative, dialogorientierte und experimentelle Konferenzformate umzusetzen sind. So wurde etwa gänzlich neu das Format einer „Flipped/Inverted Classroom Forschungswerkstatt“ erprobt und erfolgreich umgesetzt. Als Ergebnis dieses Formats formierten sich drei Gruppen, die im Laufe des Jahres an konkreten Herausforderungen und Fragestellungen arbeiteten. Erste Ergebnisse aus diesen Forschungsgruppen werden im Rahmen der #icmbeyond22 präsentiert werden. Interessierte können sich jederzeit in die Gruppen mit den Schwerpunkten „Gestaltung der Vor-/Selbstlernphase(n)“, „Theoretische Fundierung des FC/ICM“ sowie „Differenzierung & ICM“ einbringen. Weitere Informationen dazu stehen auf der Homepage der #icmbeyond zur Verfügung → Forschungswerkstatt ICM. Dort ist auch eine ausführliche Dokumentation zu allen Workshops, Vorträgen, Diskussionsforen und vielem mehr einsehbar.
Mit diesem Tagungsband werden die Beiträge unserer Teilgeberinnen und Teilgeber der Konferenz dokumentiert und für alle Interessierten zur Verfügung gestellt. Erneut zeigt sich, wie vielfältig sich die Auseinandersetzung mit der Idee des Flipped/Inverted Classroom in Schule, Hochschule und Weiterbildung gestaltet. Forschung und Praxis können gespannt sein, welche neuen, innovativen Wege sich hier in der Zukunft noch auftun werden. Wir als Herausgeber*innen dieses Bandes freuen uns auf weitere 10 Jahre #icmbeyond und beyond…
Josef Buchner, Christian F. Freisleben-Teutscher, Karsten Morisse
Rebekka Schmidt, Ilka Mindt
Inverted Classroom: Beyond and within
#icmbeyond21 Keynote - Aufzeichnung verfügbar unter: t1p.de/key21
Angelika Neudecker
Ästhetische Praxis: Werte-Dreiklang nach Carl R. Rogers in der Out-of-Class-Phase eines Inverted Classrooms 1
"After much storm, members of the group began expressing, more and more frankly, their own significant feelings about teaching [...] lt was a very thought-provoking session. I question whether any participant in that session has ever forgotten it.“ Carl R. Rogers, 1961, S.274
Zusammenfassung
Nach dem Aufrollen des Stellenwerts des Psychotherapeuten Carl R. Rogers im Feld des Lernens, wird der von ihm vertretene Werte-Dreiklang aus positiver Zuwendung, Empathie und Kongruenz auf das Konzept des Inverted Classrooms übertragen. Dabei steht in diesem Beitrag vor allem die Mediengestaltung und - präsentation in der Out-of-Class-Phase im Fokus. Es werden erste Ideen vorgestellt, mit welchen Elementen in der Out-of-Class-Phase der genannte Carl-Rogers’sche Werte-Dreiklang verkörpert werden kann.
1 Wer ist Carl R. Rogers?
Humanistische Psychologie, Personenzentrierter Ansatz, eine Nominierung für den Friedensnobelpreis. Die Lebenszeit von 1902 bis 1987. Zahlreiche Bücher und mehr als 200 Aufsätze. 1961 das Buch mit dem Titel On Becoming A Person, und 1969 das Buch mit dem Titel Lernen in Freiheit.
Einige von Ihnen werden jetzt wissen, um wen es geht. Andere werden es eventuell erahnen, und wieder andere werden den Namen noch nie gehört haben. Es geht um Carl Ransom Rogers, bekannt als Psychotherapeut, Psychologe, Autor und Wissenschaftler. 1987 wurde er – kurz vor seinem Tod – aufgrund seiner Friedens- und Vermittlungsarbeit zwischen Kulturen und Nationen für den Friedensnobelpreis nominiert. Carl R. Rogers hat praktiziert, geschrieben und geforscht im Bereich der Psychotherapie. Er hat aber auch – was Vielen nicht bekannt ist – im Bereich des Lernens zentrale Theorien erarbeitet, Begriffe geprägt und Studien publiziert. „Die Ergebnisse dieser Studien und ihre Bedeutung für die Erwachsenenpädagogik wurden in Deutschland bisher allerdings kaum rezipiert.“ (Kunze-Pletat, 2019, S. 4).
2 Begriffe und Haltung
Begriffe, die mit Carl R. Rogers verbunden sind, sind das Signifikante Lernen, die Aktualisierungstendenz, die Fully Functioning Person, die Begegnung im voll-menschlichen Sinne und die Einzigartigkeit des Individuums. Zum Begriff des Signifikaten Lernens schreibt Carl R. Rogers (1984, S. 23): „Das signifikante Lernen verbindet das Logische mit dem Intuitiven, den Intellekt mit dem Gefühl, die Vorstellung mit der Erfahrung. Wenn wir so lernen, sind wir ganz beteiligt.“ Unter dem Begriff der Selbstaktualisierungstendenz wird die „Tendenz des Organismus, sich in die vielen unterschiedlichen Kanäle potenzieller Entfaltung zu ergießen, sofern diese als bereichernd erfahren werden“ verstanden (Rogers, 2016, S. 279). Im Original von 1961 beschreibt Rogers dies auf Seite 285 wie folgt: „...the tendency for the organism to flow into all the differentiated channels of potential development, insofar as these are experienced as enhancing.“ Im Rahmen dieses kurzen Beitrags können nicht alle Begriffe geklärt werden. Lassen Sie sich jedoch anregen, sich mit Carl R. Rogers weiter zu beschäftigen.
3 Empathie, positive Zuwendung & Kongruenz
Ganz zentrale und immer mit Carl R. Rogers in Verbindung gebrachte Kernelemente sind die Empathie, die positive Zuwendung (=Wertschätzung) und die Kongruenz (=Authentizität). Diese Begriffe tauchen auch in alltäglichen Kontexten auf, und die Bedeutung ist uns deshalb vertraut. Sie gehen in diesem Dreiklang und im Setting sowohl der Psychotherapie als auch der Lerntheorie stark auf die Arbeiten von Carl R. Rogers zurück. So ist zum Beispiel eine Grundaussage des Buches On Becoming a Person von Carl R. Rogers, dass Beziehungen, die von Empathie, positiver Zuwendung und Kongruenz geprägt sind, ein Schlüssel zum menschlichen Wachstum und menschlicher Entwicklung sind. (Rogers, 1961). Im Kontext des Lernens schreibt Carl R: Rogers dazu folgendes: „Von allen untersuchten Lehrer-Variablen waren die mit der größten Beziehung zu konstruktiven Ergebnissen: Die Empathie des Lehrers – der Versuch, die Bedeutung der Schulerfahrung für den Schüler als Person zu verstehen; positive Zuwendung – die Achtung des Lehrers vor dem Schüler als Person; und Kongruenz – das Ausmaß, in dem der Lehrer in der Beziehung zu den Schülern echt war. Dass diese Bedingungen, die sich zuvor schon als effizient in der Therapie herausgestellt hatten, sich auch auf dem Gebiet des persönlichen und theoretischen Lernens in der Schule als effizient erwiesen, ist beeindruckend“ (Rogers, 1991, S. 222).
Eine entscheidende Rolle spielt unsere Haltung als Lehrende, da Carl R. Rogers der Überzeugung war, dass das von uns ausgehende Beziehungsangebot an die Lernenden übergeordnet und unabhängig von Methode und Didaktik ist. Er schreibt hierzu u.a. folgendes: „...das relevanteste – und somit paradigmatische – Forschungsergebnis, dass die pädagogische Beziehung, wenn sie von Gruppenmitgliedern wahr- und angenommen wird, das signifikant veränderungsbewirkende und lernfördernde Element darstellt. Sie gilt aufgrund der Forschungen als ein übergeordneter zentraler Wirkfaktor in Wissenschaft, Theoriebildung und Praxis. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass Didaktik und Methodik als nachrangig betrachtet werden müssen: Ermöglicht eine Seminarleitung dieses spezifische, einstellungsbedingte Beziehungsangebot, das methodisch nicht erzeugbar ist, sondern als Beziehungsangebot von Lernenden nur erfahren werden kann, so sind Methoden zweitrangig.“ (Rogers C., 1983/2012, S. 341). Daraus lässt sich ableiten, dass wir als Lehrende unser eigenes Selbstkonzept in Bezug auf unsere Haltung und somit auch unsere Rolle überprüfen müssen, wenn wir im Sinne von Carl R. Rogers agieren möchten.
4 Werte-Dreiklang in der Out-of-Class-Phase
Es stellt sich für mich die Frage nach einer Carl-Rogers‘schen Kurs- und Mediensprache bzw -gestaltung, die vor allem in der Out-of-Class-Phase eines Inverted Classrooms wirksam ist; also in der Phase, in der die Dozierenden eben gerade nicht anwesend sind und die Lernenden somit keine direkte und unmittelbare Ansprechperson haben. Dass in der In-Class-Phase eines Inverted Classrooms der Werte-Dreiklang aus Empathie, positiver Zuwendung und Kongruenz durch die Dozierenden im Kontakt mit den Lernenden umgesetzt werden kann, wird – bei entsprechendem Mindset und nach pädagogischer Auseinandersetzung – als umsetzbar angesehen und soll in diesem Beitrag nicht im Vordergrund stehen. Doch wie ist dies auch ansatzweise in der Out-of-Class-Phase, die doch einen gewichtigen Teil einer Lehrveranstaltung im Inverted Classroom-Format einnimmt, möglich? Die Out-of-Class-Phase ist vergleichbar mit einem asynchronen Setting. Auf der einen Seite die Studierenden, auf der anderen Seite die Dozierenden und dazwischen – sozusagen als Vermittler – das Learning Management System wie zum Beispiel Moodle®, Olat® oder Ilias®. Auch die in der Out-of-Class-Phase eingesetzten Medien selbst, vereinzelte Gestaltungselemente bzw. letztlich auch die Gestaltung des gesamten Kurses im Sinne eines Gesamtkonzeptes übernehmen diese angesprochene Vermittlerrolle. Somit sind die digitalen Tools und Gestaltungselemente mehr als nur Hilfsmittel und tragen entscheidend zur Beziehungsgestaltung und zum Lernfortschritt bei. Sollten auch KI-Systeme zum Einsatz kommen, so sind diese hier ebenfalls gemeint. Es kommt also an dieser Stelle zu einer Verschneidung der drei Fachbereiche Medienpädagogik, eEducation und Ästhetische Praxis. Letzterer hat explizit die sinnliche Wahrnehmung als Forschungsfeld und begegnet uns aktuell häufig unter dem Begriff der Ästhetischen Bildung. Ästhetik hier also nicht im Sinne des Schönen, sondern in der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes aisthētik, das die Wissenschaft vom sinnlich Wahrnehmbaren bedeutet (Bibliographisches Institut, 2021).
Wie können diese Elemente bzw. das Gesamtkonzept des Kurses nun ästhetisch wirksam sein und Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz verkörpern?
Diese leere Folie soll Ihnen die Zeit geben, sich eigene Gedanken zu machen und Ideen zu formulieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie schon in Ihrer eigenen digitalen Lehre Elemente intuitiv umgesetzt, die als eine Verkörperung des Werte-Dreiklangs angesehen werden könnten.
5 Ideensammlung
In diesem Abschnitt wird eine Ideensammlung vorgestellt, um die Frage nach Elementen, die den Carl-Rogers’schen Werte-Dreiklang in der Out-of-Class-Phase verkörpern können, zu beantworten. Wenn möglich, werden auch Hinweise zur Umsetzung gegeben, da „die Versuchung groß ist, die Idee zu verwerfen, wenn man nicht gleich weiß, wie die Idee umgesetzt werden kann.“ (Böhringer, 2014, S. 132). Lassen Sie sich also inspirieren, Ideen zu formulieren, auch wenn aktuell noch nicht ganz klar ist, wie diese umgesetzt werden können.
4.1 Elemente, die Positive Zuwendung verkörpern können
Positive Zuwendung wird verkörpert durch die Sorgfalt in der Zusammenstellung der Inhalte und in der Gestaltung des Kurses. Durch Fragemöglichkeiten bleibt ein Kommunikationsangebot auch in der Out-of-Class-Phase bestehen. Hier ist natürlich wichtig, dass die Fragen zeitnah und umfassend von den Dozierenden beantwortet bzw. in der nächsten In-Class-Phase besprochen werden. Insbesondere Wahl-Möglichkeiten, die in den Kurs eingebettet sind, können als positive Zuwendung gedeutet werden. Ein naheliegendes Beispiel ist, mehrere Texte bereit zu stellen und die Lernenden selbst wählen zu lassen, welchen sie davon bearbeiten. Auch in einer ansprechenden Abwechslung von Inhalten und dem Ansprechen verschiedener Lernkanäle kann positive Zuwendung gesehen werden. Letzteres mag vielen von Ihnen schon als Selbstverständlichkeit in der Gestaltung Ihrer Kurse erscheinen; dennoch wird dieser Aspekt hier nochmals formuliert. Relevant ist sicher das Integrieren von Beiträgen, die die Kursteilnehmer:innen selbst erstellt oder eingereicht haben. Mit einem Bild- oder Videobearbeitungsprogramm können diese Beiträge ganz oder teilweise zum Beispiel zu einer Collage zusammengestellt werden und dann in das entsprechende Learning Management System und für die Kursteilnehmer:innen sichtbar platziert werden. So bringen Sie Abgaben eine positive Zuwendung entgegen. Auch das Geben von regelmäßigem Feedback und das Aufgreifen von Ideen oder Kritikpunkten, die die Lernenden eingebracht haben, können als Elemente angesehen werden, die positive Zuwendung verkörpern. Des Weiteren fallen in diese Kategorie das Ernstnehmen der Kursteilnehmer:innen und ihrer Anliegen, die Kommunikation auf Augenhöhe und die Transparenz und Fairness in der praktischen Umsetzung des Kurses und der damit verbundenen Kommunikation. Hierzu zählt auch, dass der Kurs einen zur Zielgruppe passenden Schwierigkeitsgrad hat: also weder zu schwer noch zu einfach ist. Die lehrende Person kann sich in einer Art Kurator:innenrolle wiederfinden, wobei der Kurs auf die individuellen Bedürfnisse ausrichtet wird.
4.2 Elemente, die Kongruenz verkörpern können
Kongruenz wird verkörpert, indem die Kurse kreativ-authentisch gestaltet sind und die Medien entsprechend platziert und ausgewählt wurden. Dies bedeutet allgemein auch, dass die „Handschrift“ und die persönliche Haltung der Dozierenden nicht verloren gehen, sondern ganz im Gegenteil, bis zu einem gewissen Grad ganz deutlich für die Lernenden zu spüren sind. Dabei kann der Begriff der „Handschrift“ auch im wahrsten Sinne des Wortes verstanden werden, indem diese tatsächlich im Kurs auftaucht. Die in diesem Beitrag verwendeten Abbildungen sind ein Beispiel dafür. Auch die Farbgebung im Kurs und die Wahl der Inhalte an sich können Kongruenz widerspiegeln. Kongruenz kann des Weiteren durch eingesprochene Audios oder aufgezeichnete Videos vermittelt werden. Beides kann verwendet werden, um Feedback an die Lernenden auch in der Out-of-Class-Phase zu geben. Dieses Vorgehen ist auch (oder im Besonderen) in einem asynchronen Setting möglich. Persönliche (Lebens-) Erfahrung, eigene Gefühle und Haltungen der Dozierenden sollen und dürfen in die Medien- und Kursgestaltung bis zu einem angemessenen Grad eingebracht werden. Das Offenlegen der eigenen Lernhaltung und des persönlichen Rollenverständnisses ist hier ein sehr konstruktiver und vor allem klärender Schritt. Die lehrende Person kann sich indirekt in einer Art Vorbildrolle wiederfinden, wobei sie sich selbst als auch lernende Person im Sinne des Lifelong Learning zu erkennen gibt.
4.3 Elemente, die Empathie verkörpern können
Empathie in der Out-of-Class-Phase scheint – auf Grundlage der Erfahrungen der Autorin – mit den größten Herausforderungen in der Umsetzung verbunden zu sein. Eine Lehrhaltung explizit mit Empathie zieht auch ein zur Empathie als Grundhaltung verpflichtet Sein nach sich. Was ist damit gemeint? Empathie kann nicht im Gießkannenprinzip verteilt und ohne Stetigkeit eingesetzt werden. Empathie ist ein Grundentscheid in der persönlichen Lehrhaltung, die auch eine entsprechende (und berechtigte) Erwartungshaltung beim Gegenüber generiert. Empathie nimmt entsprechend Raum ein, braucht Zeit und vor allem auch das damit verbundene Bewusstsein. Ein ständig wechselndes Maß an Empathie würde – so die These der Autorin – sehr kontraproduktiv sein und die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden belasten, da dann auch die Aspekte der Fairness und der Gerechtigkeit zum Tragen kommen. Empathie weckt Vertrauen, Vertrauen weckt Offenheit, Offenheit weckt auch Verletzlichkeit. Alles Faktoren einer intakten Beziehung und ebenfalls relevant für persönliche Entwicklung. Genau deshalb kann es aber hier auch zum Bruch von Beziehung aufgrund von Verletzungen kommen. Auslöser für Verletzungen gibt es viele, beispielhaft seien Stress, Zeitmangel und Unachtsamkeiten genannt. Nach Verletzungen braucht es die persönliche Reflexion und auch das Sich Entschuldigen. Dinge, für die im Lehralltag oft weder das Bewusstsein noch die Zeit vorhanden sind. Und dies auf beiden Seiten, sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden. Der Begriff der Empathie ist oftmals schnell gesagt, jedoch haben seine Implikationen ein Ausmaß, das in aller Regel unterschätzt wird. Nach diesem Exkurs jedoch zurück zum eigentlichen Thema. Elemente, die in der Out-of-Class-Phase Empathie verkörpern können, sind: Eine positive Fehlerkultur, damit verbunden die Aspekte der Selbstbewertung statt Fremdbewertung und die Möglichkeiten des Peer-Review. Das Anpassen des Lerntempos und eine gewisse Flexibilität in der Stoffmenge sind weitere Ideen. Auch das Bereitstellen von Hilfestellungen gezielt für persönliche Anliegen oder Bedürfnisse kann Empathie befördern. Wie schon angeklungen, kann auch einmal ein Satz, der beginnt mit „Ich entschuldige mich für ...“ sehr passend sein, wenn empathisches Verhalten das Ziel ist. Subtil auf einen schon vorangegangenen Austausch zu reagieren und diesen miteinfließen zu lassen, könnte eine weitere Idee sein. Dennoch: Im Bereich der Empathie bleiben zum aktuellen Zeitpunkt noch die meisten Fragezeichen stehen.
6 Ausblick
„Wie so vieles an seinen Werken. Einfach und logisch, und doch eine Herausforderung.“ Gruber, 2008, S. 177
Die These sei hier formuliert, dass jede/r Dozierende/r eine eigene Rogers‘sche Toolbox für die Out-of-Class-Phase für sich zusammenstellen wird, wenn es um die Umsetzung von positiver Zuwendung, Kongruenz und Empathie geht. Die drei Aspekte stehen im Wechselspiel miteinander, haben Überlappungen und bilden Schnittmengen. Widmen Sie dieser Thematik etwas Zeit und machen Sie ihr ganz persönliches Brainstorming diesbezüglich. Eine Sensibilisierung darauf lohnt sich und wird im Sinne von Carl R. Rogers und der mit ihm verbundenen Lerntheorie nicht nur zur Verbesserung Ihrer Beziehung zu den Lernenden, sondern auch zur Verbesserung der Lernqualität insgesamt beitragen. Ausgangspunkt für diese Entwicklung im Hinblick auf eine Ästhetische Praxis im Rahmen eines Inverted Classroom ist auch das Aufweichen bisher gewohnter Rollen und das Zulassen einer sogenannten gleichen Augenhöhe zwischen den Lehrenden und den Lernenden. In diesen Entwicklungen sind die Ausführungen von Carl R. Rogers auch heute noch eine sehr gute Quelle, auf die sich eine Rückbesinnung lohnt. Carl R. Rogers hat für sich selbst an einem Punkt seines Lebens den folgenden Satz formuliert: „I realize that I have lost interest in being a teacher.“ (Rogers, 1961, S. 276). So haben wir heute jedoch die Möglichkeit – und dies auch durch seine Arbeit und seine Schriften – die Quellen einer solchen Frustration sowohl auf der Seite der Lehrenden als auch auf Seite der Lernenden zu überkommen. Denn beim Lernen geht es um viel mehr als nur eine Momentaufnahme. „For it is not upon the physical sciences that the future will depend. It is upon us who are trying to understand and deal with the interactions between human beings - who are trying to create helping relationships“ (Rogers, 1961, S.57).
Gerne möchte ich die Umsetzung von positiver Zuwendung, Kongruenz und Empathie und die damit verbundene Thematik der Ästhetischen Praxis in der Out-of-Class-Phase eines Inverted Classroom hier zur Diskussion stellen. Nehmen Sie diesen Beitrag bitte als Einladung zum Austausch auf und melden Sie sich gerne bei der Autorin.





























