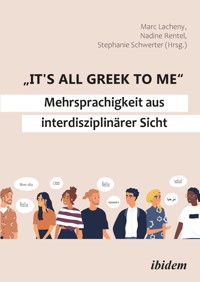
"It's all Greek to me": Mehrsprachigkeit aus interdisziplinärer Sicht E-Book
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Sprache: Deutsch
In einer zunehmend globalisierten Welt spielt Mehrsprachigkeit eine immer bedeutendere Rolle. Weltweit verwendet über die Hälfte der Menschen täglich mehr als eine Sprache. Diese Mehrsprachigkeit, die sämtliche Kommunikationsbereiche prägen kann, bringt Chancen, aber zugleich eine Reihe von Fragen und Herausforderungen mit sich – insbesondere, wenn es um direkte sprachliche Interaktion und das Gelingen von Kommunikation geht. Anhand von sich gegenseitig ergänzenden Perspektiven wird im vorliegenden, interdisziplinär angelegten Band die facettenreiche Thematik der Mehrsprachigkeit aus dem Blickwinkel der Politik, der Bildungswissenschaften und der Literatur beleuchtet. Die hier zusammengestellten Beiträge legen einen methodologischen Grundstein für weitere Reflexionen und weiterführende Forschungen zu den angesprochenen Themenbereichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ibidem Verlag, Stuttgart
Die Herausgeber*innen dieses Bandes danken der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) und dem Forschungszentrum Descripto der Université Polytechnique Hauts-de-France sehr herzlich für ihre großzügige Unterstützung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Mehrsprachigkeit und Sprachpolitik
„Brexit means Brexit?“ Zur Auswirkung des Brexits auf Mehrsprachigkeit und kulturelle Identitäten im Vereinigten Königreich und Nordirland
Gelebte Mehrsprachigkeit? Der Fall der països catalans
„The guide spoke poor English“ und „Rien n’est écrit en français sauf le prix“ Mehrsprachigkeit in Deutschland aus der Perspektive internationaler Touristen
Mehrsprachigkeit in Speisekarten Mit und ohne Übersetzung
Mehrsprachigkeit und Bildung
Förderung von Mehrsprachigkeit durch Bilingualen Unterricht?
Brauchen wir künftig noch Dolmetscher? Dolmetschen und Dolmetscherausbildung in Zeiten von Mehrsprachigkeit und Digitalisierung
Mehrsprachigkeit in der Verwaltung im Spannungsfeld zwischen Gesetzes- und Kundenorientierung am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit
Reflexionen über kulturelle Zugehörigkeit anhand von studentischen Interviews. Ein Beitrag zur deutsch-französischen Mehrsprachigkeitsdidaktik an der Hochschule
„You haven’t crescendo and diminuendo in this bar“ Mehrsprachigkeit im Kammermusikunterricht
Mehrsprachigkeit und Literatur
Charon versus Hieronymus. Überlegungen zum inflationären Gebrauch einer Übersetzungsmetapher
Von 99 francs zu Neununddreißigneunzig Zur Übersetzung von Frédéric Beigbeders Gesellschaftssatire
„It is so delightful für jemand, der fühlt und denkt wie ich“ Mehrsprachigkeit in den England-Reiseberichten Heinrich Heines und Hermann Fürst von Pückler-Muskaus
Transkulturalität und Transsexualität. Der ‚Fall‘ Jayrôme C. Robinet
Sprache und Identität in Ett nytt land utanför mitt fönster von Theodor Kallifatides
„Ich begab mich ins Deutsche, als würde der Kampf gegen die Stummheit weiter gehen“ Übersetzungsprozesse in Vielleicht Esther von Katja Petrowskaja
„Je tricote depuis l’enfance une langue constituée de deux fils“ Darstellung und Reflexion von Mehrsprachigkeit in französischen Comics
Autoren
Autorinnen und Autoren
Einleitung
Marc Lacheny, Nadine Rentel, Stephanie Schwerter
„In what language am I, suis-je, bin ich [...]?“
Steiner (125)
In einer zunehmend globalisierten Welt spielt das Thema der Mehrsprachigkeit eine immer bedeutendere Rolle. Weltweit verwendet über die Hälfte der Bevölkerung täglich mehr als eine Sprache (Grosjean 1982). Die Sprachwissenschaft nimmt in diesem Zusammenhang eine Einteilung der Mehrsprachigkeit in individuelle, gesellschaftliche, territoriale und institutionelle Mehrsprachigkeit vor. Während es im ersten Fall um das Beherrschen mehrerer Sprachen durch eine Person geht, fokussiert die Dimension der institutionellen Mehrsprachigkeit auf die Tatsache, dass öffentliche Organisationen und die Verwaltung eines Staates mehrsprachig ausgerichtet sind. Unter territorialer Mehrsprachigkeit wiederum wird das Phänomen so verstanden, dass auf einem bestimmten Territorium mehrere Sprachen gleichzeitig vorhanden sein können. Mit gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit ist dagegen gemeint, dass sich ein gegenseitiges Durchdringen von Sprachgemeinschaften nachweisen lässt. Dies ist häufig der Fall in Grenzgebieten bzw. in der Nähe von Sprachgrenzen, wo Individuen aufgrund des Überlappens von Sprachen im Alltag mehr als eine Sprache verwenden.
Eine Vielzahl von Menschen leben in Ländern, in denen mehrere Sprachen im öffentlichen Leben verwendet werden, so dass die Mehrsprachigkeit bereits in ihrem kulturellen Selbstverständnis verankert ist. Aber auch ohne ein genuin mehrsprachiges Umfeld können Individuen mehrsprachig sein. Diese individuelle Mehrsprachigkeit ist durch unterschiedliche Faktoren bedingt. Einen zentralen Stellenwert nimmt in diesem Kontext die Frage ein, wie individuelle Mehrsprachigkeit definiert werden kann. In Anlehnung an Grosjean (10) wird Mehrsprachigkeit als der regelmäßige Gebrauch mehrerer Sprachen oder Dialekte im Alltag verstanden. Mehrsprachige Individuen sind demnach Sprecherinnen und Sprecher, die für das kommunikative Bewältigen ihrer Belange mehr als zwei Sprachen oder Dialekte verwenden. Oksaar definiert den Begriff ähnlich mit folgenden Worten:
Mehrsprachigkeit ist die Fähigkeit eines Individuums, hier und jetzt zwei oder mehr Sprachen als Kommunikationsmittel zu verwenden und ohne weiteres von der einen Sprache in die andere umzuschalten, wenn die Situation es erfordert. (31)
Das Umschalten zwischen Sprachen und sprachlichen Varietäten, in der Forschungsliteratur auch als Code-Switching bezeichnet (u. a. Bullock & Toribio, MacSwan; Yow et al.), steht im Zentrum dieser Definition. In einigen Forschungsansätzen wird weitergehend differenziert zwischen der Zweisprachigkeit bzw. dem Bilinguismus, der das Beherrschen von exakt zwei Sprachen umfasst, und der Mehrsprachigkeit, die auf Kompetenzen in drei oder mehr Sprachen oder Dialekten abhebt. Im vorliegenden Sammelband steht diese Differenzierung nicht im Fokus; bereits der aktive Gebrauch von mehr als einer Sprache wird als Mehrsprachigkeit klassifiziert.
Ausschlaggebend bei all diesen Überlegungen ist die Tatsache, dass die Sprecherinnen und Sprecher ihre kommunikativen Ziele erreichen – die vollständige grammatikalische und lexikalische Korrektheit der Äußerungen ist dabei jedoch sekundär. Wichtig ist somit die Abgrenzung zum Konzept der „Gleichsprachigkeit“ (Oksaar 31). Obwohl im Alltag mit dem Begriff der Zwei- oder Mehrsprachigkeit häufig Individuen bezeichnet werden, die von Geburt bzw. frühester Kindheit an zwei oder mehr Sprachen erwerben und diese auf demselben Kompetenzniveau beherrschen, lässt sich dies in der Realität nicht in der Mehrheit der Fälle beobachten. Nichtsdestotrotz wird auch im Rahmen restriktiverer Forschungsansätze zur Mehrsprachigkeit (vgl. etwa Hagège) die Einstellung vertreten, dass Individuen dasselbe Kompetenzniveau in allen vier sprachlichen Fertigkeiten nachweisen müssen, um als zwei- bzw. mehrsprachig bezeichnet zu werden. Nur ein geringer Anteil mehrsprachiger Menschen verfügt jedoch über ein gleichhohes Niveau sowohl in der Sprachproduktion als auch im Sprachverständnis in den jeweiligen Sprachen und in allen erdenklichen Verwendungskontexten. Unseres Erachtens setzt ein offener gedachtes Konzept von „Mehrsprachigkeit“dieses Können auch nicht voraus (Stitzinger 33). Eine große Zahl von Menschen erwirbt eine Zweit- oder Drittsprache erst im späteren Verlauf des Lebens und häufig im institutionellen Kontext, etwa an der Schule oder an der Universität. Damit verbunden sind zwangsläufig Unterschiede in Bezug auf die sprachlichen Teilkompetenzen, die jedoch in den meisten Fällen dem Erreichen kommunikativer Ziele nicht im Wege stehen. Die Globalisierungsprozesse der letzten Jahre haben erheblich dazu beigetragen, dass Menschen für das Bewältigen kommunikativer Aufgaben im beruflichen Kontext Fremdsprachen erwerben oder sich durch fremdsprachliche Kompetenzen bessere Bildungs-, Berufs- und damit einhergehend bessere Verdienstmöglichkeiten erhoffen.
Ein weiterer Auslöser für individuelle Mehrsprachigkeit sind Migrationsprozesse. Um sich erfolgreich in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren, sind Migrantinnen und Migranten gezwungen, die Sprache ihres Gastlands zu erlernen, wodurch sie automatisch zu mehrsprachigen Individuen werden. Im Rahmen der Integration dieses Personenkreises spielt der Bereich der Bildung eine zentrale Rolle. Häufig wird dabei die Frage aufgeworfen, bis zu welchem Grad die Mehrsprachigkeit der Lernenden im Bildungssektor berücksichtigt bzw. gewinnbringend in den Unterricht integriert wird, oder ob die unterschiedlichen Herkunftssprachen als defizitär angesehen werden. Es stellt sich dabei häufig die Frage, ob in nationalen Bildungssystemen spezifische didaktische und translatorische Ansätze entwickelt werden, die den Kindern von Migrantinnen und Migranten dabei helfen, die Sprache ihres Gastlands zu erwerben. Weiterhin ist die Erforschung der unterschiedlichen Ebenen der Interaktion zwischen den Sprachen der Aufnahmegesellschaft und der von Migrantinnen und Migranten gesprochenen Sprachen von Relevanz.
In Literatur und Kultur blickt Mehrsprachigkeit auf eine lange Geschichte zurück. Viele der ältesten auf Latein schreibenden Meister waren nicht von römischer Geburt. Während Seneca, Quintillion und Lucan aus Spanien stammten, floss in Virgils und Catullus’ Adern keltisches Blut. Sie alle schrieben nicht in ihrer Muttersprache. Römische Autoren wie Cicero und Caesar waren wiederum bekannt dafür, sowohl auf Lateinisch als auch auf Griechisch zu schreiben (Mackey 42). Im Mittelalter waren viele Autorinnen und Autoren sowie die Leserinnen und Leser polyglott, eine Tendenz, die bis Ende des 17. Jahrhunderts anhielt (43). Auch wenn die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller in klassischem Latein schrieben, ließen sie regelmäßig ganze Strophen und Verse in ihrer Muttersprache in ihre Texte einfließen (Foster 20; Steiner 197-198). Als es im 19. Jahrhundert jedoch zur Bildung von Nationalstaaten und damit zum nationalstaatlichen Denken kam, wurde für zahlreiche Autorinnen und Autoren die Wahl der Sprache zu einem politischen Akt mit der Konsequenz, dass sich viele von ihnen für eine Nationalsprache entschieden und so der Mehrsprachigkeit den Rücken kehrten (Mackey 44). Das Schreiben in der Staatssprache bedeutete den Aufbau der Nation zu unterstützen, während die Integration von mehreren Sprachen in einen Text ausdrückte, dass sich die Schriftstellerinnen und Schriftsteller dezidiert gegen die Nation stellten (Grutman, „Écriture bilingue et loyauté linguistique“).
Erst in der Epoche des Postkolonialismus kam es zur Wiederaufwertung des mehrsprachigen Schreibens (Meylaerts, „Multilingualism“ 538). Mehrsprachigkeit wurde in diesem Zusammenhang als Mittel angesehen, um sich gegen die von den Kolonisatoren auferlegte Sprache aufzulehnen und letztere subversiv durch die Einfügung von Substraten zu verändern (Denti 524). Meylaerts geht sogar auf Grund des wachsenden Interesses an mehrsprachiger Literatur so weit, die letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts zum „tournant multilingue“1 zu erklären („Heterolingualism“ 2).
Heutzutage ist Mehrsprachigkeit insbesondere im Kontext der gegenwärtigen Migrantenliteratur ein viel diskutiertes Thema. Migrationserfahrungen werden durch die häufig autobiographisch geprägten Erzählungen der Autorinnen und Autoren für die Lesenden der Zielkultur unmittelbar erfahrbar gemacht, wobei sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller oft einer hybriden Art des Schreibens bedienen, die stark von ihrer Muttersprache beeinflusst ist. Die Wahl der Sprache, die Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund für ihre Romane oder Kurzgeschichten treffen, gibt in vielen Fällen entscheidende Hinweise über ihre Identifizierung mit der alten bzw. neuen Kultur.
Im literarischen Kontext unterscheidet András Horn zwischen drei Arten von Mehrsprachigkeit: die Koexistenz verschiedensprachiger Werke innerhalb einer Nationalliteratur, das Nebeneinander von in unterschiedlichen Sprachen verfassten Texten im Oeuvre einer Autorin bzw. eines Autors, und letztendlich die Präsenz mehrerer Sprachen innerhalb ein- und desselben Schriftstücks (225). Des Weiteren entwirft Horn eine „Typologie der literarischen Sprachmischung“ (226), mit Hilfe derer er das Funktionieren von Mehrsprachigkeit zu deuten versucht. Wird Fremdsprachliches in ein literarisches Werk eingeflochten, kann es laut Horn als Zitat fungieren, einen komischen Effekt erzeugen, zur sprachlichen Vielfalt beitragen, sprachspezifische Bedeutungen vermitteln, Träger auktorialer Aussagen sein, zur Charakterisierung der Figuren beitragen, eine fremdländische Realität darstellen, sowie, rein ästhetisch gesehen, zum Träger „lautlicher Schönheit“ werden (226).
In einem erweiterten Kontext gesehen kann ein Text nicht nur in dem Fall als mehrsprachig gesehen werden, wenn es zur Mischung verschiedener Sprachen kommt, sondern auch dann, wenn unterschiedliche Dialekte, Soziolekte bzw. Idiolekte miteinander in Dialog treten, oder im Extremfall auch gänzlich erfundene Sprachen (Grutman, Des langues qui résonnent, 158). Nach diesen Kriterien kann eine Vielzahl von den unterschiedlichsten Genres angehörenden Textarten als mehrsprachig aufgefasst werden (Stratford 460).
Ganz im Sinne der Feststellung It’s all Greek to me, mit der Sprecherinnen und Sprecher hervorheben, dass sie in einer bestimmten Kommunikationssituation nichts oder nur erschwert verstehen, beleuchten die in drei Themenbereiche gegliederten Beiträge dieses Sammelbands die Hindernisse und Risiken, die mit Mehrsprachigkeit und kultureller Pluralität in diversen Settings einhergehen können. Die im Band vereinten Studien zeigen aber zugleich das Potenzial von Strategien zum Überwinden des Nichts-Verstehens auf, die sich in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen verorten lassen.
Der erste Teil des interdisziplinär angelegten Bandes It’s all Greek to me setzt sich mit dem Thema „Mehrsprachigkeit und Sprachpolitik“ auseinander. Die sprachenpolitische Ausrichtung von Ländern oder Institutionen kann das gegenseitige Sich-Verstehen behindern, indem dem Ausbilden einer mehrsprachigen Kompetenz von Personen oder der Ausrichtung der Sprachenwahl an den Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen ein nur geringer Stellenwert zugewiesen wird. Dies weist Angela Vaupel eindrucksvoll in ihrem Beitrag „Brexit means Brexit“ nach, in dem sie eine höchst aktuelle Frage behandelt, nämlich die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU auf Mehrsprachigkeit und kulturelle Identitäten. Ein Paradebeispiel für „gelebte Mehrsprachigkeit“ hingegen stellt im Anschluss der Fall des von Benjamin Meisnitzer und Bénédict Wocker analysierten katalanischen Sprachraums dar. Tilman Schröder wiederum untersucht Mehrsprachigkeit in Deutschland aus der Perspektive internationaler Touristinnen und Touristen, eine Thematik, die in der Folge von Eva Lavric und Monika Messner in ihrem Beitrag „Mehrsprachigkeit in Speisekarten“ um eine kulinarische Dimension erweitert wird.
Der zweite Teil des Buches widmet sich dem Themenbereich „Mehrsprachigkeit und Bildung“. Hier wird zum einen die grundlegende Frage aufgeworfen, welche Rolle dem Ausbilden und Festigen einer mehrsprachigen Kompetenz im Kontext von Bildungsplänen und didaktischen Szenarien zugemessen wird und welche fremdsprachendidaktischen Ansätze geeignet erscheinen, um das Risiko des Nicht-Verstehens zu minimieren. Auch die Berechtigung des Berufsbilds der Dolmetschenden wird angesichts des Postulats einer idealerweise mehrsprachigen Gesellschaft kritisch hinterfragt. Während Benjamin Meisnitzer und Fabian Neumeister untersuchen, ob Mehrsprachigkeit durch Bilingualen Unterricht gefördert wird, debattieren Martina Emsel, Elke Krüger und Tinka Reichmann darüber, ob in Zeiten von Mehrsprachigkeit und Digitalisierung auch in der Zukunft noch ein Bedarf an Dolmetscherinnen und Dolmetschern bestehen wird. Gundula Gwenn Hiller beleuchtet das Thema der Mehrsprachigkeit im Kontext der deutschen Verwaltung am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit. Nadine Rentel bietet im Anschluss anhand von Studierendeninterviews einen Beitrag zur deutsch-französischen Mehrsprachigkeitsdidaktik an der Hochschule. Im Rahmen der Musikpädagogik gibt Monika Messner einen ungewohnten Einblick in den Einsatz von Mehrsprachigkeitsstrategien im Kammermusikunterricht
Der dritte und zugleich letzte Teil des Bandes befasst sich mit der Verbindung zwischen Mehrsprachigkeit und Literatur. Die Lektüre literarischer Werke, die entweder (und wenn auch nur ansatzweise) mehrsprachig sind oder die Frage der Mehrsprachigkeit unter unterschiedlichen Blickwinkeln reflektieren, kann dazu führen, dass die Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Sprachen und Kulturen auf Seiten der Rezipientinnen und Rezipienten gefördert werden. Oftmals mag es auch der Fall sein, dass erst durch die Konfrontation mit anderssprachlichen und -kulturellen Universen in der Literatur ein Bewusstsein für den Reichtum von Mehrsprachigkeit geschaffen wird. Unter dem Titel „Charon versus Hieronymus“ stellt Béatrice Costa philosophische Überlegungen zum inflationären Gebrauch der Fährmann-Figur an, die in der Literatur häufig als Metapher für die Tätigkeit der Übersetzerinnen und Übersetzern zu finden ist. Stephanie Schwerter analysiert die Rolle der Mehrsprachigkeit anhand der Übertragung von Frédéric Beigbeders Gesellschaftssatire 99 francs ins Deutsche, Englische, Spanische und Russische. Leslie Brückner dagegen untersucht das Zusammenspiel von mehreren Sprachen in den England-Reiseberichten Heinrich Heines und Hermann Fürst von Pückler-Muskaus. Das Navigieren zwischen Sprachen und Kulturen steht ebenfalls im Zentrum von Carolin Fischers Beitrag, in dem die verschiedenen Dimensionen von kulturellen und sprachlichen Grenzüberschreitungen um den Aspekt der Transsexualität erweitert werden.
Die nachfolgenden beiden Kapitel widmen sich der Stellung von Mehrsprachigkeit innerhalb der Migrantenliteratur. Thomas Johnen liefert eine präzise Analyse von Sprache und Identität in Ett nytt land utanför mitt fönster von Theodor Kallifatides, und Katja Grupp untersucht diverse Übersetzungsprozesse in Vielleicht Esther von Katja Petrowskaja. Der Band endet mit Betrachtungen zur Mehrsprachigkeit im Hinblick auf eine weitere Textsorte: Mit einer Reihe von Beispielen illustriert Beate Kern verschiedene Arten von Sprachwechsel in französischen Comics.
Anhand der sich gegenseitig ergänzenden Perspektiven wird im vorliegenden interdisziplinären Band die facettenreiche Thematik der Mehrsprachigkeit aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert, wobei die Thematik jedoch nicht erschöpfend behandelt wird. Es wird beabsichtigt, einen methodologischen Grundstein für weitere Reflexionen zu legen und so weiterführende Forschungen zu den angesprochenen Themenbereichen anzuregen. Ein potentieller Forschungsansatz wäre beispielsweise die Untersuchung der Verbindung von Mehrsprachigkeit und Übersetzung in Bezug auf Migrantenliteratur. Hier entsteht u.a. die Frage, auf welche Weise von Migrantinnen und Migranten geschriebene Werke als kulturelle Produkte Eingang in unterschiedliche Kulturkreise finden. Dies ist jedoch nur eines der vielen in der Zukunft zu vertiefenden Forschungsfelder, welche sich im Zusammenhang mit dem Thema der Mehrsprachigkeit ergeben.
Bibliographie
Aronin, Larissa; Hufeisen, Britta. The Exploration of Multilingualism: Development of Research on L3, Multilingualism and Multiple Language Acquisition. John Benjamins, 2009.
Bullock, Barbara, Toribio, Almeida. The Cambridge Handbook of Linguistic Codeswitching. Cambridge University Press, 2012.
Denti, Chiara. „L’hétérolinguisme ou penser autrement la traduction.“ Meta. Bd. 62, Nr. 3, 2017, S. 521-537.
Foster, Leonard. The Poet’s Tongues: Multilingualism in Literature. Cambridge University Press, 1970.
Grosjean François, Parler plusieurs langues : le monde des bilingues. Albin Michel, 2015.
Grosjean, François. Studying Bilinguals. Oxford University Press, 2008.
Grosjean, François. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Harvard University Press, 1982.
Grutman, Rainier. „Écriture bilingue et loyauté linguistique.“ Francophonie d’Amérique. Nr. 10, 2000, S. 137-147.
Grutman, Rainier. Des langues qui résonnent l’hétérolinguisme au XIXe siècle québécois. Fides, 1997.
Horn, András. „Ästhetische Funktionen der Sprachmischung in der Literatur.“ Arcadia. Bd. 16, Nr. 3, 1981, S. 225-241.
Mackey, William. „Literary Diglossia: Biculturalism and Cosmopolitanism in Literature.“ Visible Language. Bd. 21, Nr. 1-2, 1993, S. 40-66.
MacSwan, Jeff. Grammatical Theory and Bilingual Codeswitching. MIT Press, 2014.
Meylaerts, Reine. „Multilingualism as a Challenge for Translation Stu-dies.“ The Routledge Handbook of Translation Studies, Carmen Millán; Francesca Bartrina (Hrsg.), Routledge, 2013, S. 537-551.
Meylaerts, Reine. „Heterolingualism in/and Translation: How Legitimate are the Other and his/her Language? An Introduction.“ Target. Bd. 18, Nr. 1, 2006, S. 1-15.
Oksaar, Els. Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung. Kohlhammer, 2003.
Steiner, Georg. After Babel – Aspects of Language and Translation. Oxford University Press, 1992.
Stitzinger, Ulrich. Vom Potenzial zur Ressource. Pädagogische Fachkräfte im Kontext sprachlich-kultureller Diversität am Beispiel der Sprachbeobachtung. SpringerVS Research, 2019.
Stratford, Madeleine. „Au tour de Babel! Les défis multiples du multilinguisme.“ Meta. Bd. 53, Nr. 3, 2008, S. 457-470.
Yow, W. Qin, Tan, Jessica S. H., Flynn, Suzanne „Code-switching as a Marker of Linguistic Competence in Bilingual Children. Bilingualism: Language and Cognition.“ FirstView, 2017, S. 1-16. doi: 10.1017/ S1366728917000335.
1 „Wende der Mehrsprachigkeit“.
MEHRSPRACHIGKEIT UND SPRACHPOLITIK
„Brexit means Brexit?“Zur Auswirkung des Brexits auf Mehrsprachigkeit und kulturelle Identitäten im Vereinigten Königreich und Nordirland
Angela Vaupel
Als der britischen Öffentlichkeit am 23. Juni 2016 die Möglichkeit geboten wurde, über den Austritt aus oder den Verbleib in der Europäischen Union (EU) abzustimmen, löste das Referendum massive Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Landes, der politischen Parteien, unter Freunden und sogar in Familien aus. Die Auswirkungen der anschließenden knappen Mehrheitsentscheidung, die EU zu verlassen, sind weitreichend und anhaltend. Sie betreffen alles, vom schwankenden Kurswert des britischen Pfunds über Immobilienpreise bis hin zu Lebensmittelpreisen und Lieferzeiten in britischen Supermärkten. Während solcherlei Entwicklungen zu erwarten waren und nach dem Ende der Übergangsperiode bereits spürbar sind, gab es auch einige überraschende, immaterielle Veränderungen als Folge der Brexit-Abstimmung. Eine davon ist der Einfluss, den die Entscheidung auf die Einstellung des Landes zur Mehrsprachigkeit und dem Status Moderner (Fremd-) Sprachen1 im Bildungsbereich hat.
1. Das verstärkte Ansteigen linguaphober Tendenzen innerhalb der britischen Bevölkerung seit dem Brexit-Referendum
Das Ergebnis der Volksabstimmung förderte eine Welle öffentlicher Feindseligkeit gegenüber anderen Sprachen als Englisch, welche besonders in England zu beobachten ist. Sollte diese Reaktion sich durchsetzen, würde es die globalen Ambitionen Großbritanniens gerade dann erschweren, wenn der Bedarf an Fremdsprachen am größten sein könnte. Laut Kelly (vii) gibt es aber auch Hinweise darauf, dass die Aussicht auf den Brexit eine größere Anzahl von Menschen im Vereinigten Königreich dazu veranlasst habe, andere Sprachen zu lernen, sei es durch formellen Sprachunterricht oder durch informelle Wege (z.B. E-Learning). Der Status Quo sieht allerdings nach wie vor so aus, dass viele Briten dem Erwerb anderer Sprachen ablehnend gegenüberstehen und die internationale Rolle des Englischen für sie als Englisch-Muttersprachler zwar Vorteile mit sich bringt, aber auch eine gewisse Abhängigkeit vom guten Willen anderer. Es gibt sicherlich keinen ernsthaften Zweifel daran, dass gute Englischkenntnisse im 21. Jahrhundert eine wichtige Grundvoraussetzung für Erfolge in der internationalen Wirtschaft, Diplomatie, wissenschaftlichen Forschung und kulturellen Zusammenarbeit sind. Doch nur Englisch sprechen zu können wird inzwischen selbst von britischen Arbeitgebern als Nachteil angesehen (UKCES).
Drei Viertel der 65 Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs (d.h. ca. 49 Millionen Menschen) sind einsprachig und sprechen ausschließlich Englisch (Coussins; Harding Esch 1-11). Viele Briten glauben, es bestünde für sie keine Notwendigkeit, eine Fremdsprache zu erlernen, weil Englisch auf der ganzen Welt weit verbreitet ist. Doch obwohl Englisch global als lingua franca gilt, mit geschätzten 1,75 Milliarden Menschen, die Englisch auf alltagstauglichem Niveau sprechen, beherrschen nur ca. 6% der Weltbevölkerung (ca. 340 Millionen Menschen) Englisch als Muttersprache, und 75% der Weltbevölkerung sprechen überhaupt kein Englisch (1-11). Außerdem scheint sich die Stellung der englischen Sprache als bevorzugte Zweitsprache der Welt zu verändern: Wie eine aktuelle Sprachstudie (Kelly) nach der Brexit-Kampagne zeigt, gibt es inzwischen mehr Weblogs auf Japanisch als auf Englisch, während Arabisch die am schnellsten wachsende Sprache in den sozialen Medien ist. Der Anteil der auf Englisch geschriebenen Webinhalte nimmt ab, während die Anzahl der Webinhalte auf Mandarin zunimmt (Kelly). Die weiträumige Verwendung der englischen Sprache hat(te) außerdem Auswirkungen auf viele andere Sprachen, was teilweise zu Sprachwechsel2 und zum Vorwurf des linguistischen Imperialismus sowie zu Gegenmaßnahmen führt(e), wie zur Einführung von Quoten für muttersprachliche Kulturprodukte in staatlichen Medien (z.B. in Frankreich). Die englische Sprache selbst ist inzwischen auch anfälliger für Sprachverschiebungen geworden, d.h. sie weicht immer mehr vom Standardgebrauch ab, da multiple regionale Varianten die Norm des Standardenglischen beeinflussen.
Fakt ist außerdem, dass das Vereinigte Königreich sehr wohl eine mehrsprachige Gesellschaft ist und es immer schon war: Indigene Sprachen wie Cornisch, Schottisch-Gälisch und Walisisch haben im Laufe der Jahrhunderte die Sprachlandschaft der Regionen und das Selbstverständnis der Menschen als Briten geprägt. Obwohl Cornisch ums Überleben kämpft, erfahren die gälischen Sprachen heute wieder stärkere Unterstützung. Der walisische Sprachunterricht durchläuft z.B. derzeit eine beispiellose Phase regionalstaatlicher Investitionen und wird als integraler Bestandteil eines neuen, walisischen Schulcurriculums positioniert, das kritische und kulturell-informierte walisische Weltbürger erziehen will (Kelly 13-24).
In jüngster Zeit wurde die britische Sprachlandschaft durch Sprachen bereichert, wie z.B. Polnisch und Arabisch, die mit den veränderten Migrationsmustern in Großbritannien und Nordirland verbunden sind. Laut der letzten Volkszählung von 2011 leben über vier Millionen Menschen im Vereinigten Königreich, die Englisch nicht als Mutter- oder Erstsprache sprechen. Polnisch ist in England und Wales nach Englisch die am weitesten verbreitete Sprache: von den über 56,1 Millionen Einwohnern Englands und Wales sprechen etwa 546.000 Polnisch, was in etwa der Anzahl von Walisisch-Sprechern entspricht. Nach Englisch, Walisisch und Polnisch sind indische bzw. pakistanische Sprachen wie Urdu, Bengali, Gujarati und Punjabi prävalent, die zusammen die Muttersprache von etwa einer Million Menschen im Vereinigten Königreich ausmachen. Fast 140.000 Einwohner gaben bei der letzten Volkszählung an, überhaupt keine Englischkenntnisse zu besitzen (LinguaLinx).
Angesehene Sprachwissenschaftler (z.B. Gorrara und Tinsley) warnen seit langem davor, und besonders seit dem Brexit-Referendum, dass die Briten nach dem Volksentscheid zunehmend linguaphob werden, als Folge von Isolationismus und fremdenfeindlichen Tendenzen eines erstarkten Nationalismus. Diese Tendenz beruht häufig auf diffusen Bedrohungsgefühlen, wird vom politischen Rechtspopulismus innerhalb der britischen Parteienlandschaft bedient und wurde im Vorfeld des Referendums von den rechten Medien vorsätzlich und massiv geschürt.
“That English is somehow the norm is a complete misapprehension of the facts, but this notion that everyone is speaking English is persistent and believed by many in the UK,” said Gorrara, warning that economic opportunities and bridge-building with the rest of the world was at risk after Brexit if Britons did not become less “linguaphobic” and learn more languages. (Cain 2018)3
Laut einer Studie der Cardiff Business School aus dem Jahr 2014 kosten mangelnde Sprachkenntnisse den britischen Staat 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, d.h., ein Verlust von jährlich 50 Milliarden britischen Pfund (Cannadine 2019). Ein Bericht des BritishCouncil von 2017 („Languages for the Future“) stellt weiter fest, die fünf wichtigsten Sprachen, die das Vereinigte Königreich nach dem Brexit zum Erhalt und Ausbau von Wohlstand und Einfluss benötige, seien Spanisch, Mandarin, Französisch, Arabisch und Deutsch. Der gleiche Bericht folgert außerdem, dass es ein „wachsendes Sprachdefizit“ gibt, welches erst recht nach dem Brexit zunehmen dürfte, da die britische Sprachindustrie – einschließlich Dienstleistungen wie Übersetzung und Dolmetschen – stark auf EU-Bürger angewiesen ist, deren Fachwissen zukünftig schwieriger zugänglich sein wird. Tatsächlich ist bereits ein Rückgang in den Einwanderungszahlen von EU-Immigranten auszumachen, ebenso eine erhöhte Anzahl an EU-Rückwanderern, die das Vereinigte Königreich als Folge des Referendums, des Anstiegs rassistisch-motivierter Attacken oder aufgrund der Unsicherheit bezüglich des eigenen Aufenthaltsstatus und eingeschränkter Bürgerrechte verlassen.
Das Referendum hat tiefgreifende Vorurteile gegen Sprecher anderer Sprachen als Englisch offengelegt: Politiker und Kommentatoren – darunter der ehemalige UK Independence Party (UKIP) und gegenwärtige Parteiführer der Brexit Party Nigel Farage, ebenso wie der derzeitige Premier Boris Johnson – trieben die fremdenfeindliche Rhetorik voran, indem sie etwa behaupteten, dass man in vielen Teilen Englands bereits kein Englisch mehr spräche. Inzwischen gibt es regelmäßige Medienberichte darüber, dass Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften oder auf den Straßen schikaniert werden, wenn sie eine andere Sprache als Englisch sprechen (Gorrara 2018). Die beunruhigende Präsenz der Sprachfeindlichkeit ist nur ein Vermächtnis der Referendumskampagne, aber wie so viele andere Formen von Vorurteilen ist sie nichts Neues: Linguaphobie ist ein Konzept, das erstmals in den 1950er Jahren entwickelt wurde, um eine Form der Monolingualität zu identifizieren, die sich in der Feindseligkeit gegenüber dem Erlernen anderer Sprachen zeigt.
Für einen der führenden Experten für moderne Linguistik in Großbritannien, Charles Forsdick an der Universität Liverpool, hat sich die britische Linguaphobie nach dem Referendum in ein ideologisches Phänomen übersetzt, das die nationale Zugehörigkeit im Hinblick auf die ausschließliche Verwendung der englischen Sprache beurteilt (Forsdick). Wie Forsdick feststellt, ist diese ideologische Monolingualität eine zutiefst fehlerhafte Wahrnehmung der Sprachgeschichte Großbritanniens, die sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart der Mehrsprachigkeit im Land verzerrt. Eine dermaßen insulare Einstellung dürfte ein schlechtes Rüstzeug für die schöne neue post-Brexit-Welt des globalen Freihandels und der Kulturdiplomatie sein, in der Großbritannien zukünftig als Hauptakteur agieren will.
Parallel dazu ist jedoch auch der Widerstand gegen das Sprechen von Englisch in anderen Teilen Europas gestiegen: dem ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, wurde z.B. während einer Rede vor europäischen Diplomaten für seine Aussage applaudiert, dass langsam aber sicher Englisch in Europa an Bedeutung verliere (Rankin 2017). Korrekt und weniger polemisch ist, dass englische Muttersprachler heute tatsächlich eine schrumpfende Minderheit von Englischsprechern sind und dass vorherrschende Formen des Englischen als Verkehrssprache zunehmend vom britischen Standardgebrauch abweichen. Wie das folgende, von Jenkins (27-28) zitierte Beispiel verdeutlicht:
At many EU meetings, interpretation is provided for at least some combinations of languages, but more and more speakers choose to speak in English rather than in their own language ... When they speak, no-one or hardly anyone in the audience listens to the interpreters. But when a British or Irish participant takes the floor, you can often notice some participants suddenly grab their earphones [...]. Ironically, the people whose language has been learned by everyone are becoming those who most need the expensive and stiffening intermediation of interpreters in order to be understood (Van Parijs 219).4
Der Kernpunkt ist hier, dass die muttersprachlichen Delegierten Englisch so sprechen, als ob sie sich an ein ebenfalls muttersprachliches Publikum von Englischsprechern wenden und nicht an ein internationales Publikum mit anderen Erstsprachen als Englisch. Folglich werden nur wenige oder gar keine Zugeständnisse, beispielsweise in Bezug auf Redegeschwindigkeit oder die Verwendung von lokalen britischen oder irischen Idiomen, gemacht. D.h., der Gebrauch des Englischen wird von Englisch-Muttersprachlern nicht zugunsten des mehrsprachigen Publikums angepasst, was von der „Englisch als Lingua Franca Forschung“ (ELF) als Ausdruck mangelnder transkultureller Fähigkeiten aufgrund von Einsprachigkeit gewertet wird (Jenkins 28-29). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für Englisch als Verkehrssprache der entscheidende Unterschied nicht mehr zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern besteht, was i.d.R. implizierte, dass die Muttersprachler die „Besitzer“ der englischen Sprache sind. Stattdessen wird der entscheidende Unterschied nun der zwischen mehr- und einsprachigen ELF-Benutzern sein: also zwischen denjenigen, die je nach Bedarf in andere Sprachen hinein- und hinausschlüpfen können (translanguaging) und denen, die dies nicht vermögen.
2. Der Rückzug der Modernen Fremdsprachen innerhalb der formellen Bildung
Die Aussicht auf ein breiteres Klima der Fremdenfeindlichkeit, des Misstrauens gegenüber Europa und einer allgegenwärtigen Betonung der Dominanz der englischen Sprache ist für das Erlernen von Fremdsprachen im Vereinigten Königreich nicht förderlich. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass eine vom British Council 2019 beauftragte Umfrage unter rund 700 Fremdsprachenlehrern in England ergeben hat, dass ein Drittel der Befragten der Meinung ist, der Brexit habe zu einer negativen Einstellung zum Fremdsprachenlernen in ihrer Schule geführt, sowohl bei Eltern als auch bei Schülern (Cain 2019).
Laut einer Eurobarometer-Umfrage der Europäischen Kommission (2006) erwerben die meisten Europäer in den EU-Mitgliedsstaaten ihre Fremdsprachenkenntnisse im Rahmen der weiterführenden Schulbildung. Das Vereinigte Königreich stellt dabei keine Ausnahme dar, allerdings geht der moderne Fremdsprachenunterricht im britischen Sekundarschulbetrieb in den meisten Fällen kaum über das Anfangsstadium der Fremdsprache hinaus (zumindest bis zur Mittleren Reife) und gilt bei den meisten Erwachsenen dann als längst vergessen. Derzeit sprechen etwa 23% der britischen Bürger Französisch als Fremdsprache, gefolgt von 9%, die Deutsch, und 8%, die Spanisch als Fremdsprache sprechen. Das Sprachniveau wurde bei der Erhebung allerdings nicht differenziert. Die Prävalenz des Französischen als wichtigste Fremdsprache innerhalb der Schulbildung ist das Ergebnis ihrer frühen Aufnahme in die nationalen Lehrpläne des Landes, bzw. der Regionen für Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren. Eine curriculare Regeländerung im Jahr 2004 hatte jedoch zur Folge, dass Schüler ab dem 14. Lebensjahr keine Fremdsprache mehr erlernen müssen und diese abwählen dürfen. Natürlich hat dies wenig zur Förderung einer Kultur beigetragen, die Mehrsprachigkeit als positive und wünschenswerte Zusatzqualifikation einstuft.
Als Konsequenz hat sich die Zahl der Schüler, die an GCSE-Prüfungen5 für Moderne Fremdsprachen (MFS) teilnehmen, halbiert und liegt nun deutlich unter 50%. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf das Hochschulstudium von Fremdsprachen, so dass die Anzahl von Bewerbungen von Abiturienten für ein MFS-Studium in den letzten zehn Jahren um 57% gesunken ist (Cain 2019). Ein Negativtrend also, der bereits vor dem Brexit angefangen und v.a. mit sozio-ökonomischer Benachteiligung zu tun hat, der jedoch durch die Negativstimmung und den Anstieg von Euroskeptizismus seit dem Brexit-Referendum sowie durch die wirtschaftliche Umorientierung (bzgl. internationaler Handelsabkommen) nicht aufzuhalten scheint. Für die Universitäten heißt dies, dass aufgrund geringerer Bewerberzahlen in den letzten zehn Jahren mindestens zehn Moderne Sprachabteilungen geschlossen wurden und weitere neun durch Stellenabbau deutlich verkleinert wurden (Cannadine 2019). Ein weiterer Umstand, der für ein ungünstiges Umfeld für formelles Fremdsprachenlernen sorgt, ist die Schätzung, dass z.Z. etwa 35% aller MFS-Lehrer und 85% aller Fremdsprachenassistenzen an den Schulen des Vereinigten Königreichs EU-Bürger sind (Cannadine).
D.h., Großbritannien und Nordirland bringen derzeit nicht annähernd genug MFS-Absolventen hervor, um den bereits existierenden sowie vorhergesagten Lehrermangel auszugleichen; ganz unabhängig davon, ob EU-Bürger im Land tätig bleiben, als MFS-Tutoren neu rekrutiert werden, oder nicht. Die Verflechtung zwischen Modernen Fremdsprachen und allem anderen geht natürlich weit über den Bildungsbereich hinaus: etwa ein Drittel der Dolmetscher im öffentlichen Dienst, die in britischen Gerichten, Polizeistationen und im nationalen Gesundheitsdienst arbeiten, sind ebenfalls EU-Bürger, ganz zu schweigen von der häuslichen Kranken- und Altenpflege. Ohne sie würde die Justiz oder die Gesundheitsversorgung in dem ohnehin schon stark strapazierten System für eine große Zahl von Menschen verzögert oder verweigert werden6.
Doch gibt es auch positive Beispiele im Bereich des modernen Sprachenunterrichts, wie man es vor allem in Schottland sehen kann: Die schottische und von der EU empfohlene Bildungsrichtlinie „1+2“ (d.h. Muttersprache plus zwei weitere Sprachen) ist eine ehrgeizige Vorgabe, die sicherstellen will, dass junge Menschen die Möglichkeit erhalten, neben Englisch nicht nur eine, sondern zwei weitere Sprachen zu erlernen. Zudem beinhaltet die Richtlinie auch Pläne bezüglich der Gewährleistung von Gälisch-Unterricht, denn Schottland ist ein multilinguales Land mit drei offiziell anerkannten Nationalsprachen, nämlich Englisch, Gälisch/Gáidhlig und Scots (seit 2005; 2015 wurde zusätzlich die Gebärdensprache in die Liste aufgenommen) (Doughty; Spöring 138). Die Erfahrungen, die sich aus der 1+2 Sprachpolitik ergaben, konzentrierten sich hauptsächlich auf den Schulsektor, und als Reaktion auf diese als zu eng empfundene Orientierung begann man mit einer Sektor-übergreifenden Umsetzung der 1+2 Strategie, d.h. durch die Kollaboration von Schulen, Universitäten, Erwachsenenbildung, Stadtverwaltungen und Regionalpolitik sowie von einheimischen wie ausländischen Kulturorganisationen.
Besonders im Zusammenhang mit seiner Flüchtlingspolitik zeigt uns Schottland heute, dass dort moderne Fremdsprachen nicht länger nur ein Zusatzaspekt in Diskussionen über Bildung, Arbeitsplätze oder Gesundheit sind, sondern dass es vielmehr eine aktive, legislative Berücksichtigung von Sprachen und mehrsprachigen Realitäten in Integrationsfragen gibt7. Dies stellt einen klaren Bruch mit bisherigen MFS-Bildungsmodellen in Schottland dar, welche sich auf das Erlernen europäischer Sprachen konzentrierten, aber nun zu einer Verschiebung hin zum Erlernen globaler Sprachen führen könnte. Experten innerhalb der schottischen Fremdsprachendidaktik sind sich bewusst, dass es auch weiterhin gilt, das Fremdsprachenlernen zu fördern und fordern deshalb von der schottischen Regierung:
[…] find ways of getting languages to be given the same priority as STEM subjects, including in the promotion of teacher training and the expansion of a graduate and non-graduate workforce with a range of language qualifications gained in further and higher education. Strategically planned and funded research to support the implementation process is urgently needed. These are definitely areas where Scottish Government support will be crucial. (Doughty; Spöring 145-146)8
An dieser Art der aktiven Sprachpolitik und anhand des Selbstverständnisses als multilinguale Nation lässt sich im Übrigen sehr gut ersehen, inwiefern der Brexit ein „englisches Problem“ ist und mit dem Erstarken eines speziell englischen Nationalismus zusammenhängt, wie es schon an den Mehrheitsverhältnissen des Referendum-Ergebnisses deutlich wurde. Wenngleich es auch in England bei Regierungsstellen eine gewisse Wertschätzung von Fremdsprachen gibt, ist diese in der Regel klar mit einem Kosten-Nutzen-Faktor verbunden: z.B. arbeitet das britische Außen- und Commonwealth Ministerium nun aktiv an der Verbesserung des Arabischunterrichts und der Aufnahme von Immersionstrainings als Teil der landesinternen Ausbildung für Arabisch-Studenten (Coussins; Harding-Esch 7). Dies hat sowohl mit der globalen Neuorientierung Großbritanniens als auch mit dem Anstieg von Terroranschlägen durch (britische) Islamisten zu tun. Die Einsicht, dass Mehrsprachigkeit sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch von Vorteil ist („soft power advantage“), teilen alle politischen Parteien, aber gerade von der rechten Regierungspartei unter Premier Johnson wird dieses Thema in der öffentlichen Debatte gerne vermieden, da man sich die Unterstützung der anglozentrischen Nostalgiker, britischen Nationalisten und der „bildungsfernen Masse“ für die Brexit-Wahlkampagne (samt anschließender Regierungswahl) sichern musste.
2.1 Fallstudie Nordirland
Der geographische und politische Status Nordirlands im Vereinigten Königreich ist einzigartig und hat darum Konsequenzen für das Umfeld von Sprachenlernen, die Rolle von Sprachen innerhalb der Gesellschaft sowie für die regionale Sprachenpolitik. Nordirland ist verfassungsmäßig Teil des Vereinigten Königreichs (aber nicht Großbritanniens), ist jedoch aufgrund seiner Geschichte und v. a. in Bezug auf die politische Zusammenarbeit in den durch das Belfaster Friedensabkommen 1998 geschaffenen Nord-Süd-Gremien eng mit der Republik Irland verbunden.
Was die Situation bezüglich des Erlernens von Modernen (Fremd-) Sprachen in Nordirland anbelangt, sind viele der Probleme und Herausforderungen denen ähnlich, wie sie bereits für den Rest des Vereinigten Königreichs dokumentiert sind, da das nordirische Bildungssystem in Bezug auf Richtlinien und die Beurteilung von Leistungen weitgehend an dasjenige in England und Wales angeglichen ist. Mit einem wesentlichen Unterschied: Nordirland ist die einzige Region, in der es keinen Anspruch auf Fremdsprachunterricht in der Grundschule gibt. Diese nordirische Praxis ist sowohl mit der in den anderen Regionen des Vereinigten Königreichs als auch mit der in anderen europäischen Ländern völlig unvereinbar: so lernen in Europa etwa 80% der Grundschüler bereits eine zweite Sprache (Carruthers; Ó Mainnín 161).
Von den beiden nordirischen Universitäten, der Ulster University (UU) und Queen’s University Belfast (QUB), bietet nur die QUB vollen Zugang zu MFS-Hochschulabschlüssen. Die UU kündigte 2015 die bevorstehende Schließung ihrer Fremdsprachenabteilung an und hat inzwischen den Zugang zu Abschlüssen in Fremdsprachen komplett eingestellt. Die QUB bietet z. Z. noch (neben Irisch) Studiengänge in Französisch, Spanisch und Portugiesisch an, sowie innerhalb des Studienganges International Business die Wahlnebenfächer Deutsch und Mandarin. In Nordirland ist es damit z.B. nicht mehr möglich, einen Hochschulabschluss in Deutsch zu erwerben – in der Sprache, die in einer weit beachteten Confederation of British Industries Umfrage aus dem Jahr 2019 von britischen Unternehmen stets als zweitwichtigste Sprache nach Französisch genannt wird.
Die beiden regionalen Pädagogischen Hochschulen bieten ebenfalls keine Sprachoptionen (mehr) an, außer Irisch an der katholischen PH. Durch die Einordnung von Fremdsprachen als schwierige Schulfächer und den auf die Schulen ausgeübten Druck, immer bessere Prüfungsergebnisse zu erzielen, um die Bildungsfinanzierung aufrechtzuerhalten und konkurrenzfähig zu bleiben was Schülerzahlen angeht, sind Lehrer wie Schüler gleichermaßen auf andere Fächer ausgerichtet. Traditionell wurden neben Geographie und Geschichte, die über nicht-indigene Kulturen und Perspektiven im nationalen Lehrplan informieren, besonders auch MFS als kulturvermittelnde Schulfächer betrachtet. Diese Chance, das kulturelle Bewusstsein und interkulturelle Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu erweitern, scheint in den Hintergrund zu treten. Der Fairness halber sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass der einzige Wachstumsbereich, den man in Bezug auf das MFS-Lernen in Nordirland beobachten kann, Mandarin ist. Allerdings geschieht dies eher auf einer tokenistischen Ebene, wo einige Grund- und Sekundarschulen Mandarin als Enrichment Learning [Anreicherungslernen] anbieten, seitdem Großbritannien versucht, sich auf dem globalen Markt neu zu positionieren.
Bis vor kurzem lag der pädagogische Schwerpunkt auf dem Ausbau der Beziehungen zwischen den zwei großen Kulturgemeinschaften in Nordirland, d.h. auf sozioreligiösen und identitätsstiftenden Unterschieden, weshalb den zugewanderten ethnischen Minderheiten bildungspolitisch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der Unterricht von Englisch als zusätzliche Sprache (TEAL) für newcomer pupils [Neuankömmlinge] wurde zwar in die Lehrerausbildung und Schulbildung integriert, aber der Muttersprachenunterricht der meisten ethnischen Minderheiten wird i.d.R. privat von den Immigrantengemeinden selbst organisiert (McKendry 154). So wie die zunehmende Einwanderung und Globalisierung zu einer größeren sprachlichen Disposition des Englischen als lingua franca geführt haben, haben sie auch zu einer größeren Mehrsprachigkeit in Nordirland beigetragen, die allerdings im hiesigen Bildungssystem derzeit nicht zum Vorteil genutzt wird.
Nordirland unterscheidet sich auch in einem weiteren bildungspolitischen Aspekt von den anderen, dezentralen Regionen im Vereinigten Königreich: Es gibt keine spezifischen Rechtsvorschriften zum Schutz einheimischer Minderheitensprachen, also weder für Irisch noch für Ulster Scots9. Sowohl Wales als auch Schottland haben entsprechende Gesetze erlassen, und in der Republik Irland ist die Stellung von Irisch als Landessprache und als erste von zwei offiziellen Sprachen (neben Englisch) in der Verfassung und einem offiziellen Sprachengesetz verankert (Ó Caollaí 2020). In Nordirland hingegen wird die irische Sprache von der unionistischen, pro-britischen Bevölkerung größtenteils abgelehnt, während sie von den irischen Nationalisten als nationale Kultursprache geschätzt wird. Wie Carruthers und Ó Mainnín (167) darüber hinaus erklären, wurde auch das Ulster Scots weitgehend abgelehnt; ironischerweise vornehmlich von der eigenen Sprechergruppe, den Unionisten, aufgrund des niedrigen Status von Ulster Scots gegenüber der englischen Sprache.
Der Auftrag, die sprachliche Vielfalt zu unterstützen, wurde zwar erstmals im Belfaster Karfreitag Friedensabkommen von 1998 formuliert und von den Unterzeichnenden akzeptiert, aber Spannungen blieben bestehen. Insbesondere seit dem erneuten Druck der nicht-unionistischen Parteien auf die Einführung eines Irish Language Acts [irisches Sprachgesetz] in der Region: 15 Jahre nach Unterzeichnung des St.-Andrews-Abkommens, in dem die britische Regierung bereits die Einführung eines irischen Sprachgesetzes billigte, ist das Gesetz zur Gleichstellung der irischen Sprache in Nordirland noch immer nicht verabschiedet aufgrund des massiven Widerstands der pro-britischen Unionisten:
Some of the arguments against the act also include claims that Irish would become a compulsory subject taught in all schools; it would dilute the North’s “Britishness”; it would see Irish lifted above all other languages (such as English and Polish) while health, education and other public services are in need of greater funding; that Irish has been “weaponised” and “politicized”, and that quotas would be introduced for Irish speakers in the civil service which would discriminate against people from a unionist background. While such generalisations and critiques are undoubtedly promoted in some political quarters, language campaigners say they are also largely inaccurate. (Ó Caollaí 2020)10
Wenngleich die Gleichstellung der irischen Sprache in Nordirland noch nicht gesetzlich verankert ist, gab es in den ersten Wochen des Jahres 2021 einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, indem der Belfaster Stadtrat entgegen unionistischen Stimmen grünes Licht für zweisprachige Straßenschilder (auf Antrag) gegeben hat. Obwohl Irisch die bevorzugte Wahl für eine alternative Sprache im Stadtbild Belfasts ist, können auch Anträge für andere „lokale“ Sprachen gestellt werden, einschließlich Ulster Scots und Chinesisch (die Muttersprache der größten Zuwanderergemeinde Nordirlands). Was an dieser Entscheidung wichtig und positiv ist (neben dem indirekten Eingeständnis kolonialer Sprachdiskriminierung gegenüber dem Irischen und dessen Sprechern), ist die Anerkennung und Respektierung von Sprachenvielfalt in einer Region, die berüchtigt ist für Sektierertum und Ausgrenzung. Es scheint, dass die alte Garde von „Grabenkämpfern“ schwindenden politischen Einfluss hat – kurioserweise beschleunigt durch den Brexit, da Nordirland im Gegensatz zu Großbritannien durch das „Nordirland Protokoll“ auch nach dem Brexit eine Sonderstellung innehat, um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden.
Mit der Einführung des überarbeiteten nordirischen Curriculums von 2007 nach dem Friedensabkommen sollte insbesondere das Sekundarstufenfach Gesellschaftskunde zum Motor für interkulturelles Lernen werden, mit einem Schwerpunkt auf Vielfalt, Inklusion, globalen, lokalen und „glokalen“ Perspektiven (d.h. ein Zusammenwachsen globaler und lokaler Erfahrungen als Ergebnis von intensivierter Globalisierung und Zuwanderung). Indessen zeigt der „reale“ Lehrplan im Klassenzimmer ein anderes Bild, da nämlich konfliktfreie Themen untersucht werden, anstatt z.B. die Ursachen des Nordirlandkonflikts oder des Anstiegs von Fremdenfeindlichkeit in der nun multikulturelleren Region zu erforschen. Zusätzlich brachten neueingeführte Abiturfächer (oder Äquivalente, z.B. BTEC11), wie Film- und Medienkunde oder Kommunikation und Kultur, innovative Ansätze und Methoden für interkulturelles Lernen in die Schulen. Obwohl dies allgemein natürlich eine sinnvolle Ergänzung eines jeden Lehrplans im 21. Jahrhundert darstellt, gibt es keinen Zweifel daran, dass traditionelle Fächer wie MFS, die lange für ihren Bildungsbeitrag respektiert wurden, inzwischen an Boden verloren haben zugunsten angeblich einfacherer Fächer, in denen möglicherweise bessere Notenerfolge erzielt werden.
Weitere Probleme, die zu dem Elend von MFS-Lernen in Nordirland beitragen, sind der bereits erwähnte Mangel an qualifizierten MFS-Lehrkräften und mehr noch die Tatsache, dass der kulturelle Wert des Fremdsprachenlernens weder an Schüler, Eltern oder Schulleiter vermittelt wird. Dies steht ganz im Gegensatz zur offiziell verordneten Profilierung der sogenannten STEM-Fächer, wie es auch besonders in Schottland kritisiert wird12.
Die politische Landschaft nach dem Brexit, in der Nordirland weiterhin EU-Zöllen und neuen Güterkontrollen aus/nach Großbritannien unterliegt, sowie die demographische Parität von Briten und Iren in Nordirland ab 2021 bedeutet, dass die Nord-Süd-Strukturen, die sich bereits positiv auf die Förderung sprachlicher Vielfalt ausgewirkt haben, in Zukunft eine verstärkte Rolle spielen werden. Denn wo es bereits enge wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit gibt, lässt eine politische Union oft nicht lange auf sich warten. Das Ansehen und die Bedeutung von MFS-Lernen in der Republik Irland hat hingegen zugenommen: Der unmittelbare politische Kontext der irischen Languages Connect Bildungsstrategie für Fremdsprachenlernen ist der „Aktionsplan für Bildung 2016-19“, der darauf abzielt, die Sprachkompetenzstandards der Lernenden in mindestens einer Fremdsprache zu verbessern. Languages Connect baut dabei auf früheren Alphabetisierungs- und Irisch-Sprachinitiativen auf und konzentriert sich auf vier Kernbereiche: das Lernen und das Lernumfeld, die Sprachgemeinschaften der Immigranten, die Profilierung des Sprachenlernens und die Rolle von Fremdsprachen in der Wirtschaft.
Man folgt dabei den europäischen Sprachstandards, verspricht die Einsetzung einer Beratungsgruppe für Fremdsprachen und eine formelle Überprüfung bisheriger Ergebnisse im Jahr 2022. Sharon Jones (2018), die aus einer nordirischen Perspektive die südirische Languages Connect Strategie betrachtet, kommt zu dem Schluss, dass die „Landschaft des Sprachenlernens“ auf der irischen Insel geradezu darauf wartet, miteinander verbunden zu werden durch die Überbrückung von Lücken zwischen den Regionen, Sektoren, Disziplinen, Bildungsphasen und ungleichen Chancen13.
2.2 Aktuelle Auswirkungen der Corona/ Covid-19 Pandemie
Inzwischen wütet die Corona-Pandemie auch in Großbritannien und (Nord-)Irland mit regionalen Lockdowns von März bis Juli 2020, diversen „Lockdown lights“ und einer weiteren Verschärfung seit Beginn des Jahres 2021 (dem Redaktionsschluss für dieses Kapitel). Wissenschaftlicher Austausch, wenn es sich nicht gerade um Virologie und Epidemiologie handelt, findet seitdem international größtenteils online statt, und Distanzlernen ist in der institutionellen Bildung die Devise – zumindest an den britischen und irischen Universitäten, während die meisten Schullehrer nach den Sommerferien von September bis Dezember 2020 wieder vor ihren Klassen standen. Obwohl die Universitäten prompt dazu übergingen, Präsenzvorlesungen und -seminare relativ erfolgreich durch Distanzlernen zu ersetzen, wirkten sich die Schließungen auf das Lernen und die Prüfungen sowie auf die Sicherheit und den rechtlichen Status der internationalen Studierenden in ihrem Gastland aus.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass hierzulande die Krise auch generelle Fragen über den Wert einer durch hohe Studiengebühren finanzierte Hochschulausbildung aufgeworfen hat, die neben Bildungsinhalten auch Möglichkeiten für Networking und soziale Begegnungen umfassen soll. Um relevant zu bleiben, werden die Universitäten deshalb ihre Lernumgebung neu erfinden müssen, damit die Digitalisierung z.B. die Beziehungen zwischen Studierenden und Lehrenden erweitert und ergänzt. Besonders durch den Lockdown der Schulen hat sich aber herausgestellt, was vorher schon vermutet und als dringend verbesserungswürdig angemerkt worden ist, nämlich dass digitales Lernen zu wenig gefördert, in der Lehrerausbildung vernachlässigt und insgesamt maßgeblich unterfinanziert ist. Insbesondere Lernende in den am stärksten marginalisierten Gruppen, die keinen Zugang zu digitalen Lernressourcen haben oder denen es an Belastbarkeit und Engagement fehlt selbstständig zu lernen, laufen Gefahr ins Hintertreffen zu geraten.
Die katastrophalen Auswirkungen von Corona/Covid-19 auf die ohnehin schwache Position der MFS in der britischen und nordirischen Bildungslandschaft wurde schnell ersichtlich: Studierende wurden von ihren Heimatuniversitäten aus dem Erasmusjahr oder aus Praktika umgehend zurückbeordert. Bewerbungen auf Zuteilung neuer Fremdsprachenassistenzen für Schulen wurden auf Eis gelegt und Arbeitsverträge mit ortsansässigen Sprachassistenten werden nicht mehr automatisch verlängert. Klassenfahrten in Zielsprachenländer mussten zwangsläufig abgesagt werden, und es ist unklar, ob und wann diese nachgeholt werden. Darüber hinaus wird im Distanzunterricht den Kernfächern Priorität gegeben. Hinzu kommt, dass das zentrale Anliegen von Sprachen die Kommunikation von Menschen miteinander ist; d.h., als Unterrichtsfächer sind sie in einem besonders hohen Maß auf soziale Nähe angewiesen, welches pandemiebedingt derzeit nicht möglich ist. Sprachlehrer in allen Bildungskontexten haben zwar beträchtliche Anstrengungen unternommen, um den virtuellen Sprachunterricht so interaktiv wie möglich zu gestalten, doch sowohl Schüler und Studenten als auch Lehrer und Dozenten sind sich weitgehend einig, dass es keinen Ersatz für das MFS-Lernen von Angesicht zu Angesicht gibt:
“The issue with online learning is that our access to facial and bodily gestures and eye contact is affected”, according to Professor Dan McIntyre, a specialist in English language and linguistics at Huddersfield University. “Understanding what someone is saying to us involves so much more than simply interpreting the meaning of words and sentence structures […]”. (Wittenberg 2020)14
Darüber hinaus stellen die typischen, technischen Herausforderungen beim Distanzlernen ein besonders schwerwiegendes Problem für MFS-Lernsituationen dar: Ist eine schlechte Tonqualität oder häufiges Einfrieren der Übertragung schon bei Online-Videokonferenzen ermüdend und nicht zielführend, kann dieses rein technische Problem sich beim MFS-Unterricht tatsächlich kontraproduktiv auf den Lernerfolg auswirken und das Selbstvertrauen des Lerners untergraben.
3. Schlussfolgerungen
Nach den (vorerst) abgeschlossenen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU im Dezember 2020 wird – neben Großbritanniens Ausschluss von europäischen Sicherheitsnetzwerken und polizeilichen Datenbanken – besonders der Austritt aus dem Erasmus+ Programm ab 2022 von den britischen Medien kritisch betrachtet. Noch im Januar 2020 hieß es dazu von Premierminister Johnson, die Teilnahme an Erasmus sei durch den Brexit nicht gefährdet. Inzwischen lautet die Regierungsdevise, man werde stattdessen ein eigenes Ersatzprogramm mit „den besten Universitäten der Welt“ einrichten, das nach dem britischen Computerpionier Alan Turing benannt werden soll, und welches Kritiker schon vor Programmeinführung durch Unterfinanzierung und den einseitigen Fokus auf britische Studenten als gescheitert sehen.
Mit dem Wegfall von Erasmus aus dem Abkommen zwischen Großbritannien und der EU endet ein Programm, das seit 1987 Studentenaustausch sowie Schulverbindungen, Berufserfahrung und Lehrstellen in ganz Europa angeboten hat. Unter der letzten Version des Programms (Erasmus+) haben etwa 200.000 Menschen teilgenommen, darunter etwa 15.000 britische Universitätsstudenten pro Jahr (Adams 2020). Johnsons rechtspopulistische und euroskeptische Regierung nennt die unverhältnismäßigen, hohen Kosten für Großbritannien als Hauptgrund für den Ausstieg aus dem europäischen Austauschprogramm, wohingegen man den nicht unwahrscheinlichen Verdacht äußern könnte, dass es wohl eher darum geht, die nächsten Generationen junger Briten von Europa zu „entwöhnen“ und eine anglozentrische Sicht der Welt zu stärken. Die Vermutung liegt nahe, dass aufgrund mangelnder Fremdsprachenkenntnisse die Mehrheit zukünftiger britischer Teilnehmer am Alan Turing Programm (Aus-) Bildungseinrichtungen im englischsprachigen Ausland besuchen wird.
Englisch bleibt auch weiterhin als offizielle EU-Sprache erhalten. Die Auswirkungen des Brexit auf die Sprachpolitik der EU bleibt allerdings abzuwarten, und es wäre möglich, dass die EU durch die Beibehaltung des Englischen als Arbeits- und Verkehrssprache ohne die dominierende Präsenz britischer Muttersprachler eine eigene, regionale Variante des Englischen (Sprachdialekt) für ihre Bedürfnisse entwickelt, ähnlich wie z.B. Hiberno-Englisch, Amerikanisch oder weitere postkoloniale Varianten des Englischen. Wie bereits erwähnt und im Rahmen der EFL-Forschung argumentiert (siehe Jenkins; Garcia; Wei), wird sich die Art von Englisch, die in der EU und der übrigen Welt als lingua franca verwendet wird, zunehmend von der des Englisch-Muttersprachlers unterscheiden, und Englisch-Muttersprachler werden in transkulturellen Kontexten zunehmend benachteiligt sein.
Außerdem dürfte die Rückkehr zu mehr multilingualen Praktiken innerhalb der wissenschaftlichen Forschung durch die rapiden Fortschritte im Bereich der maschinellen Übersetzung beschleunigt werden. Folgerichtig gibt es vereinzelt wieder lautere Stimmen, die sich für die Wiederbelebung des Fremdsprachensektors in der britischen Bildungslandschaft einsetzen: Universities UK und British Academy sind z.B. Teil einer Koalition von Partnern, die der britischen Regierung bereits im Sommer 2020 eine nationale Strategie zur ganzheitlichen Förderung des Sprachenlernens vorgelegt haben. Zur erfolgreichen Umsetzung einer solchen landesweiten, holistischen Strategie wäre allerdings ein politisches Klima nötig, in dem Themen wie Mehrsprachigkeit und Multikulturalismus nicht politisch verdächtig und umstritten sind!
Währenddessen wirkt sich die Gesundheitskrise längst negativ auf die öffentlichen Bildungsausgaben in Großbritannien und Nordirland aus, da Mittel in den Gesundheitssektor und die angegriffene Wirtschaft umgeleitet werden. Außerdem drohe durch den Corona-bedingten Wegfall von Studiengebühren-zahlenden nationalen und internationalen Studenten bereits einem Dutzend britischer Universitäten langfristig die Insolvenz, falls sie nicht von der Regierung gerettet werden, so lautet eine Forschungsanalyse des britischen Instituts für Finanzwirtschaft (Baker 2020). D.h., im Hochschulsektor werden künftig noch mehr Gelder rigoros gekürzt, umgeleitet und durch Stellenabbau kompensiert werden, wobei die Erfahrung der letzten Jahrzehnte lehrt, dass besonders die MFS-Abteilungen davon betroffen sein werden. Zusammenfassend lässt sich also bis dato feststellen, dass seit dem Austrittsergebnis des Brexit-Referendums ein zunehmender Anstieg von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Vereinigten Königreich zu verzeichnen ist und es einen Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und dem dramatischen Rückgang der Zahl der Schüler und Studenten, die sich in den letzten Jahren für ein Sprachstudium entschieden haben, zu geben scheint (Stringer 2020).
Ein weiteres Kernproblem ist, dass die Regierung den MINT-Fächern immer mehr Priorität einräumt, während die kumulativen Auswirkungen der Mittelkürzungen bereits seit 2011 verheerende Auswirkungen für MFS im gesamten formellen Bildungsbereich haben und zu verminderten Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens führen. Obwohl es vielleicht übertrieben ist zu behaupten, dass der mangelnde Wert, der dem Erlernen von Fremdsprachen in der Schulbildung beigemessen wird, der Grund für den Anstieg der Fremdenfeindlichkeit in den letzten Jahren ist, trägt dieser Umstand zumindest dazu bei. Wenn Kindern und Jugendlichen vermittelt wird, dass es keinen Wert hat andere Sprachen zu lernen, werden sie daraus selbstverständlich folgern, dass es ebenfalls wertlos ist, etwas über andere Kulturen zu lernen, was letztendlich zur Skepsis oder Abneigung gegenüber „Fremdem“ führen kann. Somit könnte das aussageschwache Zitat „Brexit means Brexit“ [Brexit bedeutet Brexit] der von Brexit-Hardlinern in ihrer eigenen Konservativen Partei 2019 abgesetzten Premierministerin Teresa May bedeuten, dass sich das Vereinigte Königreich nicht nur politisch und ökonomisch von Europa verabschiedet hat, sondern offenbar auch sprachlich-kulturell.
Bibliographie
Adams, Richard. „UK students lose Erasmus membership in Brexit deal.” The Guardian, 24.12.2020. www.theguardian.com/education/2020/dec/24/uk-students-lose-erasmus-membership-in-brexit-deal, besucht: 09.01.2021.
Baker, Simon. „Covid-19 crisis could bankrupt a dozen UK universities, IFS warns.” The Times Higher Education, 06.07.2020. www.timeshighereducation.com/news/covid-19-crisis-could-bankrupt-dozen-uk-universities-ifs-warns, besucht: 12.01.2021.
British Academy et al. „Towards a National Languages Strategy: Education and Skills”, 2020. https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/towards-national-languages-strategy-education-and-skills /, besucht: 09.01.2021.
British Council. „Languages for the Future - the foreign languages that Wales and the UK need to become truly global nations”, 2017. https://wales.britishcouncil.org/en/languages-future-foreign-languges-wales-and-uk-need-become-truly-global-nations, besucht: 09. 01. 2021.
Cain, Sian. „British ,linguaphobia’ has deepened since Brexit vote, say experts.” The Guardian, 28.05.2018. www.theguardian.com/books/2018/may/28/british-linguaphobia-has-deepened-since-brexit-vot e-say-experts,besucht: 24.10.2019.
Cannadine, David. „Brexit Britain cannot afford to be laissez-faire about its languages crisis.” The Guardian, 01.03.2019. www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/01/britain-learning-languages-bre xit--education, besucht: 24.10.2019.
Carruthers, Janice; Ó Mainnín, Mícheál B. „Languages in Northern Ireland: Policy and Practice.” Languages after Brexit. How the UK speaks to the World, Michael Kelly (Hrsg.), Palgrave Macmillan, 2018, S. 159-173.
Cerulus, Laurens. „Ireland to fund Erasmus scheme for Northern Irish students.” Politico, 27.12.2020. https://www.politico.eu/article/ireland-fund-erasmus-northern-irish-students/, besucht: 22.01.2021.
Confederation of British Industries; Pearson. „Education and Skills Survey Report. People and Skills.” CBI, 29.11.2019. www.cbi.org.uk/articles/education-and-learning-for-the-modern-world/, besucht: 10.03.2020.
Coussins, Jean; Harding-Esch, Philip. „Introduction.” Languages after Brexit.How the UK speaks to the World, Michael Kelly (Hrsg.), Palgrave Macmillan, 2018, S. 1-11.
Doughty, Hannah; Spöring, Marion. „Modern Languages in Scotland in the Context of Brexit.” Languages after Brexit.How the UK speaks to the World,Michael Kelly (Hrsg.), Palgrave Macmillan, 2018, S. 137-149.
García, Ofelia; Wei, Li. Translanguiging. Language, Bilingualism and Education. Palgrave Macmillan, 2014.
Gorrara, Claire. „Britain must address its linguaphobia now to survive post-Brexit.” The Conversation, 07.06.2019. http://theconversation.com/britain-must-address-its-linguaphobia-now-to-survive-post-br exit-97787, besucht: 24.10.2019.
Jenkings, Jennifer. „Trouble with English?” Languages after Brexit. How the UK speaks to the World, Michael Kelly (Hrsg.), Palgrave Macmillan, 2018, S. 25-35.
Jones, Sharon. „Languages Connect 2017-2026 Ireland’s Strategy for Foreign Languages in Education: a View from Initial Teacher Education in Northern Ireland.” Multilingualism: Empowering Individuals, Transforming SocietiesProject(MEITS). 23.05.2018, www.meits.org/opinion-articles/article/languages-connect-2017-2026-irelands-strategy-for-foreign-languages-in-educ, besucht: 10.03.2020.
Kelly, Michael (Hrsg.). Languages after Brexit. How the UK Speaks to the World. Palgrave Macmillan, 2018.
Ó Caollaí, Éanna. „Explainer: Breaking the deadlock over an Irish Language Act.” The Irish Times, 09.01.2020. www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/explainer-breaking-the-deadlock-over-an-irish-language-act-1.4135275, besucht: 09.01.2021.
Piazza, Nicole. „How many different languages are spoken in the UK.” LinguaLinx Language Solutions. 2019-2020. www.lingualinx.com/blog/the-different-languages-spoken-in-the-uk,
besucht: 24.10.2019.
Rankin, Jennifer. „Brexit: English is losing its importance in Europe, says Juncker.” The Guardian, 05.05.2017, www.theguardian.com/politics/2017/may/05/brexit-english-is-losing-its-importance-in-europ e-says-juncker, besucht: 10.02.2020.
Schleicher, Andreas. „The Impact of Covid-19 on Education. Insights from Education at a Glance 2020.” OECD, 2020.
Stringer, Olivia. „Why are foreign languages so taboo for Brits?” Shout out UK (SOUK), 12.10.2020, www.shoutoutuk.org/2020/10/12/why-are-foreign-languages-so-taboo-for-brits/, besucht: 12.01.2021.
UK Commission for Employment and Skills. „Employer Skills Survey 2011.” UKCES, 31.05.2012, www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2011, besucht: 24.10.2019.
Universities UK. „Language learning vital to pandemic recovery.” UUK, 07.07.2020, www.universitiesuk.ac.uk/news/Pages/Language-learning-vital-to-pandemic-recovery.aspx, besucht: 09.01.2021.
Van Parijs, Philippe. Linguistic Justice for Europe and for the World. Oxford University Press, 2011.
Wittenberg, Daniel. „Language learning needs to be protected from becoming a casualty of coronavirus.” iNews, 12.06.2020, https://inews.co.uk/opinion/languages-lockdown-coronavirus-casualty-442 845, besucht: 12.01.2021.
1Während in Großbritannien im Allgemeinen der Begriff Modern Foreign Languages [Moderne Fremdsprachen] verwendet wird, wird in Nordirland die Bezeichnung Modern Languages [Moderne Sprachen] benutzt, um die Einbeziehung von Irisch (Gälisch) zu garantieren. Das irische Gälisch ist die Kultursprache (aber nicht unbedingt Muttersprache) der Irisch-stämmigen, d.h., irisch-nationalistischen Bevölkerungsgruppe in Nordirland und hat eine große identitätsstiftende Bedeutung.
2 Ein Begriff aus der Soziolinguistik, der bedeutet, dass Individuen oder eine Sprachgemeinschaft von einer Sprache A in eine andere Sprache B wechselt (language shift). Ein kompletter Sprachwechsel kann sich über mehrere Generationen hinziehen.
3 „Dass Englisch irgendwie die Norm ist, ist eine völlige Verkennung der Tatsachen. Aber diese Vorstellung, dass jeder Englisch spricht, hält sich hartnäckig und wird von vielen im Vereinigten Königreich geglaubt“, sagte Gorrara und warnt, dass die wirtschaftlichen Chancen und der Brückenschlag mit dem Rest der Welt nach dem Brexit gefährdet seien, wenn die Briten nicht weniger „sprachfeindlich“ werden und mehr Sprachen lernen. (Diese und folgende Übersetzungen von Zitaten sind meine eigenen Übersetzungen.)
4 Bei vielen EU-Sitzungen wird zumindest für einige Sprachkombinationen gedolmetscht, aber immer mehr Redner ziehen es vor, auf Englisch zu sprechen, statt in ihrer eigenen Sprache ... Wenn sie sprechen, hört niemand oder kaum jemand im Publikum den Dolmetschern zu. Wenn jedoch ein britischer oder irischer Teilnehmer das Wort ergreift, kann man oft beobachten, dass einige Teilnehmer plötzlich zu ihren Kopfhörern greifen [...]. Ironischerweise werden die Menschen, deren Sprache von allen gelernt wurde, zu denjenigen, die am meisten die teure und steife Vermittlung von Dolmetschern brauchen, um verstanden zu werden.
5General Certificate of Secondary Education (GCSE) entspricht in England, Wales und Nordirland etwa dem deutschen mittleren Schulabschluss.
6 Was während der Corona/Covid-19 Pandemie seit März 2020 erschreckend deutlich wird.
7 Für detaillierte Informationen, vgl. A. Phipps. „Language plenty, refugees and the post-Brexit world: New practices from Scotland” in M. Kelly (Hrsg.), S. 95-109.
8 […] Wege [zu] finden, um den Sprachen die gleiche Priorität wie den MINT-Fächern einzuräumen, auch bei der Förderung der Lehrerausbildung und dem Wachstum von graduierten und nicht-graduierten Arbeitskräften mit einer Reihe von Sprachqualifikationen, die in der Weiter- und Hochschulbildung erworben werden. Strategisch geplante und finanzierte Forschung zur Unterstützung des Umsetzungsprozesses ist dringend erforderlich. Dies sind definitiv Bereiche, in denen die Unterstützung der schottischen Regierung entscheidend sein wird.
9 Ulster Scots ist ein Dialekt der schottischen (gälischen) Sprache, der in Teilen der Provinz Ulster in der Republik Irland und Nordirland gesprochen wird, und der auf die (koloniale) Siedlungsgeschichte der Insel zurückgeht.
10 Zu den Argumenten gegen das Gesetz gehören auch Behauptungen, dass Irisch zu einem Pflichtfach in allen Schulen werden würde; dass es das „Britisch-sein“ des Nordens verwässern würde; dass es Irisch über alle anderen Sprachen (wie Englisch und Polnisch) erheben würde, während Gesundheit, Bildung und andere öffentliche Dienste mehr finanzielle Mittel benötigen; dass Irisch als „Waffe“ benutzt und „politisiert“ wurde und dass Quoten für Irischsprachige im öffentlichen Dienst eingeführt würden, was Menschen mit unionistischem Hintergrund diskriminieren würde. Während solche Verallgemeinerungen und Kritiken in einigen politischen Kreisen zweifellos gefördert werden, entgegnen Sprachaktivisten, dass sie weitgehend falsch sind.
11Business and Technology Education Council (BTEC): Ein BTEC ist eine Qualifikation, die auf praktisch-angewandten und nicht auf theoretisch-akademischen Leistungsnachweisen basiert.
12 Mit STEM-Fächer sind Science, Technology, Engineering und Mathematics gemeint, den dt. MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik entsprechend.
13 Die irische Regierung hat inzwischen versprochen, ihr Erasmus+ Kontingent für nordirische Studenten zu öffnen (Cerulus, 2020).
14 „Das Problem beim Online-Lernen ist, dass unser Zugang zu Mimik und Gesten und Blickkontakt beeinträchtigt wird“, so Professor Dan McIntyre, ein Spezialist für englische Sprache und Linguistik an der Universität Huddersfield. „Zum Verständnis, was jemand zu uns sagt, gehört so viel mehr dazu, als nur die Bedeutung von Wörtern und Satzstrukturen zu interpretieren […]“.
Gelebte Mehrsprachigkeit? Der Fall der països catalans
Benjamin Meisnitzer, Bénédict Wocker
1. Der Sprachraum des Katalanischen – die països catalans als mehrsprachiger Sprachraum
Mehrsprachigkeit oder Multilingualismus als „Fähigkeit eines Individuums, sich in mehreren Sprachen auszudrücken“ (Bußmann 453), ist zunehmend der Regelfall in unseren modernen Gesellschaften. Aber auch die „Geltung mehrerer Sprachen in einer Gesellschaft oder in einem Staat“ (453) ist keine Seltenheit in Europa und der Welt und ist von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Der Fall Kataloniens ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, da sich die (Dominanz-)Verhältnisse zwischen den beiden vorherrschenden gesellschaftlichen Sprachen Spanisch und Katalanisch in der Vergangenheit häufig verschoben haben und die dortige Situation zeigt, dass gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in der Regel nichts mit Symmetrie zwischen den beiden Sprachen zu tun hat, wie wir herausarbeiten werden.
1.1 Katalanisch in den països catalans
Das katalanische Sprachgebiet erstreckt sich auf das Gebiet, das einst im Römischen Reich der Hispania Citerior entsprach, genauer gesagt der Provincia Tarraconensis (Herling 537): vom Fürstentum Katalonien über die Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza), nach Valencia bis ins östliche Aragon („La Franja“), bei einer konfliktbehafteten Sprachklassifizierung in Valencia1 (Katalanisch vs. Valencianisch). Das Katalanische ist hier regionale Amtssprache2 und kooffizielle Sprache neben Spanisch, welches folglich jede Bewohnerin und jeder Bewohner zu beherrschen hat, da es Staatssprache ist.
Daneben genießt das Katalanische sehr weitgehende Rechte: Die Bürger können sich an alle Behörden in Katalanisch wenden und jederzeit Antwort in dieser Sprache verlangen; Gerichtsverhandlungen müssen auf Katalanisch geführt werden, wenn ein Betroffener dies verlangt; Gesetze werden zweisprachig publiziert; der Unterricht in den obligatorischen staatlichen Elementarschulen erfolgt auf Katalanisch; Beamte müssen das Katalanische in Wort und Schrift beherrschen und diese Kenntnisse durch entsprechende Prüfungen nachweisen; die Beschilderungen von Straßen und Plätzen ist katalanisch, offizielle Geltung haben nur die katalanischen Ortsnamen. (Bossong 108)
Ergänzend ist noch der in der Franja gesprochene Dialekt, der Ribagorça, zu nennen, den circa 40.000 Menschen sprechen und der keinen kooffiziellen Status genießt, sondern lediglich eine anerkannte Minderheitensprache ist (Bossong 109).
Im Fürstentum Andorra ist Katalanisch die offizielle Amts- und Staatssprache (Bossong 106), und gemäß einer Umfrage des Institut d’Estudis Andorrans3 nutzen 2018 40,5% der Bevölkerung das Katalanische als häufigste Sprache im Alltag, neben Spanisch (43,0%), und für 35,7% der Einwohnerinnen und Einwohner ist das Katalanische Erstsprache (L1), während es für 43,2% das Kastilische ist. Noch 1995 gaben 42,7% an, Katalanisch als L1 zu sprechen, und nur 34,6% Spanisch. Es wird ersichtlich, dass das Katalanische durch das Spanische auf der einen und das Französische auf der anderen Seite unter massivem Druck steht, vor allem bedingt durch das Schulwesen, die Medien und die zunehmende Zuwanderung. Interessant im Fall Andorras ist wiederum die Frage nach der eigenen Sprache, sprich die Identitätsfrage, bei der immerhin 45,9% der Befragten Katalanisch angeben und nur 42,6% Kastilisch. Vergleicht man die Zahlen von 2009 und 2014, oszillieren die Zahlen nur leicht.
Ebenfalls katalanischsprachig ist die Gegend um Perpignan in Frankreich und Alghero auf Sardinien (Italien). Der Fall von Andorra hat bereits gezeigt, dass der Sprachraum des Katalanischen ein mehrsprachiger ist, in dem mehrere Sprachen in Konkurrenz zueinander stehen und wo ein massiver Druck von Seiten des Kastilischen ausgeht, obwohl das Katalanische hier die offizielle Amtssprache ist. Im Fall der Stadt Alghero4 ist das Katalanische eine im Rahmen des Gesetzes 482 von 1999 geschützte Minderheitensprache (Bossong 2008: 109), die Kolonisten aus Barcelona im Rahmen einer Neubesiedlung der Stadt nach der Vertreibung der Sarden 1372 aufgrund eines Volksaufstandes gegen den König Pero IV von Aragon mitbrachten (107).
Sardinien stand im Mittelalter unter aragonesischer Herrschaft; 1372 vertrieb der aragonesische König Pedro el Ceremonioso nach einer Revolte die autochthone sardische Bevölkerung und siedelte Katalanen an. So kommt es, dass heute in der Stadt nicht das Sardische (oder Sassaresische) des unmittelbaren Hinterlandes gesprochen wird, sondern nur das lokale Katalanisch sowie natürlich Italienisch. (Bossong 107)





























