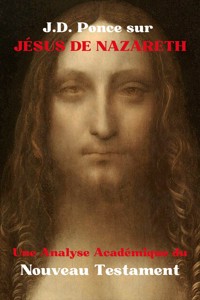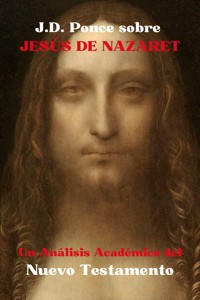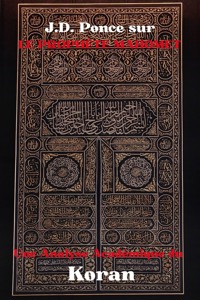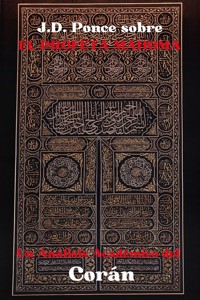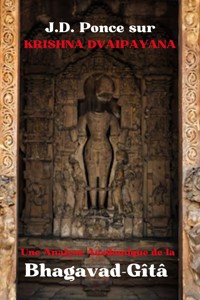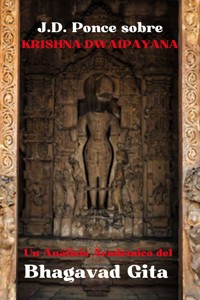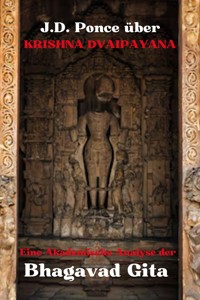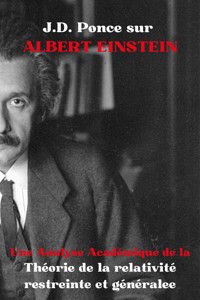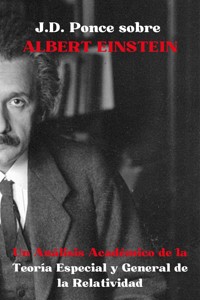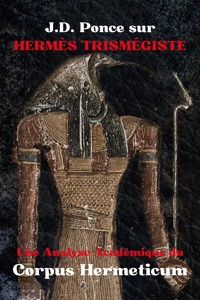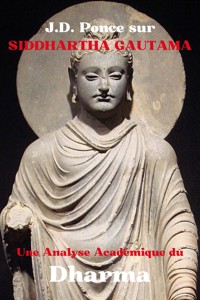6,99 €
6,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: J.D. Ponce
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Dieser spannende Aufsatz konzentriert sich auf die Erklärung und Analyse von Martin Heideggers „Sein und Zeit“, einem der einflussreichsten Werke der Geschichte, dessen Verständnis sich aufgrund seiner Komplexität und Tiefe beim ersten Lesen dem Verständnis entzieht.
Unabhängig davon, ob Sie „Sein und Zeit“ bereits gelesen haben oder nicht, dieser Aufsatz wird es Ihnen ermöglichen, in jede einzelne seiner Bedeutungen einzutauchen und ein Fenster zu Heideggers philosophischem Denken und seiner wahren Absicht zu öffnen, als er dieses unsterbliche Werk schuf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
J.D. PONCE ÜBER
MARTIN HEIDEGGER
EINE AKADEMISCHE ANALYSE VON
SEIN UND ZEIT
© 2024 von J.D. Ponce
INDEX
VORÜBERLEGUNGEN
Kapitel I: HEIDEGGERS KONTEXT
Kapitel II: EINFLÜSSE UND QUELLEN
Kapitel III: SCHLÜSSELTHEMEN IN SEIN UND ZEIT
Kapitel IV: die Frage des SEINS
Kapitel V: DIE ONTOLOGISCHE UNTERSUCHUNG
Kapitel VI: Die Strukturanalyse des Seins
Kapitel VII: Ontologische und ontische Prioritäten
Kapitel VIII: DIE FRAGE DES SEINS - DER DOPPELWEG
Kapitel IX: DER ANALYTISCHE RAHMEN DES DASEINS
Kapitel X: ONTOLOGIE - ZERSTÖRUNG UND REKONSTRUKTION
Kapitel XI: PHÄNOMENOLOGISCHE METHODEN
Kapitel XII: DASEIN - THEMEN UND UNTERSCHEIDUNGEN
Kapitel XIII: IN-DER-WELT-SEIN
Kapitel XIV: DIE WELTLICHKEIT DER WELT
Kapitel XV: MIT-SEIN UND SELBST-SEIN
Kapitel XVI: Das Sein als solches
Kapitel XVII: DIE ROLLE VON SPRACHE UND KOMMUNIKATION
Kapitel XVIII: DAS PHÄNOMEN DER FÜRSORGE
Kapitel XIX: REALITÄT, WAHRHEIT UND OFFENLEGUNG
Kapitel XX: WIRKUNG UND EINFLUSS VON SEIN UND ZEIT
Kapitel XXI: 50 WICHTIGE ZITATE VON HEIDEGGER
VORÜBERLEGUNGEN
Martin Heidegger gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Er wurde am 26. September 1889 in Messkirch, Baden-Württemberg, Deutschland geboren. Seine Erziehung in einem konservativ-katholischen Elternhaus beeinflusste seine frühen Interessen und intellektuellen Bestrebungen stark. Durch den theologischen Austausch in seiner Familie und in der Schule entwickelte sich in ihm schon früh ein angeborenes Interesse an Philosophie und Theologie.
Im Jahr 1909 immatrikulierte sich Heidegger an der Universität Freiburg zum Studium der Theologie und Philosophie, die er damals als ein einziges Fach belegen musste. In dieser Zeit lernte er den für seine Phänomenologie bekannten Edmund Husserl kennen und wurde dessen Schüler. Fasziniert von Husserls Phänomenologie versuchte er anschließend, intellektuelle Verbindungen zu diesem großen Denker aufzubauen.
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, hatte Heidegger keine andere Wahl, als sich bei den deutschen Streitkräften zu melden, was sein Universitätsstudium behinderte. Die schreckliche Realität seines Militärdienstes sowie die philosophischen Fragen, die der Krieg aufwarf, beeinflussten sein Denken über die menschliche Existenz und dienten ihm als Einführung in die Philosophie, die er später verfolgen sollte.
Nach dem Krieg kehrte Heidegger zu seinem Fachgebiet zurück und begann mit der Forschung auf dem Gebiet der Ontologie. Er versuchte, die grundlegenden Probleme des Seins und der Realität zu beantworten, indem er auf seine Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgriff. Seine Beziehung zu den alten Griechen und insbesondere zu Aristoteles half ihm auch dabei, den Rahmen seiner Philosophie zu schaffen und ihn auf tiefere Fragen auszurichten.
In dieser Zeit begann er mit dem Verfassen der ersten Entwürfe seines späteren Meisterwerks „Sein und Zeit“. Ein Schlüsselaspekt, der zur Entwicklung seiner Philosophie beitrug und auch heute noch Forscher und Denker motiviert, ist die einzigartige Kombination zweier wesentlicher Dimensionen: seine direkten und indirekten Erfahrungsformen sowie lange Phasen der Selbstbeobachtung.
Kapitel I
HEIDEGGERS KONTEXT
Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts:
Deutschland war zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt von gesellschaftlichen, politischen und geistigen Umbrüchen. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Land politisch unruhig, hatte wirtschaftliche Schwierigkeiten und litt unter der Demütigung, die ihm der Versailler Vertrag zugefügt hatte. 1919 wurde die Weimarer Republik gegründet, doch aufgrund des instabilen politischen Klimas, das durch Inflation, Armut und Extremismus verursacht wurde, gelang es ihr nicht, ihre Stabilität aufrechtzuerhalten.
Während dieser Zeit entstanden durch kulturelle Bewegungen wie Dadaismus, Bauhaus und Expressionismus neue Formen der Kunst und des Ausdrucks. Gleichzeitig erleichterte der Aufstieg des Nationalismus und Militarismus den Aufstieg der autoritären Regierung.
Der Reichtum und die Vielfalt seiner Geschichte erleichterten die Entwicklung der philosophischen Ideen Martin Heideggers in diesem Kontext. Die Spannung zwischen Nationalismus und Extremismus, verbunden mit intellektuellem Eifer und historischer Gewalt, führte zur Entstehung von „Sein und Zeit“ als Antwort auf die existenziellen Herausforderungen der Zeit.
Um die Aspekte zu beleuchten, die Heideggers Leben und Philosophie sowie die ethnische Zugehörigkeit Deutschlands beeinflusst haben, ist es wichtig, die Geschichte des Landes zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu kennen.
Soziale Dynamik und intellektuelles Klima Europas in den 1920er Jahren:
Im Römerbrief führten die Kämpfe des Ersten Weltkriegs zu Ernüchterung und Neubewertung. So kam es in den frühen 1920er Jahren zu intellektuellen, kulturellen und sozialen Veränderungen. Die neue Moderne brachte neue Ansätze mit sich, die die Individualität betonten. Tief verwurzelte Werte und traditionelle Normen wurden energisch abgelehnt, während neue Ideen eingeführt wurden. Die Gesellschaft hat eine rasante Urbanisierung und Industrialisierung erlebt, die zu tiefgreifenden Veränderungen in der Denk- und Lebensweise geführt haben.
Gleichzeitig erlebte die europäische Gesellschaft eine starke künstlerische, philosophische und wissenschaftliche Aktivität. Die Existenz von Sokrates und Nietzsche bleibt eine weit verbreitete Denkschule, die die Existenz tiefgreifend beeinflusst. Gleichzeitig beeinflussten neue Zweige der Soziologie und Psychologie die Konzeption der Sozial- und Geisteswissenschaften nachhaltig. Die Philosophie des Wiener Kreises verknüpfte traditionelle metaphysische Argumente mit der Idee der logistischen Philosophie und trug so zur Bildung neuer Ideen und zur Evolution von Glaubensvorstellungen bei.
Gleichzeitig drehte sich die psychokulturelle Perspektive des Europas der 1920er Jahre um eine Revolution im literarischen und künstlerischen Bereich. Alle Dadaisten, ebenso wie die Surrealisten und die Bauhaus-Schule, strebten danach, die Moderne anzunehmen und Kunst und Literatur zu einem politischen Kommentar und einer Kritik des Status Quo zu verbinden. Dazu gehörte auch eine völlige Revolution in der Kunstphilosophie sowie in den Grenzen zwischen Skulptur und Malerei und den bereits erwähnten Bausteinen der Quanten- und Relativitätsmechanik. Diese Ereignisse veränderten die Philosophie radikal und führten zu neuen konstruktivistischen und modernen Überlegungen zur philosophischen Spekulation.
Gleichzeitig war die politische Landschaft Europas in den 1920er Jahren nicht weniger chaotisch: Nach dem Zusammenbruch der traditionellen Modelle entstanden neue faschistische und kommunistische Modelle. Die kriegsbedingten Unruhen der 1920er Jahre waren anarchisch und befreiten die Gesellschaft vom Joch extremer Gewalt: Sie wurden einerseits von radikalen politischen Bewegungen und andererseits von einer zivilisierten, selbstverwalteten Gemeinschaftsgesellschaft angeführt.
Der Einfluss der politischen Situation auf ihre Ideologien:
Der Erste Weltkrieg, der Versailler Vertrag und später die Weltwirtschaftskrise stürzten Deutschland in politische Konflikte, die den allgemeinen Zustand der Welt zu dieser Zeit widerspiegelten. All diese Faktoren haben Martin Heideggers ideologisches Grundgerüst geprägt und das Denken in seinem berühmtesten Werk „Sein und Zeit“ bestimmt.
Die Niederlage der Weimarer Republik und der Aufstieg des Faschismus veränderten viele Postulate von Heideggers Philosophie. Die Schnittstelle zwischen dem politischen Sein und seiner eigenen kurzen Erfahrung des Nationalsozialismus verdeutlicht die tiefen Verbindungen zwischen Philosophie und Politik.
Die gegenseitige Abhängigkeit der Realität als Individuum, als politisches Subjekt, der ewige Versuch, die Nichtexistenz des Totalitarismus zu erreichen, und das Paradox der Existenz von Bedeutung sind einige der miteinander verbundenen Themen in Heideggers Philosophie.
Religiöse Unterströmungen im Nachkriegsdeutschland:
Deutschland stand nach dem Ersten Weltkrieg vor enormen gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. In der Nachkriegszeit wurden Kultur und intellektuelles Denken stark von der Religion beeinflusst. Dieser Wandel brachte einen Umbruch im Glauben und in der Religion mit sich, begleitet von einer ganzen Phase der Selbstbeobachtung und der Hinterfragung des Sinns des Lebens.
In einem Kontext der Unsicherheit verließen sich die Menschen auf die therapeutische Kraft der Theologen, um angesichts von Glaubensfragen und der Bedeutung des Krieges Trost zu finden. Andere Bewegungen sind entstanden. Theologen wie Karl Barth und Rudolf Bultmann versuchten, die durch den Krieg hervorgerufene Krise der religiösen Gewissheit durch ein tieferes Verständnis der Religion zu lösen.
Gleichzeitig begannen die Lehren der östlichen Religionen, sich einer Faszination für die Emotionen hinzugeben, die das Leid der Globalisierung hervorrief. Die Schriften der berühmten Meister Eckhart und Jakob Böhme eröffneten eine neue Perspektive auf die Existenzangst, die sie beherrschte.
Auch religiöse Debatten waren mit der Entwicklung der Philosophie dieser Zeit verknüpft, insbesondere mit der Arbeit existenzialistischer Philosophen wie Kierkegaard und Nietzsche. Die Elemente Angst, Verzweiflung und Suche nach einem authentischen Leben waren in den spirituellen Konflikten des Nachkriegsdeutschlands tief verwurzelt.
Darüber hinaus nahm die Suche nach einer neuen religiösen Orientierung im Kontext einer Gesellschaft, die einen politischen und sozialen Wandel durchlief, eine neue Form an. Während der Weimarer Republik verschärfte ein sozialer Konflikt zwischen orthodoxen religiösen Institutionen und modernistischen Ansichten die religiösen Schwierigkeiten noch weiter.
Mit anderen Worten: Die religiösen Themen im Nachkriegsdeutschland stellen eine reiche Mischung komplexer Soziologie, Philosophie und Religion dar. Zusammengenommen bildeten diese unterschiedlichen Wechselbeziehungen die existenziellen Probleme, die in Martin Heideggers großem Werk „Sein und Zeit“ entwickelt wurden.
Philosophische Traditionen und Neuerungen vor „Sein und Zeit“:
Der Großteil der westeuropäischen Philosophie entstand im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Es gab noch immer Überbleibsel des deutschen Idealismus sowie die Anfänge der Phänomenologie, die auf den deutschen Philosophen Husserl zurückzuführen waren. Diese beiden kombinierten Phänomene haben zu unterschiedlichen und manchmal widersprüchlichen Gedanken geführt. Logik und Philosophie haben nach dem Ersten Weltkrieg stark gelitten. Bei vielen Menschen zeigen sich Anzeichen von Existenzängsten und ein Gefühl der Suche nach Authentizität.
Da es gemeinsame Wurzeln mit der traditionellen Metaphysik hat, ebnete es den Weg für radikalere metaphysische Ideen, die einen beträchtlichen Aufschwung erlebt haben. Der Existentialismus erfreut sich immenser Popularität. Kierkegaard und Nietzsche begannen dank der Säkularisierung, sich für den Menschen zu interessieren. Die Menschen begannen, ihre gelebte Erfahrung höher zu schätzen als abstrakte Gedanken.
In dieser Zeit erlebte die Philosophie einen Wandel und die Phänomenologie entstand. Husserl schlug mit der Phänomenologie eine neue erkenntnistheoretische Strategie vor und wurde zum Vater dieser neuen Bewegung. Sein Engagement für ein direktes Verständnis von Erfahrungen hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Heideggers Philosophie.
Das Gespenst der traditionellen Metaphysik, verkörpert durch Persönlichkeiten wie Aristoteles und Descartes, schwebte über dem europäischen Denken. Heideggers Einbindung in diese Traditionen erwies sich als entscheidend für die Entwicklung seiner einzigartigen Vorstellungen von Ontologie und dem Wesen des Seins.
Ökonomische Faktoren, die die europäische Philosophie beeinflussen:
Seit dem 20. Jahrhundert war Europa mit einer Reihe wirtschaftlicher Probleme konfrontiert, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelten und zu weitaus tiefgreifenderen philosophischen Veränderungen führten. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die europäischen Nationen gezwungen, sich mit den Folgen wirtschaftlicher Zerstörung, Hyperinflation und Arbeitsplatzmangel auseinanderzusetzen. Dieses finanzielle Chaos schuf ein Klima der Verwirrung und Angst und löste eine starke Welle des Nachdenkens und philosophischer Auseinandersetzungen mit der Realität des Lebens aus.
Der wirtschaftliche Niedergang hat das Verständnis und die Zugänglichkeit dieser philosophischen Konzepte beeinträchtigt. Die überwiegende Mehrheit der Intellektuellen und Denker war wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt, die sie daran hinderten, gründliche Forschung zu betreiben, Artikel zu veröffentlichen oder sich auch nur an konstruktiven Debatten zu beteiligen. Darüber hinaus haben die wirtschaftlichen Zwänge, denen akademische Institutionen und Verlage unterliegen, dazu geführt, dass diese ihre Mittel, Ressourcen und Aufmerksamkeit nicht mehr der Verbreitung und Entwicklung philosophischen Wissens widmen. Dadurch ist ein Umfeld entstanden, das der Entwicklung authentischer Ideen nicht förderlich ist.
Die Transversalität von Philosophie und Ökonomie in den Beziehungen zwischen Industrie, Technologie und menschlichen Beziehungen wurde deutlich aufgezeigt. Die zunehmende industrielle Revolution und der weitverbreitete Aufstieg der Konsumkultur erforderten ein tieferes Verständnis der Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Struktur des Bewusstseins, der Gesellschaft und der Ethik. Philosophen haben sich mit Fragen wie den moralischen Konsequenzen des Kapitalismus, der Umwandlung von Wissen in eine Ware und den Auswirkungen dieser Wirtschaftssysteme auf die menschliche Identität und das menschliche Handeln befasst.
Aufgrund der Existenz verschiedener Wirtschaftssysteme, darunter Marxismus, Sozialismus und Kapitalismus, die bereits Teil umfassenderer philosophischer Debatten waren, wurden wirtschaftliche Überlegungen mit bestimmten politischen Ideologien verflochten. Der Zusammenprall dieser Wirtschaftssysteme und ihrer konkreten Praktiken ebnete den Weg für die Entwicklung von Diskussionen über Egalitarismus, soziale Gerechtigkeit und die moralischen Dimensionen des Kapitalismus.
Aufgrund der politischen Unruhen, mit denen die gesamte europäische Gesellschaft konfrontiert war, mussten sich Philosophen täglich mit soziokulturellen Veränderungen auseinandersetzen. Wo enden Existenz und Sein, und wo beginnen die Werte der Gesellschaft? Das Verständnis dieser Probleme ist von größter Bedeutung, wobei gleichzeitig das Chaos der wirtschaftlichen Instabilität im Auge behalten werden muss. Offensichtlich hatten diese wirtschaftlichen Faktoren großen Einfluss auf die Themen, Debatten und Erwartungen der europäischen Philosophie jener Zeit.
Kapitel II
EINFLÜSSE UND QUELLEN
Phänomenologische Ursprünge von Martin Heidegger:
Heideggers phänomenologische Anfänge reichen zurück bis in seine Studienjahre der Philosophie in Freiburg und anschließend in die Beschäftigung mit den Werken Edmund Husserls. Dort beteiligte er sich an der phänomenologischen Bewegung in der europäischen Philosophie des 20. Jahrhunderts.
Sein Engagement für die Phänomenologie führte ihn dazu, sich mit einigen grundlegenden Problemen der menschlichen Erfahrung und Existenz auseinanderzusetzen. In Anlehnung an Husserls Ansatz zum Bewusstsein und zu den Phänomenen untersuchte er die grundlegenden Bestandteile der menschlichen Existenz sowie die Verbindung zwischen In-der-Welt-Sein, Zeitlichkeit und Bedeutung.
Was Heideggers phänomenologische Wurzeln am meisten auszeichnet, ist seine Entschlossenheit, das Skelett der menschlichen Existenz durch die Vermittlung persönlicher Erfahrungen offenzulegen, im Gegensatz zu anderen metaphysischen Methoden. Damit entfernte er sich von den Methoden der klassischen Philosophie und wollte seine Studien auf den Einzelnen und seine Lebenserfahrung konzentrieren, insbesondere auf die ihn umgebenden alltäglichen Phänomene und Situationen.
Heideggers Studium der Phänomenologie zeigt sich in seiner eingehenden Analyse von Wörtern als Mittel zum Ausdruck und zur Offenbarung des menschlichen Lebens. In „Sein und Zeit“ untersucht Heidegger den großen Einfluss der Sprache auf das Verständnis des Seins und betont ihre Wechselbeziehung mit der Vision der Realität und der Manifestation einer sinnvollen Existenz in der Zeit.
Darüber hinaus wurden die früheren phänomenologischen Einflüsse von Heideggers Werk durch seinen frühen innovativen Ansatz zur Ontologie definiert, in dem er versuchte, die grundlegenden existenziellen Rahmenbedingungen der menschlichen Lebensweise hervorzuheben. Indem er das Sein in seiner radikalsten Form analysierte, wollte er die üblichen Grenzen der Ontologie überschreiten und eine neue Perspektive auf den Platz des Menschen in der Welt präsentieren.
Letztendlich ebneten die phänomenologischen Fragen in der Geschichte der Ontologie den Weg für die Existenzphänomenologie als einen der produktivsten Zweige seiner Philosophie, der die grundlegendsten Änderungen in der Ausrichtung der Lebensphilosophie und seiner Gedanken zur menschlichen Existenz für zukünftige Generationen anstrebte.
Der Einfluss von Edmund Husserl auf Heideggers Denken:
Der deutsche Philosoph Edmund Husserl, Begründer der Phänomenologie, ist für seinen Einfluss auf die Philosophie Martin Heideggers bekannt. Martins Entwicklung wurde maßgeblich durch seine enge Beziehung zu Husserl und dessen phänomenologischer Methode beeinflusst. Der Einfluss von Husserls phänomenologischen Techniken und Methoden ist in „Sein und Zeit“, seinem Meisterwerk, deutlich spürbar.
Als Assistent des berühmten Philosophen an der Universität Freiburg erhielt er Zugang zu Husserls Ideen. Dies war einer der wichtigsten Wendepunkte in seinem Denken, als er beschloss, seine Philosophie durch die Übernahme von Husserls Techniken neu auszurichten. Husserls Betonung der Untersuchung des Bewusstseins und der persönlichen Erfahrung hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das idealistische Denken und trug zur Gestaltung der mit Heidegger verbundenen Philosophie der Existenzphänomenologie bei.
Die phänomenologische Reduktion war Husserls Haupteinflusspunkt. Er wollte, dass wir alle natürlichen Einstellungen und Vorurteile aufgeben, um das Wesen der Phänomene zu verstehen. Dieser Ansatz integriert Paradigmenwechsel in philosophische Strukturen. Darüber hinaus wird dieser Begriff verwendet, um die grundlegenden Bestandteile des menschlichen Lebens und seines Daseins in der Welt zu erklären.
Darüber hinaus rückten Husserls Studien zum Bewusstsein und seiner Orientierung bzw. seinem intendierten „Objekt“ in den Mittelpunkt von Heideggers Interesse. Husserls Erläuterung der Intentionalität diente als Grundlage für Heideggers spätere Untersuchung der menschlichen Beziehungen zur Welt, die schließlich seine ontologischen Untersuchungen in „Sein und Zeit“ prägten.
Die transzendentale Phänomenologie und ihr Interesse an der Aufdeckung der integrierenden Strukturen des Bewusstseins beeinflussten Heideggers Verständnis der Existenzanalyse zutiefst. Die Integration der Husserlschen Methode in Heideggers Denken führte zu einer eingehenden Untersuchung der ontologischen Konstitution des Daseins und seines authentischen Seins.
Die Interaktion zwischen den beiden Philosophen beinhaltete auch ihre gegenseitige Meinungsverschiedenheit hinsichtlich des Umfangs der Phänomenologie. Husserl befasste sich ausschließlich mit der eingehenden und direkten Untersuchung des Bewusstseins und seiner willkürlichen Handlungen, während Heidegger sich aus ontologischer Sicht auf die Bedingungen der menschlichen Existenz konzentrierte. Dieser Unterschied stellte einen wichtigen Dialog dar und kennzeichnete Heideggers radikalen Bruch mit Husserls Phänomenologie. Er zeigte, wie sich sein philosophisches Projekt in eine Untersuchung der ontologischen Strukturen des Seins verwandelte.
Existenzielle Merkmale in „Sein und Zeit“:
Wie wir bereits gesehen haben, ist der Existentialismus einer der wichtigsten Aspekte von Martin Heideggers „Sein und Zeit“. Die Analyse des Seins und der Existenz ohne eine existenzielle Komponente fehlt in seinem Werk völlig. Wie bereits erwähnt, werde ich die existenziellen Komponenten seines Textes analysieren. Dies wurde im vorherigen Kapitel klar erklärt. Anstatt sich auf traditionelle Philosophien zu verlassen, entwickelte Heidegger eine innovative Methodologie im Hinblick auf den Existentialismus, die sich auf das Verständnis des menschlichen Lebens durch den Begriff „Dasein“ konzentrierte, der eine ausschließlich menschliche Seinsweise bezeichnet.
Heidegger untersucht das Dasein in seinen retrospektiven Analysen der Seinserfahrung, die von der wesentlichen Frage des Seins ausgehen. In seinem Bemühen, den existentiellen Zustand und die existentielle Bedingung des Daseins zu verstehen, versucht Heidegger zu verstehen, was es bedeutet, in der Welt zu sein. Während die Zeitlichkeit, Stimmung und Alltäglichkeit des Daseins untersucht werden, wird die menschliche Existenz durch das Prisma Heideggers tiefgreifend enthüllt.
Die von Heidegger in „Sein und Zeit“ vorgenommene Analyse basiert auf dem Konzept der Angst bzw. der Existenzangst. Heidegger ist der Ansicht, dass Angst die ontologische Struktur des Daseins offenbart, das heißt seine grundlegende Spannung zwischen Existenz und Nichtexistenz. Diese Angst ermöglicht es uns, authentisches Engagement gegenüber unseren eigenen Grenzen zu verstehen und trägt dazu bei, die Existenzbedingungen in all ihren Dimensionen zu verstehen.
Heideggers Behandlung von Authentizität und Unechtheit offenbart das strukturelle Paradox der Existenz des Daseins. Es beschreibt die Machtlosigkeit des Einzelnen angesichts unterdrückender gesellschaftlicher Normen und einer sich ständig ändernden öffentlichen Stimmung, die ihn tief von seinem sogenannten wahren Selbst entfernt. Heideggers Existenzanalysen legen die Existenz einer authentischen Seinsweise nahe, die eine radikale Bestätigung der eigenen Person als Mensch erfordert, im Widerstand gegen gesellschaftliche Konformität.
In diesem Licht stellt Heideggers Untersuchung des Todes als ultimative Möglichkeit das Dasein vor die Herausforderung, sich mit seiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Die Konfrontation mit dem Tod führt uns zu dem Verständnis, wie die Akzeptanz der Zwänge der Existenz aus einer bestimmten Perspektive zu einem authentischen Leben beitragen kann.
Eine besondere Resonanz der existenzialistischen Elemente Heideggers findet sich im weiteren Kreis des existenzialistischen Denkens, beginnend mit Kierkegaard, Nietzsche und Sartre, der auch in „Sein und Zeit“ untersucht wird. Heideggers tiefgründiges Verständnis der menschlichen Natur hatte zweifellos einen erheblichen Einfluss, von der Philosophie und Psychologie bis hin zur Literatur und Kunst.
Auswirkungen des Aristoteles-Rahmens:
Heideggers Verständnis von Ontologie, Metaphysik und Sein wurde aus der Perspektive des Aristoteles geformt, die als Rahmen für „Sein und Zeit“ diente. Gerade Aristoteles' Trennung von Wirklichkeit und Möglichkeit, also von Wesen und Existenz, sowie sein Substanzbegriff hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf Heideggers Untersuchung der schädlichen Bestandteile der Strukturen der menschlichen Existenz.
Aristotelische Vorstellungen von Finalität und finaler Ursache, die er Teleologie nannte, hatten einen erheblichen Einfluss auf Heideggers Analyse der menschlichen Authentizität und sinnvollen Existenz. Die strengere und bedingtere Konzeption der Eudaimonie – „Glück“ oder „Gedeihen“ – hat wesentlich zum Verständnis der Natur der authentischen Existenz des Daseins (des Menschen) beigetragen, die Heidegger in diesem Sinne vor Augen hat.
Aristoteles‘ ethischer Rahmen (seine Tugendethik und praktische Weisheit oder Phronesis) wies bemerkenswerte Parallelen zu Heideggers Interpretation von Authentizität, Situiertheit und den ethischen Aspekten des Seins zum Tod hin auf. Diskussionen über Fürsorge, Bewusstsein und ethisches Verhalten im authentischen Dasein wurden später von Heidegger in den Dialog über die Ethikphilosophie des Aristoteles integriert.
Darüber hinaus beeinflussten die erkenntnistheoretischen Theorien des Aristoteles, insbesondere jene, die sich auf den Wissenserwerb durch Erfahrung und Wahrnehmung beziehen, Heideggers Denken über die Phänomenologie und den körperlichen Charakter der menschlichen Existenz. Aristoteles‘ Übernahme oder Aneignung von Wahrheit, Verständnis und Interpretation brachte Heideggers phänomenologische Untersuchungen zur Weltlichkeit und der Offenbarung des Seins erheblich voran.
Kierkegaard und Nietzsche: Vorläufer des Existentialismus.
Søren Kierkegaard und Friedrich Nietzsche sind wahrscheinlich die beiden strengsten Denker, deren Beitrag zur Entwicklung des existenzialistischen Denkens bemerkenswert ist. Ihre Arbeit war ein Eckpfeiler der Existenzialismusbewegung und anderer Denker wie Martin Heidegger. Wie immer begannen diese beiden Denker mit dem Menschen: Existenz, Sinn, Freiheit und die grundlegende Frage der Authentizität.
Eine der Grundideen von Kierkegaards Philosophie ist die Existenz als Konzept. Er analysierte die verschiedenen Ebenen menschlicher Erfahrung und konzentrierte sich dabei auf die Auseinandersetzung des Einzelnen mit dem Leben und darauf, wie er die Existenz als Realität wahrnimmt. Kierkegaard konzentriert sich auf die individuelle Dimension der Existenz und betont, dass die subjektive Erfahrung eines Individuums im Kontext eines lebenswerten Lebens und einer sinnvollen Existenz von Bedeutung ist.
Kierkegaards Konzept der Authentizität bezieht sich auf die Fähigkeit, man selbst zu sein, unabhängig von gesellschaftlichen Idealen und Erwartungen. Er stellte den identitätszerstörenden Konformismus in Frage und plädierte für eine authentische Existenz, die auf persönlicher Verantwortung, Selbstverständnis und einer tiefen und aufrichtigen Sorge um die wichtigsten Fragen des Lebens beruht. Für Kierkegaard bedeutet Authentizität, die der Existenz innewohnenden Unsicherheiten zu akzeptieren und aktiv Entscheidungen zu treffen, die die eigene Identität und Werte genau widerspiegeln.