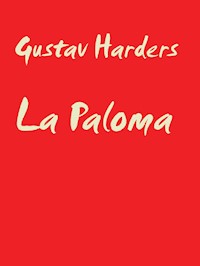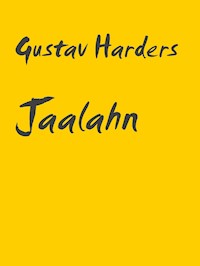
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies Buch möchte zunächst ein Bild aus dem heutigen Indianerlager in Amerika geben. Sodann möchte es jenen Leuten, die für die Indianer, als einem schmutzigen, faulen, durch Trunk verkommenen Volk nichts übrig haben, zeigen, dass ihre Ansicht, es sei daraus nichts zu machen, eine irrige, auf Unkenntnis der Indianerart beruhende ist. Es möchte ihnen dies eigenartige Volk näher bringen und sie erkennen lassen, dass alle Zivilisationsversuche, zumal solche, die zwangsweise durchgeführt werden, vergeblich sind, wenn nicht Evangelisation vorangegangen ist oder wenigstens mit den Zivilisationsbestrebungen Hand in Hand arbeitet. Die in der Erzählung berichteten Begebenheiten beruhen fast ausschließlich auf Wahrheit, nur dass, wie man das ja wohl gelegentlich tut, um ein Zeit- und Sittenbild in Erzählungsform zu bieten, von Verschiedenen Erlebtes, Gehörtes, Gesehenes an einen Ort, in eine Zeit und auf einzelne Personen zusammengetragen ist. Erzähler und Verfasser wünschen nicht als identische Personen angesehen zu werden. Es ist dies ein erster Versuch des Verfassers, eine derartige Erzählung zu schreiben. Der geehrte Leser wolle sie freundlich und milde aufnehmen. Arizona, Juni 1911 Gustav Harders
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jaalahn
Zum Buch1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. KapitelSchlussImpressumZum Buch
Dies Buch möchte zunächst ein Bild aus dem heutigen Indianerlager in Amerika geben. Sodann möchte es jenen Leuten, die für die Indianer, als einem schmutzigen, faulen, durch Trunk verkommenen Volk nichts übrig haben, zeigen, dass ihre Ansicht, es sei daraus nichts zu machen, eine irrige, auf Unkenntnis der Indianerart beruhende ist. Es möchte ihnen dies eigenartige Volk näher bringen und sie erkennen lassen, dass alle Zivilisationsversuche, zumal solche, die zwangsweise durchgeführt werden, vergeblich sind, wenn nicht Evangelisation vorangegangen ist oder wenigstens mit den Zivilisationsbestrebungen Hand in Hand arbeitet.
Die in der Erzählung berichteten Begebenheiten beruhen fast ausschließlich auf Wahrheit, nur dass, wie man das ja wohl gelegentlich tut, um ein Zeit- und Sittenbild in Erzählungsform zu bieten, von Verschiedenen Erlebtes, Gehörtes, Gesehenes an einen Ort, in eine Zeit und auf einzelne Personen zusammengetragen ist. Erzähler und Verfasser wünschen nicht als identische Personen angesehen zu werden.
Es ist dies ein erster Versuch des Verfassers, eine derartige Erzählung zu schreiben. Der geehrte Leser wolle sie freundlich und milde aufnehmen.
Arizona, Juni 1911
Gustav Harders
Gustav Harders wurde 1863 in Kiel geboren. 1889 wanderte er nach Amerika aus und heiratete dort. Er war Pastor und Rektor der lutherischen Kirche und Schule in Milwaukee und diente anschließend bis zu seinem Tod im Jahr 1917 in Indianerreservationen in Arizona als christlicher Missionar.
1. Kapitel
„Ein kranker Mann“, tönt es hinter mir, und zugleich zupft jemand an meinem Hemdsärmel. Ich drehe mich um. Hinter mir steht ein altes Indianerweib und weist mit dem Zeigefinger der Rechten auf eine der etwa dreißig Hütten, in deren Mitte ich soeben zu den Indianern gepredigt hatte.
„Ein kranker Mann“, sagt sie noch einmal, „dort, dort!“
Sie packt mich an meinem Gürtel und macht einen Versuch, mich nach der Hütte hinzuziehen. Die Alte ist offenbar Gattin oder Mutter des Kranken, und es reut mich, dass sie mich an dem Krankenbett haben will. Ich gehe mit ihr.
Als ich in die Nähe der Hütte komme, fällt mir sofort die große Sauberkeit auf, in der die Umgebung gehalten ist. Da liegen keine Knochen, Blechkannen, Hasenfelle, Hühnerfedern, Lumpen und anderer Abfall umher wie meistens in den Indianerhütten, und auch die Hütte selbst macht keinen üblen Eindruck.
Nicht in ihrer Bauart unterscheidet sie sich von den übrigen: Auch sie ist in Halbkugelform hergestellt. Bei einem Durchmesser von zirka zehn Fuß sind etwa zwölf Fuß lange Strauchschößlinge in den Boden gesteckt; sie sind alle nach der Mitte hin heruntergebogen und dort zusammengebunden. Aber die Leinwand, die darüber gespannt ist, ist sauber und stark; ihre einzelnen Stücke sind geschickt und sorgfältig befestigt; glatt und prall ist die Leinwand über das Strauchwerk gezogen, schier wie das Lederkleid eines Schlagballes besten Fabrikats.
Mein Dolmetscher Nauogo, der mir gefolgt ist, flüstert mir zu: „Der Mann ist schwindsüchtig, er ist vor einigen Monaten aus G., wo er gearbeitet hat, krank hierher heimgekehrt.“
Damit sind wir an der Hütte herangekommen. Nauogo lüftet das Zelttuch, und wir kriechen durch die drei Fuß hohe Öffnung ins Innere.
Es ist ein heißer Tag. Ich trage nur ein leichtes seidenes Hemd und ein Paar leinener Beinkleider. Aber in der Hütte brennt ein kräftiges Feuer, neben dem der Kranke, in mehrere wollene Decken gehüllt, auf dem Erdboden ruht.
Er hat den Kopf in die Rechte gestützt, während er mit der Linken das Feuer schürt. Die Hand, die den Schürstock hält, ist abgemagert, aber wohlgeformt, wie meistens die Indianerhände, die schwere Arbeit nicht zu tun pflegen.
Wir setzen uns am Feuer nieder. Die Indianer Arizonas, unter denen ich mich hier aufhalte, üben die Sitte des Grüßens nicht, wenn sie jemandem begegnen oder in eines anderen Hütte treten. Man nimmt einfach am Feuer Platz und wartet stumm ein paar Minuten, bevor ein Gespräch begonnen wird. Ich mache es auch so.
Der Kranke hat uns noch keines Blickes gewürdigt. Er hat den Kopf etwas nach vorn geneigt, und ein breitrandiger Hut, den er trägt, verdeckt uns das Gesicht vollständig.
Jetzt kommt auch die Alte herein und setzt sich gleich uns ans Feuer.
„Seine Mutter“, flüstert Nauogo, „sie hat nur das eine Kind noch. Die anderen sind schon alle tot. Sie hat schon fast alle ihre Pferde, wohl an hundert, verkauft, um all die Ärzte und Medizinmänner zu bezahlen, bei denen sie Hilfe für ihren Sohn gesucht. Alles umsonst. Sie verstehen kein Englisch“, sagt er, als ich ihm ein Zeichen mache, er solle nicht so reden.
Ich halte es jetzt für gegeben, zu dem Kranken zu sprechen. Weil ich als Geladener in der Hütte bin, brauche ich nicht auf eine Anrede des Hausherrn zu warten, wie es sonst die Sitte erfordert. „Habe gehört, dass du krank bist, mein Freund, darum bin ich zu dir gekommen.“
Er hat nichts darauf zu erwidern.
„Ich bin kein Arzt“, hebe ich wieder an. „Medizin kann ich dir nicht bringen; aber ich kann dir von jemandem erzählen, der mehr vermag als alle Ärzte der Welt und der helfen kann und will, wo kein Arzt und Medizinmann mehr Hilfe weiß. Soll ich einmal von ihm reden?“
Keine Antwort. Keine Bewegung in dem lang hingestreckten Körper; nur die linke Hand schürt müde und lässig das hell lodernde Feuer, das des Schürens nicht bedarf.
Ich rede weiter. Nauogo übersetzt Satz für Satz in die Sprache des Kranken. „Der, von dem ich dir eben sagte, hat mich zu dir geschickt. Ich bin sein Diener. Er hat mich geheißen, wo Kranke, Elende, Sünder, Mühselige, Sterbende, Gefangene, Verlassene sind, da soll ich hingehen und ihnen von ihm erzählen. Soll ich dir einmal seinen Namen nennen? Soll ich dir sagen, wer er ist und wie und wo du ihn finden kannst?“
Wieder keine Antwort. Ich aber fahre fort und erzähle ihm von Jesu Christo, dem Sohne Gottes, der in diese Welt kam, zu suchen und selig zu machen, was verloren war, der sich einen Arzt heißt und der da sagt: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, die Schwachen.
Es ist, als wenn ich zu einem Stein redete. Der Mensch spricht nicht, er rührt sich nicht. Auch das Schüren im Feuer hat er eingestellt.
Nauogo wird schon ungeduldig. Er sagt: „Wir wollen gehen. Er will nichts von dir wissen. Er spricht nicht.“
Aber ich mache noch einen Versuch. Ich sagte: „Wir können zu dem großen Helfer reden. Er hat versprochen, bevor er diese Welt wieder verließ: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. – Wir sind unser vier. Du, deine Mutter, Nauogo und ich. Wollen wir einmal mit ihm reden?“
Meine Erwartung, er würde nun eine abweisende Bemerkung oder wenigstens ein abwehrendes Zeichen machen, erwies sich als irrig. Er gab keinen Laut von sich, noch kam irgendwelche Bewegung in dem noch immer in derselben Lage hingestreckten Körper.
„Wenn man mit Jesu redet, so nennt man das Beten. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Du weißt nicht, wie man zu ihm betet. Mich hat man das gelehrt, und darum will ich jetzt für dich zu ihm beten. Ich weiß, es ist ihm recht, wenn ich das tue, und er hört es gern.“ Und dann betete ich.
Ich hatte das Amen gesprochen. Als dann immer noch kein Leben in den Kranken kam, war es mit Nauogos Geduld zu Ende. Er sprang auf und sagte: „Ich gehe“, und er wandte sich zum Ausgang.
Ich erhob mich auch; und während ich das tat, legte ich meine Hand auf die Schulter des Kranken, und ohne mir weiter etwas dabei zu denken, sagte ich in seiner Sprache die Abschiedsworte: „Jaalahn schick – e – i!“ Das ist: Leb wohl, auf Wiedersehen, mein Freund.
Da, mit einem Ruck, so kurz und hart, dass der Hut herunter glitt, flog der Kopf des Kranken in die Höhe. Ein Wort in seiner Muttersprache aus des Fremdlings Mund hatte ihn aus seiner Zurückhaltung herausgerissen.
Ich erschrak und fuhr zusammen, weniger infolge dessen, was geschehen, als ob des Anblicks, der sich mir so ganz unerwartet bot. Weder im Leben noch auf Bildern hatte ich je ein so schönes, edles Antlitz gesehen. Wie feinster brauner Seidensammet erschien die dunkle, rot durchglühte Haut. Der Mund, ein wenig geöffnet, zeigte die schönsten weißen Zähne. Leise bebten die Flügel der stolzen, leicht gebogenen Nase. Und – die Augen! In ihrer schwarzen Tiefe brennt ein Feuer, ein Feuer, man weiß nicht, ob es aus dem Himmel oder aus der Hölle stammt. Und die Augen, sie richten sich auf mich. Sie suchen die meinen. Sie lassen mir keine Zeit, darüber zu sinnen, was das für ein Feuer sei, das da in ihnen brennt; aber sie lassen es mich fühlen. Es ist mir, als wollten ihre Strahlen sich in mein Innerstes bohren, als lechzten sie danach, mir meine Seele auszuschlürfen.
Mein Denken verwirrt sich, meine Geistesruhe verlässt mich.
Aber nur momentan. Sofort mir klar: Hier gilt es einen Kampf. In diesem Kampf unterliegen, heißt, alles verlieren.
Auge wider Auge. Blick wider Blick. Und von dem brennenden Verlangen erfüllt, Liebe und Vertrauen dieses schönen Menschenkindes zu gewinnen und ihm die ganze Liebe, deren das eigene Herz fähig ist, zu schenken, senke ich meiner Augen Blicke in die seinen.
Da öffnen sich die Augen noch weiter, und das Feuerbrennen und Strahlenschießen wird heftiger, lebhafter, wie unerwarteter Widerstand das wirkt. Die Augen fangen an zu reden, ich weiß nicht, was; es ist mir zurzeit auch ganz gleichgültig; nur heißer, glühender wird mein Verlangen, die Seele dieses Menschen zu gewinnen, für mich, für den, in dessen Dienst ich stehe, Jesum von Nazareth, der Juden König.
Obwohl mir nicht klar ist, was die beiden schwarzen Augen da reden, ist mir’s doch, als ob jedes ihrer unausgesprochenen Worte dazu beitrüge, in meinem Herzen die Liebesglut zu meinem Gegner stärker, lichter zu entfachen. Sie wollen töten, vernichten, die Augen; aber sie beleben, erwecken, nähren. Anstatt des Gegners Kräfte zu schwächen und lahmzulegen, stärken sie dieselben von Sekunde zu Sekunde.
So konnte es nicht anders enden, als wie es geschah. Nachdem wir uns wohl zwei Minuten angeschaut und mit den Blicken gerungen, ergab sich der Indianer. Langsam senkten sich Blick und Haupt, und der Kranke lag wieder vor mir, wie er gelegen, als ich die kleine Hütte betrat. Da legte ich ihm noch einmal die Hand auf die Schulter und sagte, ihm die Rechte über das verglimmende Lagerfeuer hinstreckend; „Jaalahn schick – e – i!“
Er nahm die Hand, drückte sie leise, schaute aber nicht auf und sagte auch kein Wort. Ich erwartete aber kein solches, jetzt noch nicht; aber davon war ich in meinem Herzen überzeugt: Wenn ich wiederkäme, würde er mit mir reden.
Ich reichte noch der Alten die Hand, und dann kroch ich zur Hütte hinaus. Momentan durchzuckte mich der Gedanke, mich noch einmal umzuschauen, um zu sehen, ob der Kranke mir vielleicht nachblicke. Ich gab das aber sofort wieder auf, ja, ich schämte mich dessen. Wie durfte ich denken, dass dieser Mann, der den Fremdling anfangs keines Blickes gewürdigt hatte, sich dazu herablassen würde, dem Gegner, vor dessen Augen sein Blick sich gesenkt, mit den seinen zu folgen! Nie hätten diese Augen so etwas fertig gebracht.
Tief aufatmend stand ich wieder im Freien. Ich hatte ein Gefühl, als sei eine Kraft von mir ausgegangen, und langsam folgte ich Nauogo, der schon bei unseren Pferden angelangt war, die wir etwa zweihundert Fuß von der Hütte des Kranken an einen Moskitestrauch angebunden hatten.
Ich war, nachdem ich mich zu Nauogo gesellt, gerade damit beschäftigt, mein Sattelzeug zu ordnen, und hatte eben den Bauchriemen angezogen, als ich, aufblickend, eiligen Schrittes eine junge Indianerin sich uns nähern sah.
Sie schien Angst zu haben, wir möchten ihr davonreiten, bevor sie uns erreicht, und machte Zeichen mit beiden Händen, die uns sagten, dass wir warten sollten, sie wolle etwas von uns.
Es war eine anmutige Erscheinung, die da auf uns zu kam. Sie war mittelgroß und schlank gewachsen; ihre Bewegungen waren von natürlicher, angeborener Eleganz, die sonderlich dadurch zur Geltung kam, dass das Mädchen einen steinigen, unebenen Weg gehen musste.
Der weite, faltige Rock, den sie trug, war purpurrot, am Saum mit mehreren breiten weißen und blauen Streifen geziert. Die lose Bluse mit den weiten Ärmeln, die leicht darüber fiel, war von lichtblauer Farbe, und über den Rücken hing ihr bis auf den Boden herab ein mehr zum Schmuck als zu sonst etwas dienender satt goldgelber Mantel, wie ihn die Indianerinnen zu tragen pflegen.
Viele Perlenschnüre von Glas und allerlei Münzen hingen ihr um den Hals und an den Armgelenken und glitzerten im Sonnenschein gerade, wie die pechschwarzen Haare zu sprühen schienen, die in dicken, dichten Strähnen tief auf den goldgelben Mantel herab fielen.
Diesen kunstlos aus ein paar Kalikostreifen zusammengenähten Mantel blies ein frischer Wind in die Luft, während das Mädchen in stetig zunehmender Eile uns näher und näher kam.
Ganz außer Atem hielt sie bei uns an und trat dicht an mich heran.
Es dauerte eine geraume Zeit, bis sie reden konnte. Man sah es, das Mädchen befand sich in einem Zustand hochgradiger Erregung.
Sie legte ihre Hände ineinander, wie einer, der beten will. Mit feucht schimmernden Augen blickte sie zu mir auf und sagte in fließendem Englisch, wie man es selten von einem Indianermädchen zu hören bekommt: „Wirst du ihn gesund machen?“
Sie sagte das wie ein Mensch, dem es um seiner Seele Seligkeit bange ist. Die Qualen eines zu Tode geängstigten Herzens sprachen aus dem Ton, in dem sie redete, und wie war es so klangvoll, so weich, so berückend süß, dieses Organ! Wie aus dem Herzen kommend und tief dem Hörer zu Herzen dringend die Worte!
Wirst du ihn gesund machen? Es war Fragen und Bitten zugleich. Flehentliches Bitten und besorgtes Fragen, sonderlich als das Mädchen diese Worte wiederholte, dieweil ich nicht gleich antwortete; dazu legte sie beschwörend ihre beiden Hände in meine Rechte, die bereits den Zügel des Pferdes hielt.
„Ich kann keinen Menschen gesund machen; das kann nur Gott!“, sagte ich ruhig und langsam.
„Den kenne ich nicht!“, entgegnete sie schroff.
„Ich will dir von ihm sagen“, erwiderte ich, „wie ich eben dem Kranken von ihm gesagt habe“, denn dass sie von diesem redete, war mir gewiss.
Sie schien wenig auf diese meine Worte zu achten, denn kaum hatte ich ausgeredet, da setzte sie ein, und die Worte sprudelten nur so von ihren Lippen: „Unsere Medizinmänner können ihm nicht helfen. Sie taugen nichts, sine sind alle Betrüger und Lügner. Die Ärzte in G. können auch nicht helfen, und der Regierungsarzt versteht nichts. Aber er darf nicht sterben. Er darf nicht!“
Sie stampfte mit dem Fuß auf den Erdboden. „Nein, er darf nicht sterben; ich will’s nicht, ich erlaube es nicht! Er muss leben! Hörst du, blauäugiger Mann?! Er muss, er muss! Er soll leben für mich! Und wenn du ihn nicht gesund machst, wehe dir! Was willst du sonst hier? Dann magst du wieder hingehen, woher du gekommen. Wir wollen dich nicht, wir können dich nicht gebrauchen, wenn du uns nicht unsere Kranken gesund machen willst!“
Der Ton, in dem sie redete, war immer heftiger, drohender, fordernder geworden. Aber plötzlich schlug er um. Er wurde wieder weich und süß, schier noch weicher, als er klang, da sie ihre erste Frage an mich richtete. „Aber wenn du ihm hilfst, Blauauge, liebes Blauauge, danken will ich dir, danken mein Leben lang, und alles tun, was du willst. Ich habe noch nie einem weißen Mann gedankt, noch nie!“
Sie sprach wieder erregt und heftig, und das Funkensprühen ihrer schwarzen Augen setzte wieder ein. „Der weiße Mann hat mich in seine Schule genommen, sieben lange Jahre hat er mir alles gegeben, was nötig zum Leben und Lernen war. Kleider, Schuh, Essen, Trinken, Bücher, alles, alles hat er mir gegeben und mich gar vieles lernen lassen. Oft hat man uns gesagt in der großen Schule, wie so dankbar wir dem weißen Mann sein müssten. Dankbar?“
Sie lachte auf. „Dankbar? Wofür? Dafür, dass er uns, wie einem Hund, ein paar Brocken hinwirft, wo eigentlich alles uns gehört, was er sein eigen zu nennen sich erdreistet? Dankbar sein dem, der uns etwas gibt, was wir gar nicht haben wollen, nachdem er uns alles, was wir hatten und liebten, genommen: unser Land, unsere Freiheit, unsern Willen, unser Glück? Ihm dankbar sein? Aber dir, Blauauge, will ich danken. Du sollst der erste weiße Mann sein, dem Dallediene Juvildelle ein Achächäe (ich danke dir) murmelt. Was sage ich? Murmeln?“
Sie war näher an mich herangetreten, und – alles um sich her, selbst indianischen Brauch und Frauensitte vergessend – legte sie ihre Hände auf meine Schultern und rüttelte meinen Körper, als wolle sie mich zwingen, ihr zu Willen zu sein: „Wenn du ihn gesund machst, wenn du Jorjillja Haschkuhwahl nicht sterben lässt, schreien will ich, schreien hinauf zur goldenen Sonne, zu dem blauen Himmel, zu unsern schneebedeckten Bergen, dass es weithin widerschallt: ,Weißer Mann, ich danke dir‘!“
Die Erregung übermannte sie. Ihre Hände glitten von meinem Schultern, und ohne ein Wort der Erwiderung abzuwarten, wandte sie sich um und ging, die ersten Schritte langsam, dann schneller und schneller, schließlich rennend in der Richtung von dannen, aus der sie gekommen war.
Ich schaute ihr nach, bis sie hinter einer Felswand, wo wohl ihre Hütte sein mochte, verschwunden war.
Nauogo saß schon längst auf seinem Pferd. Ich musste wohl oder übel auch mein Pferd besteigen und mit meinem Begleiter nach Hause reiten. Am liebsten hätte ich mich irgendwo auf die Erde geworfen, irgendwo, wo mich niemand gestört hätte, um über das heute Erlebte nachzudenken und die empfangenen Eindrücke zu sammeln und zu ordnen.
Schnell hintereinander hatte ich zwei Menschenkinder kennen gelernt, die meine höchste Teilnahme wachriefen; ein paar Seelen, wie ich sie im Lager der Indianer in Arizonas Wüstensteppen nimmer zu finden erwartet hatte.
„Die will ihn heiraten!“, sagte Nauogo, während ich mich in meinen Sattel schwang und mich anschickte, dem Voranreitenden zu folgen.
„So?“
„Ja, und er will sie heiraten.“
„So?“
„Ja, aber die Alten wollen es nicht, ihr Vater nicht und seine Mutter nicht!“
„Ist das so?“
„Ja, weil er krank ist. Und der Agent gibt ihnen keinen Erlaubnisschein zum Heiraten.“
„Er gibt nicht –?“
„Nein, weißt du das nicht? Indianer müssen gesund sein, wenn sie einen Heiratsschein erhalten wollen. O, die beiden wollen auch nicht heiraten, solange er krank ist. Wenigstens er nicht. Sie freilich, glaube ich, würde ihn heiraten, auch wenn er schon so elend wäre, dass er keinen Schritt mehr gehen könnte.“
Nauogo erzählte weiter und weiter. Aber ich hörte nicht mehr zu. Meine Gedanken blieben bei dem Kranken, den er eben erwähnt hatte, und ich sah wieder seine Augen auf mich gerichtet, die Augen, die eine Sprache zu reden schienen, die ich zunächst nicht verstand. Ich fing an, darüber nachzugrübeln, was diese Augen gesprochen hatten ...
„Höre einmal, ich glaube, du hörst gar nicht zu, während ich dir erzähle. Ich habe dich eben etwas gefragt, und du gibst mir keine Antwort!“, weckte mich Nauogos Stimme aus meinem Nachsinnen auf.
„Ich denke über etwas nach!“, sagte ich.
„Worüber?“
„Über Jorjilljas Augen.“
„Ja, der hat Augen!“, sagte Nauogo. „Alle Indianer haben Augen, andere Augen als der weiße Mann, dessen Augen verblichen sind gleich seinem Angesicht, und der mit seinen Augen nicht den hundertsten Teil von dem sehen kann, was richtige Augen sehen. Weißt du noch gestern?“ Und er lachte leise. „Ich fragte dich, wie viele Pferde du auf dem Berg dort sehen konntest, und du sagtest, da seien ja gar keine. Und meine Augen sahen über hundert. Doch ich wollte von Jorjillja sagen: Ja, der hat Augen! Mit den Augen hat er die Dallediene vom fernen Nahatigostrom her zu sich in unser Tal gezogen.“
Jetzt hatte Nauogo wieder mein Interesse.
„Das musst du mir erzählen“, sagte ich, „aber nachher. Lass mir jetzt noch einen Augenblick Ruhe. Ich will nachsinnen.“
„Dann gib mir Tabak und Papier, damit ich rauchen kann.“
Ich reichte ihm das Gewünschte, und wir ritten schweigend in leichtem Trab nebeneinander her. Nauogo drehte sich eine Zigarette nach der anderen und rauchte sie sehr schnell, was er immer tat, wenn ihm etwas auf der Seele brannte, was er gern los sein wollte. Und ich dachte an Jorjilljas Augen.
Allmählich klärten sich meine Gedanken. Ich sah, ich fühlte, was in diesen Augen lag. Es war ein Bekenntnis gebrochener Kraft, die Andeutung einer mit Recht zu fordernden, aber zugleich entschieden zurückgewiesenen Großmut des Überwinders. Es sprach aus diesen Augen ein schreiendes Verlangen nach Trost, und dabei wieder zugleich ein energisches Protestieren gegen jeden Versuch, trösten zu wollen.
Die Stellung des Besiegten dem Sieger, die Herzensstellung des Indianers dem weißen Mann gegenüber sprachen aus dem Blick, mit dem Jorjillja Haschkuhwahl den Eindringling in seiner Hütte angeschaut hatte.
Aber auch das war mir klar, klar nicht nur aus dem Ausgang unseres Augenkampfes, nein, vielmehr aus dem Bild, das sich meine Fantasie von Jorjilljas Seele malte, wie dieser sein müsse und nicht anders sein könne. Gelang es, den Widerstand zu brechen, dieser Indianer würde sich gewiss trösten lassen, auch von dem verhassten weißen Mann, wie ein weinend Kindlein sich von seiner Mutter trösten lässt.
„Nauogo!“
„Ja, mein Herr!“
„Sag, wie war es mit der Dallediene, mit dem Nahatigo und mit Jorjilljas Augen, die das Mädchen hierher gebracht haben?“
Nauogo begann: „Du kennst den Nahatigo noch nicht, bist noch nicht in den White Mountains gewesen. Dort wird der Strom geboren. Einer der höchsten Gipfel jener Berge ist seine Mutter, dessen ewiges Schneekleid ihm Vater und Ernährer. Täglich wird er neu gezeugt und neu geboren. Er wird nimmer alt und schwach und matt. Wie der sich durch die Felsen bricht und über Felsen dahinspringt und jagt! Er murmelt nicht so müde, so träge, so überdrüssig, wie es eure großen Flüsse im fernen Osten tun. Ich habe sie nicht leiden mögen, eure Flüsse, als ich vor Jahren einmal bei euch im Osten war. ,Dach – haje, dach – haje‘, sagte der Nahatigo. ,Immer ohn’ Ende, immer ohn’ Ende.‘ Wie jauchzend klingt sein rollend Dach – haje. Frische, unermüdliche Kampfeslust und unverwüstbare Lebensfreude wehen dich aus seinen Fluten an, wo immer du an sein Bett trittst. Den ganzen Lauf entlang, von seiner Geburtsstätte an bis zu der Stätte, wo er furchtlos sich in Black Rivers Arme wirft, ist er immer derselbe, immer gleich in Kraft und Lust. Der Nahatigo vermengt sich nicht mit dem Black River; er ringt mit ihm, ringt sich durch ihn hindurch, bis Salt River die beiden aufnimmt, bis diese beiden sich selbander in das große Weltmeer ergießen.
Mein Freund, du kennst den Salt River. Wenn du seinem Lauf folgst und zu Plätzen kommst, wo es in den Wassern wütet, braust und rauscht, wo weder Mensch noch Tier noch ein Gefährt sich einen Weg hindurch bahnen könnte, dann wisse, das ist Salt River nicht, da zeigt sich der Nahatigo, der nimmer sich ergibt, der selbst durch das Weltmeer hin sich seine eigenen Wege schafft und bahnt. So erzählen uns unsere Väter, die haben es von den ihrigen vernommen, und wir sagen es unseren Kindern. Und es ist Wahrheit ... Du lächelst? ... Du hast den Nahatigo noch nicht gesehen. Sobald dein Auge ihn erschaut, wirst du nicht mehr zweifeln. Der Nahatigo, der kann nicht sterben. Dach – haje, dach – haje, immer ohn’ Ende, immer ohn’ Ende!
Am Nahatigo wurde Dallediene geboren. Einige Meilen nördlich von dem Platz, wo der Nahatigo zum Black River kommt, ist eine weite große Strecke schönsten Landes. Kein Platz im ganzen Arizona, wo das Welschkorn so reift, wo Hafer und Weizen so gedeihen. Eine große Sippe unseres Volkes hat sich dort oben niedergelassen. Vor langen Jahren schon. Der weiße Mann hat sie noch nicht von dort vertrieben. Er wird es aber tun“, setzte er bitter hinzu, „wenn erst der eiserne Weg dorthin gebaut sein wird, dann wird es heißen: Das Land ist zu gut für die Indianer, sie wissen es nicht auszunutzen, sind auch zu träge dazu. Auf einem Stück Land, das eine Indianerfamilie kümmerlich ernährt, können vier weiße Familien reich werden. Es ist nicht recht, dass man das faule Volk hier lässt. Ander Land ist gut genug für sie. Man muss die Gegend für den strebsamen und fleißigen Weißen eröffnen.
Und dann müssen die Indianer fort. Sie müssen die ihnen lieb gewordenen Stätten verlassen und anderswo eine neue Heimat gründen, wo der weiße Mann sie hinweist. Wir kennen das. Ist schon oft so gewesen, wird auch am Nahatigo so werden, ich weiß das. Aber jetzt noch nicht. Bis heute ist der nächste Eisenbahnstrang noch über hundert Meilen davon entfernt. Noch haben die Leute dort Ruhe und dürfen das Land, das schöne, ihre liebe Heimat nennen.“
„Nauogo, du übertreibst“, unterbrach ich ihn.
„Ich übertreibe nicht“, entgegnete er erregt, „hast du nicht gelesen, wie es vor etwa Jahresfrist einem unserer Brüderstämme erging? Sie sollten zum dritten oder vierten Mal wandern, weil der weiße Mann ihr Land gebrauchen musste. Um sie nicht zu sehr zu erbittern, kam ein Mann von der Regierung, der musste mit dem Häuptling umherreisen und ihm viele Plätze zeigen, zwischen denen er einen Wohnsitz für sein Volk wählen sollte. Der aber wollte die alle nicht und zeigte und bat um einen Platz steinigen Wüstenlandes. Als der Beamte dem Häuptling sagte, das Land sei ja zu nichts gut, was er damit wolle, entgegnete dieser, er wolle einen Platz für sein Volk, der ihm Heimat bleiben könne, wo er sicher sei, dass des weißen Mannes Neid und Habsucht sie nicht wieder vertreiben würden, und dafür sei das Land gut.
Aber ich will nicht weiter davon reden. Ich wollte dir ja vom Nahatigo und von Dallediene Juvildelle erzählen. Also am Nahatigo ... Die Indianer dort oben sind reich. Groß ist die Zahl ihrer Pferde, die in den Bergen grasen. Die Tiere sind stark und kräftig. Sie trinken Nahatigowasser, das schafft ihnen Muskeln wie Eisen, und gut ist der Preis, der für Nahatigopferde bezahlt wird. Der reichsten Männer einer ist Dalledienes Vater. Viel Land hat er und viele Pferde; dazu ist er ein Medizinmann, zu dem von weit und breit die Leute kommen, sich durch seinen Sang und seine Künste heilen zu lassen. Kein Medizinmann in unserem ganzen großen Volk hat solchen Ruf wie er. Seine Medizin ist gut, seine Kunst gewaltig. Er hat sie von der Sonne gelernt.“
„Von der Sonne? Was du sagst, Nauogo, glaubst du das?“
Nauogo zuckte die Achseln, wie einer, der nicht weiß, ob er ja oder nein sagen soll, der aber für seine Person sich ganz klar ist, wie er denkt, nur seinen Standpunkt nicht preisgeben möchte.
Nach einer Pause des Schweigens fährt er in seinem Bericht fort. „Es habe sich einmal so getroffen, so erzählt Juvildelle, dass er gerade an einem Platz war, wo ein Regenbogen auf die Erde stieß. Da hat er sein Pferd an den Regenbogen gebunden und ist auf diesem hinaufgestiegen in den Himmel, hoch hinauf, bis zur Sonne. Er hat mit ihr geredet, und sie hat ihm viel Weisheit gelehrt zu Nutz der Indianer, Kranke zu heilen, Regen zu machen, böse Geister zu bannen, die Zukunft zu ergründen und viele andere Dinge mehr. Der alte Juvildelle ist ein kluger Mann, ein großer Mann.“
Ich hielt es nicht für entsprechend, jetzt mit Nauogo eine Auseinandersetzung über Medizinmänner und ihr Treiben zu halten, sondern verschob das auf später und ließ ihn weiter erzählen.
„Zum weißen Juvildelle sind auch Jorjilljas Leute gekommen. Sie haben weder die Kosten noch den weiten beschwerlichen Weg gescheut. Einen neuen Wagen haben sie für die Reise gekauft und mit schöner Leinwand überspannt, wie wohl keiner unseres Volkes einen so schönen Wagen hat. Viele weiche Steppdecken und wollene Decken haben sie angeschafft und Vorräte zum Essen und Trinken. Der Kranke hat nicht Not gelitten auf der weiten Reise. Ein Onkel hat die Pferde getrieben, und die Mutter samt zwei jungen Söhnen ihrer Schwester haben des Kranken gewartet. Nach sechs Wochen kamen sie zurück, Juvildelles Künste haben Jorjillja nichts helfen können.
Einige Tage später erschien Dallediene in unserem Lager. Sie war von einer alten Tante begleitet, die noch heute bei ihr ist. Sie kamen geritten, mehrere Packtiere trugen der Tante ganzen Hausrat. Schon viele Boten des alten Juvildelle sind hier gewesen, die Tochter heimzurufen. Aber sie geht nicht.
Demnächst wird wohl der Alte selber kommen. Es wird ihm nichts helfen. Die Augen, weißt du, Jorjilljas Augen haben es ihr angetan. Nur einmal soll sie den Jorjillja, dieweil er am Nahatigo weilte, gesehen haben; aber das war genug. Das entschied für ihr ganzes Leben. Nachdem Jorjillja den Nahatigo verlassen, konnte Dallediene dort nimmer leben. Sie musste ihm folgen, und sie werden Mann und Weib, das steht fest, wenn ... nun, wenn Jorjillja nicht sterben muss.“
Die letzten Worte kamen sehr langsam und ruckweise heraus. Der Indianer mag vom Tod weder hören noch reden, eines Verstorbenen Name wird von seinen Verwandten nie wieder genannt. Nauogo konnte wohl augenblicklich keine andere Ausdrucksweise für das, was er sagen wollte, finden, und so gebrauchte er das Wort „sterben“.
Aber damit war auch seine Lust, noch weiter zu sprechen und zu erzählen, vergangen. Der Tod mit seinen Grauen, mit seinem dunklen Dahinter, woran das Wort „sterben“ das Kind des Heidentums gemahnt, warf seine düsteren Schatten in Nauogos Seele. Er mochte nicht mehr reden.
Er brach ab, und ohne noch ein Wort zu wechseln, gelangten wir nach einer kleinen halben Stunde bei unserer Wohnstätte an.
Auch in meinem Innern hatte das „Sterbenmüssen“ trübe Stimmung geweckt. Muss er wirklich sterben? Gibt es keine Rettung für ihn? Ist diesen beiden Menschenkindern, einem an des andern Seite, kein irdisch Liebesglück mehr zugedacht?
Allmächtiger, liebevoller Gott, wenn’s sein darf nach deiner Weisheit und Güte, lass Jorjillja Haschkuhwahl genesen!
Wie füreinander geschaffen, erschienen mir Jorjillja und Dallediene. Ich konnte es verstehen, wenn ich so an die jungen Indianer dachte, wie sie mir täglich begegneten, dass erst ein Jorjillja Dalledienes Weg kreuzen musste, bis ihr Herz von Liebe ergriffen werden konnte.
Zu ihm konnte sie hinaufschauen wie zu etwas Höherem, Besserem, ihm konnte die stolze Maid ihr Ich opfern und ihm Weib und Dienerin sein, Dienerin, wie es dem Weib des Indianers nach Brauch und Sitte zukommt.
Und Jorjillja? Ich wusste bis heute noch nichts aus seinem Leben. Aber ich hatte so eine dunkle Ahnung, als rede seine Krankheit von stürmischer, kochender Jugendlust, die nicht Zaum noch Zügel hatten bändigen können. Er mochte wohl manches Mädchens Herz gebrochen, manches mit dem heißen Verlangen, den schönen Jüngling zu besitzen, erfüllt haben; aber die wahre, ernste, heilige Mannesliebe, die gewinnen oder in Verzweiflung stürzen muss, die konnte das Herz eines Jorjillja erst packen, wenn eine keusche, ernste Jungfrau, eine Frauenseele, wie Dallediene Juvildelle, ihm entgegentrat.
Wird der Knabe sterben müssen ...?
2. Kapitel
Bei unserem Abschied von Jorjillja hatte Nauogo gesagt, wir würden in etwa einer Woche wiederkommen. Schon nach zwei Tagen war ich wieder da. Ich wäre vielleicht schon eher wieder dort gewesen, denn ich brannte vor Verlangen, Jorjillja zu sprechen und ein ernstes Wort von seinen Lippen zu hören, aber es regnete ...
Am Abend meines ersten Besuchstages bei dem Indianer setzte der Regen ein, und es regnete drei Nächte und zwei Tage.
Wenn es regnet, bleibt der Arizonamann in seiner Hütte. Es ist dankbar für jeden Regen, zumal er so spärlich fällt; aber seine Liebe gehört dem goldenen Sonnenschein.
Arizonas Sonnenstrahlen sind heiß, glühend heiß, sie sengen, versengen, aber sie stechen nicht, sie brennen, verbrennen, aber doch tun sie niemandem weh. Man meidet sie nicht, man sucht sie; nur in Mittsommers hoher Mittagsstunde schaut man sich nach schützendem und kühlendem Schatten um.
Ist aber der Himmel bewölkt, und öffnet er gar seine Wassertore, dann ist Weg und Steg wie ausgestorben, Nur die nötigen Arbeiten werden im Freien verrichtet, nur was unbedingt sein muss. Es regnet ja, die Sonne scheint ja nicht; wer kann da frisch und fröhlich und arbeitslustig sein?
Ich aber war es doch in diesen beiden Tagen. Ich quälte meinen Kopf und meine Zunge, etliche indianische Sätze sich einzuprägen und wiederzugeben. Ich wollte mit diesen Sätzen die Unterhaltung mit Jorjillja beginnen. Mir war nicht bange, dass ich sonst keine Antwort bekommen würde. Das war es nicht. Er würde auch sprechen, wenn ich englisch zu ihm reden würde; aber ich wollte ihm mein Entgegenkommen zeigen; vielleicht gelang es mir sogar, ihm eine kleine Freude zu bereiten. Und so lernte ich.
Es lernt sich gut, wenn der Wind den Regen gegen die Fensterscheiben treibt. Mein kleines Adobihaus (Lehmhütte) hat so liebe kleine Fensterscheiben, nicht große moderne, nein, ganz kleine, immer zwölf Scheiben in einem Fenster. Ich liebe die kleinen Fensterscheiben und die breiten Fensterbänke, wie sie die dicken Adobiwände schaffen.
Es war gar traulich in dem kleinen Haus, und ich lernte. Es waren nur Sätze allgemeinen Inhalts: Wie geht es dir heute, mein Freund? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wie schön ist’s, dass die Sonne wieder scheint; und noch ein paar Sätze mehr.
Das Lernen war schwere, harte Arbeit, aber Nauogo ein geduldiger, unermüdlicher Lehrer im Immerwiedervorsagen, zumal ich ihm eine Kiste Zigarren zu unbegrenztem Gebrauch zur Verfügung gestellt hatte.
Mit meinen indianischen Sätzen bewaffnet, Bibel und einige Bilder in der Satteltasche, trat ich am Morgen des dritten Tages in Nauogos Begleitung meinen zweiten Ritt zu Jorjilljas Hütte an.