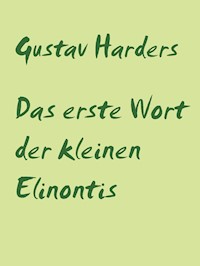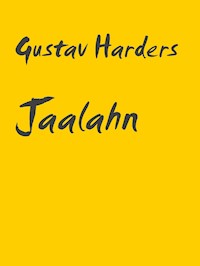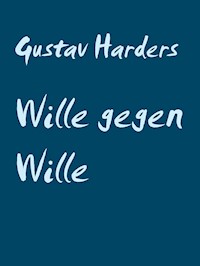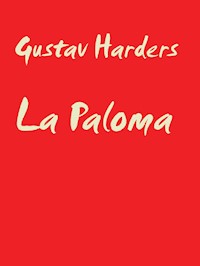
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von Lust und Leid aus den Lagern der Indianer und Mexikaner im Westen Nord-Amerikas. Gustav Harders wurde 1863 in Kiel geboren. 1889 wanderte er nach Amerika aus und heiratete dort. Er war Pastor und Rektor der lutherischen Kirche und Schule in Milwaukee und diente anschließend bis zu seinem Tod im Jahr 1917 in Indianerreservationen in Arizona als christlicher Missionar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
La Paloma
Zum BuchVorwortProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. KapitelSchlussImpressumZum Buch
Eine Geschichte von Lust und Leid aus den Lagern der Indianer und Mexikaner im Westen Nord-Amerikas.
Gustav Harders wurde 1863 in Kiel geboren. 1889 wanderte er nach Amerika aus und heiratete dort. Er war Pastor und Rektor der lutherischen Kirche und Schule in Milwaukee und diente anschließend bis zu seinem Tod im Jahr 1917 in Indianerreservationen in Arizona als christlicher Missionar.
Vorwort
Sollte dem Bruder in Christo, dessen Tätigkeit in dieser Geschichte geschildert ist, dieses Buch begegnen und sollte er seine Person, die namenlos hier auftritt, wiedererkennen, so entbietet der Schreiber ihm seinen Gruß und dankt ihm für alles, was er ihm in der Zeit des Zusammenlebens mit ihm in Wort und Tat gewesen ist.
Arizona, Juni 1913
Der Verfasser
Prolog
Es war am 10. Dezember des Jahres 1912. Am Zehnten jeden Monats ist Zahltag, und die sämtlichen Arbeiter des großen Minendistrikts von G. erhalten ihren monatlichen Lohn. Da sind dann die Straßen der Stadt bis in die späte Nacht hinein mit Menschen gefüllt. Die Geschäfte sind etliche Stunden länger geöffnet als an den übrigen dreißig Tagen des Monats, ja etliche schließen die ganze Nacht hindurch ihre Türen nicht. An diesem Abend werden Schulden bezahlt und Einkäufe gemacht. Der Hausvater muss kaufen, was er seit dem letzten Zahltag Weib und Kindern versprochen hat. In nur wenigen Häusern wird an diesem Abend gekocht. Die meisten Familien essen zu Abend in einem Restaurant, darauf freuen sich die Kinder den ganzen Monat hindurch.
Langsam schlenderte ich die lange Hauptstraße hinunter, das Menschengewoge anschauend, dem Geschwätz und dem Lärm zuhorchend.
An einer Straßenecke saß ein alter blinder Mexikaner, der auf seiner Geige spielte. Die Geige war schlecht, aber das Spiel nicht übel. Reine, klare Töne entlockte der Blinde seiner schlechten Geige, wohlklingende konnte er auf solchem Instrument nicht schaffen. Und dann: Es war kein totes, seelenloses Spiel, wie man es meistens von solchen Bettelmusikanten hört; man merkte es, fühlte es, die Geige war nicht nur des blinden Alten Lebenserwerbsmittel, sie war auch seines Lebens Trost und Freude und seiner blinden Augen einzig Licht.
Im Vorübergehen legte ich ein Geldstück in des Spielers schmutzigen Sombrero, den er neben sich hingelegt hatte, und sagte zu dem Alten, der gerade sein Stück beendet hatte: „Das war sehr schön.“ Dann ging ich weiter.
Das kurze, anerkennende Wort musste den Blinden erfreut haben. Ein Wort des Dankes wäre vom Straßenlärm verschlungen worden und nicht an meine Ohren gedrungen; so hob er wieder an zu spielen.
Aber nicht die Fortsetzung des Geigenspiels noch der Gedanke, dass er für mich spielte, hemmte meine Schritte, zwang mich, beiseite zu treten und still zu stehen. Der Blinde spielte ein Lied, er spieltemeinLied. Er spielte ein Lied, das meinem für das Reich der Töne fast gänzlich unempfänglichen Gemüt zuerst einen Begriff davon gegeben, welch eine Gewalt die Musik über ein Menschenherz ausüben kann, ein Lied, das einzig und allein mit seinen Tönen – denn seine Worte sind mir bis heute noch unbekannt – es verstanden hat, so oft in meinem Leben mich weinen und lachen, jubeln und klagen, zagen und fragen, sinnen und schweigen, trostlos und friedvoll zu machen. Der blinde Geiger an der Straßenecke spielte „La Paloma“, ein mexikanisch-spanisches Liebeslied von einer wilden Taube.
Das Lied war verklungen, der Spieler setzte seinen Bogen ab. Nun war das Danken an mir. Ich ging zurück zu dem Alten und sagte ihm, er sei gewiss hungrig, es solle mit mir zum Essen kommen.
Er erhob sich, und ich leitete ihn in ein chinesisches Restaurant. Solche haben alle in dem hinteren Teil des Lokals kleine Zimmerchen, in denen man ungestört und ohne lästige Zuschauer essen und trinken kann.
Es schmeckte dem Alten; und als er die Mahlzeit, die ich ihm hatte kommen lassen, beendet, bat ich ihn, ehe er an seinen Platz auf der Straße zurückginge, mir noch einmal das Lied zu spielen, das er eben zuvor gespielt habe.
Schnell stimmte er seine Geige und spielte das liebe Lied. Es spielte es einmal und noch einmal und dann noch einmal.
„Das Lied hat drei Verse“, sagte er, als er den Bogen absetzte.
Während des Spielens war der Vorhang, der das Zimmer abschloss – Türen haben diese kleinen Räume nicht – leise zurückgeschoben worden, und der Chinese, Eigentümer des Lokals, und etliche seiner chinesischen Angestellten schauten lauschend herein.
„Schöne Musik“, sagte der Chinese, „sehr schön. Keine chinesische Musik. Chinesische Musik schöner. Diese Musik auch schön, sehr schön.“
„Ja“, sagte ich, während ich den Alten aus dem Zimmer hinausgeleitete, „das Lied ist schön, ich werde eine Geschichte darüber schreiben.“
„Was? Schreiben? Eine Geschichte? Hier in meinem Geschäft? Schreiben? Eine Geschichte? Schreiben? Schreiben?“, schrie ganz entsetzt der kleine Chinese. Die Chinesen haben nämlich einen sehr hohen Respekt vor allem Geschriebenen und geraten immer in Angst und Aufregung, wenn man vom Schreiben spricht oder gar Geschriebenes ihnen einhändigt.
„Nichts von dir, nichts von deinem Haus“, sagte ich, um den Chinesen zu beruhigen. „Hast du nicht verstanden? Über das Lied, das der Mexikaner eben gespielt, will ich eine Geschichte schreiben.“
Wir traten auf die Straße. Durch das Fenster, das sich in der Ladentür befand, schaute ich noch einmal in das Innere des Lokals zurück. Der Chinese schaute uns starr nach. Er hatte ohne Zweifel den Zusammenhang noch nicht begriffen, und das Schreiben der Geschichte dieses Liedes wird ihm wahrscheinlich noch manches Kopfzerbrechen kosten; mir aber, dem Geschichtenschreiber, nicht im Mindesten. Die Geschichte lebt in mir seit vielen Jahren, das seelenvolle Spiel des Alten hatte den Gedanken ausgelöst, sie niederzuschreiben.
Hier ist sie ...
1. Kapitel
Ein neuer Missionar war auf dem Weg nach Arizona, um im Dienst einer kirchlichen Gemeinschaft den Indianern das Evangelium von Christo zu verkündigen.
In El Paso hielt er sich etliche Tage auf. El Paso ist eine der bedeutendsten Städte des großen Staates Texas und liegt hart an der mexikanischen Grenze. Eine elektrische Straßenbahn brachte ihn von El Paso in fünfzehn Minuten nach dem Städtchen Ciudad Juarez, das außer anderen Sehenswürdigkeiten sonderlich eine im sechzehnten Jahrhundert erbaute Kirche aufzuweisen hat.
Diese besuchte der Missionar und freute sich an den alten Bildern, dem kostbaren Schnitzwerk und andern Dingen.
Hierauf betrat er wieder den Kirchplatz, der sich indessen mit einer Menge Menschen gefüllt hatte. Meistens waren es Mexikaner; aber auch eine bedeutende Anzahl von Amerikanern mochte darunter sein.
Die Mexikaner waren alle im Sonntagsstaat, viele bunte Seide sah man an den Frauengestalten, sonderlich Schals, welche die Mexikanerinnen so malerisch über ihre glänzenden schwarzen Haare zu legen wissen.
Trotz des heißen Sommers sah man auf den Köpfen der Männer neben aus Stroh geflochtenen Sombreros auch solche aus dickem Filz mit Silberband und Silberborden geschmückt, dazu Anzüge aus schwerem Samt, die bekannten kurzen Jacken und die eng anschließenden, aber weit über die Füße fallenden Hosen.
Eine Weile freute sich der Missionar an dem bunten, ihm neuen Bild; dann aber ging er in den Trubel hinein, um sich zu erkundigen, was denn eigentlich los sei.
Ein Amerikaner, den er befragte, entgegnete ihm: „Sie müssen ein Fremder sein; denn sonst wüssten Sie, dass heute, wie allwöchentlich an diesem Tag, dort drüben in der großen Arena ein Stiergefecht stattfinden wird. Das ist immer ein Festtag für die Stadt und bringt viel gutes amerikanisches Geld über die Grenze; für dieses Geld nehmen wir auch den uns nicht gerade sympathischen Amerikaner mit in Kauf. Das Stiergefecht müssen Sie sich unbedingt ansehen. In El Paso und Juarez gewesen zu sein und kein Stiergefecht erlebt zu haben, das ist ungefähr dasselbe, wie in Rom gewesen zu sein, ohne den Papst gesehen zu haben.“
Der Missionar lächelte. Er war nämlich einmal in Rom gewesen, hatte aber den Papst nicht gesehen, sich auch nicht die geringste Mühe gegeben, denselben zu Gesicht zu bekommen. So hätte er also auch ruhig Ciudad Juarez wieder verlassen können, ohne einem Stiergefecht beigewohnt zu haben.
Er sagte das dem Herrn, als der ihn fragte, warum er lache, fügte aber hinzu: Die Stiergefechte spielten eine so bedeutende Rolle im Leben der Spanier wie Mexikaner, dass er sich wohl einmal ein solches anschauen möchte, und zwar, um die Mexikaner, mit denen er ohne Zweifel in Zukunft viel in Berührung kommen würde, schneller und besser verstehen zu lernen.
Er dankte dem Herrn für die ihm gewordene Auskunft und folgte dem Menschenstrom, der sich nach der Arena hin bewegte.
Allerlei Händler und Händlerinnen hatten sich eingefunden. An der Seite des Weges hatten sie kleine Tische aufgestellt oder Teppiche auf den Sand gebreitet, auf denen sie ihre Waren feilboten: buntfarbiges, dem Fremden unbekanntes Zuckerwerk, frische und gedörrte Früchte, Zuckerrohr, kleine Kuchen, Limonade, Gefrorenes, die unentbehrlichen Torteos und Tomates und andere Dinge mehr. Hat der Mexikaner am Alltag einmal freie Stunden, so muss er beständig etwas zu knabbern und zu kauen haben.
Die Verkäufer machten auch sehr gute Geschäfte. Wohl wenige der Mexikaner mochten in die Arena gehen, ohne sich etwas von den angebotenen Leckereien mitzunehmen.
Die für die Stiergefechte in Ciudad Juarez bestimmte Arena ist ein gewaltiger, runder, massiver Steinbau, natürlich ohne Dach; die Zuschauer sitzen unter freiem Himmel.
Als der Missionar in die Nähe des Eingangstores kam, las er die links darüber mit großen Buchstaben, englisch und spanisch geschriebenen Worte: „Sitze im Schatten zwei Dollars.“
Auf der andern Seite des Tores war zu lesen: „Sitze in der Sonne einen Dollar.“
Unser Freund dachte, er sei nicht nach dem Südwesten des Landes gekommen, um sein Dasein im Schatten zu fristen, sondern um die Sonne zu genießen; und so kaufte er sich den billigeren Sonnensitz und trat in die Arena ein.
Es waren breite Steinsitze, die sich amphitheatralisch aufbauten. Der Sitz, auf dem man saß, diente zugleich dem über und hinter einem sitzenden Zuschauer als Schemel.
Kleine mexikanische Buben sprangen die Sitzreihen auf und nieder und boten Kissen an, die man für 25 Cents während der Vorstellung benutzen durfte, wenn man nicht auf dem harten, heißen Stein sitzen wollte. Ihr Vorrat schien unerschöpflich zu sein; denn kaum hatten sie einen Arm voll an den Mann gebracht, so verschwanden sie und kamen mit einer neuen Ladung wieder.
Der Zuschauerraum, der Platz für etliche Tausend Leute bietet, füllte sich mehr und mehr; die für den Beginn des Stiergefechts angesetzte Zeit war herangekommen, und die Leute fingen an ungeduldig zu werden.
Auch die Musikanten waren erschienen und hatten an der für sie bestimmten Stelle über dem Eingangstor Platz genommen. Sie machten aber noch keine Anstalten zu spielen.
Da rief plötzlich ein Mexikaner mit lauter, fordernder Stimme: „Musica, musica!“
Ein zweiter wiederholte das Wort, ein dritter, ein vierter; dann zwanzig, hundert, zweihundert, tausend, alle. Alles rief: „Musica, musica, musica!“
O, wie das klang! Wozu noch Musik? Das war schon Musik, lauter Musik. Die ganze Luft schien von lauter Musik erfüllt zu sein.
Dem Missionar schlug das Herz; unwillkürlich richtete er sich auf in seinem Sitz, als könne er da noch mehr in sich aufnehmen von dieser Musik, die er noch nie gehört, die ihn schier berauschte; und er wünschte, die Leute möchten noch lange so weiter rufen und die Musikanten mit ihren Blechhörnern nicht diese Musik zum Schweigen bringen.
Aber es ging nicht nach seinem Wunsch und Willen. Ein Tusch, und dann setzten die Musikanten ein; ärgerlich setzte der Missionar sich wieder auf seinen Platz. Von der Musik, die nun kam, wollte er nichts wissen, und gerade wollte er darüber philosophieren, wie selten es doch im Menschenleben nach Wunsch und Willen gehe und wie gerade die lebhaften Wünsche meistens unerfüllt bleiben, als die Töne, die von der Musikantenbühne herunterkamen, ihn wider Willen zu lauschen zwangen.
Was war das für eine eigenartige Tonführung, ein so ganz fremder, unbekannter Rhythmus?
Gespannt und immer gespannter lauschte er der unbekannten Weise.
Je länger er lauschte, desto mehr war er gefesselt. Er hatte ein Gefühl, als hätten unsichtbare Mächte ihn an Händen und Füßen gepackt und zögen, zerrten ihn mit sich fort; als wäre er hoch in die Lüfte gehoben, dann plötzlich losgelassen, in die Tiefe stürzend, aber sofort wieder aufgefangen, sanft gebettet, geliebkost und geschmeichelt, und wiederum, aus seinen Träumen aufgerüttelt, durchströmt von unbekannter Kraft, von Kampfeslust und Siegesfreudigkeit; als könnte er Himmel erstürmen und Welten besiegen.
Jetzt konnte er wirklich nicht sitzen bleiben, er musste Bewegung haben; er sprang auf und, obwohl er ein fast fünfzigjähriger Mann, stürmte er gerade so schnell wie die Kissenbuben, die steinernen Sitzreihen hinauf bis zur allerhöchsten, wo er sich ganz erschöpft und tief aufatmend niederließ.
Das wunderbare Lied war inzwischen verklungen. Die Musikanten spielten schon ein anderes Stück, darauf noch eins; und dann verkündeten Trompetenstöße den Anfang des Stiergefechts und die Ankunft der Preisrichter, die auf einer besonderen, mit mexikanischen und amerikanischen Fahnen dekorierten Bühne Platz nahmen.
Zwei Trompetenbläser verließen die Musikantenbühne und begaben sich zur Loge der Preisrichter, wo sie sich zur Linken und Rechten derselben aufstellten. Auf ein Zeichen des Richters stießen sie in ihre Instrumente, und die Tore auf der gegenüberliegenden Seite der Arena öffneten sich.
Es war hübsch, wunderhübsch, als jetzt die Cuadrilla ihren Einzug hielt. Der Matador voran, gefolgt von den Banderillos, den Chulos und Picadores.
Die eng anschließenden Jäckchen und Kniehosen zeigen der Männer tadellosen Körperbau. Stolz tragen sie den dreieckigen Hut auf dem bezopften dunkeln Kopf. Die bunten, leuchtenden Farben des Samts und der Seide ihrer Kleider und sonderlich des großen kostbaren Mantels, den sie mit der dem Spanier wie Mexikaner eigenen Grandezza zu tragen wissen, strotzen von unzähligen goldenen und silbernen Plättchen, Perlen und Edelsteinen.
Und wie leichtfüßig sie über den weichen und tiefen Sand der Arena dahin schreiten! Kaum Spuren hinterlassen die kleinen feinen Schuhe, welche die mit seidenen Strümpfen bedeckten Füße tragen. Leise wiegt sich der Oberkörper in den Hüften der Männer, während sie, von allen Seiten mit lautem Jubel begrüßt, die Arena umschreiten und dann vor der Loge des Richters haltmachen.
Eine tiefe Verbeugung, und dann die Rüstung zum Kampf. Die kostbaren Mäntel können sie beim Kämpfen nicht gebrauchen, die müssen durch starke, blutrote Ledermäntel ersetzt werden. Das wissen die Zuschauer, und von allen Seiten strecken sich Arme schöner Frauen und Jungfrauen aus: Sie wollen die Mäntel aufbewahren, während die Männer da unten dem Kampf wider den Stier obliegen.
Sie geben nicht ohne Wahl die Kleidungsstücke her; suchend, prüfend, überfliegen die Augen des Matadors und seiner Genossen die Reihen der Schönen, die sich um ihre Gunst und Auszeichnung bewerben. Denn für eine Auszeichnung halten es die Damen, wenn sie von den Stierkämpfern dazu ausersehen werden, einen Dienst zu tun, den sonst ein Herr der Dame oder ein Diener seiner Herrschaft leistet.
Nachdem die Männer die gefunden, die sie für die Schönste und Anziehendste halten, rollen sie ihre Mäntel zusammen und werfen sie nach kurzem Mienenspiel auf beiden Seiten mit kraftvollem Wurf, wobei sie so recht Gelegenheit haben, ihre Fähigkeit zu geschmeidiger, eleganter Körperbewegung zur Geltung bringen, in weitem Bogen der Auserkorenen in die ausgestreckten Arme. Nach dankendem Gruß setzt sich die errötende Dame und breitet den Mantel über ihre Knie oder über die Brüstung der Loge.
Nun beginnt der Kampf. Die Tore werden aufgestoßen, und der Stier stürmt herein; während er die Barriere der Arena passiert, wird ihm ein kurzer, mit bunten Bändern geschmückter Dolch zwischen die Rippen gestoßen, um ihn wütend und kampflustig zu machen.
Doch ein Stierkampf soll hier nicht beschrieben werden; von dem kann man in vielen anderen Büchern lesen. Wir sind hier nur dem Missionar gefolgt, und der saß da hoch oben auf seinem Steinsitz und hatte meistens die Augen geschlossen. Er zitterte für das Leben der Kämpfenden; ihn jammerte des grausen Spieles, das man mit den armen Schlachtopfern, Stieren und Pferden, erbarmungslos trieb, ihn entsetzte vor allem die Wahrnehmung, dass die große Masse der Zuschauer an diesem blutigen, unbarmherzigen Schauspiel ein sich beständig steigerndes Entzücken und Wohlgefallen zeigte.
„Was haben doch Satans List und Tücke, Macht und Bosheit aus Gottes Kindern gemacht!“, seufzte er in seinen Gedanken und dachte dabei nicht nur an die andern, sondern auch an sich; denn es zeigte sich auch bei ihm, dass er das „andere Gesetz“ in seinen Gliedern hatte, von dem St. Paulus in seinem Brief an die Römer (Kap.7.23) schreibt.
Wie gesagt, er schloss seine Augen, aber er öffnete sie auch wieder. Er öffnete sie nicht darum, weil das eine menschliche Gewohnheit ist, die Augen wieder zu öffnen, nachdem man sie zeitweilig geschlossen gehalten, sondern darum, weil diese Augen sehen wollten. Sie wollten sehen, was da unten vor sich ging und was schließlich daraus werden würde. Er schloss sie, wenn der Stier wütend und schnaubend auf seinen Peiniger losstürmte oder auch, wenn er mit gesenktem Haupt kampfbereit ihm gegenüberstand und nur die geringste Bewegung mit seinem Kopf machte, die jederzeit zu einem Todesstoß für den werden konnte, der ihm nach seinem Leben trachtete.
Die Vorgänge in der Arena stießen den Mann ab und zogen ihn auch wieder an. Er mochte das Blut nicht sehen, das Blut, das dem gejagten und gepeinigten Tier aus den Nüstern, aus seinem von Spieß- und Speerstichen zerstoßenem und zerfleischtem Rücken floss; und doch gehörte das rote Blut mit hinein in das ohnegleichen farbenprächtige Gesamtbild.
Er schalt solche Art zu kämpfen als frevelndes Gottversuchen; und doch fesselte ihn diese Vorführung von menschlicher Kraft und Geistesgegenwart, Gewandtheit und Geschwindigkeit, Kühnheit und Keckheit in so vollendeter, mit Stolz und Selbstbewusstsein gepaarter Bewegung.
Ja, als schließlich der Kampf soweit vorgeschritten ist, dass der Matador mit dem ausgebreiteten roten Tuch in der Linken und dem langen Schwert stoßbereit in der Rechten dicht vor dem Stier steht und ihm das Schwert in dem Moment, da der Stier ihn mit seinen Hörnern in die Lüfte schleudern will, hinter dem Nacken bis ans Heft in den Leib stößt, da zwingt der Missionar seine Augen, sich nicht zu schließen, dieweil er sehen will ... Lautlos sinkt der Stier zusammen. Ein paar Zuckungen mit den Beinen, und er ist tot.
Ein Beifallsschreien der tausendköpfigen Menge erhebt sich. Die Begeistertsten der Männer werfen ihre Hüte in die Arena, die sie nachher für Geld wieder einlösen, um dem Matador, der seine Sache gut gemacht, ihre Anerkennung zu zeigen.
„Musica! Musica!“, tönt es wieder, und in dasMusica-Rufen hinein das Wort: „La Paloma! La Paloma!“ Und immer mehr „La Paloma! La Paloma!“ und schließlich nur noch: „La Paloma! La Paloma! La Paloma!“, bis die Antwort von der Musikantenbühne kommt.
Mit voller Kraft setzt das Orchester ein und spielt jetzt dem gefeierten Matador zu Ehren das Lied, das dem Missionar die Liebe abgezwungen, das die Musikanten zu Anfang spielten, dessen Namen er nun kennt:La Paloma.
Mit demselben, wenn möglich mit noch größerem Entzücken folgt der Missionar den Klängen der Musik und flüstert dabei vor sich hin: „La Paloma. La Paloma.“
Er versucht, das Wort so auszusprechen, wie es klang, als die Mexikaner vorher es riefen. Aber das kann er nicht. Ein offenes „A“, ein so süßes, rundes, mehr gesungenes als gesprochenes „O“ kann er mit seinen Sprachorganen nicht hervorbringen.
Kopfschüttelnd und leise lächelnd stellt er seine Bemühungen ein. In weite Ferne und längst vergangene Zeiten trugen ihn seine Gedanken. Er saß für einen Moment wieder auf der Schulbank eines Gymnasiums seiner verlorenen Heimat und lernte Latein – „Palumbes, palumbis, die Ringeltaube“, er hatte diese Vokabel noch nicht vergessen.
Er hatte sie immer so gehasst die lateinische Sprache mit ihren ehernen Regeln und steinernen Gesetzen, gegen die zu verstoßen geradezu für ein Verbrechen galt. Als Tertianer hatte er einmal „ich habe gesehen“ mit „visi“ übersetzt. Der Lehrer hatte das falsche „s“ mit sieben dicken roten Strichen unterstrichen und ein riesengroßes rotes Kreuz am Rand des Heftes gemacht und ihn bei Zurückgabe der Arbeit dem Hohn und Gelächter der ganzen Klasse preisgegeben. Seit jenem Tag hatte der Knabe diese Sprache nur noch mehr gehasst.
Jetzt fand er sie in der spanischen Sprache wieder, wie er sie früher schon in der französischen und italienischen wiedergefunden hatte. In all diesen Sprachen gefiel sie ihm besser. Nach seiner Meinung hatte der Italiener sie fließend, der Franzose elegant, der Engländer praktisch und – das hatte er jetzt schon herausgehört – der Spanier klingend gemacht.
„Der Spanier hat das hässliche, steife, harte, alte Latein in Musik gesetzt“, murmelte der Missionar vor sich hin und wiederholte leise die beiden Worte „Palumbes“ und „La Paloma“. Wie tot und klanglos das eine, wie lebendig und klangvoll das andere Wort!
„Ja, ja, so ist’s“, sagte er fortfahrend noch einmal zu sich selber, „der Franzose hat das Latein für den Salon, der Engländer für das Geschäftshaus, der Italiener für den Ausruf auf der Straße, der Spanier aber für den Konzertsaal zurechtgestutzt.“
Erneute Trompetenstöße weckten ihn aus seinen Gedanken auf. Ihm fiel ein, dass er auf den Anzeigenzetteln gesehen, dass fünf Stiere getötet werden sollten. Schnell erhob er sich und eilte aus der Arena hinaus. Er hatte genug; mehr wollte er von diesem Schauspiel nicht sehen ...
Draußen vor der Arena war ein großes Menschengewoge, wohl meistens Leute, die auf Freunde und Bekannte warteten, um sich nach vollendeter Schaustellung von ihnen erzählen zu lassen.
Als der Missionar durch die Menschenmasse dahinging, fiel ihm das Lied wieder ein, und er versuchte, die Melodie vor sich hinzupfeifen. Aber es wollte nicht recht gehen, er hatte sie nicht ganz gepackt, nicht richtig behalten.
Er versuchte es noch einmal, als plötzlich jemand neben ihm sagte: „Das war nicht recht, mein Herr“, und sich zu ihm gesellend ihm die Melodie vorpfiff.
Der Missionar schaute den willkommenen Begleiter an. Es war ein alter, wohlgekleideter Mexikaner. Er mochte wohl an die siebzig Jahre alt sein, wenn nicht schon darüber. Er sprach ein gebrochenes, aber verständliches Englisch.
Der Missionar hegte keinen Zweifel, dass der alte Mexikaner, der sich so unaufgefordert zu ihm gesellt hatte, für eine Stunde oder länger als Gesellschafter zu haben war; und so fragte er ihn denn, ob er mit ihm gehen wolle, sie wollten sich einen Platz suchen, wo sie sich hinsetzen und etwas genießen könnten, und er solle ihn dann das LiedLa Palomalehren.
Sofort sagte jener zu.
In Ciudad Juarez sind die Geschäftshäuser, Hotels und Restaurants meistens in den Händen von Amerikanern und Ausländern. Der Missionar hatte sein Mittagessen bei einem Deutschen eingenommen, der samt seiner Frau aus Hamburg herübergekommen war. Zu dem gingen die beiden nun wieder hin.
Hinter dem Restaurant war ein von einer hohen Adobemauer umgebener Garten, in dem alte Maulbeerbäume schönen Schatten gaben. Tische und Bänke standen unter diesen Bäumen. In einer Ecke des Gartens stand ein besonders großer und alter Baum, unter diesem nahmen die beiden Platz, und der Missionar bestellte Kaffee und Kuchen.
Nachdem sie etwas gegessen und getrunken hatten, kamen sie wieder auf das Lied zu sprechen, und der Alte erzählte ihm, dass es wohl keinen Mexikaner gäbe, der dieses Lied nicht kenne, liebe und immer wieder singe und spiele.
„Ich habe es heute zuerst gehört“, sagte der Missionar, „aber ich habe es gleich liebgewonnen“, und er fing wieder an, es zu pfeifen. Sie brauchten sich nicht zu genieren, es war niemand außer ihnen beiden in dem kleinen Baumgarten.
Der Mexikaner meinte, es ginge schon besser als zuvor, und pfiff es ihm wieder vor.
Und dann pfiffen sie beide und übten so lange, bis der Missionar es allein konnte und meinte, dass er das Lied nun nie wieder vergessen werde.
Inzwischen mochte wohl die Schaustellung in der Arena beendet worden sein, denn der Garten füllte sich mit Leuten, meistens Amerikanern, doch hier und da in ihrer Begleitung auch ein Mexikaner besserer Klasse. Die meisten bestellten sich Bier oder Wein, und der Missionar dachte, sein Begleiter würde vielleicht auch gern etwas Derartiges trinken. Doch der wies ab und dankte entschieden.
Die beiden hatten sich auch schon ihre Namen genannt. Antonio Romo hieß der Mexikaner, wollte aber nur Antonio genannt werden, weil alle Leute ihn nur Antonio nannten.
„Trinken Sie überhaupt kein Bier oder geistige Getränke, Antonio?“, fragte der Missionar.
„Nein“, sagte er.
„Warum nicht?“
Antonio Romo knöpfte sein leichtes seidenes Hemd auf, unter dem ein sauberes rosa Unterhemd sich zeigte. Er öffnete auch dieses, und ein kleines silbernes Bildnis der Mutter Maria mit dem Jesusknaben auf dem Arm, das an feiner silberner Kette auf der dunkelbraunen Brust des Alten hing, kam zum Vorschein.
„Um ihretwillen“, sagte er, das Bildnis ergreifend, „ich habe es gemerkt, sie sieht es nicht gern.“
„Ich sehe, Sie sind ein Katholik“, sagte der Missionar.
Der Mexikaner warf sich in die Brust und sagte: „Ja, mein Herr, ich bin ein Kind derIglesia Katholica grande.“
Er sagte das in einer so eigenartigen, auffallenden Weise, dass der Missionar sofort den Gedanken bekam, die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche müsse im Leben des Alten eine besondere Rolle gespielt haben, irgendwie entscheidend über Glück oder Unglück, Leid oder Freude gewesen sein. Er hätte gar gern gewusst, was es damit auf sich habe, da er ein Interesse an dem Alten gewonnen. Um ihm womöglich bei dem Thema zu halten, sagte darauf der Missionar: „Ich bin ein Protestant.“
„Dann hassen Sie wohl die heilige Jungfrau?“
„Was? Ich die Mutter meines Herrn hassen? Nein, ich liebe und ehre sie. Der heilige Engel hat sie die Gebenedeiete unter den Weibern genannt, und unser himmlischer Vater hat sie wert und würdig erachtet, die Mutter seines einzigen Sohnes zu werden. Die Verheißung Gottes hat sich an ihr erfüllt, dass die Kraft des Heiligen Geistes sie überschatten solle und dass das Heilige, das von ihr geboren werden sollte, Gottes Sohn heißen würde. Wie können Sie nur denken, dass ich Maria nicht lieben und ehren sollte!“
„Sie sind anders wie die andern“, entgegnete Antonio, „die andern verachten sie und verachten uns, weil wir sie lieben.“
„Ich fürchte, Sie verstehen die nicht richtig, die Sie ,die andern‘ nennen. Christen verachten keinen Menschen, weder den geringsten noch den schlechtesten. Sie lieben sie alle, wie ihr himmlischer Vater die ganze Welt so geliebt hat, dass er ihr seinen eingeborenen Sohn gab. Sie möchten so gern, dass alle Menschen von diesem Sohn Marias hörten und von der Maria lernten, alle Worte, die von diesem ihren Sohn gesagt sind, in ihren Herzen zu bewegen und zu bewahren. So bin auch ich unterwegs, um zu Leuten zu gehen, die noch nichts von Gottes und Mariens Sohn wissen, um ihnen von ihm zu sagen.“
„Wohin gehen Sie und zu wem?“, unterbrach Antonio den Sprechenden.
„Ich gehe zu den Indianern in Arizona.“
„Nach Arizona?“, fragte Antonio hastig und offenbar interessiert. „Da ist es schön. Ich bin dort gewesen. Vielleicht gehe ich noch einmal wieder dorthin. Vielleicht bald. Hoffentlich sehen wir uns dort wieder. Ich möchte Sie weiter hören.“
„Arizona ist groß, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. So sagte auch damals der Engel zu Maria. Gern, sehr gern würde ich Sie wiedersehen, Antonio!“, sagte der Missionar, als Antonio sich jetzt erhob und ihm die Hand zum Abschied reichte.
Ohne noch ein Wort seines neuen Bekannten abzuwarten, ging Antonio davon. Er ging mit eiligen, elastischen Schritten, die eigentlich gar nicht zu dem Alter des Mannes passten.
Der Missionar bemerkte wieder das eigentümliche Wiegen des Oberkörpers in den Hüften, das ihm an den Stierkämpfern in der Arena so gefallen hatte. Ob der Antonio in seinen jungen Jahren auch einmal ein Matador oder Banderillo gewesen war?
Doch das interessierte den Missionar weniger; aber was es mit derIglesia Katholica Grandeauf sich habe, das hätte er wohl wissen mögen, denn das war ihm jetzt ganz klar: Es gab eine Stunde in Antonio Romos Leben, wo diese eine bedeutende, entscheidende Rolle gespielt haben musste ...
Am nächsten Tag setzte der Missionar seine Reise nach Arizona fort. Zunächst ging es durch Neu-Mexiko.
Schon in Texas waren unter den Passagieren viele Mexikaner gewesen; der Missionar hatte sie aber weit weniger beachtet als jetzt, nachdem er die Bekanntschaft Antonio Romos gemacht hatte.
Er wunderte sich über sich selbst, dass er sie bislang fast ganz beiseite hatte liegen lassen. Sie waren doch eine recht interessante und auffallende Reisegesellschaft, diese Mexikaner, besonders wenn so eine ganze, auf der Wanderschaft begriffene Familie in den Eisenbahnwagen hereinkam.
Ihren ganzen Hausrat hatten sie bei sich. Jeder trug etwas, Vater, Mutter und die Kinder, vom größten bis zum kleinsten.
Der Vater hatte immer ein großes, unförmiges Bündel aufgerollter Bettdecken. Das älteste Kind trägt das Baby, ein anderes den Korb, der etwas zum Essen und Trinken für die Reise enthält. Ein weiteres hat einen großen Korb oder Kasten, in dem etliche lebendige Hennen untergebracht sind. Noch ein anderes hat den Besen, das Bügeleisen und ein Jesus- oder Muttergottesbild in billigem Goldrahmen.
Dann die Mutter, die Hauptperson in der Familie: Sie hat in der einen Hand einen Eimer, der vollgefüllt ist mit Tellern, Tassen, Löffeln, Messern und Gabeln, ganz oben drauf hat sie das wichtigste Stück des ganzen beweglichen Eigentums der Familie, die Weckuhr.
Diese lässt sie auch nicht aus der Hand, sie hat sie die ganze Reise über auf dem Schoß und hält sie fest. Es hängt ja so viel für alle davon ab, dass der Mann zur rechten Zeit am Morgen auf seinem Arbeitsplatz erscheint, wo er den Unterhalt für die Frau und alle die Kinder verdienen soll.
Die Kleider, die sie besitzen, haben die Leutchen all auf dem Leib, oft drei oder vier Röcke und Hosen übereinander, einerlei, wie heiß es ist. Es ist ihnen dies die bequemste Art, die Sachen zu transportieren. Dabei kriechen sie noch so dicht wie nur möglich zusammen, schwatzen und kichern unaufhörlich und machen so recht den Eindruck anspruchsloser und darum glücklicher und zufriedener Menschen.
Es waren fast ausschließlich Leute, die aus dem Innern Mexikos kamen, um in den Vereinigten Staaten bessern Verdienst zu finden als in der Heimat. So sprachen sie alle nur spanisch, und der Missionar musste sich damit begnügen, die Kinder durch allerlei kleine Dinge zu erfreuen, die er von den bekannten fliegenden Händlern kaufte, wie sie sich auf allen amerikanischen Eisenbahnen befinden.
Bald aber, je weiter die Reisenden nach Arizona hineinkamen, stellten sich auch Indianer in dem Zug ein, und von da an gehörte die Aufmerksamkeit und das Interesse des Missionars diesen seinen ihm zur Fürsorge befohlenen roten Brüdern.