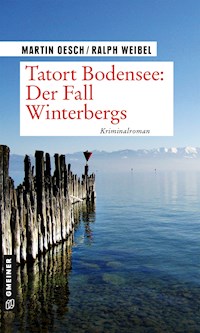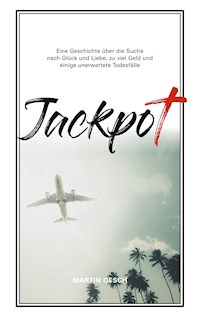
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rätselhafte Todesfälle erschüttern Krauchtal, ein Dorf in den Schweizer Voralpen: Der Bäcker wird im Mehltank begraben, die Biologie-Lehrerin erstickt an einem Ei und der Wirt versinkt im See einer geheimnisvollen Höhle. Was haben diese Toten mit dem Gewinn eines Millionen-Jackpots zu tun? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Polizei, sondern auch Carl Humboldt, einen bald 50jährigen Journalisten, der sich eigentlich mit seinem geistigen Vorruhestand bereits abgefunden hatte. Unvermittelt sieht er sich aber inmitten einer Jagd nach Millionen und der Suche nach dem Mörder, die ihn um die halbe Welt und gleichzeitig immer tiefer in die wenig ruhmreiche Vergangenheit des Dorfes und seiner Bewohner führt. Jackpot: Eine Geschichte über Glück und Liebe, über zu viel Geld und einige unerwartete Todesfälle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Oesch, Jahrgang 1962, wohnt im Osten der Schweiz, ganz in der Nähe von Krauchtal, wenn es den Ort nur gäbe. Er leitete viele Jahre lang das Programm eines Radiosenders, bis er beschloss, dass ihm die Wirklichkeit zu langweilig wird. Da erfand er Carl Humboldt und dessen Abenteuer mit dem Jackpot.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
KAPITEL 1
»Arschloch«, dachte Humboldt und sagte: »Ich sehe das Problem.« Er rümpfte die Nase. »50 Gramm. 50 Gramm!« wiederholte Tanner mit Nachdruck. »Und 2 Franken, lächerlich.« Rote Flecken zeigten sich auf Tanners Hals, was sie immer taten, wenn er aufgeregt war. »Wie konntest Du daraus nur eine Geschichte zimmern?« Humboldt sass ganz vorne auf der Stuhlkante und überlegte sich, ob Arschlochs Frage eine Antwort verdiente. Die Sekunden verstrichen. Die Luft im Chefbüro – eine Mischung aus abgestandenem Zigarettenrauch und Schweiss – war zum Schneiden dick. »Ein Konsumthema …«, begann Humboldt schliesslich, machte eine Pause, betrachtete seine Fingerspitzen, was er immer tat, wenn er nicht mehr weiterwusste, und fasste neuen Mut: »Bringt mir mehr Konsumthemen, verlangst Du ständig. Das war eins. Und ein gutes dazu!« Die Geschichte war folgende: Die Bäckerei Simoni verlangt für ihren Advents-Panettone, der seit Mitte Oktober im Verkauf ist, 2 Franken mehr als letztes Jahr, und macht ihn gleichzeitig 50 Gramm leichter.
»Simonis Schummeleien« war schliesslich der Titel des Einspalters am letzten Mittwoch. Simoni nahm zu den Vorwürfen im Artikel keine Stellung, sondern wählte umgehend Tanners Nummer und machte dem Chefredaktor des Toggenburger Volksfreundes klar, was mit dem fünfstelligen Werbebudget der Bäckerei Simoni geschehen wird, sollte das Blatt nicht eine Gegendarstellung abdrucken. »Gegendarstellung?« krächzte Tanner in sein Telefon. Da gab es nichts Anderes darzustellen. 2 Franken, 50 Gramm. Das waren die Tatsachen. »Ich lasse mir was einfallen« versprach Tanner Simoni und hängte auf.
»Also keine Gegendarstellung. Sonst eine Idee, Humboldt?« Die Frage war rhetorisch gemeint. Carl Humboldt war mit Baujahr 1970 der älteste Redaktor im fünfköpfigen Team beim Volksfreund. Vor einem Jahr erst heuerte er hier an. Die Bemühungen um Arbeit, welche die Arbeitslosenkasse von ihm verlangte, trugen unverhofft Früchte und trieben Humboldt in die voralpine Provinz. Und hier fiel er auf, nicht nur wegen seiner Grösse von 1 Meter 90. Die Kurzhaarfrisur mit ersten grauen Ansätzen war immer top gepflegt, gekleidet war er immer mit Hemd, im Sommer ein Baumwoll- oder Leinenhemd, im Winter ein solches aus Flanell. Humboldt lenkte den Blick von seinen Fingerspitzen wieder zurück auf Tanner, kratzte sich diskret den beginnenden Bauchansatz, betrachtete die Schweissflecken unter Tanners Achseln und liess seinen Kopf leicht nach links fallen. Was für ein verheissungsvoller Wochenstart. Schweigen. Humboldt räusperte sich: »Hier geht’s um die Glaubwürdigkeit.« Pause. «Nicht nur um meine, sondern auch die Deiner verdammten Postille.« Mittlerweile roch es doch sehr streng hier. Samuel Tanner, übergewichtig, leicht untersetzt und Chef hier seit Menschengedenken, drehte sich langsam einmal um 360 Grad in seinem Bürostuhl, um etwas Zeit zu gewinnen. »Du lieferst mir bis Mitte Woche eine Geschichte über Simonis Panettone. Wie verdammt glutenfrei der ist, möglicherweise vegan, was weiss ich … Oder dass die Kunden extra von Zürich nach Krauchtal fahren wegen dem exquisiten Stück Teig. Irgendwas halt!« Humboldt betrachtete mit ein wenig Sorge, wie die roten Flecken am Hals langsam über Tanners Doppelkinn nach oben wanderten, so dass mittlerweile sein ganzes Gesicht ein einheitliches Rot annahm. Eine weitere Pause. Tanners Bürostuhl quietschte bei der leichtesten Bewegung leise. Das uralt iPhone 4 in Humboldts Hosensack, vorsichtshalber auf lautlos gestellt, vibrierte kurz. Wohl der falsche Zeitpunkt, einen Blick darauf zu werfen. »Nun denn, wenn das alles ist«, murmelte Humboldt und machte sich daran, aufzustehen und den Rückzug anzutreten. Tanner erhob sich ebenfalls und baute sich, obwohl mindestens einen Kopf kleiner, vor Humboldt auf: »Bieg das wieder gerade, oder der Verlust unserer verfickten Glaubwürdigkeit wird ein absurdes Luxusproblem bleiben! Tu was. Mach was!!« bellte er ihn schliesslich an. »Und was von beidem zuerst?« fragte Humboldt nach einer kurzen Pause unschuldig zurück.
KAPITEL 2
»Tock, tock.« Dumpf hallten Simonis Schritte im 30’000 Liter fassenden Mehltank im Keller der Bäckerei. Halbjährliche Inspektion wegen möglichem Schimmelbefall. An einem Montag, weil da die Bäckerei geschlossen hat. Und im Oktober, bevor der Weihnachtsrummel losging. Vor allem die Nahtstellen sind heikel und wurden darum besonders gründlich von der Taschenlampe ausgeleuchtet. Die berühmte Ouverture zu Rossinis »Diebische Elster« dröhnte laut durch das Kellergewölbe. Italienische Oper! Wie er sie liebte. Eine Zuneigung, die leider gänzlich einseitig war. Wenn Unmusikalität sich in einem Menschen manifestierte, dann in der Person von Federico Simoni: Mitte 40, Sohn italienischer Einwanderer und Meisterbäcker in zweiter Generation. Simonis lautes Pfeifen begleitete Rossinis meisterlich gesetzte Tonfolgen weder melodisch noch rhythmisch akkurat. Was freilich niemandem weniger auffiel als dem gut gelaunten Simoni. Der kauerte auf dem Boden des Tanks, befreite mit einem feinen Pinselchen die letzten Mehlreste aus den Ritzen, leuchtete diese sorgfältig aus und quittierte das Nichtvorhandensein dunkler Flecken mit einem zufriedenen Grunzen.
Simoni war so in die wunderbare Musik versunken, dass er nicht bemerkte, wie das skurrile Treiben am Boden des Tanks durch die Luke aus vier Metern Höhe beobachtet wurde. Was für eine grossartige Inszenierung! Mit Rossini als Soundtrack, mit dem Bäcker und seinem Mehl als Hauptdarsteller und dem Keller der Bäckerei als Kulisse. Und so griff ein dunkel gekleideter Mann oben nach dem ersten der aufgeschnittenen Mehlsäcke, die bereitstanden, um den Tank für die nächsten Wochen wieder aufzufüllen. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe nach unten zu Simoni. Der, irritiert von einem zweiten Lichtkegel, unterbrach das Pfeifkonzert, rückte seine Brille zurecht und schaute verwirrt nach oben, zur Quelle des Lichtstrahls. Was für ein Blick: Er zeigte totale Ratlosigkeit, aber auch die vage Erkenntnis, dass hier in dem Moment etwas fürchterlich schieflief. Die ersten 20 Kilo Mehl trafen Simonis Gesicht frontal pünktlich zu einem Crescendo Rossinis. Die Brille fiel zu Boden und wurde vom Mehl begraben. Augenblicklich raubte der feine aufgewirbelte Staub Simoni Sicht und Atem. Bei der nächsten Packung Mehl erwischte es Simonis Taschenlampe, die ihm aus der Hand rutschte und beim Aufprall ihren Dienst quittierte. Verzweifelt versuchte der Bäcker, in der Dunkelheit und ohne Brille die Orientierung nicht zu verlieren. Das Bemühen, Augen und Rachen vom Mehl zu befreien, wurden von der dritten und vierten Ladung von oben zunichte gemacht. Simoni verlor nun das Gleichgewicht und rutschte in seinen mit einer feinen Plastikfolie überzogenen Schuhen auf dem Mehl aus. Unaufhörlich folgten weitere Ladungen Mehl in immer schnellerem Rhythmus. Fast schien es, als ob der Täter Rossinis Tempo aufnahm. Der Boden war bereits mit einer dicken Mehlschicht bedeckt. Auf allen Vieren tastete Simoni vergeblich nach Brille oder Lampe und irrte immer zielloser im nebligen Weiss umher. Er musste stark husten, und mit jedem Mal füllte sich seine Lunge weiter mit dem feinen weissen Pulver. Im Zehnsekundentakt folgte nun eine Ladung Mehl nach der anderen und begrub Simoni immer tiefer und tiefer unter einer feinen, weissen Mehlschicht. Er atmete nur noch stossweise und schien sich seinem Schicksal ergeben zu haben. Nach weiteren fünf Minuten Mehldusche war – abgesehen von Rossinis fröhlicher Begleitung – endlich Ruhe. Die Leiter, über die Simoni den Tank betreten hatte, wurde nun ohne Eile zurück nach oben gezogen. Der Strahl der Taschenlampe suchte durch den Mehlstaub ein letztes Mal den Boden ab, der nun so friedlich und ruhig dalag wie eine frisch verschneite Winterlandschaft. Keine Spur mehr von Simoni. Er war unter dem Mehl begraben. Zur Sicherheit folgten weitere zehn Säcke. Dann war Schluss. Als letztes fiel aus der Luke ein kleiner metallener Gegenstand ins Mehl. Der verschwand augenblicklich im Weiss. Dann wurde vom ungebetenen Besuch die Luke zum Tank vorsichtig und fachkundig verschlossen. Nur Rossini musizierte aus den Boxen unverdrossen weiter. Der Chor sang von einem glücklichen Tag: Oh, che giorno fortunato!
KAPITEL 3
Wenn Humboldt etwas richtig gut konnte, dann nichts tun. Er war ein Meister der Prokrastination. Und bevor Sie jetzt nachschlagen müssen: Er schob gerne Aufgaben vor sich her. Eigentlich beschreibt das hässliche Fremdwort eine Arbeitsstörung. Aber für ihn war das keine Störung. Humboldt fühlte sich wohl dabei. Er war charakterlich das pure Gegenteil seines berühmten Namensvetters, des umtriebigen deutschen Entdeckers Alexander von Humboldt. Carl war faul, meistens, ausser einmal täglich beim Schreiben. Seine Jobs verdankte er aber in der Tat meist seinem Nachnamen Humboldt. Sein mittlerweile pensionierter Vater war ein ebenso geschätzter wie auch gefürchteter Dozent für Deutsche Sprache an jeder Journalismus-Schule nördlich der Alpen, Verfasser diverser Standardwerke auf diesem Gebiet, mit immer akkurat gescheitelter Silbermähne und, etwas vom wenigen, das er seinem Sohn vererbte, stechend blauen Augen. Die Familienverhältnisse waren – obwohl Humboldts in sehr wohlhabenden Verhältnissen in einem Herrschaftshaus an der Zürcher Goldküste wohnten, schwierig. Humboldts Mutter verliess ihren tyrannischen Ehemann, als Carl zehn Jahre alt war. Sie brannte mit einem von Seniors Studenten nach Deutschland durch und brach jeden Kontakt zu ihren Männern ab. So wurde Carl von einer strengen Haushälterin aufgezogen: Mathilda, gesegnet mit kupferroten Haaren, die sie stets ordentlich zu einem Dutt frisierte, und mit einem Geruch und einem Herz aus Stahl. Ihr konnte Carl nie etwas recht machen, und so wuchs im Halbwüchsigen bereits die Erkenntnis heran, dass er gerade so gut nichts machen konnte als etwas mutmasslich Schlechtes, das jedenfalls nicht gefiel. Mathilda, so hätte jeder Hobbypsychologe diagnostiziert, war darüber hinaus schuld an Carls Autismus der Damenwelt gegenüber: Bindungsängste wegen mangelnder Mutterliebe und übermächtiger weiblicher Autoritätsperson.
Sein Vater war oft ausser Haus, unterrichtete an Schulen im ganzen deutschsprachigen Raum. Sie hatten zeitlebens kein besonders herzliches Verhältnis: »Du bist ein talentierter Taugenichts«, meinte der Senior zum Junior. Immerhin: Der Name Humboldt führte immer noch zu leichten Beben in Journalistenkreisen. So glaubte mancher Chefredaktor, sich mit dem Namen auch Qualität einzukaufen. Wie vor knapp einem Jahr auch Samuel Tanner vom Volksfreund. Er war der letzte in der Reihe, was damals weder er noch Humboldt ahnten.
»Und? Wie lief’s?« fragte Sunny, als Humboldt das Chefbüro verliess. »So gut wie’s unter diesen Umständen gehen konnte«, antwortete er. »Dicke Luft momentan. Und wenn Du ihm nicht das Deo wechselst oder dafür sorgst, dass er überhaupt eines benutzt, befürchte ich für den Frühling mit steigenden Temperaturen noch Schlimmeres.« Sonja Krüger, dank ihrem sonnigen Gemüt von Humboldt und dem Rest der kümmerlichen Truppe »Sunny« gerufen, war ein ehemaliges Foto-Modell und auch heute noch, geschätzt Mitte 30 und seit rund zwei Jahren Tanners Assistentin, eine erhabene Erscheinung: Eine Frau, die wo immer sie auftrat, auffiel, nicht zu letzt dank ihrer Grösse von knapp einem Meter 80. Sunny überging Humboldts Anspielung wegen dem Deo routiniert und kommentarlos. Von ihrer Liaison zu Tanner wusste die gesamte Redaktion, obwohl sich die beiden nach Kräften bemühten, diese so diskret wie möglich zu halten. Humboldt fragte sich regelmässig, was eine Frau wie Sunny an einem Mann wie Tanner reizt. Die Macht vielleicht? Oder das fast schon mütterliche Bemühen, so einen wie Tanner noch umzuerziehen, ja ansatzweise mit gestalten zu können?
»Wenn Du mir in den nächsten Tagen einen Termin bei Simoni organisierst …«, bat Humboldt Sunny. »Simonis Schummeleien?« fragte sie zurück. »50 Gramm, 2 Franken«, bestätigte er. Da vibrierte sein Handy ein zweites Mal im Hosensack. Später. Genug geärgert für heute. Jetzt war es Zeit fürs Feierabendbier. »Bis morgen!« Sunny sah Humboldt nach: Schöner Arsch, dachte sie. Dabei meinte sie das Körperteil und noch nicht den Charakter.
KAPITEL 4
Schauen Sie sich das Dorf von oben an, wie bei einer Modelleisenbahn. Sofern Sie überhaupt etwas sehen, denn der Nebel hält sich jetzt schon, zu Beginn des Herbsts, hartnäckig im engen Tal des Toggenburgs. Krauchtal war mit knapp 1000 Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden weit und breit und wirkte bei solchem Wetter besonders verschlafen. Das Inventar war mittlerweile recht übersichtlich: Zentral gelegen ein Bahnhof mit Zugshalt jede Stunde, einmal talauf-, einmal talabwärts. Immerhin im Takt. Die Umfahrungsstrasse, vor drei Jahren mit Pomp eröffnet, sorgte zwar für weniger Abgase, sog aber gleichzeitig noch das letzte Leben aus dem Dorf. Strukturwandel nannte sich das wohl in Ökonomen-Deutsch. Wer konnte floh ins Unterland, in die Stadt. Die Jungen verliessen das Dorf spätestens fürs Studium und kehrten nicht mehr zurück. Handwerksbetriebe verschwanden, eine Drogerie und die Metzgerei ebenso. Die Spezialitäten-Bäckerei Simoni hielt sich tapfer, dazu das Restaurant Leuen mit dem Mehrzwecksaal für Gemeindeversammlungen und das Weihnachtsessen des FC Krauchtal, der auf einem holprigen Fussballfeld eine kleine Junioren- und eine jedes Jahr weiter dezimierte Senioren-Abteilung beschäftigt hielt. Ausserdem gab es ein kleines Schulhaus mit noch vier Klassen. Der Skilift, der gleich daneben im Winter vor zwei Jahren letztmals einige wenige Verwegene 500 Meter weit einen Hügel hochzog, wird wohl auch diesen Winter nicht mehr in Betrieb gehen. Die Menschen hier wohnten meist in kleinen Häuschen aus den 50er oder 60er Jahren, die über die Hügel verstreut lagen, oder in einem der schmucklosen Mehrfamilienhäuser, die zwischen 1985 und 1995 zwischen Bahnhof und Umfahrungsstrasse entstanden. Blieb nur noch die Lokal-Redaktion des »Volksfreunds«, die sich günstigst in den verwaisten Büroräumlichkeiten einer ehemaligen Grossschreinerei einmietete und die Zentrale in Kirchwil mit Lokalstoff aus dem ganzen Toggenburg versorgte. In Druck ging das monatlich immer dünner werdende Blatt längst im Unterland. Gerüchte über eine Schliessung der lokalen Aussenstelle machten immer wieder die Runde, was der Laune der dort Beschäftigten nicht ausserordentlich förderlich war.
Während Humboldt durch das verlassene Dorf zu seinem verfrühten Feierabend-Bier schlenderte, nahm er sich vor, mal wieder nachzufragen, was an den Gerüchten dran sei, dass auch der letzte Lebensmittelladen, eine Migros mit dem Nötigsten für den täglichen Bedarf, das Dorf verlasse. Gute Geschichten waren rar im Tal.
Da stand sie: Haare und Augen so dunkel wie Öl, eine Haut so ebenmässig wie frisch geschliffener Kristall, meist mit einem Duft nach feinstem Patchouli verziert, dazu ein Gang wie ein Engel auf der Wolke: Shaila war eine Schönheit, mehr noch: die ästhetische Perfektion in der Gestalt eines Weibs. Und damit der Hauptgrund, warum das »Red Tiger« überhaupt noch ab und zu Gäste hatte. Ein bescheuerter Name für ein Lokal in einem Dorf wie Krauchtal, geschuldet der ehemaligen Wirtin und Mutter von Shaila: einer Frau aus Sri Lanka, die Mitte der achtziger Jahre vor dem Bürgerkrieg floh mit nichts als ihrem geretteten Leben und einem Kochbuch. »Tiger ist schlauer als Löwe«, meinte sie damals mit Blick auf den gastronomischen Konkurrenten im Dorf und so wurde aus dem Sternen ein asiatisch-indisches Restaurant mit exotischem Namen. In der freien Wildbahn liefen sich Tiger und Löwe zwar nie über den Weg. Im kleinen Krauchtal hingegen hatten das »Red Tiger« und der »Leuen« dasselbe, immer übersichtlicher werdende Jagdgebiet, das zur Hauptsache aus wenigen Jass-Runden und Familienfeiern bestand. Der Kobelt Franz, ein Einheimischer, Goalie in der Seniorenfussballmannschaft des FC Krauchtal, das weil gross gewachsen, mit schlaksigem Gang und gelassenem Gemüt, verliebte sich auf der Stelle in die Frau aus Sri Lanka. Ihr Kind, eben die Shaila, kam exakt zehn Monate nach der deren ersten Begegnung auf die Welt und schien sich das beste aus den beiden Gen-Pools geschnappt zu haben. Leider war dem Hausherrn kein langes Leben beschert: Über 20 Jahre Wirteleben forderten ihren Tribut, und so starb der Kobelt Franz mit 55 an einem Herzinfarkt zwischen den Pfosten des FC Krauchtal. Gerade noch hatte er einen Penalty abgewehrt, da brach er unter der Last des Jubels seiner Mitspieler zusammen. Shailas Mutter, nun ihrerseits mit gebrochenem Herzen und mit wachsendem Heimweh, kehrte ein Jahr später ins nun friedliche und dank Tourismus wieder hoffnungsvolle Sri Lanka zurück und hinterliess ihrer Tochter, die hier aufgewachsen war und nicht mitwollte, das Lokal.
»Carl. Wie schön!« Shaila war eine der wenigen im Dorf, die ihn beim Vornamen nannte. »Wie immer: Ein Tiger?« »Gerne!« Curry lag in der Luft. Der Gesellschaft Shailas zu Liebe trank Humboldt das importierte und darum stark überteuerte indische Gebräu. Dazu servierte sie eine Schale mit gerösteten Kichererbsen. Humboldt war schnell zufrieden. Er genoss es, in Shailas Nähe zu sein. Denn sie war nicht nur schön, sondern ebenso schlau, wenn nicht sogar noch schlauer als schön. Shaila war nicht nur Humboldts beste Freundin, sondern – wenn er ehrlich war – momentan auch die einzige. So war es auch leicht, die beste zu sein. Natürlich hatte Humboldt viele Bekanntschaften, Frauen mochten grosse Männer wie ihn. Leichtes Spiel, am Anfang. Aber immer, wenn’s ernst wurde, flüchtete er. Das letzte Mal kostete ihn seine Flucht den Job. Die Lehre aus seiner Affäre mit Gisela W., Chefredaktorin der Mittelland-Zeitung: Don’t fuck your boss. Zumindest diese Gefahr drohte hier beim Volksfreund nicht, dachte Humboldt mit einer Mischung aus spontaner Dankbarkeit und leichter Übelkeit.
Das Lokal war leer. Typisch für einen nebligen Abend im Oktober. Schön schäumte das Tiger im Glas. Humboldt nahm einen kräftigen Schluck und erzählte Shaila vom Gespräch mit Tanner, was sie etwas unsensibel aber korrekt mit »Luxusproblem!« kommentierte. »Und sonst?« Humboldt betrachtete nachdenklich seine Fingerspitzen. Da war doch noch was. Kurz bevor das Schweigen peinlich wurde, fielen ihm die SMS wieder ein. Er fingerte sein iPhone aus der Hosentasche, und da waren sie, die beiden Mitteilungen:
Heute, 15.21
Gute Geschichte! Interesiert?
Heute, 15.43
Geben Sie heute noch Bescheid. Sonst verfellt das Angebot
Humboldt kannte die Nummer des Absenders nicht. Es war keiner seiner abgespeicherten Kontakte.
»Schau mal«, sagte er und zeigte Shaila die Nachrichten. Eine wunderbare schmale Falte bildete sich auf ihrer Stirn: »Schlampig«, meinte sie. »Was schlampig?« »Zwei Schreibfehler. Ausserdem fehlt der Punkt. Hinter das Wort »Angebot« gehört ein Punkt. Unsorgfältig jedenfalls, oder er hatte es eilig.« »Oder sie.« »Sie?« »Das könnte auch eine Frau geschrieben haben.« »Kaum. Ein Ausrufezeichen hinter »Gute Geschichte«. Das sieht ganz nach einem Mann aus. Angeber.«
KAPITEL 5
Humboldt lag auf dem Sofa im Zimmer 11, trank billigen Rotwein, wenn auch Bio, und wartete. Im Pay-TV lief ein Fussballmatch, Premier League, dritter gegen elfter. Wer tut sich so was an? Der Ton war abgedreht. Humboldt hatte so immerhin das Gefühl, nicht allein zu sein, und wurde doch nicht gestört beim Nichtstun. »Bin interessiert!« schrieb er noch im Red Tiger während dem dritten Bier. »Nimm das Ausrufezeichen weg«, riet Shaila. »Bleib entspannt und mach einen Punkt.« Das war vor drei Stunden. Seither wartete Humboldt. Seine ›Wohnung‹ war ein Hotelzimmer im Leuen: hartes Bett, enge Dusche, kleine Küche, das letzte Mal Anfang der 90er Jahre renoviert. Es roch etwas nach abgestandener Feuchtigkeit. »Bekommst Du nicht mehr raus aus den alten Mauern«, meinte der Leuen-Chef Milo Babic schulterzuckend. Verwohnt nannte man so was wohl. Das Zimmer war ein Spiegel von Krauchtal, von Humboldt selbst: die besten Zeiten schon hinter sich. Der Vorteil der Unterkunft war: 750 im Monat, inklusive. Also finanziell seinem Journalistenlohn angemessen. Und Babic nahm so mit immerhin einem der zwölf Zimmer des Hauses noch etwas Geld ein. Wohnen im Leuen, Essen und Trinken beim Tiger. Umgeben von Raubtieren.
Humboldt hatte Shaila sehr lieb, und wer weiss, was wäre, wenn es da nicht den beträchtlichen Altersunterschied gäbe. Sie war Ende Zwanzig, er bald 50. Dazu kam die latente Unlust von Humboldt, sich auf richtige Arbeit einzulassen, das galt für Beziehungsarbeit ebenso. So waren sie immerhin beste Freunde, without benefits. Vorläufig. Humboldt für sich schloss da nichts aus.
Ein unspektakuläres 0:0 wurde abgepfiffen, und bevor die Expertenrunde ihre unerträgliche Analyse beginnen konnte, zappte sich Humboldt durch die restlichen knapp hundert Sender und schaltete schliesslich den Kasten aus. Noch immer keine Antwort. Vielleicht war der Punkt anstelle des Ausrufezeichens doch zu entspannt gewesen, zu wenig interessiert. Eine gute Geschichte, das hätte ihm im Volksfreund etwas Luft verschafft und ihm möglicherweise sogar den Kreuzgang zu Simoni erspart. Entspannt bleiben … Shaila hatte gut reden. Ein weiteres Glas Rotwein unterstützt die Entspannung, dachte Humboldt und griff nach der Flasche, als sein Handy diskret laut gab:
Heute, 22.51
187 Millionen für Krauchtal. Rekord-Jackpot geht ins Toggenburg!
Humboldt starrte aufs Display, trank einen grossen Schluck Wein und tippte:
22.52
Quelle?
22.53
Der Gewinner!
KAPITEL 6
Die Zunge fühlte sich am nächsten Morgen leicht pelzig an. Da half alles Bio nichts. Aber wenigstens war der Rest des Kopfs nach einer ausgiebigen Dusche und dem zweiten Kaffee schnell wieder klar. Zeichen von beginnendem Alkoholismus?
Leider meldete sich Shaila gestern Abend nicht mehr. Es war auch schon nach 23 Uhr, als er ihr die aufregende Neuigkeit mitteilen wollte. Denn Humboldt war auch leicht angetrunken klar: Soweit machten die SMS Sinn. Tatsächlich gab es letzten Freitag bei der Ziehung der Euromillions nur einen Gewinner, der einen dreistelligen Millionenbetrag einstrich. Die Nachricht stand am Samstag auch im Toggenburger Volksfreund auf der Seite mit den vermischten Meldungen. Wohin das Geld fliesst, war in der ersten kurzen Agentur-Meldung freilich im Dunkeln geblieben. Humboldt erinnerte sich: Wurde da nicht üblicherweise das Land, sogar die Region, wo der Schein aufgegeben wurde, auf Nachfrage bekannt gegeben? Keine grossartige Recherche, aber so lange es niemand anderes tat, war es Humboldts Primeur. Und den konnte er, angesichts des Panettone-Gates, gut gebrauchen. Das war der Plan für heute. So was hatte er selten.
Schöne Schlagzeile jedenfalls: Millionen für Krauchtal. Je länger Humboldt über die mögliche Geschichte nachdachte, desto besser gefiel sie ihm. Ein Dorf wird von Millionen geflutet: Wer ist der Gewinner? Alle rätseln, verdächtigen einander. Der Bäcker den Wirt, der Pfarrer den Ministranten, der Schüler den Lehrer. Wer verhält sich auffällig? Gibt als erster ohne Grund eine Runde im Leuen aus? Und was passiert mit den Millionen an Steuereinnahmen, die fällig werden? Wo nicht viel ist, wächst der Neid besonders gut.
Das Ding konnte tatsächlich gross werden. Mit einer für seine Verhältnisse ungewohnten Dynamik wählte Humboldt ein frisches Hemd und kontrollierte – das hatte ihm die verflossene Gisela beigebracht – im Badezimmer-Spiegel die Nasenhaare, respektive die gewünschte Abwesenheit derselben.
Vom Leuen in die Redaktion des Volksfreunds war es nur ein gut fünfminütiger Spaziergang. Fast alles in Krauchtal lässt sich übrigens in fünf Minuten zu Fuss erreichen, ausser Shailas Red Tiger, das etwas ausserhalb lag. »Richte Tanner aus, er soll mir den Aufmacher für morgen freihalten«, bat Humboldt Sunny, als er die Redaktion betrat. »So früh, so dynamisch? Wie kommt’s? Und nicht einmal ein Guten Morgen liebe Sunny, hervorragend siehst Du heut mal wieder aus!« Nachdem es keine Anzeichen für einen kurzen Flirt gab, rief Sunny ihm nach: »Aber gerne doch!« Schon knallte die Türe zu Humboldts Büro zu.
Bis Mittag brauchte er Gewissheit, ob die Jackpot-Geschichte tatsächlich eine war. Er schob einen Stapel mit Notizen für den Nachruf auf eine vor Monatsfrist verstorbene langjährige Volksfreund-Abonnentin beiseite und startete den PC. Und wartete. Und wartete. Und wartete bis sich auch das Betriebssystem bequemte, die Arbeit aufzunehmen. Als sein Handy den Ententanz von sich gab, zuckte er wie immer zusammen. Kollege Graf, der Blödmann aus dem Büro nebenan, hatte ihm vor einem Monat unter dem Vorwand, ein dringendes Update warte auf den Download, diesen unsäglichen Klingelton auf dem Handy eingerichtet und weigerte sich seither standhaft, diesen Mist rückgängig zu machen. Immerhin verkürzte der zum Ton gewordene Schrecken Humboldts Reaktionszeit bei eingehenden Anrufen auf rekordverdächtige Werte. Shaila, endlich! Er erzählte ihr von den beiden neuen Mitteilungen seit den Feierabendbieren gestern. Nach kurzem Nachdenken sagte sie bestimmt: »Carl, überleg! Da treibt jemand ein Spiel mit Dir! Du bist Journalist und kein Treuhänder. Was ist sein Interesse an Dir? Warum sollte ein Lottogewinner freiwillig auf sich aufmerksam machen wollen?« Die Frage, musste Humboldt sich eingestehen, hatte was.
KAPITEL 7
Cornelia Zahner war eine langweilige Person. Als Romanfigur würde sie wohl früh in der Geschichte geopfert werden, damit der Leser wegen ihr nicht schläfrig wird. Kein Wunder war genau dies auch ihr Schicksal hier und heute, als sie einem alten Bekannten leichtsinnigerweise die Türe öffnete.
Mit Ende Dreissig sah Frau Zahner aus wie Mitte Fünfzig. Und meist fühlte sie sich auch so. Ihre Haut war so grau wie ihr Alltag, ihre Haare so spröde wie ihr Charakter. Seit ihr Mann, damals Lehrer wie sie an der Krauchtaler Schule, vor dreizehn Jahren unter nie ganz geklärten Umständen nach einer Weihnachtsfeier den Weg nach Hause verpasst hatte und tags darauf erfroren im Wald aufgefunden wurde, hatte sich die Witwe Zahner weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war stattdessen religiös geworden. Ihr Teilzeitpensum als Biologie-Lehrerin versah sie unauffällig, nie gab es Klagen, nie gab es Lob. Ihr Gemeinderatsamt als politische Vorsteherin des Schulbetriebs im Nebenamt und der sonntägliche Besuch der heiligen Messe in der katholischen Kirche Krauchtal blieben ihre einzigen öffentlichen Auftritte ausserhalb der Schule. Cornelia Zahners wahre Leidenschaft galt den Orpington-Hühnern, die sie in ihrem Garten hielt. Aus England stammend waren sie grösser und schwerer als die einheimischen Rassen: also hervorragende Eier- und Fleischproduzenten. Und der Leuen war Abnehmer für beides. Milo Babic und der verstorbene Klaus Zahner waren damals beste Freunde. Und Babic fühlte sich darum der Hinterbliebenen verpflichtet, ihr mit dem regelmässigen Kauf von Hühnerfleisch und -Eiern etwas Gutes zu tun.
Ansonsten interessierte sich niemand für die Hühner, und niemand interessierte sich für Cornelia Zahner. Dass ihrem Leben nun an einem gewöhnlichen Dienstag ein so eigenwilliges und gewaltsames Ende bereitet würde, war so gesehen eine überraschende und für sie selbst durchaus unpassende Wendung. Und dass dabei ein Ei aus ihrem Hühnerstall eine entscheidende Rolle spielte, war bittere Ironie. Opfer und Täter begrüssten sich herzlich, wie es sich für Altbekannte gehört. Und als die beiden sich kurz nach dem Eindunkeln mit zwei Gläsern Eierlikör aus eigener Produktion zuprosteten, schmeckte sie das starke Beruhigungsmittel, das der Besuch unbeobachtet in ihr Glas gab, in der klebrig-süssen Masse nicht. »Ich bin ja so gerne in ihrer Gesellschaft«, sagte sie frei von jeglichen Anzüglichkeiten. Nach dem Gottesdienst-Besuch am Sonntag und den Montagslektionen in der Schule fiel sie tags darauf öfter in ein emotionales Loch. Da kam ihr Besuch gerade recht. »Erzählen Sie, wie war Ihr Wochenende?« Trotz langer Bekanntschaft siezten sie sich beide. »Das Alter, meine Liebe. Es strengt mich tatsächlich immer mehr an.« Der Mann tat einen tiefen Seufzer und schaute nachdenklich in die zähe gelbe Flüssigkeit. »Da kommt so ein Gläschen Zaubertrank gerade recht. Sehr zum Wohle uns beiden!«
Schon nach dem zweiten Schluck dämmerte Cornelia Zahner in ihrem weichen Fauteuil langsam weg. Vertrag den Alkohol einfach nicht mehr, dachte sie noch. Immer nur die wenigen Schlückchen Messwein … »Cornelia? Liebe Frau Zahner, wie geht es Ihnen?« fragte ihr Gegenüber. Zunge und Lippen gehorchten ihr nicht mehr. Ihr Blick wurde glasig, versuchte einen Punkt zu fixieren. Vergeblich. Der Gast sass ihr nun wortlos gegenüber. Er genoss den Moment der Rache für einen Moment und griff dann in seine Jackentasche. Als ihr ohne Gegenwehr ein ungeschältes Orpington-Ei in den Rachen geschoben wurde, vernahm sie nur noch knapp die Worte: »Für Dein Schweigen. Damals.« Dann wurde die Luft knapp und ihre Welt dunkel. Cornelia Zahner und das Leben: sie wurden voneinander erlöst.
KAPITEL 8
»Wart nur Sunny. Heut schreiben wir Geschichte.« Es war 5 vor 10, und Humboldt hatte die Infos zusammen für den ersten Aufmacher zum Thema »Jackpot für Krauchtal«: Tatsächlich bestätigte Swisslos, dass der 187-Millionen-Schein in Kirchwil, dem nächst grösseren Ort talabwärts, abgegeben wurde. Weitere Infos, insbesondere zum Gewinner, gab es natürlich keine. Die brauchte er im Moment aber auch nicht. Die Story würde auch so für genügend Wirbel sorgen. Die Frage war nur, ob Tanner die Quellenlage genügte. »Zur Not machen wir ein Fragezeichen hinten hin«, schlug Humboldt an der Redaktionssitzung selbst vor. »Was Fragezeichen??? Das hat ein verdammtes Ausrufezeichen verdient!!!« Der fremde Brauch des Lächelns war Tanner auch in diesem Moment gänzlich unbekannt. Immerhin schien Sunny Humboldts Ratschlag in Sachen Deo für den Chef beherzigt zu haben. Ein billiger Duft, zu stark aufgetragen, lag in der Luft. »Aufmacher, vierspaltig, dazu zwei Kästchen: eins zu den erwarteten Steuereinnahmen, eins mit der Stellungnahme der Gemeindepräsidentin. Alles für morgen. Online warten wir noch. Sonst haben die nationalen Geier das morgen auch schon im Blatt«, befahl Tanner. Das sah jetzt schwer nach Arbeit aus, und das war nur sehr bedingt im Sinne Humboldts. »Könnten nicht auch Graf und seine Praktikantin?« fragte er mit Blick auf den 10 Jahre jüngeren Kollegen, der sich meist mit Belanglosigkeiten aus dem Toggenburger Vereinsleben aufhielt. Als er seinen Namen hörte, schweifte Grafs Blick Richtung Fenster und fixierte dort einen Punkt, der unendlich weit entfernt sein musste. »Bitte Humboldt. Da hast Du einmal im Leben eine richtig fette gute Geschichte, und willst sie gleich wieder abgeben? Kommt nicht in Frage«, meinte Tanner bestimmt. »An die Arbeit. Und vorläufig Stillschweigen, verstanden?« Kollege Graf schwankte zwischen etwas Neid für Humboldts gute Geschichte und viel Schadenfreude für die Mehrarbeit, die nun auf den Streber wartete.
»Ach Humbi! Ich bin ja sooo stolz …« »Humbi« war Sunnys Rache an Humboldts »Sunny«. »Und sag meinem Schwesterchen einen lieben Gruss.« Simone Krüger war Sunnys zwei Jahre jüngere Schwester. Mit nur halb so viel Schönheit gesegnet und halb so wenig Skrupel versehen wie Sunny, schaffte es Simone mit Mitte Dreissig problemlos an die Spitze der politischen Gemeinde Krauchtal, wo sie ebenso taten- wie auch hilflos der Entvölkerung des Tals zuschauen musste. Aber die Kombination von »Politik« und »Ehrgeiz« und »Selbstvertrauen« zündete auch hier auf dem Land, wo fähiges Personal rar war, tadellos. Ihren höheren politischen Ambitionen kam der mutmassliche Millionensegen für Krauchtal bestimmt entgegen, war sich Humboldt sicher. Nur: Wie heftig dieser Segen ausfiel, darüber musste er sich erstmal schlau machen.
»Steueramt, Hartmann.« Nach nur zweimal Klingeln nahm Boris Hartmann ab. Wer mochte schon Steuerbeamte? Etwas litt auch er darunter. Aber die Zeit härtet einen Hartmann ab. Noch sieben Jahre sind’s bis zur frühzeitigen Pensionierung. Und seit er vor drei Jahren von Kirchwil nach Krauchtal versetzt wurde (Gerüchte, er habe der 17jährigen KV-Stiftin eine Spur zu lange nachgeschaut, wollten nicht verstummen) brannte er auf die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was für ein ausserordentlich hartnäckiger Steuerbeamte er war und dass jede – auch gerne grössere – Gemeinde sich glücklich hätte schätzen können, ihn in ihren Reihen zu wissen. Diese Gelegenheit sollte nun kommen. Und sie begann an diesem Tag mit dem Anruf des Journalisten Carl Humboldt. Schon nach der ersten Frage leckte Hartmann Blut. Das war seine Chance. Das war sie in der Tat, wenn auch am Ende die Geschichte so gar nicht im Sinne Hartmanns ausgehen sollte.
KAPITEL 9
»Zweimal Gross-Kleinschreibung, vier Komma-Fehler und einmal Dativ statt Genitiv.« Es hörte sich an wie eine Bestellung im Restaurant. Gerade noch rechtzeitig vor Redaktionsschluss schickte Shaila die gegengelesenen Texte an Humboldt zurück. Meist hatte sie Zeit dafür zwischen den wenigen Gästen im Red Tiger. »Das war schon schlechter, lieber Carl.« Ihr gelang es, dabei nicht herablassend zu tönen. Humboldt nahm die Korrekturen gerne entgegen. Lieber so, als wenn Chef Tanner, der blöde Graf oder gar die Praktikantin die Fehler entdeckt hätten.
Der Hauptartikel handelte schmucklos die Fakten ab, die an sich schon spektakulär genug waren: »Rekord-Jackpot für Krauchtal« lautete die Schlagzeile. Der Lottoschein, der am Freitag als einziger die richtigen Zahlen bei den Euromillions tippte, war laut Auskunft von Swisslos in Kirchwil abgegeben worden. Und gemäss Informationen, die dieser Zeitung exklusiv vorlägen, sei der Gewinner oder die Gewinnerin in Krauchtal wohnhaft. Einer von 984 Einwohnern, abzüglich der Kinder: ein überschaubares Trüppchen von Verdächtigen. Jeder konnte es sein: der Nachbar, die Arbeitskollegin, der Lehrling, der in der Migros die Gestelle auffüllt. So leicht würde niemand in den nächsten Tagen Gipfeli in der Pause spendieren, ohne subito verdächtigt zu werden, der Gewinner zu sein.
Im ersten Kästchen, das Humboldt zum Aufmacher stellte, rechnete der Chef des Steueramts, Boris Hartmann, vor, dass je nach Religionszugehörigkeit und Zivilstand des Gewinners in der Wohngemeinde allein zwischen 18 und 25 Millionen Franken Steuern fällig würden. Die genaue Veranlagung hinge noch von Details ab. Aber er rechne mindestens mit einem Betrag im zweistelligen Millionenbereich, gab Hartmann so emotionsfrei wie möglich zu Protokoll. Viel Geld jedenfalls, das, so der Tenor des zweiten Kästchens, in nachhaltige Projekte zum Wohle der Gemeinde, ja der gesamten Region Toggenburg eingesetzt werden sollte. Natürlich entscheide, so Gemeindepräsidentin Simone Krüger ganz staatsmännisch (,staatsfraulich‘ existiert im Duden nicht), am Schluss der Stimmbürger, ob das Steuergeld in einen Innovationspark oder einen Wellness-Tempel fliesse. Sie sei jedenfalls bestrebt, das weitere Vorgehen so transparent und zügig wie möglich abzuwickeln. Die Einberufung einer Gemeindeversammlung in den nächsten Tagen schiene ihr ein probates Mittel dazu.
»Schöne Leistung«, murmelte Tanner in sich hinein, als er Humboldts Texte las. Er tat sich sichtlich schwer mit Lob. Immerhin stand das Simoni-Panettone-Problem nun nicht mehr ganz oben auf der To-Do-Liste. »Der Online-Push geht erst um 8 raus …«, » …damit sich die schwindende Zahl der Zeitungsabonnenten nicht einmal mehr verschaukelt fühlt«, machte Humboldt für sich den Satz fertig. »Und überleg Dir eine Hand voll Folgegeschichten. Den Teig kneten wir noch eine ganze Zeit lang«, so Tanner. Humboldt glaubte gern, dass dieses Bild keine Anspielung auf Simonis Panettone war. Soviel Esprit wollte er seinem Chef nicht unterstellen.
Einmal mehr das Betteln versäumt, dachte Shaila beim Kassensturz. Da blieb nie viel Geld am Schluss des Tages übrig, seit ihre Mutter nach Sri Lanka zurückgekehrt war. Dank deren Curry fanden immerhin einige Landsleute den Weg nach Krauchtal: Familienfeste, Geburts- und Feiertage sorgten damals wellenartig für schöne Umsätze. Für einheimische Gaumen aber war Mutters Küche zu wenig kompromissbereit. Sie hatte ihre Prinzipien. Auch dieses Gen schien Shaila in sich zu tragen. Kemal, der als ehemalige Aushilfe nach Mutters Heimreise die Küche übernahm, erreichte in Sachen Curry leider nicht ganz die Meisterschaft, um die Gäste auf Dauer zu halten. Heute drei Essen, gestern zwei. Für die Jassrunde und das Feierabendbier zogen die Einheimischen – mit Ausnahme von Carl – den Leuen vor.
Wie lange konnte sie das Red Tiger noch halten? Vaters Lebensversicherung gab einen gewissen Rückhalt. Aber das Geld löste sich wegen der Fixkosten des Tigers schneller auf als ein Eiswürfel an der Sonne Sri Lankas. Nicht, dass Shaila diese gekannt hätte: Sri Lanka blieb eine Idee, genährt durch die Erzählungen ihrer Mutter von früher. Nun steckte sie jedenfalls in Krauchtal fest, spürte die neidischen Blicke der einheimischen Frauen und die lüsternen der Männer. Doch ihrer Mutter nachreisen in ein ihr unbekanntes Land, das für sie auch keine Heimat war? Und dabei die bequemen Segnungen der europäischen Zivilisation einfach so zurücklassen? Züge die pünktlich fuhren, Licht das immer brannte, eine Spülung, die einfach spült.
Die Bequemlichkeit, da war die Shaila dem Phlegma Humboldts durchaus nah. Überhaupt der Carl. Den mochte sie sehr und hoffte inständig, dabei nicht einem lange vermissten Vaterbild nachzujagen. Sie freute sich jetzt und heute mit ihm über diese komische Jackpot-Geschichte. Die schien ihm einen bis anhin unbekannten Elan zu verleihen. Bleib dran, Carl! Aber lass Dich nicht reinlegen.
An Tagen wie diesen wünschte sich Shaila eine starke Person an ihrer Seite. Jemand, der nicht blendet, und sich auch nicht von Shailas attraktiven Äusserem blenden liess. Jemand, der sie ernst nahm, der ihr hier half. Was ganz Altmodisches wünschte sie sich: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Shaila träumte weiter und überlegte kurz, was sie wohl mit 187 Millionen Franken anstellen würde. Erstaunt stellte sie fest, dass sie keine schnelle Antwort hatte. Glück kaufen? Frieden stiften. Sinn finden! Genau, das war’s: Einen Sinn fürs Lebens finden, weil sie ja doch davon ausging, dass es ihr einziges war. Und hoffentlich noch etwas dauerte.
KAPITEL 10
»Geldregen für ein kleines Dorf« titelte der Tagesanzeiger online. »Millionen-Jackpot! Wer ist der Gewinner?« fragte blick.ch. Tatsächlich schaffte es eine Meldung des Toggenburger Volksfreunds zum ersten Mal seit Menschengedenken in die überregionalen Medien. Sogar die nationale Nachrichtenagentur vermeldete gewohnt trocken, aber wie alle anderen immerhin mit Bezug auf den Volksfreund: »Toggenburger Dorf freut sich über Millionen. Gemeindepräsidentin verspricht nachhaltige Entwicklung.«
Sunny füllte die Gipfel aus Simonis Bäckerei in eine Schale und spendierte dazu – auf Anregung von Tanner – eine Schachtel Nespresso Kaffee-Tabs zu Handen der Redaktionssitzung. So was verstand er unter Wertschätzung. »Gratulation!« murmelte Tanner, mehr zu sich selbst als in die Runde. »Wollte mit Simoni einen Termin abmachen«, flüsterte Sunny Humboldt zu. »Aber der war nicht in der Bäckerei heut Morgen. Das Personal schien ebenso erleichtert wie ratlos. Seine Frau sagte was von Weiterbildung.« Egal. Beide wussten, dass die Simoni-Geschichte nun sowieso für einige Tage in den Hintergrund rückte. »Gratulation!«, wiederholte sich Tanner. »Schön gemacht, Team! Aber nun legen wir nach«, begann er die Redaktionssitzung am abgegriffenen und leicht schwankenden Stehtisch.
»Arschloch«, dachte Humboldt einmal mehr. Es war seine Geschichte, aber das »Schön gemacht« legte die grösstmögliche Distanz zwischen dem Absender und dem eigentlichen Adressaten. Und wen meinte er mit Team und wir? »Ich will morgen die Seite 1 voll damit: Umfragen, Reaktionen, Einschätzungen. Und ab jetzt wird alles sofort gepusht. Wir behalten den Lead!« plusterte Tanner sich auf. Natürlich war das Quatsch. Natürlich würden die anderen nun übernehmen, die öffentlich-rechtlichen TV- und Radio-Stationen mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten, die nationalen Boulevardzeitungen, die sich wie hungrige Heuschrecken auf die »Jackpot«-Geschichte stürzten. Humboldt lehnte sich zurück, betrachtete seine Fingerspitzen, und nahm sein iPhone in die Hand. Er öffnete die letzte Unterhaltung mit dem Unbekannten und tippte.
Heute, 10.44
Zufrieden?
10.57
Gut gemacht. Kompliment. Aber jetzt beginnt die Arbeit. Bereit?
Humboldt wunderte sich kurz. Kein Schreibfehler diesmal. Alle Satzzeichen korrekt. Er zögerte kurz und tippte dann kurz und bündig.
11.01
?
KAPITEL 11
Missmutig trottete Humboldt nach der Sitzung zurück ins Büro. Jetzt fängt der andere auch noch an mit Arbeit. Du kannst mich mal, dachte er. Schieb mir ein paar von deinen Millionen rüber, und ich zeig dem Tanner und seinem Volksfreund den Mittelfinger. Das journalistische »Feu sacré«, das Humboldts Senior ständig seinen Schülern predigte, war bei ihm seit geraumer Zeit nur noch ein zartes Flämmchen, das beim leichtesten Windstoss ganz auszugehen drohte.
Wie so viel Unheil kam die Lustlosigkeit über die Jahre schleichend. Humboldts Ehrgeiz wurde von den Chefs, die er hatte, Stück für Stück zurechtgestutzt und abgeschliffen. Die Chefs waren entweder feingeistige Despoten, ungerechte Choleriker, weltfremde Autisten oder – wie in Tanners Fall – eine ungeniessbare Kombination aus all dem. Dazu kam, dass der Wert seiner Arbeit im digitalen Zeitalter bedrohlich gegen Null tendierte. Information war ein Gut, für das immer weniger Konsumenten zu bezahlen bereit waren. Ein Fakt, der Humboldts Selbstwertgefühl, das vom Elternhaus her bereits der fragilen Statur einer Giacometti-Figur glich, weiteren Abbruch tat.
Als er kurz vor Mittag immer noch auf das leere weisse Rechteck auf dem Bildschirm starrte, musste er zugeben: Ich steck in einem kreativen Loch. Kein Plan für einen ersten Satz zum Thema Lottogewinn. Sollte er das Business wechseln? Als Bierzapfer ins Red Tiger? Bahnhofsvorstand in Krauchtal? Und so begann Humboldt eine Liste mit Berufen, die er lieber ausübte als den hier. Flink hüpften die Finger plötzlich über die Tastatur. Schreibblockade ausgetrickst. Als er nach einigen Minuten die erste Seite voll hatte und beim »Totengräber« angekommen war, hielt er inne. Fertig geträumt. Jetzt hatte ihn die Gegenwart wieder.
Totengräber. Eine gute Wahl, denn Humboldts journalistische Lebensversicherung war in der Tat der Tod. Die Ausgangslage war: Gestorben wird immer. Und so kam Tanner in Anbetracht der immer spärlicher fliessenden Werbegelder auf die Idee, eine neue Einnahmequelle anzuzapfen: Für jede gebuchte Todesanzeige bot der Volksfreund – gegen einen kleinen Aufpreis – einen persönlichen Nachruf an, der, natürlich mit Foto, im redaktionellen Teil des Volksfreunds erschien. Im Herbst und Winter wurde mehr gestorben. Die Saison war gerade erst eröffnet.
Niemand auf der Redaktion riss sich um die makabre Aufgabe. Und so kam es, dass Humboldt das Ressort Nachrufe übernahm, das gesicherte Aufträge bereithielt und dazu meist frei von Zeitdruck oder aufwändiger Recherche war. Mit der Eloquenz eines Bestattungsunternehmers setzte Humboldt seine anteilnehmende Miene auf und führte das Gespräch mit einem Hinterbliebenen, meist die Tochter des Hauses, kramte in Schachteln mit alten, vergilbten Fotos und entschied sich für eine Aufnahme, die den Verstorbenen in möglichst günstigem Licht zeigte: Beim Hochstemmen des Pokals für den legendären Kreisliga-Cupsieg des FC Krauchtal anno 1961, beim Verkauf von selbst gebackenem Kuchen zu Gunsten der mittlerweile aufgelösten Pfadfinder-Abteilung Krauchtal oder bei der Entgegennahme des Früchtekorbs anlässlich einer Tombola im Saal des Leuen. Oder bei der Eröffnung des eigenen Geschäfts respektive einem Jubiläum desselben: Wie beim Kobelt Franz, der zum 20jährigen Wirte-Jubiläum stolz vor dem Red Tiger posierte, seine geschäftige Frau an der einen und seine damals schon wunderschöne Tochter Shaila an der anderen Seite. Ein Bild aus glücklichen Tagen. Humboldt gab es nie zurück, sondern bewahrte es zusammengefaltet in seiner Brieftasche auf.
KAPITEL 12
Google und Co. sei Dank: Schon am frühen Nachmittag war der Artikel »Lottogewinner, und was aus ihnen wurde« fertig. Nur wenige der Gewinner wurden glücklich. Viele waren nach einigen Monaten oder Jahren wieder arm wie eine Kirchenmaus. Humboldt war zufrieden mit seiner Arbeit. Er hatte geliefert. Solide. Pünktlich. Tanner verlangte weitere Geschichten. Auf das billige Deo packte er nun noch ein aufdringliches Rasierwasser obendrauf. Humboldt würde wieder mit Sunny reden müssen. »Ein Interview mit dem Lottogewinner, das wäre doch ganz famos«, meinte Tanner naiv. »Keine Chance«, winkte Humboldt ab. »Swisslotto gibt keine Auskunft.« Was ja auch vernünftig war, wenn man bedenkt, was über einen Millionengewinner hereinbricht. Und sein privater Informant? Die Telefon-Nummer hatte keinen Besitzer, jedenfalls keinen, der irgendwo registriert ist. Vermutlich ein Prepaid-Handy, so fantastisch anonym wie bis vor einigen Jahren ein Schweizer Nummernkonto. Die neuen Steuervereinbarungen machten es auch für Lottogewinner immer schwieriger, das Geld am Fiskus vorbei zu schleusen. Am sichersten stapelte man die Notenbündel bei sich zu Hause im Estrich. Und, das riet nun auch Swisslos, führte weiterhin ein möglichst unauffälliges Leben. Sicher war diese Lösung freilich nur im Hinblick aufs Steueramt. Ansonsten, dazu riet allerdings niemand offiziell, blieb nur der Transfer des Geldes auf eine Bank in eine der Staaten, die auf der schwarzen Liste der EU standen, weil diese sich einen Dreck um einen Informationsaustausch kümmerten. Deren Angebot: Wir passen diskret auf Dein Geld auf und verlangen eine Verwaltungsgebühr, die in keinem Verhältnis zur Versteuerung steht.
»Die Abhandlung über Steuervermeidung kannst Du Dir sparen«, meinte Tanner am Nachmittag. »Zu theoretisch, und nur für den Lottogewinner von Interesse.« Da hatte Scheiss-Kollege Graf, das musste sogar Humboldt zugeben, einen besseren Vorschlag: »Wir machen eine Liste mit Ideen, was Krauchtal mit den Millionen erwarteter Steuereinnahmen tun könnte.« »Plus eine Vox Pop dazu«, ergänzte seine Praktikantin, froh über die Aussicht, dank der Umfrage wenigstens für einige Stunden an die frische Luft und unter normale Leute zu kommen. »Und eine Sidestory über das Echo, das unsere Geschichte in den nationalen Medien ausgelöst hat«, versuchte Humboldt sich zurück ins Spiel zu bringen. »Etwas viel Selbstbeweihräucherung«, kommentierte Tanner, um dann doch noch ein Einsehen zu haben: »Andererseits haben wir auch selten Grund dazu.«
KAPITEL 13
Am Mittwoch, dem Tag, an dem Leuenwirt Milo Babic spurlos verschwand, nahm die Geschichte rund um den 187-Millionen-Jackpot dank Humboldts Artikel richtig Fahrt auf: Auswärtige Medien schickten ihre Korrespondenten ins Tal, politische Parteien stellten erste Forderungen auf, was mit den mutmasslichen Steuereinnahmen zu geschehen habe: Investieren, Sparen, Verschenken – die ganze Bandbreite an mehr oder weniger sinnvollen Ideen.
Im nächstgelegenen Polizeiposten in Kirchwil nahm Oberleutnant Georg Michel missmutig das Telefon ab. Michel war ein Polizist, wie er im Buche steht. Zwar schmeichelte auch ihm die Uniform keineswegs. Aber er trug sie mit Stolz und Würde. Und sein Schnauz war immer korrekt getrimmt. Er hatte gerade die letzten Parkbussen abgeheftet und begann sich etwas zu langweilen, als das Telefon wie bestellt schellte. Das Sodbrennen bringt mich noch um, dachte er beim Abheben. Und lag damit, wie so oft bei seinen Prognosen, deutlich daneben. »Polizeiposten Kirchwil. Oberleutnant Michel.« »Knäbel am Apparat.« Das waren nun überraschende Informationen, denn der Schulleiter von Krauchtal meldete eine seiner Lehrkräfte als vermisst. »Cornelia Zahner ist eine äusserst pflichtbewusste Person. Nie würde sie ohne triftigen Grund unentschuldigt vom Unterricht fernbleiben«, versicherte Knäbel. »Hmmm.« Michel machte ein undefinierbares Geräusch in den Hörer und versuchte so etwas Zeit zu gewinnen. »Seit wann denn in etwa so?« »Seit heute Morgen. Die 3a. Biologie von 9.15 – 10.05.« Michel legte sich sachte die Antwort im Kopf zurecht und malte Kringel auf den Zettel vor sich: »Wissen Sie, Herr Knäbel. Gut rufen Sie uns an und melden, wenn was verdächtig ist. Aber eine erwachsene Person, die seit …«, er brauchte einen Moment, um zu rechnen: » … knapp vier Stunden verschwunden ist. Da bin ich jetzt, bei allem Respekt, noch nicht extrem alarmiert.« In der Schweiz werden jedes Jahr hunderte von Männern und Frauen als vermisst gemeldet. Die meisten tauchen nach einigen Tagen unversehrt wieder auf. »Frau Zahner ist zweifelsohne eine erwachsene Person, und ihr Fernbleiben ist momentan nur aus arbeitsrechtlichen Gründen verdächtig. Natürlich wird Ihr Anruf, lieber Herr Knäbel, bei uns registriert. Aber Sie verstehen bestimmt auch, dass ich heute noch kein Sondereinsatz-Kommando zusammenstelle.« »Was raten Sie mir denn?« Knäbel schien ernsthaft besorgt. Michel hörte durch das Telefon, wie er nervös die Mine seines Kugelschreibers rein- und rausdrückte. »Ersatz für die weiteren Biologie-Stunden suchen«, riet Michel wenig senibel. Das Schweigen am anderen Ende deutete er für einmal korrekt: nicht zufrieden. So legte er nach: »Und wo wohnt denn die Frau Zahner?« Michel schrieb sich unter dem Blumenmuster auf dem Zettel die Adresse auf und versprach, noch heute einen Augenschein bei Zahners Haus zu nehmen. Was er dort vorfinden würde, ahnte er bereits: ein ordentlich verschlossenes Haus, keine Gewalteinwirkung an Türen oder Fenstern. Auffällig war, so stellte Oberleutnant Michel einige Stunden später fest, als er auf dem Nachhauseweg einen Abstecher zu Zahners Haus machte, einzig eine Schar grosser Hühner, die im Garten nach Körnern pickten. Na, die kommen als mögliche Täter ja wohl kaum in Frage, dachte er sich und machte immerhin eine Notiz mit Erinnerungsfunktion ins iPad: Meldung an Tierschutz Kirchwil. Gefahr von verwahrlosten Hühnern.
KAPITEL 14
Für einen unbeteiligten Betrachter glichen die Vorgänge in Krauchtal und Umgebung einem Stileben, wie es ein wenig begabter Maler sieht: ein Apfel, eine Rose, ein Buch, ein Glas Wein. Alle Gegenstände einzeln betrachtet, wollten sie sich einfach nicht recht zu einem stimmigen Ganzen formieren. Und so brachte vorläufig auch niemand die prominenten Abwesenden in Krauchtal mit dem Millionen-Jackpot in Verbindung: Cornelia Zahners Verschwinden: ungewöhnlich. Aber ein Verbrechen? Bäcker Simoni, gekränkt von den Enthüllungen des Volksfreunds: für einige Tage abgetaucht? Später noch Leuen-Wirt Babic, wie schon öfter ohne Entschuldigung in seine alte Heimat abgereist, um sich dort um die geliebten Reben in seinem Weinberg zu kümmern?
Offiziell gemeldet war zur Stunde nur Zahners Verschwinden: vorübergehend versenkt in der Bürokratie des Polizeipostens Kirchwil. Maria Simoni ihrerseits vermutete, dass die neue Praktikantin im Verkauf mit dem plötzlichen Verschwinden ihres Mannes zu tun haben könnte. Sie behielt nach aussen so gut es ging die Kontenance. »Auf Weiterbildung«, antwortete sie schnippisch auf Fragen wie heute Morgen von der Zeitungstussi nach dem Verbleib ihres Göttergatten. Dabei vermutete sie ihn entweder in einer Loge im Teatro La Fenice in Venedig oder zwischen den Schenkeln der Praktikantin in deren Liebesnest. Beides hatte – so musste sie bitter feststellen – tatsächlich im weitesten Sinne mit Weiterbildung zu tun. Im Leuen wiederum gingen unter der harten Fuchtel von Hana, einer Cousine von Babic, die Geschäfte ihren gewohnt trostlosen und unaufgeregten Gang. Einen Lichtblick gab es immerhin: Erfreut nahm sie die Reservation des grossen Saals für eine ausserordentliche Gemeindeversammlung auf übermorgen Abend entgegen. Ihre Sorge galt ab sofort der Frage, wo sie innerhalb von zwei Tagen genügend Servierpersonal auftreiben konnte, um eine mutmasslich euphorisierte Gemeindeversammlung nach allen Regeln der gastronomischen Kunst so gut es ging zu melken. Um ihren abwesenden Cousin kümmerte sich Hana im Moment nicht.
»Zwischen Steuersenkung und Wellness-Tempel«
Humboldt versuchte am frühen Mittwochabend die Mitteilungen der Parteien zu einem Dreispalter für die Donnerstags-Ausgabe zu verschreiben. Danach musste die Vox Pop der Volontärin noch redigiert werden, weil sich Graf mit einem Schnupfen frühzeitig in den Feierabend entschuldigte. Immerhin war die ganze Frontseite voll: »Lots of Lotto« kalauerte Humboldt vor sich hin. Tanner wartete noch auf die Themenvorschläge für morgen. So also fühlt sich Arbeit an. Das wird das späteste Feierabendbier seit Wochen. Andererseits fühlte er zum ersten Mal seit langem so etwas wie Lust an der Arbeit: Zwar nur kümmerlich anerkannt. Aber dafür schweizweit gelesen. Humboldt hoffte, Shaila schloss den Tiger nicht schon um zehn, wie sie es unter der Woche, wegen Mangel an Gästen, ab und zu tat. Er checkte sein iPhone: 21.34 Uhr. Und auch noch immer keine Nachricht von seinem Informanten, dem mutmasslichen Jackpot-Gewinner. Vielleicht war »?« doch zu allgemein gehalten. Zu flapsig. Vielleicht wünschte nun der Herr (wenn Shaila mit ihrer Vermutung denn recht hatte, was sie meistens tat) angesprochen zu werden mit: »Ihro mit Geld vollgestopfte Hochwürden. Was darf Euer untertänigster Diener, Lohnschreiber bei der örtlichen Dorfpostille, für ihro Hochselig- und Geldadeligkeit als nächstes dem gemeinen Volke mitteilen?«
Etwas Neid kam in Humboldt auf. Er kam zwar aus wohlhabendem Hause, sein Herr Vater verdiente als Dozent und Autor mehr als gut. Allerdings schien es der Senior mit dem Sterben und Vererben nicht allzu eilig zu haben. 187 Millionen … Was er mit so viel Geld anstellen würde? Richtig: Zuerst mal ein Bier kaufen. »Enter« »Enter« »Enter«. Nacheinander schickte Humboldt die letzten drei Texte auf ihre digitale Reise in die Zentrale nach Kirchwil und löschte das Licht in der Redaktion, schloss ab und hielt müde, kurz vor 22.00 Uhr, auf das Red Tiger zu. Diskret beobachtet von einem Paar graugrünen, leicht wässrigen Augen. Soweit lief alles nach Plan. Humboldt machte seine Sache wie erwartet gut.
KAPITEL 15
Rechts oben neben dem Eingang flimmerte in miserabler Bild- und Tonqualität ein Bollywood-Streifen über den betagten Bildschirm. Ergänzt wurde der Soundtrack mit dem Klappern von Geschirr: Shaila räumte hinter der Theke die Abwaschmaschine aus. »Oh Carl, Du noch so spät?« Humboldt konnte ihren Tonfall nicht deuten: Freude, Verlegenheit, Unpässlichkeit? »Aber nur wenn’s noch noch was gibt.« Da hörte er schon, wie sich der Kronenverschluss mit einem leisen Plopp von der Flasche trennte und eine Schale mit Kichererbsen gefüllt wurde. »Ich freu mich, dass Du noch vorbeischaust«, sagte Shaila. »Hab nicht mehr mit Deinem Besuch gerechnet.« »Tja die Arbeit hat sich in den letzten Stunden etwas emanzipiert.« Das war zwar als Entschuldigung gemeint, doch schwang dafür etwas zu viel Stolz in seiner Stimme mit. Shaila schenkte sich ein alkoholfreies Ingwerbier ein und setzte sich zu Humboldt. »Hast Du eine neue Nachricht bekommen?« fragte sie. Er schüttelte den Kopf. Einige Sekunden Schweigen.
»Ich habe Sorgen«, sagte Shaila unvermittelt. Humboldt glaubte trotzdem zu wissen, was jetzt kommt: Das Red Tiger kostet mehr, als es einbringt. Das Problem war nicht neu. Er versuchte ihr Mut zu machen: »Warte doch ab, was hier in den nächsten Monaten alles abgeht. Vielleicht schafft es Krauchtal tatsächlich, mit den Steuergeldern was Gescheites anzufangen. Dank kluger Politik ziehen junge Familien hierher, dank grosszügigem neuem Spa und Wellness kommen viele Tagestouristen. So oder so ist das Red Tiger dann …« Humboldt redete sich gerade in Euphorie, als Sheila seine Hand nahm: »Meine Mutter.« Humboldt schluckte leer. »Mein Onkel hat sich heute Abend überraschend gemeldet. Der Monsun. Meiner Mutter ist nichts passiert, aber ihr Restaurant sei zur Hälfte weggeschwemmt worden.« Shaila erzählte weitere Details aus dem Bericht ihres Onkels. Humboldt sah, wie traurig sie war. Als er sich eine Viertelstunde später und nach einem zweiten Bier auf den Heimweg machte, merkte er, wie sich seine Prioritäten verschoben hatten. Er tippte in sein Gerät:
Heute, 23.11
Wird die ›Arbeit‹ gut bezahlt?
KAPITEL 16
Er fühlte sich alt. Lange würde er sich vermutlich nicht mehr an seinen Millionen freuen können. Beim letzten Untersuch stellte sein Hausarzt einige auffällige Werte fest und wollte ihn zu weiteren Abklärungen ins Spital schicken. Doch er hatte abgelehnt, sich damit auch abgefunden, seine letzten Monate wie seine letzten Jahre hier zu verbringen: in möglichst grosser Bescheidenheit und Abwesenheiten von medizinischem Personal. Und nun das: 187 Millionen. Gewonnen an einem Tag im Oktober mit den Zahlen, die er schon seit Jahren tippte. Keine Geburtstage dabei, keine Träume, nein einfach sechs Zahlen, die ihm gefielen.
Als erstes spürte er einen Adrenalinschub. Heftig. Zuerst Freude, grosse Freude. Kurz darauf – unter massivem Alkoholeinfluss – Verwirrung und hunderte von Fragen. Wem sollte er davon erzählen? Natürlich seinem Financier, der ihm wöchentlich die Ausgaben fürs Lotto spendierte. Der war grosszügig: Er begnüge sich im Fall eines Gewinns mit 20 Prozent, war seit jeher abgemacht. »Alles andere sei Wucher!« Der Deal trug ihm immerhin schon einmal 47.85 Franken ein. Der hielt bestimmt den Mund, war ja Teil seines Jobs. Doch wem konnte er ausserdem vertrauen? Seiner Tochter natürlich. Was hätte er dafür gegeben, wäre sie jetzt hier und könnte sich mit ihm freuen, Pläne machen. Aber sie trieb sich irgendwo in der Grossstadt rum, nahm das Telefon ausnahmsweise nicht ab, ausgerechnet heute. Sich alleine am vielen Geld freuen, machte irgendwie … keine richtige Freude.
Aber das Geld machte ihn endlich unabhängig. Ein Zustand, den er seinen Lebtag bis heute nie erreicht hatte. So machte er sich an die Arbeit, um hier im Tal wenigstens etwas aufzuräumen. Eine späte Rache für eine lebenslange Demütigung und eine zerstörte Familie. Das wollte gut geplant sein. Er nahm sein neu erworbenes Prepaid-Gerät und schrieb – mittlerweile arg betrunken – am Sonntagabend bereits eine Nachricht an Milo Babics Nummer, die er beruflich in einem zweiten Handy gespeichert hatte:
Heute, 23.12
Guten Abnd Herr Babic. ich möchte ein grosses Fest veranstalten. Am liebsten im leuen. Was meinen sie Können wir uns bald treffen
Erwartet schnell kam die Antwort, schliesslich ging’s hier um mutmasslich viel Geld. Natürlich könne man sich treffen. Je schneller desto besser. Mittwoch passe zum Beispiel sehr gut, am liebsten am Nachmittag. Aus Diskretionsgründen, so schrieb der mutmassliche Auftraggeber zurück, wäre ein Treffen ausserhalb des Dorfes angezeigt. Ob er, Babic, die Kristallhöhlen kenne? Ein ungewöhnlicher Ort für eine Besprechung. Aber Babic fragte freundlicherweise nicht nach, sagte zu und schrieb brav ein »K.H.« in seine Agenda.
KAPITEL 17
Auf der Krauchtaler Gemeindekanzlei herrschte am Mittwoch schon am Morgen rege Betriebsamkeit. Gemeindepräsidentin Simone Krüger wusste dank ihrer Schwester schon am Vorabend vom Jackpot für Krauchtal. Ihr war schnell klar, was zu tun war. Aktiv werden. Sofort eine Gemeindeversammlung einberufen. Es wurde eine kurze Nacht. Simone wusste in ihrem Leben schon früh, was sie wollte. Von dem zog sie das ab, was sie nicht erreichen konnte und verfolgte das, was übrigblieb, mit ganzer Konsequenz. Das machte sie klar und stark. Und für den, der dafür ein Auge hatte, sogar attraktiv. Am nächsten Morgen hatte Simone Krüger einen Schlachtplan.
Der Artikel im Volksfreund hatte eingeschlagen. Auch im Rest des Landes. Eine neue Sau wurde durchs mediale Dorf getrieben. Simone Krüger war in ihrem Element. Sie hatte schnell reagiert, professionell. TV-Interviews, Anfragen von Zeitungen und Agenturen, ein Foto hier, ein Foto da. So hatte die Geschichte einen Kopf, solange nicht der des eigentlichen Gewinners bekannt wurde, was äusserst selten der Fall war. Simone Krüger wusste: Das war ihre Chance. Die Millionen für ihre Gemeinde mussten mit ihrem Namen verknüpft bleiben. Goldene Aussichten für ihre Ambitionen auf ein Regierungsamt auf nächsthöherer Ebene.
Doch nun galt es kühlen Kopf zu bewahren. Die Gemeindeversammlung hatte zum Glück nur konsultativen Charakter: Die Einwohner von Krauchtal konnten wohl Vorschläge einbringen, entscheiden würde sie. Und das Gremium von Amateuren, das den Gesamtgemeinderat bildete und das sie nach Belieben manipulieren konnte: Giovanoli, eine Million für ihn: ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr und ein gehöriges Volksfest dazu, das Volk und der Vorstand der technischen Betriebe waren zufrieden. Für Zahner gab’s eine Rundum-Erneuerung der IT-Einrichtung an der Schule: mittlerer sechsstelliger Betrag. Da lag sogar noch ein Gratis-Apero zu Beginn des neuen Schuljahres drin. Rudolph als Vorsteher der Sozialen Dienste darf den Ärmsten ein Geschenk machen: Steuerbefreiung für Einkommen unter 50’000: Peanuts. Bleibt der Chef des Krauchtaler Bauamtes Salzmann. Mit ihm zusammen wollte Krüger eine Vision des »Volksfreundes« umsetzen. Ihre familiären Kontakte in die Redaktion waren dabei im Vorfeld einmal mehr Gold wert. Schön wenn der Vorschlag zuerst von einem neutralen Medium kam: Wie wär’s mit einem millionenschweren Wellness- und Spa-Zentrum, angebaut an den Leuen. Den Einheimischen zuerst natürlich, aber auch den Touristen und damit dem hiesigen Gewerbe und dessen nachhaltiger Entwicklung zum Wohle.
Ein bisschen Steuerhinterziehung, viel Misstrauen gegenüber dem meisten Fremden (Kulinarisches selbstverständlich ausgenommen) und trotz ansehnlichem Wohlstand immer noch Lust nach mehr Geld: Eigentlich war Milo Babic ein gelungenes Beispiel für perfekte Assimilation und damit auch Integration bei Land und Leuten in den Schweizer Voralpen. Beim Jassen im Leuen vergass er als rücksichtsvoller Gastgeber gerne mal den einen oder anderen Wys anzugeben und spendierte im richtigen Moment eine Runde Freibier an die siegreichen Mitspieler. Beschallt wurde die Wirtsstube mit einer kruden Mischung aus deutschsprachigem Schlager und volkstümlicher Musik aus den Alpen und dem Balkan. Kurzum: Der Stammtisch im Leuen, ein Ort, um sich wohl zu fühlen. Neben Zahnstochern, Aromat und Maggi erinnerte nur ein Tabasco-Fläschchen auf dem Tisch an den nicht ganz lupenreinen Background der heimischen Idylle. Babics Einbürgerung vor drei Jahren war reine Formsache. Konsequenterweise amtet er an jenem Abend als grosszügiger Gastgeber der entscheidenden Gemeindeversammlung, freilich diskret im Hintergrund.
Doch als nun, am Mittwoch kurz nach 15 Uhr, eine Rotweinflasche mit einem gezielten Schlag auf den Hinterkopf Babics Leben so unvermittelt beendete, starb er also als aufrechter Schweizer. Es wäre ihm bestimmt ein Trost gewesen, hätte er gewusst, dass die meuchelnde Flasche einen feinen Tropfen aus dem heimischen Weinberg beherbergt hatte und darum sogar seinen Namen (»Babic Cuvée«) trug, bevor sie zum Mordinstrument mutierte.
Der Täter betrachtete angewidert die Sauerei, die er selber angerichtet hatte. Schon wieder ein Freundschaftsdienst. Tolle Freundschaft. Aber eben: Eine Hand wäscht die andere … Guter Input. Flasche abwischen, nur keine Fingerabdrücke. Danach warf er sie achtlos in eine Ecke und schleifte Babics Leiche mühsam an den Rand des Sees in der Kristallhöhle. Schon wieder so eine Plackerei. Die Mehlsäcke bei Simoni hinterliessen einen dumpfen Schmerz in seiner Lendengegend. Aber der hier wog bestimmt vier Säcke aufs Mal. Nach über zehn Minuten gab er dem leblosen Körper endlich einen Tritt und schaute zufrieden zu, wie er unter die Wasseroberfläche verschwand. Er beschwerte die Leiche absichtlich nicht. Soll sie ruhig nach einer gewissen Zeit wieder auftauchen. Das war Teil des Plans.