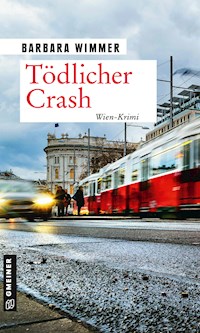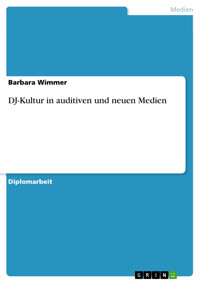Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalistin Stefanie Laudon
- Sprache: Deutsch
Wien 2028. Ein Staranwalt wird tot im Wald aufgefunden. In seiner Hand befindet sich ein Zettel mit seinem Todestag und einem großen X. Feinde hatte der Mann viele, denn er vertrat sämtliche Lobbyisten im Land und kannte all ihre dunklen Geheimnisse, von Korruption bis zu Betrug. Über einen schlecht abgesicherten Computer landen die Dossiers in den Fingern der kritischen Investigativ-Journalistin Stefanie Laudon, die im Netz weiter ermittelt. Plötzlich gerät auch sie ins Visier der Täter …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Wimmer
Jagd im Wiener Netz
Kriminalroman
Zum Buch
Mysteriöse Botschaft Wien 2028. Stefan Huss war ein erfolgreicher Staranwalt in Wien – bis ihn ein Jogger im Wald beim Dehnepark im 14. Bezirk tot auffindet. Die Ambulanz kann nur noch den Tod des Mannes feststellen, der sehr häufig prominente Fälle und vor allem Lobbyisten vertreten hat. In seiner Hand befindet sich ein Zettel mit seinem Todestag und einem großen X. Über einen schlecht abgesicherten Computer landen die Dossiers in den Fingern der kritischen Investigativ-Journalistin Stefanie Laudon, die im Netz weiter ermittelt. Doch sie steht selbst unter enormen Druck. Die Tageszeitung „24 Stunden“, bei der sie arbeitet, wird gerade digitalisiert, und die zu erledigenden Aufgaben verdichten sich. Stefanie hat die Nase voll davon und versucht es mit Entspannung im Kurzurlaub am Attersee. Dort stößt sie allerdings auf eine weitere Leiche – und gerät ins Visier der Täter.
Barbara Wimmer ist preisgekrönte Netzjournalistin, Buchautorin und Vortragende. Sie wurde in Linz geboren und zog danach zum Studieren nach Wien. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften begann sie als Journalistin bei einer großen Tageszeitung zu arbeiten. Sie schreibt als Redakteurin seit rund 15 Jahren über Technik-Themen wie IT-Sicherheit, Netzpolitik, Datenschutz und Privatsphäre. Wimmer entwickelte im Laufe der Zeit zahlreiche Ideen, wie sich Zukunftsthemen auch literarisch spannend verarbeiten lassen. 2018 gewann sie den Journalistenpreis „WINFRA“, 2019 wurde sie mit dem Dr. Karl Renner Publizistikpreis und dem Prälat Leopold Ungar Anerkennungspreis ausgezeichnet.
Mehr Informationen zur Autorin unter: barbara-wimmer.net
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Marko / AdobeStock und marcel strauss / unsplash
ISBN 978-3-8392-7282-4
Kapitel 1
November 2028
Stefan Huss blickte auf seine teure Apple Watch, die er am Arm trug. 12.52 Uhr. Es war Wochenende, und er hatte gerade mit seiner Frau zu Mittag gegessen. Das Aktivitätsprofil seiner Apple Watch verriet ihm, dass er heute erst 205 Kilokalorien verbraucht hatte und noch nicht trainiert hatte. Ein Zustand, den er schleunigst ändern wollte.
»Hast du deinen Reishi schon genommen?«, fragte die Stimme seiner Frau aus der Küche.
»Nein, noch nicht!«, rief Stefan. Er war in letzter Zeit immer so müde, und seine Frau war deshalb auf die Idee gekommen, ihn mit dem Pilz des ewigen Lebens ein wenig auf Vordermann zu bringen. Der Heilpilz zählte zu den ältesten Arzneimitteln der Welt und sollte ein wirksames Stärkungsmittel sein, um das Immunsystem zu unterstützen und auch die Müdigkeit zu beseitigen. Er sollte sich dadurch wieder fitter fühlen. Heute war sein erster Pilz fällig. Er hatte seiner Frau murrend zugestimmt, als sie vor ein paar Tagen mit dieser Idee dahergekommen war. Vital Therapia, eine österreichische Firma, steckte hinter dem Vertrieb, und er dachte sich insgeheim: Selbst wenn es nichts nutzen sollte, schaden kann es auf keinen Fall.
Stefan Huss versuchte auch bereits seit einigen Wochen, seine Müdigkeit mit Laufen zu bekämpfen. Dreimal die Woche ging er im angrenzenden Dehnepark im 14. Wiener Gemeindebezirk joggen, um den Stress aus dem Büro loszuwerden. Der Park im Westen Wiens war ein Teil des Wienerwalds und bestand aus einem einzigartigen wildromantischen Baumbestand mit einhundert Jahre alten Platanen, zwei Seen, die mit Wasserschildkröten, Enten und Reihern besiedelt waren, herrlichen ruhigen Waldlichtungen zum Waldbaden und einer perfekten Laufstrecke für Stefan Huss. Längst war seine Tätigkeit als Rechtsanwalt nicht mehr so glamourös wie in jener Zeit, als er noch die großen Fälle des Landes bearbeitet hatte. Stattdessen war immer mehr Bürokram zu erledigen, der daraus bestand, die Arbeit von Maschinen zu kontrollieren und ob diese die Formulare auch wirklich richtig ausgefüllt hatten. Statt in Gerichtssälen und vor TV-Kameras verbrachte der ehemalige Star-Anwalt immer mehr Zeit damit, in der Kanzlei den Verwaltungskram vom Tisch zu bekommen. Mehr als eine Sekretärin konnte sich Stefan Huss nämlich nicht leisten, nachdem er sich mit riskanten Aktiengeschäften verspekuliert hatte. Früher hatte er vor Gericht geglänzt, er hatte vor allem große Wirtschaftsbosse und sämtliche Lobbyisten des Landes verteidigt, die seiner Partei, der Konservativen Familien Partei (KFP) nahestanden. Parteimitglied war er seit 1980, er war noch während seines Studiums dem Konservativen Studentenverband (KV) beigetreten, um dort zu zeigen, auf welcher Seite er stand. Er hatte zahlreiche Prominente in dem Land vertreten, unter anderem den ehemaligen Finanzminister Wolfgang Steinrigl, der leider bei einer Fahrt in seinem selbstfahrenden Auto verstorben war. Aber er hatte auch Wolfgang Sputnik vertreten, einen ehemaligen Telekom-Boss eines teilstaatlichen Konzerns, dem nachgesagt worden war, in seine eigene Tasche zu wirtschaften, sowie Günther Fritzer, einen Lobbyisten der Internet Society Austria (ISA). Dieser verstand es, Gelder zu lukrieren, um damit die Anliegen der großen Wirtschaftsbosse im Sektor der Informationstechnologie bei der KFP zu pushen. Doch auch dieses halblegale Vorgehen landete vor den österreichischen Gerichtshöfen. Stefan Huss gewann die Verfahren für all seine Klienten. Keiner musste ins Gefängnis, alles ging gut aus. Das war er seinen Verbandsfreunden freilich schuldig. Das Geld, das er damit verdient hatte, steckte er allerdings nicht in den Ausbau seiner Kanzlei, sondern vielmehr in Aktiengeschäfte. Diese liefen leider nicht so rosig wie erhofft. Er hatte mehr als die Hälfte seines Vermögens verloren und war zugleich auch noch in einen großen Bankenskandal verwickelt gewesen. Einer seiner KV-Freunde hatte krumme Geschäfte mit einem neuen FinTech gemacht, einer jungen Start-up-Bank, und schwups, hatten sich plötzlich alle seine anderen KV-Freunde von ihm zurückgezogen. Er war plötzlich zur »Persona non grata« abgestiegen, und kein einziger Auftrag aus dem KV hatte ihn mehr ereilt. Bei den KV-Treffen mieden ihn diejenigen, die er vor kurzem noch zu seinen Freunden gezählt hatte. Zu persönlichen Treffen wurden er und seine Frau plötzlich auch nicht mehr eingeladen. Man habe vergessen, ihn darüber zu informieren, hieß es salopp, wenn er nachfragte. Oder auch: »Was, du warst nicht da? Ist mir gar nicht aufgefallen!« Seiner Kanzlei ging es dadurch immer schlechter, und die Abwärtsspirale setzte sich fort. Stefan Huss musste sich ganz neue Klienten suchen, und die waren weit weniger wohlhabend als seine Lobbyisten und Wirtschaftsbosse. Er hatte schlagartig nur noch mit »kleinen Fischen« zu tun. Manager aus der mittleren Ebene, die Firmengelder veruntreut hatten; Männer, die ihre Frauen verklagten, weil diese ihnen Geld aus der Tasche gezogen hatten, obwohl sie fremdgegangen und aus der Sicht der Männer damit die »Ehe zerstört« hatten; und viele andere kleinere Straftaten, die in konservativen Kreisen eben so vorkamen. Einer seiner prominentesten Fälle in seiner Zeit nach dem Bankenskandal und dem Aktienverlust war der eines großen US-Pharmariesen, der gegen eine kleine Pharmafirma aus Oberösterreich kämpfte. Es ging selbstverständlich um nichts Geringeres als Patente für einen Impfstoff, in dessen Entwicklung Forscher beider Länder involviert gewesen waren und der US-Riese für sich beansprucht hatte, die Patente zuerst eingereicht zu haben. Die kleine Pharmafirma aus Oberösterreich hatte kaum eine Chance vor Gericht, obwohl sie tatsächlich schlagkräftige Beweise vorgelegt hatte. Stefan Huss erinnerte sich noch zu gut an den Fall, der nur wenige Jahre zurücklag. Es ging um einen der Impfstoffe gegen das Coronavirus, das die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen hatte. Merkwürdig, dass er ausgerechnet jetzt wieder an seinen Gegner denken musste, diesen Josef Schild, Geschäftsführer der Pharma Shield GmbH. Er hatte eigentlich ganz sympathisch gewirkt – etwas narzisstisch vielleicht –, aber am Ende hatte er ihm fast leidgetan. Doch die Patentschlacht ging an den US-Konzern Markta Cenica, der neben ihm auch noch vier weitere Anwälte engagiert hatte. Er hatte den Auftrag damals nur angenommen, weil er das Geld dringend gebraucht hatte. In der Corona-Zeit hatte er sogar einen seiner besten Anwälte ziehen lassen müssen, weil es zu wenige Aufträge in der Kanzlei gegeben hatte. Und er hatte wieder angefangen, sich selbst um Verwaltungskram zu kümmern. Ach, wie sehr wünschte er sich die alten Zeiten zurück, in denen er vom KV noch unterstützt worden war! Er vermisste die TV-Interviews, in denen er immer mit einer anderen bunten Krawatte aufgetreten war, um seinen eigenen Stil zu demonstrieren. Und die Schulterklopfer, die ihm jeder positiv abgeschlossene Fall eingebracht hatte, sei er auch noch so dreckig und korrupt gewesen.
»Da, nimm!« Stefan Huss’ Frau war zu ihm ins Schlafzimmer gekommen, um ihm den Reishi-Pilz mit einem Glas Wasser zu bringen. Sie riss ihn damit aus seinen Gedanken über die gute alte Zeit und erinnerte ihn daran, was er eigentlich gerade vorgehabt hatte: Laufen gehen. Auf seine Gesundheit achten. Wieder fit werden. Denn nichts konnte ihn mehr stressen als dieser ewige Verwaltungskram. Dagegen waren die zahlreichen TV-Interviews, die er absolviert hatte, oder das nächtelange Brüten über brisanten Unterlagen positiver Stress gewesen, den er geliebt und damit auch viel leichter verkraftet hatte.
»Du musst heute wirklich damit beginnen, weil sonst wird das nie etwas damit, dass du wieder fit wirst!«, sagte seine Frau. Er wusste, dass sie recht hatte. Dennoch störte ihn, von ihr noch immer wie ein kleines Kind bevormundet zu werden. Er war ein gestandenes Mannsbild, allerdings wurde er in Gudruns Händen oft streichelweich und handzahm. Ihr zuliebe schluckte er also seine Gefühle, die ihre Bevormundung hervorriefen, und seine Skepsis, ob ein Pilz ihm wirklich helfen konnte, runter und griff nach der Kapsel. Der ehemalige Star-Anwalt bemerkte nun auch, dass er nur mit der Unterhose bekleidet vor Gudrun stand, denn zum Laufen zog er sich immer um und ein spezielles Trainingsgewand an. Die Thermo-Unterwäsche, die im Winter notwendig war, lag schon ausgebreitet am Bett, als Gudrun zu ihrem Mann sagte: »Mmmmm … ich könnte gleich überprüfen, ob das Lebenselixier bei dir schon wirkt!« Sie strich über Stefans Arm, als er die braune Kapsel mit dem Reishi, die nach nichts Besonderem schmeckte, runterschluckte. Stefan ließ sich diesen dezenten Hinweis darauf, dass seine Frau jetzt sofort mit ihm schlafen wollte, und zwar ohne dass er darauf drängte, nicht entgehen. Er gab ihr einen Kuss und zog Gudrun unmittelbar aufs Bett. Sein bestes Stück versagte mit seinen 52 Jahren nämlich noch nicht – und für Sex war er nie zu müde.
15 Minuten später verließ Stefan Huss in seinem Laufgewand die Wohnung. Zum nächsten Waldstück waren es nur fünf Minuten. Das war auch der Grund gewesen, warum sich Gudrun und er dieses Plätzchen am Stadtrand von Wien zum Wohnen ausgesucht hatten. Sie wollten nahe der Natur sein, aber doch irgendwie in der Stadt. In die Kanzlei am Wiener Opernring brauchte er mit dem Auto nur 25 Fahrminuten, und auch sonst gab es in der Nähe alles, was man so zum Leben brauchte. Früher, als sie noch einen Hund gehabt hatten, war er mit Bruno regelmäßig im Wald Gassi gegangen. Doch Bruno war im Alter von 14 Jahren gestorben, und seither war er gar nicht mehr gerne in den Wald gegangen, außer wenn Gudrun ihn zum Spazierengehen überredet hatte. Das mit dem Joggen fing er erst vor kurzem an. Je älter er wurde, desto mehr merkte er, dass ihm die Spaziergänge mit dem Hund fehlten. Doch auch zum Joggen musste ihn seine Frau zuerst überreden, da er in letzter Zeit eher unmotiviert war. Keine Lust mehr auf irgendwas. Er kam heim und hing immer nur vor dem TV ab – etwas, was er an seinen eigenen Eltern immer gehasst hatte. Anders als sie, sah er sich allerdings nicht das tägliche TV-Programm an, sondern diverse Serien. Er versank außerdem in Spielwelten auf seiner Xbox, die mit dem TV verknüpft war, und tauchte ab aus der Realität. Er ertrug das normale TV-Programm nicht, denn dort müsste er auch noch die ewig gleichen Gesichter seiner Partei- und Verbandskollegen in sämtlichen Polit-Formaten des Staatssenders sehen. Früher hatte er meistens bis spätnachts gearbeitet, wenn es einen wichtigen Fall zu betreuen gab, er saß stundenlang über den Gerichtsakten, doch diese Zeiten waren vorbei.
Stefan Huss schaltete den Trainings-Modus seiner Apple Watch ein und klickte auf »Jogging«. Der Countdown 3-2-1 lief rückwärts und er begann in langsamem Tempo. Im Wald war am Wochenende immer mehr los als unter der Woche. Viele kamen in ihrer Freizeit zum Wandern in den schönen Wienerwald. Die Gegend bot neben zwei wunderschönen kleinen Seen auch noch eine geheimnisvolle Ruine sowie einen fantastischen Blick über die ganze Stadt, wenn man es bis nach ganz oben des Satzbergs schaffte.
Als Stefan Huss einer Großfamilie, die mit ihren drei Kindern zum Waldspielplatz gekommen war, auswich, stolperte er fast über eine Wurzel. Er lief vorbei am ersten Teich, in dem gerade die Enten schwammen. Er lief weiter quer durch das flache Waldstück bis zu dem Part, an dem er eine Straße kreuzte, bei der viele Spaziergänger bereits wieder umdrehten und wo die Menschen schon deutlich weniger wurden. Er überquerte die Straße und lief hinauf Richtung Silbersee. Hierher kamen meistens keine Wochenend-Spaziergänger mehr, die meisten bogen in die andere Richtung ab, Richtung Erholungsgebiet Steinhof und Wilhelminenberg. Dort verlief auch der berühmt-berüchtigte Stadtwanderweg 4 - und viele Wanderer, die das Gebiet nicht gut kannten, hielten sich starr an diese Route. Für ihn war diese Abzweigung jedoch seine Stammstrecke. Bis zu seiner Wohnungstür schaffte er die Strecke im Lauftempo in nicht einmal 40 Minuten. Und er verbrannte dabei in der Regel rund 230 Kalorien, wie er dank seiner Apple Watch wusste.
Doch so weit kam der ehemalige Star-Anwalt heute nicht. Kurz vor dem Silbersee bemerkte Stefan Huss einen heftigen Stich in der Herzgegend. Dieser Stich war so massiv, dass er stehen bleiben musste. Er versuchte, Luft zu holen, doch es gelang ihm nicht richtig. Ein Blick auf die Apple Watch zeigte, dass sein Puls normal war, lediglich leicht erhöht, wie immer, wenn er Sport machte, aber nicht ungewöhnlich hoch. Doch das Symbol auf seiner Apple Watch, das seinen Herzrhythmus anzeigte, drehte durch. Irgendwas schien nicht zu passen. Stefan Huss wurde auf einmal schwindlig. Als er sich umsah, wusste er plötzlich nicht mehr recht, wo er gerade war. Es war doch seine Stammstrecke, aber alles rund um ihn begann zu verschwimmen. Der blaue Himmel, der zwischen den großen Nadelbäumen durchschien, wirkte auf ihn auf einmal so blau, als wäre er durch einen Instagram-Filter gejagt worden. Die Bäume, die um diese Jahreszeit noch Blätter hatten, schienen ebenfalls grüner als grün zu sein. Er fühlte sich wie in einer seiner Xbox-Spielewelten, in der alles ganz bunt und überzeichnet war. Es versetzte ihm erneut einen heftigen Stich in seiner Herzgegend, und plötzlich fiel er einfach um. Am Boden liegend, drehte er sich mit letzter Kraft auf den Rücken, sah durch die Bäume zum Himmel und dachte seinen letzten Gedanken: Verdammt, ich will noch nicht sterben! Es ist zu früh! Gudrun! Sein Herz schmerzte, noch einmal zuckte er zusammen, und von einer Minute auf die andere war er weg. Für immer, denn niemand war in der Nähe, um sein Leben mit Erste-Hilfe-Maßnahmen zu verlängern. Zumindest niemand, der dies wollte.
Kapitel 2
Wenige Minuten später, nachdem Stefan Huss im Waldstück um den Silbersee zu Tode gekommen war, schlich sich ein Mann, vorsichtig nach links und rechts blickend, an die Leiche heran. Er nahm das Handgelenk von Stefan Huss, an dem er die Apple Watch trug, und checkte darauf, ob noch ein Puls zu sehen war. Kein Puls. Der Mann wischte die Uhr danach präzise mit einem Reinigungstuch ab und drückte dem Opfer einen Zettel in die Hand. Einen Zettel, auf dem nichts zu sehen war außer einem großen X und auf dem stand: ›52 Tage‹. Sonst nichts. Dann drehte er sich noch einmal vorsichtig um, um zu prüfen, ob er nicht doch von Fremden beobachtet worden war, bevor er sich still und leise wieder entfernte.
Zufrieden rieb sich der Mann die Hände und griff nach seinem Mobiltelefon. »Mission ausgeführt«, schrieb er über den sicheren Text-Messenger Signal an Bill. Bill antwortete umgehend mit einem Daumen nach oben, der signalisierte, dass er zufrieden war. Sein Auftrag war es gewesen, Georgio dazu zu bringen, vor Ort sein Werk zu vollenden, um die Ermittler vor ein Rätsel zu stellen. Es wäre doch schade gewesen, wenn niemand etwas vom Tod des 52-jährigen Ex-Star-Anwalts mitkriegen würde! Sonst hätte man den Vorfall doch leicht mit einem stinknormalen Herzinfarkt verwechseln können, den ein Jogger im Alter des Anwalts leicht ereilen konnte. Gerade dann, wenn man so untrainiert war wie Stefan Huss. Bill zündete sich eine Zigarette an und rief seinen Auftraggeber an: »Das Spiel hat begonnen«, hauchte seine tiefe Stimme im Kater-Karlo-Modus ins Smartphone, während er den Rauch der Zigarette ausblies und sich nebenbei von einem Mädchen über den Oberschenkel streicheln ließ. Er war nicht allein in Shenzhen, aber wer hätte das auch von ihm erwartet? Er war nur der Koordinator, der Mittelsmann, der für Geld Aufträge ausführte – sei es, Menschen auszuspionieren, oder eben manchmal auch mehr. Angst, dass man ihn mal erwischen könnte, hatte Bill nicht. Er war zu gut darin, seine Spuren zu verwischen. Kaum einer der Fälle, in die er involviert war, wurde je aufgeklärt. Das war ja das Schöne an der dunklen Welt der On- und Offline-Kriminalität: Man konnte alles tun, solang man nicht erwischt wurde.
Georgio verließ den Dehnepark über ein anderes Waldstück nahe der Steinböckengasse und sah beim Abstieg direkt auf den Lainzer Tiergarten im 13. Bezirk. Er hatte bewusst einen anderen Weg gewählt als den, den er gekommen war. Er wusste nicht, was der Mann getan hatte, der heute sterben musste. Er wusste nur, dass er viel Geld dafür bekam, diesem Mann den Zettel in die Hand zu drücken. So viel Geld, dass er davon seine Familie drei Monate lang ernähren konnte – was hoffentlich bis zum nächsten gefährlichen Auftrag reichte. Solang er selbst niemanden umbringen musste, hatte er dabei kein schlechtes Gewissen. Der Mann wird schon etwas Böses getan haben. Etwas, weswegen er es verdient hatte, zu sterben. Das redete sich Georgio zumindest ein. Er war etwa gleich alt wie er selbst, vielleicht ein wenig älter gewesen.
Würde er jetzt schon sterben wollen? Beim Verlassen des Waldstücks gingen dem Polen, der seit acht Jahren in Wien lebte, wichtige Fragen über sein Leben durch den Kopf. Ein Leben, das während der Corona-Krise im Jahr 2020 komplett verpfuscht worden war. Ursprünglich hatte er in Wien ein polnisches Restaurant eröffnen wollen, doch dann kam diese Pandemie. Er fiel durch sämtliche staatliche Raster, weil er, gerade frisch übersiedelt, ein junges Restaurant eröffnet hatte. Da er in Österreich davor noch nicht gearbeitet hatte und das Restaurant mit seinen polnischen Pierogi-Teigtaschen noch zu neu war, gab es für ihn keinerlei Staatshilfen. Er hatte gerade erst den Mietvertrag unterschrieben gehabt und die ersten Leute eingestellt, als es zum vollständigen Lockdown kam, der abgelöst worden war von einem weiteren Lockdown und noch einem. Er hatte keine Zeit gehabt, ein Stammpublikum aufzubauen. Er hatte zwar unzählige Werbeanzeigen auf Facebook gebucht, um doch noch welche von seinen Teigtaschen anzubringen. Doch nichts nützte auf Dauer. Ein paar der ersten Kunden hatten sein Restaurant negativ bewertet, weil er sich im Personal vergriffen hatte. Gute Kellner zu finden war schließlich schwierig. Und Petar hatte sich den Gästen gegenüber ruppig verhalten. Also wollte auch online niemand seine Teigtaschen bestellen, denn plötzlich fielen die Bewertungen mehr ins Gewicht als beim normalen Restaurantbetrieb. Die Schulden wuchsen von Monat zu Monat, er konnte die Miete nicht mehr zahlen, der Vermieter bestand aber auf den monatlichen Raten, und deshalb nahm Georgio einen »Nebenjob« an als »Mädchen für alles Dreckige«. Ein Kumpel hatte ihn mit Bill bekannt gemacht, der allerdings irgendwo in Asien saß. Mit Bill kommunizierte er nur per supersicherem Messenger Signal, bei dem man die Nachrichten nicht mitlesen konnte. Auch telefonieren taten die beiden ausschließlich über Signal. Bill klang immer ein wenig wie Kater Karlo, sein »har har« hallte regelmäßig in Georgios Ohren nach, und manchmal träumte er auch von Bills Stimme. Er stellte ihn sich als großen, dicken Mann mit dunklem Bart vor und wie er mit seiner verrauchten, tiefen Stimme vor ihm stand, die Pistole in der Hand und diese auf ihn haltend: »Wir brauchen dich nicht mehr, Georgio, bye-bye!« Das war immer der Moment, in dem er schweißgebadet aufwachte und seine Frau ihn fragte, was mit ihm los sei. Eigentlich hatte er doch nur ein Restaurant eröffnen wollen! Jetzt musste er sich um Leichen kümmern; darum, an Tatorten falsche Beweise fort- oder hinzuschaffen; manchmal auch Waffen und Falschgeld von A nach B zu bringen. Was Bill ihm halt so anschaffte. Klar, er kassierte dafür jeweils eine ordentliche Summe, mit der er die Schulden und Kreditraten zurückzahlen konnte. Sein Restaurant lief zwar mittlerweile mit Ach und Krach, aber gerade mal so, dass sie Miet- und Personalkosten zahlen konnten. So richtig in Schwung war das Lokal nie gekommen, weil Teigtaschen plötzlich in Verruf geraten waren, nachdem in Wien ein paar illegale Teigtaschen-Fabriken aufgeflogen waren. Die hatten zwar nichts mit seinen guten polnischen Pierogi zu tun, sondern waren für chinesische Restaurants bestimmt gewesen, aber da kannte der Großteil der einheimischen Bevölkerung keinen Unterschied. Zwar kamen viele seiner Landsleute zu ihm ins Restaurant, aber das waren bei weitem nicht genügend, um das Geschäft florieren zu lassen. Viele waren von der Krise ebenfalls finanziell hart getroffen worden und konnten sich ein Leben mit regelmäßigen Restaurantbesuchen und anderen Annehmlichkeiten, die sie gewohnt waren, nicht mehr leisten. Die Schere zwischen Arm und Reich war immer weiter aufgegangen, und die zunehmende Automatisierung bei den einfachen Jobs hatte vielen seiner Landsleute die Lebensgrundlage entzogen. Minderqualifizierte hatten plötzlich keine Arbeit mehr, weil sie von Maschinen ersetzt worden waren. Besserqualifizierte waren davor aber auch nicht gefeit. Es traf ironischerweise auch ein paar seiner Kollegen, die beim Arbeitsamt (AA) beschäftigt gewesen waren. Zuerst bekamen diese ein Computerprogramm an die Seite gestellt, das sie bei ihrer Arbeit unterstützen sollte. Dadurch sollte die Effizienz erhöht werden bei der Beurteilung der begrenzten Fördergelder, die auf die Arbeitslosen verteilt werden mussten. Das klappte nur so mittelmäßig, denn keiner von ihnen wusste so recht, was er von dem Rating, das der Computer anzeigte, wirklich zu halten hatte. Man wusste weder, wie es zustande gekommen war, noch, ob die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt mitberücksichtigt worden waren. Die Tourismus-Branche hatte sich etwa nach der Corona-Krise im Jahr 2020 nie wieder so entwickelt, wie sie vorher gewesen war. Die Reiselandschaft hatte sich danach völlig verändert, und in gewisse ehemalige Skigebiete reiste jetzt kein Mensch mehr, weil es im Winter auch kaum mehr Schnee gab aufgrund des Klimawandels. Dort waren Zigtausende Jobs schlichtweg weggefallen, doch der Computer hatte in diesen Regionen noch sehr, sehr lange gute Arbeitsmarktchancen vorhergesagt und eine Aus- und Fortbildung im Tourismus-Segment empfohlen. Dabei fanden nicht einmal die Menschen, die in diesem Bereich arbeiteten und dort wohnten, noch Jobs. Sein Freund Adam hatte ihm da einiges erzählt, er war einer der wenigen, die trotz Arbeitslosigkeit fast jeden Abend zu ihm ins Restaurant kamen. Schließlich war Adam alleinstehend und hatte sonst nichts zu tun. Da er nicht kochen konnte, gab er sein ganzes Arbeitslosengeld fürs Essen in seinem Restaurant aus, sparte sich allerdings zu Hause die Kosten. So ging sich das aus. Georgio lud Adam außerdem regelmäßig auf das eine oder andere Bier ein, das konnte er sich leisten, seinem Freund und Stammgast ein Getränk zu spendieren. Adam dankte es ihm mit zahlreichen spannenden Geschichten aus seiner Zeit beim AA. Er hatte schließlich viel zu erzählen über die Schicksale derjenigen, mit denen es das Leben weniger gut gemeint hatte. Das Computerprogramm, so erzählte Adam, hatte etwa über 50-Jährige automatisch »bestraft«. Gefördert wurde in dieser Gruppe niemand mehr – und das, obwohl man in Österreich mittlerweile bis 68 Jahre arbeiten musste, Frauen wie Männer. Für 18 lange Berufsjahre würde sich eine Umschulung durchaus noch auszahlen. Der Algorithmus des AA sah das aber offenbar anders. Mit 49 bekam man noch die Chance auf einen neuen Beruf, mit 50 war das Fenster zu, da gab es keine Gnade. Anfangs hatten sie als Berater noch in das System eingreifen können, doch das war das Erste, das gestrichen worden war, nachdem der Algorithmus ein Jahr lang zum Einsatz gekommen war. Adam hatte versucht nachzufragen, was der Grund dafür gewesen war, doch er bekam von offizieller Seite keine Antwort. Inoffiziell munkelte man unter den Kollegen, dass wohl zu viele von ihnen eigenständige Entscheidungen getroffen hatten, die das Förderbudget »stark belastet« hatten. Ergo: Viele von ihnen waren zu weich gewesen, hatten zu viele Menschen nach dem beurteilt, was sie in ihnen sahen. Der Computeralgorithmus war da härter, er kannte keine Gnade. Es gab nicht nur beim Alter harte Einschnitte, sondern auch beim Geschlecht. Mütter, die Kinder zu betreuen hatten, hatten ebenso wenig Chancen wie Migranten, die in Favoriten wohnten. Dort hatte er glücklicherweise niemanden zu betreuen, er war im 13. Gemeindebezirk stationiert gewesen, einem Außenbezirk im Westen von Wien. Gleich gegenüber der Hadikgasse, einer stark befahrenen Einfallstraße Richtung Innenstadt, war die AA-Filiale gewesen, in der er beschäftigt gewesen war. 39 Jahre lang. Bis er im Alter von 60 Jahren rausgeschmissen worden war. Da hatte das AA keine Gnade gekannt. Er als ehemaliger AA-Sachbearbeiter wusste ganz genau, dass er nun acht Jahre lang bis zu seiner Pensionierung arbeitslos sein würde. Der Algorithmus stufte ihn selbstverständlich in »Segment C« ein. Er gehörte zu denjenigen mit »keinen Arbeitsmarktchancen«. Er, der stets darauf geachtet hatte, so wenig Menschen wie möglich in diese Gruppe zu stecken, war nun selbst von der Maschine stigmatisiert worden. Er wusste, was das mit den Menschen machte, die da drin landeten. Sie fühlten sich wertlos, gerade diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet hatten und darin auch einen Sinn gesehen hatten, die traf es ganz besonders. Sie definierten ihren Wert über ihre Arbeit und taten sich enorm schwer, plötzlich keine Aussicht mehr zu haben, irgendwo nützlich zu sein. Nicht selten bekamen einige seiner Klienten psychische Probleme, nachdem sie in das »Segment C« gesteckt worden waren. Er hatte sich also stets bemüht, alle, bei denen es halbwegs realistisch war, aus dieser Kategorie rauszuholen und upzugraden. Meistens fand sich ein Grund, aber manchmal war er auch zu seinem Vorgesetzten zitiert worden und hatte seine Entscheidung begründen müssen. Das war nicht immer einfach gewesen, doch das war nicht der Grund seiner Kündigung. Der Computeralgorithmus durfte eines Tages alleine entscheiden, wer in A, B oder C gesteckt wurde, wer also hohe, mittlere oder niedrige Arbeitsmarktchancen hatte. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Mitarbeiter gekündigt wurden. Schließlich fiel nun ein wesentlicher Teil, den man als Berater mit seinem Klienten verbracht hatte, weg. Die Beratungszeit wurde verkürzt, und damit waren auch weniger Sachbearbeiter notwendig als zuvor. Wie auch in der »echten« Marktwirtschaft, kündigte das AA natürlich die ältesten Mitarbeiter als Erstes, denn die verursachten die höchsten Kosten und machten die meisten Probleme. Jüngere Mitarbeiter trauten sich wesentlich seltener, dem Algorithmus zu widersprechen, und waren angepasster, braver. Sie wollten ihre Jobs behalten, kaum einer muckte heutzutage noch auf, stattdessen machten sie Dienst nach Vorschrift, ohne zu hinterfragen, wie das eigentlich vor der Einführung des Algorithmus alles abgelaufen war. Eigene Entscheidungen zu treffen lag den meisten Jungen nicht, sie waren es nicht anders gewohnt und vertrauten den Computern. Diese seien schließlich objektiv, so hatten sie es in der Schule gelernt und erlebt. Adam hingegen war ein Freigeist, ein kritischer Denker, und der Job als Sachbearbeiter beim AA war ihm da zeitlebens entgegengekommen. Es ging darum, mit Menschen zu arbeiten, Karrierewege zu planen, Leben neu zu gestalten, der Tätigkeit einen Sinn zu geben. Er sah jahrelang in hoffnungsvolle Augen, die strahlten, wenn er mit den Menschen sprach. Er besaß Einfühlungsvermögen und konnte gut mit Menschen. Er hinterfragte deren Lebensmodelle, ohne dass diese danach böse auf ihn waren. Viele hatten ihm beim zweiten oder dritten Gespräch gesagt, dass er sie zum Nachdenken gebracht hatte. Adam war richtig in seinem Job gewesen – bis es zu immer mehr Zeitdruck gekommen war, er immer weniger Zeit gehabt hatte für die Menschen, die bei ihm im Büro gelandet waren – und bis der Algorithmus eingeführt worden war, der ihn bei seinen Entscheidungen unterstützen sollte. Es war von Anfang an ein Chaos gewesen, und offiziell waren schon damals zwei Minuten Zeit im Beratungsgesprächsprozess weggekürzt worden. Das Beratungsgespräch hatte am Ende aber meistens sogar länger gedauert, weil die Menschen wissen wollten, warum ein Computer über sie urteilte und wie dieser zu der Entscheidung gekommen war. Laut Gesetz hatten sie darauf auch ein Anrecht, aber das AA versuchte, sich diesem Thema zu entziehen, und verwies die Berater auf eine Standardfloskel, mit der sie im Falle von neugierigen Arbeitslosen antworten sollten. Geklagt hatte interessanterweise nie einer von ihnen, aber das war auch kein Wunder: Wer arbeitslos war, galt in diesem Land nach wie vor als weniger wert. Die Doktrin der »Leistungsgesellschaft« war zu sehr eingeimpft in den Köpfen der Bevölkerung, vor allem am Land. Dort schämte man sich dafür, wenn man seinen Job verlor. Vor allem, wenn man in Vierteln lebte, in denen die Konservative Familienpartei (KFP) eine Absolute hatte. Die trichterte den Menschen nämlich permanent ein, dass sie nur etwas zählten, wenn sie etwas zum Erhalt der Gesellschaft beitragen würden. Sei es als junge Mutter, die ein Kind großzog, oder aber eben in einem Job als Systemerhalter. Die Familienbilder waren sogar im Jahr 2028 noch in den Köpfen der Parteihörigen einzementiert, jede andere Lebensrealität wurde zwar akzeptiert, aber nicht geschätzt. Natürlich konnte man im Jahr 2028 nichts dagegen tun, wenn jemand sich entschied, sein Leben anders zu leben. Aber das war gerade am Land noch immer eine Minderheit. Im 13. Wiener Gemeindebezirk, in dem Adam gearbeitet hatte, war dies freilich ein wenig anders. Dort betreute er vor allem alleinerziehende Mütter, die plötzlich ohne Partner dagestanden waren und auf sich alleine gestellt waren, sowie ältere Menschen, die ihren Arbeitgebern zu teuer geworden waren, und jene, die ebenfalls von Maschinen ersetzt worden waren, wie es Adam selbst passiert war. Dass es so weit kommen würde, hatte er allerdings nicht ahnen können. Er dachte, er sei so etwas Ähnliches wie beamtet und sein Job sei sicher. Dass das AA so wenig Herz zeigte und ihn mit 60 Jahren schlichtweg rausgeschmissen hatte, damit hatte er nicht gerechnet. In Hietzing blieben zwei von vier Sachbearbeitern übrig, die Drop-out-Quote betrug also 50 Prozent. In anderen Filialen waren es noch mehr gewesen, die meisten von ihnen waren über 60 Jahre alt. Natürlich hatte er eine Abfindung bekommen, doch diese brachte nicht viel, denn ihm fehlten die wertvollen Versicherungsjahre bis zur Pension. Diese würde nun rund 20 Prozent niedriger ausfallen, was immerhin 200 Euro weniger monatlich bedeutete. Er hatte es sich bereits ausgerechnet: Er würde nur knapp durchkommen, denn von der Abfindung würde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel übrig geblieben sein.
Als Georgio vom Dehnepark in sein Restaurant, das in der Märzstraße im 15. Bezirk lag, kam, saß Adam bei einem Glas Bier an einem der Vierer-Holztische. Georgio blickte sich um und entdeckte nur weitere drei Gäste in seinem Lokal. Er seufzte, ging auf Adam zu und begrüßte ihn mit einem Klopfen auf die Schulter. Adam blickte hoch und sagte: »Hey, Georgio, mein alter Freund. Wo kommst du denn her?«
»Ich hatte noch schnell was erledigen müssen …«, wich dieser geschickt der Frage aus. Adam, der von sich glaubte, viel Menschenkenntnis zu besitzen, dachte sich insgeheim, dass sein Kumpel bei einer anderen Frau gewesen sein könnte, denn er blickte schuldbewusst drein. Doch ein Blick auf die Schuhe von Georgio erzählten eine andere Geschichte: Sie waren ganz dreckig und mit großen Erdklumpen verklebt. Das hieß, Georgio musste im Wald gewesen sein, anders waren diese dreckigen Sohlen nicht erklärbar. Adam beschloss, nicht weiter nachzuhaken, und fragte seinen Kumpel: »Trinkst du ein Bier mit mir?«
»Klar doch, warte noch eine Sekunde, dann setze ich mich gleich zu dir!« Georgio verschwand hinter der Bar, zapfte zwei frische Ottakringer Bier in Halbliterkrüge und ging sofort zu seinem Freund zurück. Der Kellner schaute seinem Chef nur kopfnickend zu und bediente die restlichen Gäste im Lokal. »Na, dann prost!«, sagte Adam.
»Twoje Zdrowie!«, erwiderte Georgio. Das hieß Prost auf Polnisch, und sein Kumpel wusste bereits, was er damit meinte. Schweigend saßen die beiden nebeneinander und starrten ins Nichts. Was Adam dachte, wusste Georgio nicht. Er selbst überlegte noch, was wohl das X zu bedeuten hatte, das auf dem Zettel gestanden war, den er heute abgeliefert hatte. Wie lange es wohl dauern würde, bis dieser Zettel seine Wirkung zeigen würde? Georgio war gespannt und hoffte wie jedes Mal, keine Spuren am Tatort hinterlassen zu haben.
Kapitel 3
Mila Kosic ging wie jeden Abend mit ihrem Hund Bella eine Runde durch den Wald. Sie gingen täglich den gleichen Weg, kamen immer an denselben Orten vorbei. Sie kannte den Silbersee in all seinen Facetten. Um diese Jahreszeit war der See, der umgeben war von Nadelbäumen, dunkel. Aber einen silbrigen Schimmer, woher auch sein Name kam, wies er sehr wohl auf. Bella wollte immer ganz nach vorne zum Wasser, ihre Nase reinstecken und nachsehen, ob sich Wasservögel am Teich befanden, die sie vielleicht jagen konnte. Obwohl dem Beagle der Jagdtrieb weitgehend weggezüchtet worden war, brach er immer wieder einmal durch. Bella blieb daher meistens auch im Wald angeleint, wie es Vorschrift war. Nur wenn sie gemeinsam auf der Wiese mit dem Ball spielten oder wenn sie einmal in eine dieser Hundezonen gingen, kam die Leine weg und Bella durfte sich frei bewegen. Im Dehnepark waren sie schon so manchem Dachs begegnet, und Bella hätte nach einem anfänglichen Schrecken nichts lieber getan, als diesem Tier nachzulaufen. Auch den Enten, die manchmal am See schwammen, wäre Bella am liebsten ins Wasser gefolgt. Doch vor dem Wasser hatte sie zu großen Respekt. Sie machte maximal ihre Pfoten nass, und das auch nur im Hochsommer, wenn es denn unbedingt sein musste zur Kühlung. Mila blickte auf den Silbersee, als Bella plötzlich an ihrer Leine zu ziehen und zu bellen begann. Komisch, dachte die junge Frau. Normalerweise wollte Bella so lange wie möglich am See bleiben, doch dieses Mal drängte sie darauf, so rasch wie möglich weiterzugehen. Sie hatte eine Spur aufgenommen. Ungewöhnlich. Mila drehte sich vom dunklen, silbrigen See weg und folgte Bella das kurze, feuchte Stück durch den Dreck, der sich an dieser Stelle um diese Jahreszeit immer bildete. Diese zog immer stärker an der Leine, sodass Mila schon mit dem Gedanken spielte, sie frei laufen zu lassen. Doch da sie das Verhalten ihrer Hündin so nicht kannte und nicht wusste, was für eine Gefahr drohte, verzichtete sie darauf und versuchte, so schnell wie möglich über die rutschige, matschige Passage zu gelangen und ihrem Hund zu folgen. Dieser zog und zog und zog, und plötzlich jaulte er laut auf und blieb stehen.
Mila sah ihn sofort. Da lag ein Mann in Laufklamotten am Boden, seine Augen weit offen. Er blinzelte und bewegte sich nicht, sah ganz starr aus, und Bella schleckte seine Wangen ab und bellte ihn an. Der Mann rührte sich nicht. Mila ließ nun vor Schreck die Leine los und hielt sich die Hände vors Gesicht: Oh mein Gott, da lag ein Toter, direkt vor ihrer Nase! Ein toter Mann. Mitten im Wald. Mila sah sich nach links und nach rechts um, sie war völlig unsicher, was sie nun tun sollte. Gab es hier noch jemanden, der umherschlich und weitere Menschen töten wollte? War der Mann an einem Herzinfarkt gestorben? Was dagegen sprach, war, dass der Tote einen Zettel in der Hand hielt, auf dem ein fettes X zu erkennen war. Es wirkte wie eine Markierung. Bella hatte den Zettel mit den Zähnen geschnappt und lief damit herum. »Pfui, Bella, gib das her!«, rief die Frau ihrem Hund zu. Der kam brav zu ihr und ließ sich den Zettel von ihr tatsächlich aus der Schnauze ziehen. Mila nahm ihn, erschrak aber sogleich, schließlich handelte es sich dabei aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Beweisstück, das sie nun angegriffen hatte und auf dem sie ihre Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Dass das nicht gut war, wusste sie, denn sie sah sich regelmäßig die Landkrimis im TV an. Gegenüber Freunden würde sie das nie zugeben, aber diese Gewohnheit hatte sie von ihren Eltern übernommen, die anhand dieser Krimi-Serie die Mentalität der Österreicher besser verstehen wollten. Sie selbst stammten aus Serbien und waren als Gastarbeiter nach Österreich gekommen. Mila war hier aufgewachsen und hatte sich schon als Zehnjährige immer mit ihren Eltern diese Krimis ansehen dürfen, obwohl diese oft recht blutig und sicher nichts für kleine Kinder gewesen waren. Jetzt, wo ihre Fingerabdrücke auf dem Beweisstück waren, blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Sie wählte den Polizeinotruf, da ihr keine andere Nummer einfiel. »Hier liegt ein Toter im Wald!«, rief sie in ihr Handy.
»Sind Sie sicher, dass er tot ist? Haben Sie schon die Rettung gerufen?«, hieß es.
»Nein, habe ich nicht.«
»Geben Sie uns erst einmal Ihren genauen Standort durch«, forderte der Polizeibeamte sie auf. »Damit wir jemanden vorbeischicken können.«
»Der Tote hatte so einen Zettel in der Hand, auf dem ist ein X drauf. Ich glaube kaum, dass er den selbst so hergelegt hat, als er umgefallen ist …«
»Ich gebe das an meine Kollegen weiter«, sagte der Polizeibeamte. »Wir informieren auch die Rettung. Und bleiben Sie auf jeden Fall dort, wir brauchen Ihre Zeugenaussage«, sagte der Beamte, bevor es im Wald wieder ganz still wurde, bis Bella plötzlich abermals laut und aufgeregt zu bellen anfing.
Ein zweiter Hund war auf der Szene, die auf Mila wie ein TV-Krimi wirkte, aufgetaucht, und die beiden waren sich offensichtlich nicht friedlich gesinnt. Statt sich gegenseitig zu beschnuppern, griff die kleine weiße Promenadenmischung, die allerdings vor lauter Dreck derzeit eher braun war, Bella an und bellte unermüdlich. Die Besitzerin des Kläffers bog gerade um die Kurve, offenbar hatte sie ihren Hund von der Leine gelassen, und dieser hatte nicht mehr auf ihre Rufe reagiert. Schlecht erzogen und trotzdem frei laufend, dachte Mila. Eine ganz schlechte Idee. Als die Besitzerin den Toten sah – die offenen Augen des Mannes waren ein untrügliches Indiz dafür –, reagierte sie ebenso wie Mila. Sie hielt sich erschrocken die Hand vor den Mund, ihre Augen weiteten sich. Als Nächstes starrte sie auf Mila und den Zettel in deren Hand. Dann blieb sie gebannt stehen und wusste nicht, was sie tun sollte. Weglaufen war wohl ihre erste innerliche Reaktion. Aber das ließ Fuxi nicht zu, denn der kämpfte und raufte mittlerweile mit Bella – und zwar direkt neben der Leiche. Plötzlich beschlossen die beiden Hunde dann doch noch, Frieden zu schließen und sich lieber gemeinsam auf die Leiche zu konzentrieren. Sie zerrten am Hosenbein der Trainingsklamotten, die der Mann anhatte. Offenbar war jetzt ein Wettstreit unter den Hunden entbrannt, wer von ihnen schneller ein Stück der Hose abgerissen und seinem Frauchen gebracht hatte.
Mila war die erste der beiden Frauen, die sich aus ihrer Schockstarre löste und ihre Stimme erhob. »Bella, komm sofort her!«, rief sie nach ihrem Hund. Zur Frau neben ihr sagte sie: »Ich war das nicht«, und versuchte, Augenkontakt aufzunehmen. »Ich habe ihn hier gefunden, und die Polizei ist schon unterwegs.« Die andere entspannte sich sichtlich ein wenig, sagte aber nichts. Stattdessen versuchte nun auch sie, ihre Promenadenmischung in den Griff zu kriegen, und rief: »Komm, Foxi, komm, lass uns weitergehen!« Offenbar wollte sie diesen Ort möglichst rasch verlassen und sie zeigte kein Interesse daran, hier gemeinsam mit Mila auf die Polizei zu warten. »Uns geht das alles nix an, wir möchten damit nix zu tun haben, gell, Foxi?« Schließlich sprach sie doch zu Mila, aber ohne ihr in die Augen zu blicken. Ihr Fokus war voll auf ihren Hund gerichtet, der noch immer am Hosenbein herumkaute und es tatsächlich schaffte, ein Stück abzureißen. Als er diese seinem Frauerl brachte, ergriff sie die Gelegenheit, ihm die Leine um den Hals zu hängen und Foxi damit weiterzuschleifen.
»Warten Sie, Sie können doch nicht einfach abhauen, schauen S’, was Ihr Hund mit der Leiche gemacht hat!« Das Bein des Toten war jetzt komisch verdreht, und Mila hatte große Sorge, dass man diesen Zustand jetzt ihrer Bella in die Schuhe schieben würde. Bella war zwar nicht ganz unschuldig an dem Geschehen, auch sie hatte an dem Trainingsgewand gezogen, aber sofort aufgehört, als die Promenadenmischung unter Kontrolle war. »Das ist mir egal, einen schönen Tag noch!« Und zu ihrem Hund: »Komm, Fuxi, wir gehen jetzt!« Fuxi war da offenbar anderer Meinung und zog nur knurrend, bellend und winselnd ab.
Bella wedelte mit dem Schwanz und blickte Mila in die Augen. Auch sie wollte am liebsten sofort weitergehen und verstand nicht, wieso sich ihr Frauchen nicht entfernte. So interessant war dieser Toter aus Sicht der Hündin auch wieder nicht. Gerade als Mila sich umblickte und sich fragte, wo die Beamten blieben, tauchte neben ihr eine Polizistin mit ihrem Kollegen auf. Offenbar hatten sie erst einmal nur einen Streifenwagen vorbeigeschickt, der nach dem Rechten sehen sollte. Ihr Anruf war wohl nicht deutlich genug gewesen, dachte Mila, kurz nachdem sie erschreckt war, weil sie plötzlich mitten im einsamen Wald wieder Gesellschaft bekommen hatte. Davor, dass auch der Mörder noch hier herumlauern könnte, hatte sie interessanterweise aber keine Angst. Der war längst über alle Berge, hoffte sie. Die Polizisten sahen sich um, begutachteten die Leiche und riefen relativ rasch Verstärkung. Die Situation war eindeutig. An Mila gewandt, fragte die Beamtin: »Was hat Ihr Hund, bitte sehr, mit der Leiche gemacht? Sämtliche Spuren sind verwischt! Und was haben Sie da für einen Zettel in der Hand?« Wenigstens, war Mila beruhigt, glaubten die Beamten nicht, dass sie selbst etwas mit diesem Toten zu tun hatte. »Das war nicht meine Bella. Das war irgend so eine dahergelaufene Promenadenmischung, die sind aber gleich wieder davongelaufen!« Fast wäre sie dabei laut geworden, und die Aufregung schwang in ihrer Stimme zumindest deutlich mit. Auf den Zettel ging Mila hingegen nicht weiter ein, sie überreichte ihn der Polizistin, die etwa gleich jung war wie sie selbst. Und nach einer kurzen Pause fügte sie entschuldigend und mit gesenktem Blick hinzu: »Ich weiß eh, dass das ein Beweisstück war. Der Zettel lag direkt auf der Brust des Mannes, mein Hund hat ihn ins Maul genommen und daran gekaut. Ich hab ihn meiner Bella aber gleich weggenommen. Daran lässt sich leider nichts mehr ändern. Tut mir leid …« Ihr war klar, was das für die Ermittler bedeutete, denn auf dem Zettel hätten sich wichtige Spuren befinden können, die hiermit nun vernichtet waren. »Machen S’ Ihnen keinen Kopf«, sagte die Polizistin. »Wer rechnet schon damit, mitten im Wald auf eine Leiche zu stoßen!«
»Genau«, seufzte Mila erleichtert. Wer, verdammt noch mal, brachte jemanden mitten im Wald um und versah den Leichnam mit einem X? Der Tote war wenigstens nicht Milas erste Leiche gewesen, die sie zu Gesicht bekommen hatte. Sie war dabei gewesen, als ihr Opa starb. Sie hatte seine Hand an seinem Krankenbett gehalten, weil sonst niemand da gewesen war. Ihre Mutter war gerade dabei gewesen, Besorgungen zu machen, und plötzlich hatte ihr Opa ihr ins Ohr geflüstert: »Es ist so weit. Meine Zeit ist abgelaufen. Liebe Mila, ich habe dich lieb und richte das auch meiner Else aus.« Else war Milas Mutter, und als diese heimkam, hatte sie Mila heulend am Krankenbett ihres Vaters vorgefunden, dieser war friedlich eingeschlummert. Sie hatte Mila damals erklärt, dass jeder einmal starb und es doch ein friedlicher Tod gewesen sei, so einen würde sie sich für sich selbst auch wünschen, hatte sie gesagt. An diese Erinnerung am Krankenbett musste Mila nun im Wald denken, als sie da stand und den Polizisten dabei zusah, wie sie mit ihren Kollegen telefonierten, die Rettung noch einmal anriefen, die Situation managten. Sie war zur Zuseherin degradiert worden, nicht mehr weiter relevant. Natürlich hieß es: »Wir brauchen noch Ihre Zeugenaussage, warten Sie bitte, bis der Chefermittler eingetroffen ist.« Aber sonst gab es für sie nichts weiter zu tun. Sie stand herum und begann sogleich auch ein wenig zu frieren. Bella zog an der Leine, sie wollte zu den Polizisten, wollte sich wieder mitten ins Geschehen schmeißen, sie verstand nicht, wieso ihr das nicht ermöglicht wurde, und begann daher laut zu bellen. Sie knurrte zwischendurch auch ihr Frauchen an, blickte zur Leiche und zu den Polizisten. Die eine Beamtin kam herüber, tätschelte den Kopf von Bella, die sofort still war und sich schwanzwedelnd über die Aufmerksamkeit freute. »Bleiben S’ noch kurz da, lang dauert es nicht mehr, bis unser Kommissar kommt.«
Michael Leyrhofer war nun seit fast 25 Jahren Kriminalkommissar, zuständig für Mord und Totschlag. Als an einem Sonntagabend sein Telefon klingelte, ahnte er bereits, dass es Arbeit für ihn bedeuten würde. Wieder eine Leiche, die in Wien gefunden wurde. Wie viele Mordfälle hatte er in seiner Karriere bereits aufgeklärt? Viele. Sehr, sehr viele. Seine Arbeit hatte sich im Laufe der Jahre massiv verändert, es waren viele moderne technische und wissenschaftliche Werkzeuge hinzugekommen, die ihnen die Arbeit großteils erleichterten, sie aber auch manchmal erschwerten. Am Ende waren es meistens doch eher niedrige Beweggründe, und die Mordmotive schwankten zwischen Eifersucht, Neid, Missgunst und »einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen«. Was würde es dieses Mal sein, fragte sich Leyrhofer, als er seine Schuhe anzog – die Wanderschuhe, denn die Ermittlungen führten ihn in einen westlichen Randbezirk von Wien, und zwar mitten in den Wienerwald, sagte man ihm. Außerdem hatten die Kollegen etwas von »kein Unfalltod« gemurmelt, weil der Tote einen mysteriösen Zettel in der Hand gehabt haben sollte. Leyrhofer seufzte. Was es damit wohl auf sich hatte?
Leyrhofer stieg in sein Dienstfahrzeug, ein elektrobetriebenes Connected Car, das einen Akkuladestand von derzeit 75 Prozent aufwies – bis zur vollen Aufladung war es sich nicht mehr ausgegangen, denn er hatte nicht mit einem Anruf gerechnet –, schaltete das Navi ein und gab die nächstmögliche Adresse ein. Von dort waren es dann noch einmal zehn Minuten zu Fuß. Er freute sich schon auf den Matsch im Wald, denn die Tage davor hatte es geregnet. Er hörte schon seine Frau fluchen, die später sicherlich noch seine Schuhe putzen würde – nicht etwa, weil er das so wollte oder von ihr verlangte, sondern weil sie es nicht ertrug, wenn etwas Dreckiges in ihrer Wohnung herumstand. Sie war Ordnungsfanatikerin, und es musste immer alles sauber sein. Das galt auch für Schuhe. Doch zuerst hieß es einmal hinkommen zum vermeintlichen Tatort. Leyrhofer begann zu rechnen, wie viele Tage es noch bis zu seiner Pensionierung waren. Wenn man den Urlaub, den er am Ende noch verbrauchen würde, wegzählen würde, waren es 68 Arbeitstage. Ob sich ein Abschluss dieses Falles wirklich ausging in dieser Zeit? Manchmal zogen sich die Ermittlungen wesentlich länger, vor allem, wenn es sich nicht um klassische Mordfälle handelte. Was würde passieren, wenn sich das nicht ausging? Auf seinen Urlaub würde er auf keinen Fall verzichten wollen, das schenkte er dem Staat Österreich nicht, hatte er sich geschworen. Schließlich war er lange genug Kriminalkommissar gewesen. Rund um die Uhr erreichbar, immer parat, wenn es dringende Fälle mit höchster Priorität gab.
Michael Leyrhofers wohl bisher prominentester Fall war der Tod des ehemaligen Finanzministers gewesen, der ein paar Jahre zuvor ums Leben gekommen war. Wolfgang Steinrigl war in einem selbstfahrenden Auto verunglückt, doch anstatt eines gewöhnlichen Unfalls hatte es sich um einen Hackerangriff gehandelt. Der Fall war für ihn superkompliziert gewesen, und es hatte einige Zeit sogar so ausgesehen, als würde er zu seinem ersten nicht gelösten Mordfall. Doch dann kriegte er am Ende doch noch einen derjenigen dran, die sich dafür verantwortlich gezeigt hatten. Leider hatte er nicht alle Beteiligten einsperren können, so wie das bei Fällen, die mit Wirtschaftskriminalität zu tun hatten, wohl üblich war. Bei jedem neuen Fall hoffte er, dass er nie wieder in so einer Situation wie damals stecken würde. Und bei dem neuen Fall jetzt natürlich ganz besonders. Wie schlimm wäre das für ihn, wenn ausgerechnet der letzte Mord ungelöst blieb? Nein, besser, er machte sich gleich konzentriert an die Arbeit. Schließlich hatte er seinen Job einmal richtig geliebt. Leyrhofer rückte das Navi zurecht, das ihm 40 Minuten Fahrzeit anzeigte von seinem eigenen Standort im zweiten Wiener Gemeindebezirk nahe der Taborstraße. Auf geht’s, sagte er sich und fuhr los. Er war gespannt, was ihn im Wienerwald erwartete.
Kapitel 4
Stefanie Laudon saß an ihrem Homeoffice-Schreibtisch und tippte gerade einen Beitrag für das Blatt 24 Stunden runter, der sich mit den neuesten politischen Entwicklungen rund um die Impfauffrischung beschäftigte. Seit es das Coronavirus gab, musste die Bevölkerung regelmäßig Auffrischungsimpfungen erhalten, um vollständig gegen die Viren geschützt zu sein. Ähnlich wie bei der Zeckenimpfung wirkte das Serum immer nur für eine begrenzte Zeit. Doch dieses Jahr gab es große Probleme, denn der Impfstoff schien in Österreich vergriffen zu sein, weil es die Politik verabsäumt hatte, rechtzeitig Impfdosen nachzubestellen. Es war ein politisches Desaster, das derzeit jeden Tag neue Entwicklungen mit sich brachte, auch an Sonntagen. Heute hatte die zuständige Ministerin des grün-liberalen Regierungspartners der KFP in einem Pressegespräch erklärt, dass man nun bis zum Frühjahr 2029 genügend Impfdosen beschaffen wolle und sich entsprechende Verträge mit den Herstellern in Vorbereitung befinden würden. Stefanie hatte bei dieser Aussage laut auflachen müssen und gleichzeitig die Tränen zurückhalten. Als Journalistin in diesem Land konnte man langsam nur noch zynisch mitverfolgen, wie sich die Regierung wieder und wieder blamierte. Seit Jahren. Trotzdem war es bereits die zweite Amtsperiode dieser Koalition, denn diese hatte trotz all der Krisen und Widerstände erneut eine Mehrheit gefunden – aus Mangel an anderen Mehrheitsperspektiven. Stefanie schrieb gerade eine Analyse der aktuellen Situation für 24 Stunden, als eine Eilmeldung am Bildschirm aufblinkte.
›Toter im Wienerwald entdeckt‹, lautete die Headline der Agenturmeldung. Und darunter stand: ›Ursache unklar, Kriminalkommissariat ermittelt.‹ Stefanie seufzte laut auf, denn sie wusste, was das bedeutete: Ihren baldigen Feierabend, den sie nach ihrer Analyse mit Schokolade, einem heißen Kakao und einem gemütlichen Leseabend geplant hatte, konnte sie sich in die Haare schmieren. Bei 24 Stunden